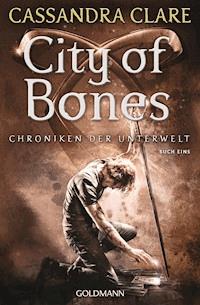10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Dunklen Mächte
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Die Gemeinschaft der Schattenjäger steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Unversöhnlicher Hass erfüllt die einzelnen Gruppen, und auf den Stufen des Ratssaales ist unschuldiges Blut vergossen worden. Auch die Blackthorns haben einen schrecklichen Verlust erlitten, und in tiefer Trauer flieht die Familie nach Los Angeles. Nur Julian und Emma machen sich auf den Weg ins Feenreich. Trotz der Gefahren, die der Fluch ihrer verbotenen Liebe mit sich bringt, wollen sie dort das Schwarze Buch der Toten wiederbeschaffen. Stattdessen entdecken sie ein Geheimnis, so dunkel und gefährlich, dass es die gesamte Unterwelt zu vernichten droht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1488
Ähnliche
Buch
Die Gemeinschaft der Schattenjäger steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Unversöhnlicher Hass erfüllt die einzelnen Gruppen, und auf den Stufen des Ratssaales ist unschuldiges Blut vergossen worden. Auch die Blackthorns haben einen schrecklichen Verlust erlitten. In tiefer Trauer flieht die Familie nach Los Angeles. Nur Julian und Emma machen sich auf den Weg ins Feenreich. Trotz der Gefahren, die der Fluch ihrer verbotenen Liebe mit sich bringt, wollen sie dort das Schwarze Buch der Toten wiederbeschaffen. Stattdessen entdecken sie ein Geheimnis, so dunkel und gefährlich, dass es die gesamte Unterwelt zu vernichten droht …
Autor
Cassandra Clares Bücher wurden weltweit bisher über 50 Millionen Mal verkauft und in 35 Sprachen übersetzt. Fast zehn Jahre nach ihrem großen internationalen Durchbruch mit den »Chroniken der Unterwelt« wurde nun auch ihre neue Reihe, die »Chroniken der Dunklen Mächte«, zum großen Bestsellererfolg. Cassandra Clare lebt in Massachusetts, USA.
Cassandra Clare
QUEEN OF AIR AND DARKNESS
Die Dunklen Mächte
BUCH DREI
ROMAN
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Queen of Air and Darkness«
bei Margaret K. McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2019
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Cassandra Clare, LLC
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe Juni 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München unter Verwendung eines Entwurfs von Russell Gordon
Umschlagmotiv: © 2018 by Cliff Nielsen
Karte von Alicante: Drew Willis
Redaktion: Waltraud Horbas
TH · Herstellung: han
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-18627-2V004
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Sarah – sie weiß wofür
Das ist des Todes Residenz,
Diese seltsame Stadt im fernen Westen.
Hier thront er und erteilt Audienz
Den Bösen und Guten, den Schlimmsten und Besten.
Hier stehen mächtige Säulenhallen
(Zermorschtes Gemäuer, das nicht zittert)
Neben Kapellen und Kathedralen
Und hohen Palästen, schwarz und verwittert.
Ringsum, vom Winde vergessen, ruht,
Wie schlafend, eine eisige Flut.
Kein Strahl aus dem himmlischen Gewölbe
Fällt auf das Dunkel dieser Stadt;
Doch einen Schimmer traurig und matt
Entsendet das Meer, das rötlich gelbe,
Und der kriecht hinauf an dunklen Palästen,
An babylonischen Türmen und Vesten
Der kriecht empor an eisernen Kerkern,
Und schattigen, ausgestorbenen Erkern,
Der schlängelt sich aufwärts an Säulenhallen
Und an gigantischen Kathedralen
Mit steinernem Zierrat von grotesken
Blumengewinden und Arabesken,
An vielen wundersamen Kapellen
Und gleitet zurück in die kalten Wellen,
Die melancholischen, schweigenden Wellen.
Von einem stolzen Turm übersieht
Der finstere König sein Gebiet.
Tempel und Gräber öffnen sich weit
Da erglänzt eine seltsame Herrlichkeit.
Doch weder die Gräber mit ihren Schätzen,
Noch die demantenen Augen der Götzen
Locken die Wogen aus ihrem Bette.
Gläsern bleibt die schaurige Glätte,
Kein Hauch, kein noch so leises Säuseln
Erhebt sich, diese Fläche zu kräuseln,
Kein Schwellen erzählt von glücklichen Seen,
Worüber heitere Lüfte wehen,
Kein Wallen erzählt, dass es Meere gibt
Die weniger grauenhaft ungetrübt.
Da regt sich etwas im trägen Meere,
Als wären die Türme plötzlich versunken
Und hätten die Flut auseinandergeschoben;
Die Woge färbt sich, als ob ein Funken,
Ein wärmender Sonnenfunken von oben
Auf sie herniedergeglitten wäre.
Und wenn nun durch den geöffneten Spalt
Der trägen, melancholischen Flut
Die seltsame Stadt versinkt – dann zahlt
Ihr die Hölle selber Tribut.
Edgar Allan Poe: »Die Stadt im Meer«
TEIL EINS
Kein Leid
Im Land der Feen können Sterbliche kein Leid empfinden, aber auch keine Freud.
Elbensprichwort
1
Der finstere König
Überall war Blut: auf dem Podium, den Stufen, an den Wänden, auf dem Boden und an den schartigen Überresten des Engelsschwerts. Später sollte der Anblick in Emmas Erinnerung von einer Art rotem Nebel getrübt sein. Eine unvollständige Zeile aus einem Gedicht ging ihr wieder und wieder durch den Kopf – von jemandem, der sich gar nicht vorstellen konnte, dass ein Mensch so viel Blut in sich hatte.
Es hieß, ein Schock würde selbst den größten Schicksalsschlag etwas abfangen, aber Emma hatte nicht das Gefühl. Sie sah und hörte alles ganz genau, und es traf sie mit voller Wucht: der Sitzungssaal, in dem es von Wächtern wimmelte; die Schreie. Sie versuchte, sich zu Julian durchzukämpfen, doch eine Gruppe von Wächtern baute sich wie eine Mauer vor ihr auf. Emma hörte weitere Schreie aus dem Saal. »Emma Carstairs hat das Engelsschwert zerschmettert! Sie hat eine der Engelsinsignien zerstört. Verhaftet sie!«
Was die Wächter mit ihr persönlich anstellen würden, war ihr vollkommen egal – aber sie musste unbedingt zu Julian. Er kauerte noch immer auf dem Boden, mit Livvy in den Armen, und widersetzte sich allen Bemühungen der Wächter, ihm den erschlafften Körper seiner Schwester abzunehmen.
»Lasst mich durch!«, protestierte Emma. »Ich bin sein Parabatai, lasst mich durch.«
»Gib mir dein Schwert«, forderte die Stimme der Konsulin hinter ihr. »Gib mir Cortana, Emma, dann darfst du zu Julian.«
Emma schnappte nach Luft und schmeckte Blut in ihrem Mund. Alec hatte inzwischen das Podium erklommen und kniete neben dem Leichnam seines Vaters. Im Sitzungssaal herrschte Chaos. Viele Schattenjäger drängten in Richtung der Türen – unter ihnen entdeckte Emma auch Mark, der den bewusstlosen Ty auf den Armen trug und sich mit den Ellbogen einen Weg durch die Menge bahnte. Er wirkte grimmiger, als Emma ihn je erlebt hatte. Kit war bei ihm. Aber wo steckte Dru? Dort drüben … Sie hockte allein auf dem Boden. Nein, Diana war bei ihr und hielt sie weinend im Arm. Ein Stück weiter kämpfte Helen sich zum Podium vor.
Emma trat einen Schritt zurück und hätte fast das Gleichgewicht verloren: Die Holzdielen waren glitschig vom vielen Blut. Jia Penhallow, die Konsulin, stand noch immer vor ihr und streckte ihr die schmale Hand entgegen, um Cortana an sich zu nehmen. Cortana.Das Schwert war ein Teil von Emmas Familie und gehörte zu den Carstairs, solange sie sich erinnern konnte. Sie wusste noch ganz genau, wie Julian es ihr nach dem Tod ihrer Eltern in die Arme gedrückt und wie sie es an sich gepresst hatte, ohne die tiefe Wunde zu beachten, die die scharfe Klinge auf ihrem Arm hinterließ.
Jia forderte sie auf, einen Teil von sich selbst aufzugeben.
Aber dort drüben hockte Julian allein, gramgebeugt, blutgetränkt.
Fast glaubte sie, Cortana aufschreien zu hören, als man es von ihr trennte.
»Geh zu ihm«, sagte Jia. Emma hörte zwar andere Stimmen – darunter die von Horace Dearborn –, die laut forderten, sie aufzuhalten, weil sie sich für die Zerstörung des Engelsschwerts und für Annabel Blackthorns Verschwinden verantworten müsse. Doch Jia wies die Wächter in scharfem Ton an, alle Anwesenden aus dem Sitzungssaal zu führen: Die nächsten Tage sind eine Zeitder Trauer, keine Zeit der Rache; wir werden Annabel finden; geh in Würde,Horace, oder ich lasse dich aus demGebäude eskortieren; jetzt ist nicht die Zeit für Vergeltung; Aline, hilf Dru und Diana auf die Beine und bring sie aus dem Saal …
Emma sank neben Julian auf die Knie. Der metallische Geruch von Blut hing in der Luft. Livvy lag schlaff in seinen Armen; ihre Haut war so weiß wie Milch. Er flehte sie nicht länger an, zu ihm zurückzukehren; stattdessen wiegte er sie, als wäre sie ein kleines Kind. Sein Kinn ruhte auf ihrem Kopf.
»Jules«, flüsterte Emma, doch dieses Wort kam ihr nur schwer über die Lippen. So hatte sie ihn während ihrer gemeinsamen Kindheit immer genannt, aber er war jetzt ein Erwachsener, ein trauernder Vater. Denn Livvy war nicht einfach nur seine Schwester gewesen: Über Jahre hatte er sie wie eine Tochter großgezogen. »Julian.« Behutsam berührte Emma seine kühle Wange, dann Livvys noch kältere Haut. »Julian, Liebster, bitte, lass mich dir helfen.«
Langsam hob er den Kopf. Er sah aus, als hätte man ihn mit einem Eimer Blut übergossen – es bedeckte seine Brust, seine Kehle, hatte Sprenkel auf seinem Kinn und seinen Wangen hinterlassen. »Emma.« Seine Stimme war kaum zu hören. »Emma, ich habe ihr so viele Iratzes aufgetragen …«
Aber Livvy war bereits tot gewesen, bevor sie den Boden des Podiums berührt hatte. Bevor Julian sie in die Arme genommen hatte. Keine Heilrune konnte hier noch helfen.
»Jules!« Helen hatte sich endlich an den Wächtern vorbeigekämpft. Sie warf sich neben Emma und Julian auf die Holzdielen, ohne die riesige Blutlache zu beachten. Benommen sah Emma zu, wie Helen vorsichtig die Reste des Engelsschwerts aus Livvys Körper zog und auf den Boden legte. Sofort waren auch ihre Hände mit Blut befleckt. Ihre Lippen waren weiß vor Kummer, und sie schlang die Arme um Julian und Livvy und flüsterte tröstende Worte.
Um sie herum hatte sich der Saal zunehmend geleert. Magnus kam auf sie zu; er war kreidebleich und schleppte sich mühsam vorwärts. Eine Gruppe von Stillen Brüdern folgte ihm. Der Hexenmeister stieg auf das Podium, woraufhin Alec auf die Beine kam und sich ihm in die Arme warf. Schweigend klammerten sich die beiden aneinander, während vier Brüder der Stille niederknieten und Robert Lightwoods Leichnam hochhoben. Seine Hände lagen gefaltet auf der Brust, die Augen waren geschlossen. Leises Raunen folgte ihm, als die Brüder ihn aus dem Saal trugen: »Ave atque vale,Robert Lightwood.«
Die Konsulin kam auf Emma, Julian und Helen zu, flankiert von mehreren Wächtern – und gefolgt von den Stillen Brüdern, die in ihren pergamentfarbenen Roben an Geister erinnerten.
»Du musst sie jetzt loslassen, Jules«, sagte Helen sanft. »Sie wird in die Stadt der Stille gebracht.«
Julian sah Emma an. Seine Augen waren so leer wie der Winterhimmel, aber Emma konnte den Ausdruck darin dennoch lesen. »Lasst ihn das machen«, bat sie. »Er möchte derjenige sein, der Livvy als Letzter trägt.«
Helen strich ihrem Bruder übers Haar und hauchte ihm einen Kuss auf die Stirn. Dann erhob sie sich und wandte sich an die Konsulin: »Jia, bitte.«
Die Konsulin nickte. Langsam rappelte Julian sich auf, Livvy fest an sich gedrückt. Dann ging er zu den Stufen, die vom Podium herabführten, mit Helen an seiner Seite und den Stillen Brüdern im Gefolge. Als Emma aufstehen und sich ihnen anschließen wollte, hielt Jia sie zurück.
»Nur die engsten Familienmitglieder, Emma«, sagte sie.
Ich gehöre zur Familie. Lasst mich durch, ich will sie begleiten. Ich will Livvy begleiten!,schrie Emma innerlich, doch sie nahm sich zusammen. Sie wollte Julianmit ihrer eigenen Trauernicht noch zusätzlich belasten. Und die Vorschriften der Stadt der Stille waren unverrückbar. Das Gesetz ist hart, aber es ist das Gesetz.
Die kleine Prozession bewegte sich auf die Saaltüren zu. Die Kohorte war verschwunden; nur noch ein paar Wächter und andere Schattenjäger hielten sich im Raum auf. Ein leiser Chor folgte dem Trauerzug: »Sei gegrüßt und leb wohl, Livia Blackthorn.«
Mit Cortana in der Hand drehte die Konsulin sich um und ging zu Aline, die erschüttert zugesehen hatte, wie Livvy aus dem Saal getragen wurde. In diesem Moment begann Emma zu zittern – ein Zittern, das aus ihrem tiefsten Inneren kam. Nie zuvor hatte sie sich so allein gefühlt: Julian hatte sie sich selbst überlassen, und die anderen Blackthorns schienen Tausende Kilometer fort zu sein, wie weit entfernte Sterne. Plötzlich sehnte sich Emma derartig nach ihren Eltern, dass es fast schon körperlich schmerzte. Sie wünschte, Jem wäre bei ihr und Cortana hinge wieder an ihrem Gürtel. Und sie wünschte, sie könnte vergessen, wie Livvy blutend und gekrümmt wie eine zerbrochene Puppe auf dem Podium zusammengesackt war, als die Fenster des Sitzungssaals explodiert waren und die gespaltene Krone Annabel verschleppt hatte. Hatte außer ihr sonst noch jemand den Vorfall beobachtet?
»Emma.« Arme schlangen sich um ihre Taille, vertraute, sanfte Arme, die sie auf die Beine zogen: Cristina, die in dem ganzen Chaos auf sie gewartet haben musste und sich nicht von den Wächtern aus dem Saal hatte vertreiben lassen. Sie war geblieben, um bei Emma zu sein. »Emma,komm, lass uns gehen. Ich kümmere mich um dich. Ich weiß einen Ort, wo wir hinkönnen. Emma. Corazoncita.Komm mit mir.«
Emma ließ sich von Cristina auf die Beine helfen. Magnus und Alec kamen auf sie zu. Alecs Gesicht wirkte angespannt, seine Augen waren gerötet. Emma umklammerte Cristinas Hand und blickte über den Saal, der ein vollkommen anderer Ort zu sein schien als bei ihrer Ankunft vor wenigen Stunden. Vielleicht lag es daran, dass die Sonne da noch nicht untergegangen war, überlegte sie, während sie mit einem Ohr zuhörte, wie Magnus und Alec Cristina baten, sie zu einem Haus zu bringen, das für die Blackthorns reserviert war. Vielleicht lag es ja daran, dass der Saal jetzt dunkler war und sich die Schatten dunkel wie schwarze Farbe in den Ecken sammelten.
Vielleicht lag es aber auch daran, dass sich inzwischen alles verändert hatte. Und dass nichts mehr so sein würde wie früher.
»Dru?« Helen klopfte leise an die geschlossene Zimmertür. »Dru, kann ich kurz mit dir reden?«
Zumindest nahm sie an, dass es sich um das Zimmer ihrer Schwester handelte. Das Kanalhaus neben der Residenz der Konsulin in der Princewater Street war vor der Versammlung für die Blackthorns vorbereitet worden, da man davon ausgegangen war, dass die Familie mehrere Nächte in Idris verbringen würde. Diana hatte Helen und Aline das Haus gezeigt, und Helen hatte Dianas liebevolle Details sehr zu schätzen gewusst: In der Küche stand eine Vase mit frischen Blumen, und sämtliche Zimmertüren waren mit Namensaufklebern versehen – der Raum mit den schmalen Betten war für die Zwillinge bestimmt, und in Tavvys Zimmer stapelten sich Bücher und Spielsachen, die Diana aus ihrer eigenen Wohnung über dem Waffengeschäft mitgebracht hatte.
Eine offene Tür erlaubte einen Blick in einen kleinen Raum mit Blumentapete. »Vielleicht würde das für Dru passen?«, schlug Helen vor. »Es ist ein so hübsches Zimmer.«
Doch Diana zog eine zweifelnde Miene. »Nein, das würde Dru nicht gefallen. Höchstens wenn die Tapete mit Fledermäusen oder Skeletten bedruckt wäre«, hatte sie geantwortet.
Bei diesen Worten zuckte Helen zusammen.
Aline drückte ihre Hand. »Mach dir keine Sorgen«, flüsterte sie und küsste Helen auf die Wange. »Du wirst sie bald wieder besser kennenlernen. Überhaupt kein Problem.«
Und vielleicht hätte ihre Frau damit ja auch recht behalten, dachte Helen jetzt und starrte auf die Tür mit dem Aufkleber Drusilla. Wenn sich die Versammlung nicht in einen Albtraum verwandelt hätte. Der scharfe Schmerz der Trauer schnitt ihr tief in die Brust – sie fühlte sich wie ein Fisch an einer Angel, der zappelte und sich wand, um den Qualen des Hakens in seinem Körper zu entkommen.
Sie verband diesen Schmerz mit dem Tod ihres Vaters, als nur ein einziger Gedanke sie auf den Beinen gehalten hatte: der Gedanke daran, dass sie für ihre Familie da sein und sich um die Kinder kümmern musste. Auch jetzt versuchte sie, ihren Kummer auf ähnliche Weise zu bewältigen. Doch es war offensichtlich, dass die Kinder sich in ihrer Gegenwart nicht wohlfühlten – wenn man sie überhaupt noch als Kinder bezeichnen konnte. Im Grunde war nur Tavvy noch ein Kind, und der befand sich im Haus des Konsuls und hatte das Grauen im Sitzungssaal glücklicherweise nicht miterlebt. Ihre eigene Familie betrachtete sie als eine Fremde.
Was den Schmerz in ihrer Brust nur noch schlimmer machte. Helen wünschte, Aline wäre bei ihr; aber ihre Frau war zum Haus der Konsulin gegangen, um ein paar Stunden mit ihren Eltern zu verbringen.
»Dru«, sagte Helen erneut und klopfte energischer an. »Bitte lass mich rein.«
Im nächsten Moment flog die Tür auf, und Helen musste ihre Hand zurückreißen, um Dru nicht versehentlich gegen die Schulter zu boxen. Ihre jüngere Schwester stand direkt vor ihr und funkelte sie an. Sie trug noch immer die schwarze Versammlungsmontur, die in der Taille und über der Brust etwas zu eng war, und ihre Augen waren so gerötet, dass es aussah, als hätte sie scharlachroten Lidschatten verschmiert.
»Ich weiß, dass du wahrscheinlich lieber allein sein willst«, setzte Helen an. »Aber ich möchte einfach nur wissen, ob es dir …«
»Gut geht?«, fragte Dru in etwas zu scharfem Ton. Die dahinterliegende Bedeutung war klar: Wie könnte es mir auch nur eine Sekunde lang gut gehen?
»Ob du einigermaßen zurechtkommst.«
Einen Moment wandte Dru den Blick ab; ihre zusammengepressten Lippen zitterten. Helen sehnte sich danach, ihre kleine Schwester einfach an sich zu ziehen und sie so fest zu drücken wie damals, als Dru noch ein trotziges Kleinkind gewesen war. »Ich will wissen, wie es Ty geht.«
»Er schläft«, erklärte Helen. »Die Brüder der Stille haben ihm einen Beruhigungstrank gegeben, und Mark ist bei ihm. Möchtest du vielleicht auch an seinem Bett sitzen?«
»Ich …« Dru zögerte, während Helen wünschte, sie könnte ein paar tröstende Worte über Tys Zustand sagen. Sie fürchtete sich vor dem, was bei seinem Aufwachen passieren würde. Er hatte im Sitzungssaal das Bewusstsein verloren, und Mark hatte ihn zu den Stillen Brüdern getragen, die sich bereits in der Garnison befunden hatten. Die Brüder hatten Ty schweigend untersucht und dann verkündet, dass er körperlich gesund sei. Aber sie würden ihm einen Kräutersud verabreichen, damit der Junge weiterhin schlief. Denn manchmal fühlte ein Bewusstsein, wann es sich abschalten musste, um sich auf den notwendigen Heilungsprozess vorzubereiten. Allerdings wusste Helen nicht, wie eine durchschlafene Nacht – oder selbst ein durchschlafenes Jahr – Ty auf den Verlust seiner Zwillingsschwester vorbereiten sollte.
»Ich will mit Jules reden«, sagte Dru schließlich. »Ist er hier?«
»Nein«, antwortete Helen. »Er ist noch immer bei Livvy. In der Stadt der Stille.« Gern hätte sie Dru gesagt, dass er jeden Moment zurückkehren würde. Denn sie wusste von Aline, dass die Zeremonie der Aufbahrung in der Stadt der Stille – die Vorbereitungen für die Feuerbestattung – nicht lange dauerte. Aber sie wollte Dru keine Versprechungen machen, die sich dann als falsch erwiesen.
»Was ist mitEmma?« Drus Ton war höflich, aber eindeutig: Ich will jemanden um mich haben, den ich kenne, und nicht dich.
»Ich werde sie holen«, versicherte Helen.
Sie hatte sich kaum von der Tür weggedreht, als diese mit einem leisen, aber entschiedenen Klick ins Schloss gedrückt wurde. Helen kämpfte gegen die Tränen an – und entdeckte Mark, der nur wenige Schritte entfernt im Flur stand. Er hatte sich ihr völlig lautlos genähert und hielt einen zerknitterten Zettel in der Hand, der nach einer Flammenbotschaft aussah.
»Helen«, sagte Mark; seine Stimme klang rau. Würde er nach all den Jahren, die er mit der Wilden Jagd verbracht hatte, auf die gleiche Weise trauern wie die Feenwesen? Er wirkte zerzaust und erschöpft, und unter seinen Augen und um die Mundwinkel herum hatten sich tiefe, menschliche Falten in seine Haut gegraben. »Ich muss dringend mit dir reden. Keine Sorge: Ty ist nicht allein; Diana und Kit sind bei ihm. Außerdem schläft er noch immer. Hast du einen Moment Zeit?«
»Ich habe Dru versprochen, Emma zu ihr zu bringen«, erwiderte Helen.
»Ihr Zimmer ist dahinten. Natürlich können wir kurz bei ihr anklopfen, bevor wir aufbrechen«, sagte Mark und zeigte auf das andere Ende des Flurs, dessen Wände in honiggelben Tönen getäfelt waren. Der Schein der Elbensteinlampen tauchte das ganze Haus in ein warmes Licht. An jedem anderen Tag hätte es bestimmt freundlich und einladend gewirkt.
»Aufbrechen?«, fragte Helen verwirrt.
»Magnus und Alec haben gerade eine Nachricht geschickt. Ich muss zum Haus des Konsuls, um Tavvy abzuholen und ihm mitzuteilen, dass unsere Schwester tot ist.« Mit gequältem Gesicht griff er nach ihrer Hand. »Bitte, Helen. Bitte komm mit.«
Während ihrer Jugend hatte Diana einmal ein Museum in London besucht, das als Hauptattraktion ein schlafendes Dornröschen aus Wachs präsentiert hatte. Ihre Haut war bleich gewesen, und ihre Brust hatte sich gehoben und gesenkt, während sie mithilfe eines kleinen, in ihrem Körper versteckten Antriebs »geatmet« hatte.
Irgendetwas an Tys Reglosigkeit und Blässe erinnerte Diana jetzt an die Märchenfigur aus dem Wachsfigurenkabinett. Ty ruhte halb zugedeckt auf dem Bett, die Hände lagen locker, aber still neben seinen Hüften. Diana wünschte sich nichts sehnlicher, als seine Finger wieder in Aktion zu sehen – so wie früher, wenn er mit einer von Julians Erfindungen oder mit dem Kabel seiner Kopfhörer gespielt hatte.
»Wird er wieder gesund?«, flüsterte Kit. Der Raum war in einem heiteren Gelb tapeziert, und bunte Patchwork-Tagesdecken lagen auf den Betten. Kit hätte sich auf das leere Bett setzen können, das für Livvy bestimmt gewesen war, doch er hatte sich dagegen entschieden. Stattdessen hockte er in einer Ecke auf dem Boden, den Rücken gegen die Wand gelehnt und die Beine angezogen. Sein Blick war auf Ty gerichtet.
Diana legte eine Hand auf Tys Stirn – sie war kühl. Sie selbst fühlte sich wie betäubt und spürte ihren Körper kaum. »Mit ihm ist alles in Ordnung, Kit«, sagte sie und zog Tys Decke höher. Doch er regte sich im Schlaf, murmelte und strampelte sich frei. Das Fenster war weit geöffnet; Diana hatte angenommen, dass Ty die frische Luft guttun würde. Doch jetzt durchquerte sie den Raum, um es zu schließen. Ihre Mutter war immer der Ansicht gewesen, dass es nichts Schlimmeres gab, als sich durch den Luftzug eine schreckliche Erkältung einzufangen – und offensichtlich blieb das, was einem die eigenen Eltern eingeprägt hatten, für immer im Gedächtnis haften.
Auf der anderen Seite des Fensters konnte Diana die Silhouette der Stadt sehen, die sich vor dem dämmrigen Abendhimmel abzeichnete. Darüber ging gerade der Mond auf. Ihre Gedanken wanderten zu einem Reiter auf einem mächtigen Ross, das über den weiten Himmel preschte. Diana fragte sich, ob Gwyn bereits von den Ereignissen des Nachmittags wusste oder ob sie ihm vielleicht eine Nachricht schicken sollte. Aber was konnte er sagen oder tun? Er war ihr schon einmal zu Hilfe geeilt, als Livvy, Ty und Kit sich in Gefahr befunden hatten. Doch damals hatte Mark ihn verständigt. Diana war sich noch immer nicht sicher, ob er aus aufrichtiger Zuneigung zu den Kindern gehandelt hatte oder nur deshalb, weil er eine Schuld begleichen musste.
Einen Moment stand sie reglos da, die Hand an den Vorhängen. Im Grunde wusste sie nur sehr wenig über Gwyn. Als Anführer der Wilden Jagd war er eine mystische Gestalt, kein gewöhnlicher Elbe. Diana fragte sich, wie jemand, der so mächtig und alt war, dass er selbst zum Bestandteil von Mythen und Sagen geworden war, herkömmliche Gefühle haben konnte. Konnte er angesichts dessen, was er im Laufe der Jahrhunderte erlebt hatte, tatsächlich noch Interesse für das Leben irgendeines Sterblichen aufbringen?
Und dennoch hatte er sie im Arm gehalten und sie getröstet, als sie ihm erzählt hatte, was bis dahin nur Catarina und ihre Eltern gewusst hatten – und ihre Eltern waren tot. Gwyn hatte sehr mitfühlend reagiert, oder nicht?
Hör auf. Diana wandte sich wieder dem Raum zu. Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um über Gwyn nachzudenken, selbst wenn sie tief in ihrem Inneren hoffte, er würde herkommen und sie wieder trösten. Nicht jetzt, da Ty möglicherweise jeden Moment aufwachte … in einer Welt, die angefüllt war mit einem neuen, schrecklichen Schmerz. Nicht jetzt, da Kit in einer Ecke kauerte, als wäre er nach einem Schiffsunglück an einen einsamen Strand gespült worden.
Diana wollte dem Jungen gerade die Hand auf die Schulter legen, als er den Kopf hob und sie ansah. Auf seinem Gesicht waren keine Tränenspuren zu erkennen. Plötzlich erinnerte sie sich daran, dass er auch nach dem Tod seines Vaters keine geröteten Augen gehabt hatte – damals, als er die Institutstür zum ersten Mal geöffnet und begriffen hatte, dass er ein Schattenjäger war.
»Ty mag vertraute Gegenstände«, sagte Kit nun. »Wenn er aufwacht, wird er nicht wissen, wo er ist. Wir sollten dafür sorgen, dass seine Reisetasche in der Nähe ist … und alles, was er sonst noch aus London mitgebracht hat.«
»Seine Sachen sind da drüben.« Diana zeigte auf Tys Reisetasche unter dem Bett, das für Livvy bestimmt gewesen war. Kit rappelte sich auf und ging darauf zu. Er öffnete den Reißverschluss und holte ein Buch hervor – einen schweren Wälzer mit altmodischer Leinenbindung. Schweigend legte er das Buch neben Tys linke Hand. Als Diana einen Blick auf den goldgeprägten Titel warf, erkannte sie, dass selbst ihr vor Schmerz betäubtes Herz noch einen Stich verspüren konnte.
Die Rückkehr des Sherlock Holmes.
Der Mond war aufgegangen, und die Dämonentürme von Alicante glühten in der Dunkelheit.
Seit Marks letztem Aufenthalt in dieser Stadt waren viele Jahre vergangen. Die Wilde Jagd war ein paarmal über Idris hinweggeflogen, und er erinnerte sich daran, wie das Land der Nephilim unter ihnen gelegen hatte und die anderen Mitglieder der Jagd gejohlt und gepfiffen hatten bei der Vorstellung, dass sie das Territorium der Schattenjäger überquerten. Doch Marks Herz hatte beim Anblick von Idris immer schneller geschlagen: die silberne Fläche des Lyn-Sees, die grünen Wipfel des Brocelind-Walds, die steinernen, über die Landschaft verteilten Herrensitze und der helle Schimmer von Alicante auf dem Hügel. Und Kieran war neben ihm geritten und hatte Mark nachdenklich betrachtet, während Mark Idris betrachtet hatte.
Mein Land, mein Volk. Meine Heimat,hatte er damals gedacht. Aber vom Boden aus wirkte die Stadt anders: irgendwie nüchterner, vom Geruch der Kanäle erfüllt und von harschem Elbenlicht beleuchtet. Das Haus des Inquisitors lag nicht weit entfernt, aber Helen und er hatten es nicht eilig. Nach ein paar Minuten räusperte Helen sich.
»Du hast unsere Tante im Feenreich gesehen«, sagte sie. »Nene. Aber nur Nene, oder?«
»Ja, am Hof des Lichten Volkes.« Mark nickte; er war froh, dass seine Schwester die Stille durchbrochen hatte. »Wie viele Schwestern hatte unsere Mutter?«
»Sechs oder sieben, glaube ich zumindest«, sagte Helen. »Aber Nene ist die Einzige, die freundlich und gütig ist.«
»Ich dachte, du wüsstest nicht, wo sie sich befindet.«
»Sie hat mir ihren Aufenthaltsort nie verraten, aber wir haben mehr als nur einmal miteinander gesprochen, nachdem man mich auf die Wrangelinsel verbannt hatte«, erklärte Helen. »Ich vermute, dass sie vielleicht Mitleid mit mir hatte.«
»Uns hat sie geholfen, ein Versteck zu finden. Und sie hat Kieran geheilt«, berichtete Mark. »Außerdem hat sie mit mir über unsere Elbennamen gesprochen.« Er schaute sich um. Sie hatten das Haus des Inquisitors erreicht – das größte Gebäude in der Straße, mit Balkonen, die über den Kanal hinausragten. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals hierher zurückkehren würde. Nicht nach Alicante. Nicht als Schattenjäger.«
Helen drückte seine Schulter, dann stiegen sie gemeinsam die Stufen hinauf und klopften an. Simon Lewis öffnete ihnen die Tür. Er wirkte niedergeschlagen und deutlich älter als bei ihrer letzten Begegnung: Seine Schultern waren breiter, seine braunen Haare länger und ein dunkler Bartschatten zeichnete sich auf seinem Kinn ab.
Er schenkte Helen ein schiefes Lächeln. »Als wir das letzte Mal hier in Alicante waren, war ich betrunken und hab irgendetwas zu Isabelles Zimmer hinaufgebrüllt.« Dann wandte er sich an Mark. »Und bei unserer letzten Begegnung hab ich im Feenreich in einem Käfig gehockt.«
Mark erinnerte sich an die Situation: Simon hatte ihn durch die Gitterstäbe eines Koboldkäfigs angestarrt, und Mark hatte ihm erklärt: Ich bin kein Elbe. Ich bin Mark Blackthorn vom Institut in Los Angeles. Es spielt keine Rolle, was die Mitglieder der Wilden Jagd sagen oder was sie mir antun. Ich weiß noch immer, wer ich bin.
»Stimmt«, bestätigte Mark. »Du hast mir von meinen Geschwistern berichtet und von Helens Hochzeit. Dafür war ich dir sehr dankbar.« Aus alter Gewohnheit machte er eine kurze Verbeugung – was ihm einen überraschten Blick von seiner Schwester einbrachte.
»Ich wünschte, ich hätte dir damals mehr erzählen können«, sagte Simon in ernstem Ton. »Und es tut mir so leid. Wegen Livvy. Wir trauern hier ebenfalls.«
Simon öffnete die Tür weit. Dahinter entdeckte Mark eine elegante Eingangshalle, mit einem großen Kronleuchter an der Decke. Links davon befand sich eine Art Wohnzimmer, in dem Rafe, Max und Tavvy vor einem nicht entzündeten Kamin hockten und mit ein paar Spielsachen spielten. Isabelle und Alec saßen auf dem Sofa: Sie hatte die Arme um seinen Hals geschlungen und weinte an seiner Brust. Ihre leisen, untröstlichen Schluchzer erinnerten Mark an seinen eigenen Verlust und den Schmerz tief in seinem Inneren.
»Bitte sag Isabelle und Alec, wie leid uns der Tod ihres Vaters tut«, bat Helen. »Wir wollten nicht einfach so hereinplatzen, aber wir sind hier, um Octavian abzuholen.«
In diesem Moment erschien Magnus an der Tür. Er nickte Helen und Mark zu, ging dann zu den Kindern und hob Tavvy vom Boden hoch. Obwohl sein kleiner Bruder ja eigentlich etwas zu groß war, um noch getragen zu werden, dachte Mark. Andererseits wirkte Tavvy sehr jung für sein Alter, so als hätte der frühe Verlust des Vaters ihn kindlicher bleiben lassen. Als Magnus auf sie zukam, hob Helen die Hände, um Tavvy in Empfang zu nehmen. Doch der streckte die Ärmchen nach Mark aus.
Leicht überrascht nahm Mark seinen kleinen Bruder auf den Arm. Tavvy drehte sich unruhig hin und her; er wirkte müde, aber aufmerksam. »Was ist passiert?«, fragte er. »Hier weinen alle.«
Magnus fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Er sah extrem erschöpft aus. »Wir haben ihm noch nichts gesagt. Weil wir dachten, dass ihr das besser machen solltet«, sagte er.
Mark trat ein paar Schritte von der Tür zurück, und Helen folgte ihm, bis sie alle drei im rechteckigen Lichtkegel des Hauseingangs standen. Vorsichtig setzte er Tavvy ab. Er würde ihm die schlechte Nachricht auf Feenweise überbringen: von Angesicht zu Angesicht.
»Livvy ist von uns gegangen, Kleiner«, sagte er.
Tavvy schaute ihn verwirrt an. »Wohin ist sie denn gegangen?«
»Ins Land des Schattens«, erklärte Mark. Er suchte nach den passenden Worten. Im Feenreich war der Tod etwas völlig anderes als in der Welt der Menschen.
Tavvy sah ihn mit seinen großen, blaugrünen Blackthorn-Augen an. »Aber wir können sie doch retten, oder? Sie zurückholen. Genau wie wir dich aus dem Feenreich zurückbekommen haben. Und wie du Kieran gerettet hast.«
Helen brachte einen erstickten Laut hervor. »Ach, Octavian«, sagte sie leise.
»Livvy ist tot«, murmelte Mark hilflos. Er sah, wie Tavvy bei diesen Worten zurückzuckte. »Das Leben der Sterblichen ist kurz und … zerbrechlich im Angesicht der Ewigkeit.«
Tränen schossen Tavvy in die Augen.
»Mark«,sagte Helen, kniete sich vor Tavvy und streckte die Hände nach ihm aus. »Livvy ist so tapfer gestorben«, sagte sie. »Unsere Schwester hat Julian und Emma verteidigt. Sie … war so mutig.«
Jetzt liefen Tavvy die Tränen übers Gesicht. »Wo ist Julian?«, schluchzte er. »Wo ist er?«
Helen ließ die Hände sinken. »Er ist bei Livvy, in der Stadt der Stille. Aber er wird bald zurück sein. Komm, wir bringen dich nach Hause, in das Haus am Kanal.«
»Nach Hause?«, erwiderte Tavvy verächtlich. »Das ist nicht unser Zuhause.«
Mark bemerkte, dass Simon aus der Tür getreten war und jetzt neben ihm stand. »Gott, der arme Junge«, sagte er. »Hör zu, Mark …«
»Octavian.« Magnus’ Stimme ertönte von der Haustür. Er blickte auf den kleinen, tränenüberströmten Jungen hinab. Aus seinen Augen sprach Erschöpfung, aber auch enormes Mitgefühl – jene Art von Mitgefühl, wie sie mit hohem Alter einhergeht.
Einen Moment lang schien es, als wollte er etwas sagen, doch Rafe und Max hatten sich zu ihm gesellt. Schweigend stiegen sie die Stufen hinunter und gingen zu Tavvy. Rafe war fast so groß wie er, obwohl er erst fünf war. Er schlang die Arme um Tavvy, und Max folgte seinem Beispiel. Und zu Marks Überraschung schien sein kleiner Bruder sich etwas zu entspannen: Er ließ sich umarmen und nickte, als Max ihm etwas ins Ohr flüsterte.
Helen richtete sich auf, und Mark fragte sich, ob sich auf seinem Gesicht wohl der gleiche Ausdruck wie auf ihrem spiegelte: eine Mischung aus Schmerz und Scham. Scham, weil sie nicht mehr tun konnten, um Tavvy zu trösten, ihren jüngeren Bruder, der sie kaum kannte.
»Ist schon okay«, sagte Simon. »Ihr habt es versucht.«
»Aber es ist uns nicht gelungen«, erwiderte Mark.
»Kummer kann man nicht heilen«, sagte Simon. »Das hat mir ein Rabbiner gesagt, als mein Vater gestorben war. Die Zeit ist das Einzige, das Kummer heilen kann … und die Liebe der Menschen, denen etwas an einem liegt. Tavvy hat beides.« Er drückte kurz Marks Schulter. »Pass gut auf dich auf«, sagte er. »Schelo ted’u od za’ar, Mark Blackthorn.«
»Und was bedeutet das?«, fragte Mark.
»Das ist ein Segensspruch«, erklärte Simon. »Noch etwas, das mir der Rabbiner beigebracht hat. ›Mögen keine weiteren Sorgen auf dir lasten.‹«
Dankbar neigte Mark den Kopf – Feenwesen wussten Segenssprüche durchaus zu schätzen. Doch sein Herz fühlte sich weiterhin schwer an: Er konnte sich nicht vorstellen, dass die Sorgen seiner Familie bald vorüber wären.
2
Die melancholischen, schweigenden Wellen
Cristina stand mutlos in der extrem sauberen Küche der Stadtvilla an der Princewater Street und wünschte, es gäbe irgendetwas aufzuräumen.
Inzwischen hatte sie Geschirr gespült, das gar nicht schmutzig gewesen war. Sie hatte den Fußboden gewischt und den Tisch gedeckt, mehrfach gedeckt. Sie hatte Blumen in einer Vase arrangiert, aber dann weggeworfen, nur um sie kurz darauf wieder aus dem Mülleimer zu fischen und erneut in eine Vase zu stellen. Sie wollte die Küche nett, das Haus einladend machen. Aber würde sich überhaupt irgendjemand dafür interessieren, ob die Küche nett und das Haus einladend war?
Nein, vermutlich nicht. Aber sie musste sich trotzdem irgendwie beschäftigen. Am liebsten wäre sie bei Emma gewesen, doch Emma saß bei Drusilla, die Emmas Hände umklammert und sich in den Schlaf geweint hatte. Cristina wollte gern bei Mark sein und ihn trösten, aber er war zusammen mit Helen aufgebrochen. Und sie freute sich für ihn, dass er wenigstens etwas Zeit mit seiner Schwester verbringen konnte, die ihm so lange gefehlt hatte.
Plötzlich wurde die Haustür so heftig aufgestoßen, dass Cristina erschrocken zusammenzuckte und eine Schüssel vom Tisch stieß. Klirrend ging das Gefäß zu Boden und zerbrach in mehrere Teile. Cristina wollte sich gerade bücken, um die Scherben aufzuheben, als sie sah, wie Julian das Haus betrat und die Tür hinter sich zudrückte. In Idris verwendeten die meisten Bewohner eher Verriegelungsrunen als Schlüssel, doch Julian griff nicht nach seiner Stele. Stattdessen blickte er starr durch die Eingangshalle in Richtung Treppe.
Cristina stand wie versteinert da. Julian wirkte wie ein Geist aus einem Shakespeare-Drama. Er hatte sich nicht umgezogen: Sein Hemd und seine Jacke waren steif vor getrocknetem Blut.
Es war ihr schon immer schwergefallen, mit Julian zu reden; aufgrund von Emmas Geständnis wusste sie mehr über ihn, als ihr lieb war. Zum Beispiel, dass er hoffnungslos in ihre Freundin verliebt war. Das ließ sich an mehreren Anzeichen eindeutig erkennen – an der Art und Weise, wie er Emma ansah und mit ihr redete, und an Tausenden winzigen Gesten, beispielsweise wenn er ihr eine Schüssel über den Tisch reichte. Cristina hatte keine Ahnung, wieso die anderen das nicht auch bemerkten. Sie hatte andere Parabatai gekannt, und keiner von ihnen hatte den anderen auf diese Weise angesehen.
Derart persönliche Informationen über jemand anderen waren schon zu besten Zeiten problematisch – doch davon konnte man im Augenblick sicher nicht sprechen. Julian starrte ausdruckslos vor sich hin, bis er sich schließlich in Bewegung setzte. Dabei rieselte das getrocknete Blut seiner Schwester von seiner Kleidung herab und fiel zu Boden.
Wenn sie einfach nur reglos stehen blieb, dann würde er sie vielleicht nicht sehen, dachte Cristina. Dann würde er vielleicht direkt nach oben gehen und ihnen beiden die peinliche Situation ersparen.
Doch während sie noch mit sich rang, versetzte ihr seine trostlose Miene einen Stich ins Herz. Ohne darüber nachzudenken, marschierte sie zur Tür.
»Julian«, sagte sie leise.
Er schien nicht überrascht. Langsam drehte er sich zu ihr um, wie ein halb abgelaufener Automat, dessen Batterien allmählich versagten. »Wie geht es ihnen?«, fragte er.
Was sollte Cristina darauf antworten? »Man kümmert sich um sie«, sagte sie schließlich. »Helen war hier und Diana und Mark.«
»Ty …?«
»Schläft noch immer.« Nervös zupfte sie an ihrem Rock. Sie hatte nach den Ereignissen im Sitzungssaal ihre gesamte Kleidung gewechselt, um sich halbwegs sauber zu fühlen.
Zum ersten Mal erwiderte er ihren Blick. Seine Augen waren gerötet, obwohl Cristina sich nicht daran erinnern konnte, dass er in Tränen ausgebrochen war. Vielleicht hatte er aber auch geweint, während er Livvy im Arm gehalten hatte – doch daran wollte sie lieber nicht denken. »Emma …«, setzte er an, »ist mit ihr alles in Ordnung? Du weißt immer, wie es ihr geht. Dir würde sie … es erzählen.«
»Sie ist bei Drusilla. Aber ich bin mir sicher, dass sie dich gern sehen würde.«
»Aber ist mit ihr alles okay?«
»Nein«, antwortete Cristina. »Wie auch?«
Julian warf einen Blick in Richtung Treppe, als könnte er sich nicht ausmalen, welche Kraft es ihn kosten würde, die Stufen hinaufzusteigen. »Robert wollte uns helfen«, sagte er. »Emma und mir. Du weißt ja über uns Bescheid. Ich weiß, dass du weißt, was wir füreinander empfinden.«
Überrascht zögerte Cristina einen Moment. Sie hätte nicht gedacht, dass Julian dieses Thema ihr gegenüber jemals ansprechen würde. »Vielleicht könnte der nächste Inquisitor …«
»Auf dem Rückweg bin ich durch die Garnison gekommen«, berichtete Julian. »Dort hat man sich bereits versammelt. Große Teile der Kohorte und die Hälfte der Ratsmitglieder. Sie diskutieren darüber, wer der nächste Inquisitor werden soll. Ich bezweifle, dass das jemand sein wird, der uns helfen will. Nicht nach dem, was heute passiert ist. Eigentlich müsste ich mir deswegen Sorgen machen«, sagte er. »Aber im Moment ist es mir vollkommen egal.«
Am oberen Ende der Treppe wurde eine Tür geöffnet, und Licht fiel in den dunklen Gang. »Julian?«, rief Emma. »Julian, bist du das?«
Beim Klang ihrer Stimme richtete er sich unbewusst auf. »Ich komme schon.« Als er die Treppe hinaufging, sah er Cristina nicht mehr an, sondern nickte nur noch kurz in ihre Richtung.
Cristina hörte, wie sich seine Schritte entfernten und seine Stimme mit Emmas verschmolz. Sie warf einen raschen Blick in Richtung Küche. Die zerbrochene Schüssel lag noch immer in der Ecke. Eigentlich sollte sie die Scherben auffegen. Das wäre eine praktische Reaktion gewesen, und Cristina hatte sich immer für praktisch gehalten.
Doch einen Moment später streifte sie ihre Monturjacke über, schob mehrere Seraphklingen in ihren Waffengurt und schlüpfte leise aus der Tür, hinaus in die dunklen Straßen von Alicante.
Emma lauschte auf das vertraute Geräusch von Julians Schritten auf der Treppe. Der Klang war für sie wie Musik, die sie seit ihrer Kindheit kannte – so vertraut, dass es fast schon keine Musik mehr war.
Sie widerstand dem Drang, erneut nach ihm zu rufen. Schließlich stand sie in Drus Zimmer, und das Mädchen war gerade erst eingeschlafen – erschöpft und noch immer in der Kleidung, die sie zur Versammlung getragen hatte. Emma hörte Julians Schritte im Flur und dann das Geräusch einer Tür, die geöffnet und wieder geschlossen wurde.
Sorgsam darauf bedacht, Dru nicht zu wecken, schlüpfte sie leise aus dem Raum. Sie wusste, wohin Julian gegangen war: durch den Flur und zu dem Zimmer, das man zu Tys Raum erklärt hatte.
Dort hatte jemand das Licht gedämpft. Diana saß in einem Sessel neben Tys Bett; auf ihrem Gesicht spiegelte sich eine Mischung aus Kummer und Erschöpfung. Kit hockte schlafend an der Wand, die Hände schlaff im Schoß.
Julian stand vor Tys Bett und blickte auf seinen Bruder hinab. Tiberius lag vollkommen reglos da – ein durch Medikamente erzeugter Schlaf. Seine dunklen Haare hoben sich deutlich von dem weißen Kopfkissen ab. Dennoch lag er auch jetzt noch auf der linken Seite des Betts, als wollte er für Livvy Platz lassen.
»Seine Wangen sind gerötet«, sagte Julian gerade. »Als ob er Fieber hätte.«
»Er hat kein Fieber«, versicherte Diana mit fester Stimme. »Er braucht den Schlaf, Jules. Denn schlafen hilft.«
Emma sah die unverhohlene Skepsis auf Julians Gesicht. Sie wusste, was er dachte: Schlafen hat mir nicht geholfen, als meine Mutter gestorben ist oder mein Vater. Und es wird auch bei diesem Verlust nicht helfen. Livvys Tod wird immer eine tiefe Wunde sein.
Diana drehte sich zu Emma um. »Was ist mit Dru?«, fragte sie.
Bei diesen Worten schaute Julian auf und sein Blick kreuzte sich mit Emmas. Sie empfand den Schmerz in seinen Augen wie einen Schlag gegen die Brust, und das Atmen fiel ihr plötzlich schwer. »Sie schläft«, berichtete Emma fast im Flüsterton. »Es hat eine Weile gedauert, aber sie ist endlich eingenickt.«
»Ich war in der Stadt der Stille«, sagte er. »Wir haben Livvy dorthin gebracht. Ich habe bei der Aufbahrung geholfen.«
Diana legte die Hand auf seinen Arm. »Jules«, sagte sie leise. »Du solltest duschen gehen und dich etwas ausruhen.«
»Ich sollte hierbleiben«, erwiderte Julian mit gesenkter Stimme. »Wenn Ty aufwacht und ich nicht hier bin …«
»Er wird nicht aufwachen«, sagte Diana. »Die Brüder der Stille sind bei der Verabreichung von Medikamenten sehr präzise.«
»Wenn er aufwacht und du stehst hier, von Kopf bis Fuß mit Livvys Blut bedeckt, wird ihm das ganz bestimmt nicht helfen, Julian«, sagte Emma. Diana warf ihr einen Blick zu, überrascht von den scharfen Worten. Doch Julian blinzelte nur kurz, als würde er aus einem Traum erwachen.
Emma streckte ihm ihre Hand entgegen. »Komm«, sagte sie.
Über den Bergen hatten sich Gewitterwolken gebildet und der Himmel war schwarzblau. Glücklicherweise war der Weg hinauf zur Garnison mit Elbenlichtfackeln beleuchtet. Cristina lief parallel zum Pfad den Hügel hinauf und hielt sich dabei bewusst in den Schatten. Der ozonhaltige Geruch des heraufziehenden Sturms lag in der Luft und erinnerte sie an den bitteren Kupfergeruch von Blut.
Als Cristina das Tor der Garnison erreichte, schwang es auf, und eine Gruppe von Stillen Brüdern trat hinaus. Ihre elfenbeinfarbenen Roben glitzerten, als wären sie mit Regentropfen bedeckt.
Hastig drückte Cristina sich an die Mauer. Sie verstieß zwar gegen kein Gesetz – jeder Schattenjäger konnte die Garnison betreten –, aber sie wollte lieber nicht gesehen werden. Als die Brüder der Stille an ihr vorbeigingen, erkannte sie, dass das Glitzern auf ihren Roben nicht von Regentropfen, sondern von feinen Glassplittern stammte.
Sie mussten sich im Sitzungssaal befunden haben, als es passiert war. Cristina erinnerte sich daran, wie das Fenster explodiert und Annabel verschwunden war – eine Mischung aus grellem Licht und einem gewaltigen Knall. Aber Cristina hatte sich auf die Blackthorns konzentriert, auf Emma und den entsetzten Ausdruck auf ihrem Gesicht, auf Mark und seinen zusammengekrümmten Körper, als würde er die Wucht eines Tiefschlags absorbieren.
Im Inneren der Garnison herrschte Stille. Cristina senkte den Kopf und lief rasch durch die Gänge, wobei sie dem Klang von Stimmen folgte, die aus dem Sitzungssaal drangen. Vor Erreichen der Tür bog sie jedoch nach rechts ab und stieg die Stufen zu den Plätzen auf der Empore hinauf, die wie eine Theatergalerie in den Saal hineinragte. Auf dem Podium unter ihr hatte sich eine Gruppe von Nephilim versammelt. Irgendjemand – die Stillen Brüder? – hatte die Glasscherben und das Blut beseitigt. Und das Fenster war wieder intakt.
Ihr könnt aufräumen und die Beweise entfernen, so viel ihr wollt,dachte Cristina, während sie sich hinkniete, um über das Geländer der Empore zu spähen. Aber es ist trotzdem passiert.
Sie entdeckte Horace Dearborn, der auf einem hohen Hocker saß. Dearborn war ein großer, hagerer Mann, nicht besonders muskulös, aber mit sehnigen Armen. Seine Tochter Zara Dearborn stand neben ihm; sie hatte die Haare zu einem ordentlichen Bauernkranz geflochten, und ihre Montur war makellos. Im Grunde besaß sie nur wenig Ähnlichkeit mit ihrem Vater – wenn man von der unterdrückten Wut in ihren Mienen und ihrer Leidenschaft für die Kohorte einmal absah. Die Kohorte … eine Splittergruppe innerhalb des Rats, die von der Überlegenheit der Nephilim gegenüber den Schattenweltlern überzeugt war, selbst wenn sie dafür gegen das Gesetz verstoßen musste.
Um sie herum drängten sich andere, junge und alte Schattenjäger. Cristina erkannte eine ganze Reihe von Zenturionen – unter anderem Manuel Casales Villalobos, Jessica Beausejours und Samantha Larkspear – sowie zahlreiche andere Nephilim, die während der Versammlung Kohortenabzeichen getragen hatten. Dazwischen stand jedoch auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Schattenjägern, die Cristinas Wissen nach nicht zur Kohorte gehörten. Wie etwa Lazlo Balogh, der Leiter des Budapester Instituts, der zu den wichtigsten Befürwortern des Kalten Friedens und der damit verbundenen Strafmaßnahmen gegenüber Schattenweltlern zählte. Josiane Pontmercy vom Institut in Marseille. Delaney Scarsbury, der an der Schattenjäger-Akademie unterrichtete. Dazu ein paar Freundinnen ihrer Mutter – Trini Castel von der Barcelona-Division und Luana Carvalho, Leiterin des Instituts in São Paulo, die Cristina beide seit ihrer Kindheit kannte.
Allesamt Kongregationsmitglieder. Cristina sprach ein stummes Dankgebet, dass ihre Mutter nicht hier sein konnte: Sie war mit einem explosionsartigen Anstieg von Halphas-Dämonen im Alameda-Central-Park beschäftigt gewesen und hatte darauf vertraut, dass Diego ihre Interessen vertreten würde.
»Wir dürfen keine Zeit verlieren«, sagte Horace, der eine Aura humorloser Strenge verströmte, genau wie seine Tochter. »Uns fehlt ein Inquisitor, ausgerechnet jetzt in diesem kritischen Moment, wo wir von Kräften außerhalb und innerhalb des Rats bedroht werden.« Er schaute in die Runde. »Wir hoffen, dass diejenigen unter euch, die unserer Sache bisher misstraut haben, sich uns nach den heutigen Ereignissen anschließen werden.«
Cristina spürte, wie ein eisiger Schauer durch ihren Körper jagte. Das war nicht einfach nur eine Versammlung der Kohorte. Hier ging es um das Anwerben neuer Mitglieder. Im Inneren des leeren Sitzungssaals, in dem Livvy kurz zuvor gestorben war. Ihr wurde übel.
»Was hast du deiner Meinung nach denn in Erfahrung gebracht, Horace?«, fragte eine Frau mit einem australischen Akzent. »Sprich offen zu uns, damit wir alle über das Gleiche reden können und es nicht zu Missverständnissen kommt.«
Er warf ihr einen Blick zu. »Andrea Sedgewick«, grinste er. »Wenn ich mich richtig erinnere, hast du für den Kalten Frieden gestimmt.«
Sie zog eine verkniffene Miene. »Ich halte nicht viel von Schattenweltlern. Aber das, was hier heute passiert ist …«
»Wir wurden angegriffen«, sagte Dearborn. »Betrogen und angegriffen, von innen und außen. Ich bin mir sicher, dass ihr es auch alle gesehen habt: das Siegel des Dunklen Hofs.«
Cristina erinnerte sich: Als Annabel verschwunden war – wie von unsichtbaren Händen durch das zertrümmerte Fenster getragen –, hatte ein Symbol in der Luft geschwebt: eine gespaltene Krone.
Die Menge murmelte zustimmend. Der Geruch von Angst lag in der Luft, wie ein Pesthauch. Dearborn schien es sichtlich zu genießen; er leckte sich beinahe die Lippen, während er sich im Saal umsah. »Der König des Dunklen Volkes hat im Herzen unseres Heimatlandes zugeschlagen. Er verhöhnt den Kalten Frieden. Er weiß, dass wir geschwächt sind. Und er lacht über unsere Unfähigkeit, strengere Gesetze zu erlassen oder sonst irgendetwas zu unternehmen, das die Feenwesen unter Kontrolle bringen würde …«
»Niemand kann die Feenwesen unter Kontrolle bringen«, warf Scarsbury ein.
»Das ist genau die Einstellung, die den Rat seit Jahren geschwächt hat«, fauchte Zara. Ihr Vater schenkte ihr ein wohlwollendes Lächeln.
»Meine Tochter hat recht«, sagte er. »Auch die Feenwesen haben Schwächen – wie alle Schattenweltler. Sie wurden weder von Gott noch von unserem Erzengel erschaffen. Sie haben Makel, die wir nie für uns genutzt haben. Aber sie haben unsere Großzügigkeit ausgenutzt und lachen sich hinter unserem Rücken ins Fäustchen.«
»Und was schlägst du vor?«, fragte Trini. »Eine Mauer rund um das Feenreich?«
Hämisches Gelächter ertönte. Das Reich der Feenwesen existierte überall und nirgends – es stellte eine andere Daseinsebene dar. Niemand konnte es abriegeln.
Horace verengte die Augen zu Schlitzen. »Ihr lacht, aber Eisentüren an allen Ein- und Ausgängen zum Feenreich würden enorm dazu beitragen, weitere feindliche Einfälle in unsere Welt zu verhindern.«
»Ist das das Ziel?«, fragte Manuel träge, als würde ihn die Antwort nicht sonderlich interessieren. »Das Feenreich abzuriegeln?«
»Wir haben mehr als nur ein Ziel, wie du genau weißt, Junge«, erwiderte Dearborn. Plötzlich lächelte er, als wäre ihm gerade ein Gedanke gekommen. »Du weißt über die Fäule Bescheid, Manuel. Vielleicht möchtest du dein Wissen ja mit uns teilen, da die Konsulin uns im Dunklen gelassen hat. Vielleicht sollten diese anständigen Bürger hier erfahren, was passiert, wenn die Tore zwischen dem Feenreich und unserer Welt weit aufgestoßen werden.«
Cristina umklammerte ihren Anhänger und schäumte innerlich vor Wut, während Manuel die verdorrten Areale im Brocelind-Wald beschrieb: der Umstand, dass sie sich jeder Schattenjägermagie widersetzten, und die Tatsache, dass eine ähnliche Fäule im Land des Dunklen Volkes zu existieren schien. Woher wusste er das?, fragte Cristina sich aufgebracht. All diese Dinge hatte Kieran dem Rat mitteilen wollen, doch er war nicht dazu gekommen. Also, woher wusste Manuel davon?
Sie konnte nur froh und dankbar sein, dass Diego ihre Bitte erfüllt und Kieran zur Scholomance gebracht hatte. Es war offensichtlich, dass ein Vollblutelbe hier seines Lebens nicht mehr sicher war.
»Der König des Dunklen Volkes ist dabei, ein Gift herzustellen und in unserer Welt zu verbreiten – eine Substanz, die bewirkt, dass wir Schattenjäger gegen ihn machtlos sind. Wir müssen jetzt und sofort handeln, um unsere Stärke zu demonstrieren«, fiel Zara Manuel ins Wort, bevor er seinen Bericht beenden konnte.
»So wie du gegenüber Malcolm Stärke gezeigt hast?«, fragte Lazlo. Belustigtes Kichern ertönte aus der Menge, woraufhin Zara errötete: Sie hatte stolz verkündet, dass sie Malcolm Fade, einen mächtigen Hexenmeister, persönlich niedergestreckt hatte. Doch später hatte sich herausgestellt, dass sie gelogen hatte. Cristina und die anderen hatten gehofft, diese Tatsache würde Zara in Misskredit bringen, aber jetzt – nach dem, was mit Annabel passiert war – erschien Zaras Lüge kaum mehr zu sein als ein dummer kleiner Scherz.
Dearborn erhob sich. »Das tut jetzt nichts zur Sache, Balogh. Die Blackthorns haben Feenblut in ihrer Familie. Sie haben eine Kreatur – ein nekromantisches, halbtotes Wesen, das unseren Inquisitor getötet und den Sitzungssaal mit Blut und Schrecken erfüllt hat – hierher nach Alicante gebracht.«
»Dabei ist aber auch eine ihrer Schwestern getötet worden«, gab Luana zu bedenken. »Die Trauer der Blackthorns war offenkundig; das hatten sie ganz bestimmt nicht geplant.«
Cristina konnte förmlich sehen, wie sich die Rädchen in Dearborns Verstand drehten. Nichts wäre ihm lieber gewesen, als den Blackthorns die Schuld zu geben und sie alle in der Stadt der Stille einkerkern zu lassen. Aber Julians Anblick, als er Livvys reglosen Körper in den Armen gehalten hatte, war einfach zu brutal und emotional gewesen und konnte nicht einmal von der Kohorte ignoriert werden. »Sie sind ebenfalls Opfer«, sagte er schnell. »Opfer des Elbenprinzen, dem sie vertraut haben. Opfer ihrer eigenen Feenverwandten. Vielleicht lassen sie sich ja jetzt überzeugen und nehmen Vernunft an. Schließlich sind sie Schattenjäger, und genau dafür steht die Kohorte – für den Schutz von Schattenjägern. Für den Schutz unserer Kinder.« Er legte eine Hand auf Zaras Schulter. »Wenn das Engelsschwert wiederhergestellt ist, wird Zara mit dem größten Vergnügen alle potenziellen Zweifel an ihren Leistungen beseitigen.«
Zara errötete erneut und nickte. Cristina fand, dass sie eindeutig schuldig wirkte. Aber die anderen hatten sich von der Erwähnung des Engelsschwertes ablenken lassen.
»Wiederhergestellt?«, fragte Trini. Sie glaubte fest an den Erzengel und seine Kräfte, genau wie Cristinas Familie. Und sie machte einen sehr besorgten Eindruck, während sie ihre dürren Hände rang. »Unsere unersetzbare Verbindung zum Engel Raziel … Glaubst du wirklich, dass wir das Schwert zurückbekommen?«
»Es wird wiederhergestellt werden«, versicherte Dearborn aalglatt. »Jia hat für morgen ein Treffen mit den Eisernen Schwestern vereinbart. Das Schwert wurde einst geschmiedet, also kann es auch erneut geschmiedet werden.«
»Aber es wurde im Himmel geschmiedet«, protestierte Trini. »Nicht in der Adamant-Zitadelle.«
»Und der Himmel hat zugelassen, dass es zerbrochen wurde«, sagte Dearborn. Cristina musste ein Keuchen unterdrücken. Wie konnte er solch eine schamlose Behauptung aufstellen? Doch die anderen schienen ihm eindeutig zu vertrauen. »Nichts kann das Engelsschwert zertrümmern – nur Raziels Wille. Er hat auf uns niedergeblickt und gesehen, dass wir unwürdig sind. Er hat gesehen, dass wir uns von seinem Mandat abgewendet haben, von unserem Dienst gegenüber den Engeln – und dass wir stattdessen den Schattenweltlern gedient haben. Er hat das Schwert zerbrochen, als Warnung.« In Dearborns Augen funkelte ein fanatischer Ausdruck. »Sobald wir uns wieder als würdig erweisen, wird Raziel gestatten, dass wir das Schwert erneut schmieden. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel.«
Wie konnte er es wagen, für Raziel zu sprechen? Was fiel ihm ein, so zu tun, als wäre er Gott?Cristina bebte vor Zorn. Doch die anderen Schattenjäger sahen Dearborn an, als würde er ihnen ein Licht in der Dunkelheit zeigen. Als wäre er ihre einzige Hoffnung.
»Und wie genau sollen wir uns als würdig erweisen?«, fragte Balogh in düsterem Ton.
»Wir müssen uns wieder daran erinnern, dass wir Schattenjäger auserwählt sind«, erklärte Horace. »Wir müssen uns daran erinnern, dass wir einen Auftrag haben. Wir sind die erste Verteidigungslinie gegenüber dem Bösen, und deshalb stehen wir an erster Stelle.Sollen sich die Schattenweltler doch um sich selbst kümmern. Wenn wir unter einer starken Führung zusammenarbeiten …«
»Aber wir haben keine starke Führung«, sagte Jessica Beausejours, eine von Zaras Zenturionenfreundinnen. »Wir haben Jia Penhallow, und sie ist besudelt. Besudelt durch die Verbindung ihrer Tochter mit Feenwesen und Mischlingen.«
Ein Aufkeuchen ging durch die Menge, dann kicherte jemand boshaft. Aller Augen hefteten sich auf Horace, doch er schüttelte nur den Kopf. »Ich werde nicht schlecht über unsere Konsulin sprechen«, sagte er steif.
Seiner Beteuerung folgte erneutes Raunen. Horaces vorgetäuschte Loyalität hatte ihm sichtlich weitere Stimmen verschafft. Cristina knirschte mit den Zähnen.
»Ihre Loyalität gegenüber ihrer Familie ist nur zu verständlich, auch wenn sie sich dadurch vermutlich hat blenden lassen«, sagte Horace. »Aber jetzt gilt nur eines: die Gesetze, die der Rat erlässt. Wir müssen strenge Regulierungen gegenüber den Schattenweltlern durchsetzen … und die strengsten gegenüber dem Lichten Volk, dem Feinen Volk – obwohl es nichts Feines an sich hat.«
»Das wird den König des Dunklen Volkes nicht aufhalten«, sagte Jessica. Allerdings hatte Cristina den Eindruck, dass sie gar nicht an Dearborns Worten zweifelte, sondern ihn eher ermutigen wollte, seine Überlegungen noch weiter auszuführen.
»Es geht darum, die Feenwesen und andere Schattenweltler daran zu hindern, sich dem König des Dunklen Volkes anzuschließen«, verkündete Horace. »Und deshalb müssen sie alle beobachtet und nötigenfalls eingekerkert werden, bevor sie die Gelegenheit haben, uns zu hintergehen.«
»Eingekerkert?«, wiederholte Trini. »Aber wie?«
»Ach, es gibt verschiedene Möglichkeiten«, sagte Horace. »Die Wrangelinsel könnte beispielsweise eine ganze Gruppe von Schattenweltlern festhalten. Aber das Wichtigste ist, dass wir zügig mit der Kontrolle beginnen. Durchsetzung des Abkommens. Erfassen aller Schattenweltler, einschließlich ihrer Namen und Wohnorte. Natürlich würden wir mit den Feenwesen anfangen.«
Zustimmendes Gemurmel ertönte aus der Menge.
»Aber selbstverständlich brauchen wir dazu einen starken Inquisitor … jemanden, der diese Gesetze erlassen und durchsetzen kann«, fuhr Horace fort.
»Dann mach du das doch!«, rief Trini. »Wir haben heute das Engelsschwert und den Inquisitor verloren – also sollten wir wenigstens einen Verlust ersetzen. Und wir haben eine beschlussfähige Menge; es sind genügend Schattenjäger anwesend, um Horace für den Posten des Inquisitors vorzuschlagen. Wir können gleich morgen früh darüber abstimmen lassen. Wer ist noch dafür?«
Ein Sprechchor erfüllte den Saal: »Dearborn! Dearborn!«
Cristina klammerte sich an das Geländer der Empore. Ihr schwirrte der Kopf. Das hier passierte nicht wirklich. So war Trini doch gar nicht, die Freundinnen ihrer Mutter waren nicht so gestrickt. Das konnte einfach nicht das wahre Gesicht der Kongregation sein.
Hastig rappelte sie sich auf – unfähig, das Ganze noch eine Sekunde länger zu ertragen – und stürmte von der Empore.
Emmas Zimmer war klein und in einem leuchtenden Gelb gestrichen, das nicht zu ihrer Trauerstimmung passen wollte. Ein weißes Pfostenbett beherrschte den Raum. Emma zog Julian zu sich heran, drückte ihn sanft auf das Bett und verriegelte die Tür.
»Warum schließt du ab?«, fragte er – die ersten Worte, die er seit dem Verlassen von Tys Zimmer gesprochen hatte.
»Du brauchst etwas Privatsphäre, Julian.« Emma drehte sich zu ihm um. Gott, sein Anblick brach ihr das Herz: Blut hatte seine Haut gesprenkelt, seine Kleidung dunkel gefärbt und war auf seinen Stiefeln zu großen Placken getrocknet.
Livvys Blut. Emma wünschte, sie wäre ihr während dieser letzten Momente näher gewesen und hätte ihr mehr Aufmerksamkeit geschenkt, statt sich Sorgen über die Kohorte zu machen und über Manuel, Zara und Jessica, über Robert Lightwood und das Exil, über ihr eigenes gebrochenes, verkorkstes Herz. Sie wünschte, sie hätte Livvy noch einmal in den Arm genommen und darüber gestaunt, wie groß und erwachsen sie geworden war und wie sehr sie sich verändert hatte … von dem pausbäckigen Kleinkind aus Emmas eigenen Kindheitserinnerungen war sie zu einer jungen Frau herangewachsen.
»Nicht«, sagte Julian heiser.
Unwillkürlich trat Emma näher zu ihm. Er musste den Kopf anheben, um ihr in die Augen zu sehen. »Was soll ich nicht tun?«
»Dir selbst Vorwürfe machen«, sagte er. »Ich kann förmlich spüren, dass du darüber nachdenkst, was du alles anders hättest machen sollen. Aber ich kann solche Gedanken nicht zulassen, sonst breche ich vollends zusammen.«
Er hockte auf der Bettkante, als könnte er die Vorstellung, sich hinzulegen, nicht ertragen. Behutsam berührte Emma sein Gesicht, strich mit der Handfläche über seine Wange. Julian erschauderte und packte grob ihr Handgelenk.
»Emma«, setzte er an. Und zum ersten Mal in ihrem Leben konnte Emma seine Stimme nicht deuten. Sie klang tief und düster. Schroff, allerdings ohne Wut. Als wollte er etwas, wobei Emma jedoch nicht wusste, was genau.
»Was soll ich tun?«, flüsterte sie. »Was soll ich tun, Julian? Ich bin dein Parabatai – ich muss dir einfach helfen.«
Er hielt noch immer ihr Handgelenk fest; seine Pupillen wirkten riesig und ließen den Blaugrünton seiner Iris wie einen schmalen Ring erscheinen. »Normalerweise schmiede ich Pläne, bei denen ich immer einen Schritt nach dem anderen mache«, sagte er. »Wenn mich alles zu überwältigen droht, frage ich mich, welches Problem als Erstes gelöst werden muss. Und wenn das behoben ist, kümmere ich mich um das nächste. Aber jetzt weiß ich nicht einmal, wo ich anfangen soll.«
»Julian, ich bin dein Kampfpartner«, erwiderte Emma. »Bitte hör mir jetzt gut zu. Das ist der erste Schritt: Steh auf.«
Einen Moment lang musterte er sie mit zusammengekniffenen Augen, dann folgte er ihrer Aufforderung. Sie standen jetzt dicht voreinander. Emma konnte die Stärke und Wärme seines Körpers spüren. Sie schob die Jacke von seinen Schultern und packte den Kragen seines Hemds. Der Stoff fühlte sich wie Wachstuch an; es klebte vor Blut. Emma riss das Hemd auf, wobei ein paar Knöpfe abplatzten.
Julians Augen weiteten sich, doch er unternahm nichts, um sie aufzuhalten. Mit einem Ruck zerrte sie das Hemd herunter und warf es beiseite. Dann bückte sie sich und zog ihm die blutverschmierten Stiefel aus. Als sie sich wieder aufrichtete, sah er sie mit hochgezogenen Augenbrauen an.
»Hast du wirklich vor, mir die Hose vom Leib zu reißen?«, fragte er.
»Sie ist mit Livvys Blut getränkt«, erwiderte sie mit erstickter Stimme. Als sie seine Brust berührte, spürte sie, wie er den Atem anhielt. Emma stellte sich vor, sie könnte die zerklüfteten Ränder seines Herzens fühlen. Auch die Haut an seinem Hals und an seinen Schultern war blutverschmiert … die Stellen, die mit Livvy in Berührung gekommen waren, als er sie an sich gedrückt hatte. »Du solltest duschen«, sagte Emma. »Ich warte hier auf dich.«
Leicht berührte er ihre Wange, strich mit den Fingerspitzen über ihre Haut. »Emma, wir beide brauchen eine Dusche.«
Dann drehte er sich um, ging ins Bad und ließ die Tür weit offen. Nach einem Moment folgte Emma ihm.
Er hatte seine restliche Kleidung zu einem Haufen auf den Boden geworfen und stand unter der Dusche, nur mit seiner Unterhose bekleidet. Wasser strömte ihm über Haare und Gesicht.
Emma musste kräftig schlucken, bevor sie ihre Sachen auszog und in Slip und Unterhemd zu ihm in die Dusche trat. Das Wasser war heiß und füllte die gemauerte Duschecke mit Dampf. Julian stand reglos unter dem Sprühkopf; hellrote Striemen hatten sich unter dem Wasserstrahl auf seiner Haut gebildet.
Vorsichtig griff Emma um ihn herum und drehte die Temperatur herunter. Wortlos sah er zu, wie sie die Seife nahm und aufschäumte. Als sie ihre schaumbedeckten Hände auf seinen Körper legte, zog er scharf die Luft ein, so als verursachte ihm die Berührung Schmerzen. Doch er rührte sich nicht.
Kräftig schrubbte Emma über seine Brust und grub ihm dabei fast die Fingernägel in die Haut, um das Blut zu entfernen. Rötlich gefärbtes Wasser strömte in den Abfluss. Die Seife duftete intensiv nach Zitronen. Sein Körper fühlte sich hart an, narbenübersät und muskulös – nicht wie der Körper eines Jungen. Nicht mehr. Wann hatte er sich so verändert? Emma konnte sich nicht an den Tag, die Stunde, den Moment erinnern.