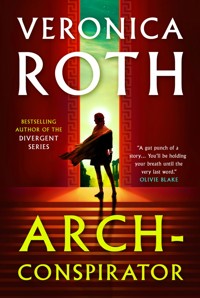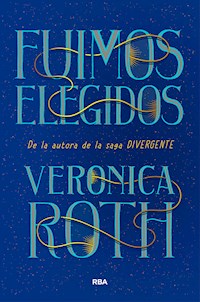9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Rat-der-Neun-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ihre Gabe ist ein Fluch, ihr Bruder ein Tyrann, ihr Geliebter ein Feind
Cyra, die Schwester des brutalen Tyrannen Ryzek, verfügt über eine besondere Gabe: Sie kann Menschen durch bloße Berührung Schmerz zufügen und sie gar töten – was ihr Bruder gezielt gegen seine Feinde einsetzt. Doch gleichzeitig muss Cyra selbst all diese Schmerzen spüren und zerbricht fast daran. Als Ryzek feststellt, dass sein neuer Gefangener Akos die Gabe hat, Cyras Schmerzen zu blockieren, stellt er ihr Akos zur Seite – um seine Waffe nicht zu verlieren.
Akos setzt alles daran, sich und seine Familie aus Ryzeks Macht zu befreien. Er hat nicht damit gerechnet, in Cyra eine Verbündete zu finden. Gemeinsam sind sie entschlossen, gegen Ryzek kämpfen, doch er hat beide in der Hand und seine Macht reicht weiter, als sie denken …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 769
Ähnliche
VERONICA ROTH
RAT
DER
NEUN
-
GEZEICHNET
Aus dem Amerikanischen
von Petra Koob-Pawis
und Michaela Link
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2017 by Veronica Roth
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
»Carve the Mark« bei Katherine Tegen Books,
an imprint of HarperCollins Children’s Books, New York
© 2017 für die deutschsprachige Ausgabe
cbt Kinder- und Jugendbuchverlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
literarische Agentur Thomas Schlück, 30287 Garbsen.
Übersetzung: Petra Koob-Pawis und Michaela Link
Lektorat: Jana Breunig und Michelle Gyo
Covergestaltung: semper smile, München
unter Verwendung des Originalmotivs © 2017 by Veronica Roth.Jacket art by Jeff Huang. Jacket design by Joel Tippie.
Map illustrated by Virginia Allyn. All other design elements go under:Typography by Joel Tippie.Used with permission. All rights reserved.
jb · Herstellung: sto
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-20793-9V005
www.cbt-buecher.de
Für Ingrid und Karl –
weil es keine Version von euch gibt,
die ich nicht liebe
TEIL 1
KAPITEL 1
AKOS
DIE RAUSCHBLUMEN BLÜHTEN nur in der längsten Nacht. Die ganze Stadt feierte, wenn sich die Blütenblätter zu einem satten Rot entfalteten – zum einen, weil die Rauschblumen das Herzblut des Volkes darstellten, zum anderen – das vermutete Akos –, damit nicht alle in der Kälte den Verstand verloren.
An diesem Tag, dem Fest der Blüte, schwitzte er in seinem Mantel, während sich der Rest der Familie noch fertig machte, daher ging er in den Garten, um sich etwas abzukühlen. Das Haus der Kereseths hatte runde Außen- und Innenmauern und in seinem Innenhof befand sich ein Brennofen. Das sollte angeblich Glück bringen.
Die frostkalte Luft brannte in Akos’ Augen, kaum dass er die Tür geöffnet hatte. Er zog seine Schutzbrille von der Stirn nach unten über die Augen. Die Wärme seiner Haut ließ das Glas sofort beschlagen. Mit behandschuhten Fingern tastete er nach dem metallenen Schüreisen und stieß es unter die Brennofenhaube. Die Brennsteine im Ofen sahen aus wie schwarze Klumpen, bis sie durch die Reibung aufflammten. Dann funkelten sie in verschiedenen Farben, je nachdem, womit sie bestäubt waren.
Die Brennsteine leuchteten blutrot auf. Hier draußen sollten sie nichts erwärmen oder beleuchten, sondern nur an den Strom erinnern. Als sei das Summen, das Akos im ganzen Leib spürte, nicht Erinnerung genug. Der Strom floss durch jedes lebende Ding und zeigte sich am Himmel in allen Farben. Wie die Brennsteine. Wie das Licht der Gleiter, die auf ihrem Weg zum Zentrum der Stadt über sie hinwegschwebten. Bewohner anderer Welten, die in diesem Planeten nur eine Schneewüste sahen, hatten sich noch nie hierherverirrt.
Eijeh, Akos’ älterer Bruder, streckte den Kopf aus der Haustür. »Willst du erfrieren, oder was? Komm schon, Mom ist fast so weit.«
Ihre Mutter brauchte immer etwas länger, um sich fertig zu machen, wenn sie in den Tempel gingen. Immerhin war sie das Orakel. Alle Blicke würden auf sie gerichtet sein.
Akos legte das Schüreisen beiseite, kehrte ins Haus zurück, schob die Schutzbrille wieder hoch und zog den Gesichtsschutz herunter.
Eingemummt in ihre wärmsten Kapuzenmäntel standen sein Vater und Cisi, seine ältere Schwester, an der Vordertür und warteten. Ihre Mäntel waren alle aus demselben Material gefertigt – Kutyah-Pelz, den man nicht färben konnte, weshalb die Kleidungsstücke alle grauweiß waren.
»Bist du so weit, Akos? Gut.« Seine Mutter machte ebenfalls ihren Mantel zu. Dabei fiel ihr Blick auf die alten Stiefel ihres Mannes. »Irgendwo wirbelt jetzt die Asche deines Vaters auf, weil deine Schuhe so schmutzig sind, Aoseh.«
»Ich weiß. Deshalb habe ich mir ja solche Mühe gegeben, sie dreckig zu machen«, erwiderte Akos’ Vater grinsend.
»Gut«, sagte sie. Tatsächlich zirpte sie es beinahe. »Mir gefallen sie so.«
»Dir gefällt alles, was meinem Vater nicht gefallen hat.«
»Das liegt daran, dass ihm nichts gefallen hat.«
»Können wir in den Gleiter steigen, solange er noch warm ist?«, bat Eijeh in nörgeligem Ton. »Ori wartet beim Denkmal auf uns.«
Akos’ Mutter hatte ihren Mantel inzwischen geschlossen und setzte den Gesichtsschutz auf. Gemeinsam eilten sie die beheizte Auffahrt hinunter – fünf in Pelze, Schutzbrillen und Fäustlinge vermummte Gestalten. Ein kompakter runder Gleiter wartete auf sie. Er schwebte auf Kniehöhe über dem festen Schnee. Die Tür öffnete sich, sobald Akos’ Mutter sie berührte, und alle stiegen ein. Niemand machte sich die Mühe, einen Sicherheitsgurt anzulegen.
»Auf zum Tempel!«, rief Akos’ Vater mit erhobener Faust. Das machte er immer, wenn sie dorthin wollten. So als würde er über einen langweiligen Vortrag oder eine besonders lange Warteschlange am Wahltag jubeln.
»Wenn wir diese Aufregung doch nur in Flaschen füllen und in ganz Thuvhe verkaufen könnten. Die meisten Leute sehe ich höchstens einmal während eines Zeitlaufs, und dann auch nur, weil am Tempel Mahlzeiten und Getränke auf sie warten«, meinte Akos’ Mutter mit einem leichten Lächeln.
»Da hast du die Lösung«, erwiderte Eijeh. »Ködere sie einfach die ganze Zeit über mit Essen.«
»Die Weisheit der Kinder«, murmelte ihre Mutter und drückte mit dem Daumen auf die Zündung.
Der Gleiter schoss so ruckartig nach oben, dass alle übereinanderfielen. Eijeh stieß Akos lachend von sich.
Vor ihnen funkelten die Lichter Hessas. Die Stadt schmiegte sich an einen Hügel. An dessen Fuß lag der Militärstützpunkt, auf dem Gipfel der Tempel und dazwischen alles andere. Ihr Ziel war der Tempel, ein großer Steinbau mit einer Kuppel aus Hunderten farbiger Glasscheiben. Wenn die Sonne schien, leuchtete Hessas Gipfel orangerot. Also so gut wie nie, da die Sonne fast niemals schien.
Der Gleiter schwebte den Hügel hinauf und driftete über die steinerne Stadt, die so alt war wie die Verbindung zwischen ihrem Volk und seinem Heimatplaneten – Thuvhe, wie alle bis auf ihre Feinde ihn nannten, ein Name wie ein Hauch, der für die meisten von außerhalb kaum aussprechbar war. Die Hälfte der schmalen Häuser war unter Schneewehen vergraben. Fast alle waren verlassen. Heute Abend versammelten sich die Menschen im Tempel.
»Hast du irgendetwas Interessantes gesehen?«, fragte Akos’ Vater seine Frau, während er den Gleiter um einen besonders hohen Windmesser steuerte, der sich im Kreis drehte.
Der Tonfall verriet Akos, dass sein Vater sie nach ihren Visionen fragte. Jeder Planet der Galaxie hatte drei Orakel, ein aufsteigendes, ein sitzendes und ein fallendes. Akos verstand nicht ganz, was das bedeutete. Er wusste nur, dass der Strom seiner Mutter die Zukunft ins Ohr flüsterte und dass die meisten Leute ihr mit Ehrfurcht begegneten.
»Ich habe neulich vielleicht deine Schwester gesehen …«, antwortete Akos’ Mutter. »Ich bezweifle jedoch, dass sie davon wissen will.«
»Sie ist nur der Ansicht, dass die Zukunft mit dem nötigen Respekt behandelt werden sollte.«
Ihre Mutter ließ der Reihe nach den Blick über Akos, Eijeh und Cisi wandern.
»So ist es wohl, wenn man wie ich in eine Militärfamilie einheiratet«, bemerkte sie schließlich. »Ihr wollt, dass immer alles unter Kontrolle ist, sogar meine Lebensgabe.«
»Darf ich dich daran erinnern, dass ich mich den Erwartungen meiner Familie entzogen habe und Bauer geworden bin statt Hauptmann beim Militär?«, wandte Akos’ Vater ein. »Meine Schwester meint es nicht böse, sie wird einfach manchmal nervös, das ist alles.«
»Hm«, murmelte Akos’ Mutter, als sei das ganz und gar nicht alles.
Cisi begann zu summen. Akos hatte die Melodie schon einmal gehört, er wusste nur nicht, wo. Seine Schwester blickte aus dem Fenster und achtete nicht auf den Streit. Kurz darauf brach das Gezänk der Eltern ab, nur Cisis Summen war noch zu hören. Cisi hatte so eine Leichtigkeit an sich, behauptete sein Vater stets. Sie verstand es, zu beschwichtigen.
Der Tempel war erleuchtet, innen wie außen. Lichterketten mit Laternen, nicht größer als Akos’ Faust, hingen über dem gewölbten Eingang. Überall waren Gleiter, auf deren dicken Bäuchen sich Streifen aus farbigem Licht spiegelten. Sie parkten nebeneinander auf dem Hügel oder umkreisten das Kuppeldach auf der Suche nach einem Landeplatz. Akos’ Mutter kannte alle geheimen Plätze rings um den Tempel, daher dirigierte sie ihren Mann zu einer dunklen Nische in der Nähe des Speisesaals und führte die Familie dann im Laufschritt zu einer Nebentür, die sie mit beiden Händen aufdrückte.
Sie eilten einen düsteren steinernen Gang entlang, über Teppiche, die so abgenutzt waren, dass man fast durch sie hindurchschauen konnte, vorbei an dem niedrigen, von Kerzen beschienenen Denkmal für jene Thuvhesi, die der Shotet-Invasion vor Akos’ Geburt zum Opfer gefallen waren.
Akos hatte seine Schritte verlangsamt, um sich die flackernden Kerzen anzusehen, und Eijeh legte ihm jetzt von hinten die Hände auf die Schultern. Akos schnappte erschrocken nach Luft. Als er begriff, wer es war, errötete er. Eijeh kniff ihm lachend in die Wange. »Ich kann sogar im Dunkeln sehen, wie rot du geworden bist!«
»Halt den Mund«, knurrte Akos.
»Eijeh«, tadelte ihre Mutter. »Zieh ihn nicht auf.«
Das sagte sie andauernd. Akos hatte das Gefühl, dass er ständig wegen irgendetwas errötete.
»War doch nur ein Scherz …«
Im Zentrum des Gebäudes, vor der Halle der Prophezeiung, hatte sich bereits eine Menschenmenge gebildet. Alle zogen ihre Überschuhe aus, streiften die Mäntel ab, schüttelten ihr von den Kapuzen plattgedrücktes Haar auf und hauchten warme Luft auf die vor Kälte klammen Finger. Die Kereseths legten ihre Mäntel, Schutzbrillen, Fäustlinge, Stiefel und Gesichtsschutze in eine dunkle Nische unter einem purpurnen Fenster, in das ein Thuvhesi-Zeichen eingeritzt war, das den Strom symbolisierte. Gerade als sie sich wieder der Halle der Prophezeiung zuwandten, hörte Akos eine vertraute Stimme.
»Eij!« Ori Rednalis, Eijehs beste Freundin, stürmte heran. Das schlaksige Mädchen wirkte etwas unbeholfen und schien nur aus Knien, Ellbogen und wirren Haaren zu bestehen. Akos hatte sie noch nie zuvor in einem Kleid gesehen, aber jetzt trug sie eines aus schwerem purpurrotem Stoff, das an der Schulter wie eine Militäruniform geknöpft war.
Schlitternd kam Ori vor Eijeh zum Stehen. Ihre Fingerknöchel waren rot von der Kälte. »Da bist du ja. Ich musste die ganze Zeit zuhören, wie zwei meiner Tanten über den Hohen Rat wettern, und jetzt bin ich kurz vorm Explodieren.« Akos hatte selbst schon eine von Oris zahlreichen Tanten über die Regierung der Galaxie schimpfen hören, weil diese sich angeblich nur dann für Thuvhe interessierte, wenn es um die Eisblumenproduktion ging, und weil sie die Angriffe der Shotet als bloße »Rechtsstreitigkeiten« abtat. Die Tante hatte nicht ganz unrecht, aber Akos fühlte sich unwohl, wenn Erwachsene sich über etwas aufregten. Er wusste dann nie, was er sagen sollte.
Da rief Ori: »Hallo Aoseh, Sifa, Cisi, Akos. Frohes Blütenfest! Komm, Eij, lass uns gehen«, fügte sie in einem Atemzug an, ohne Luft zu holen.
Eijeh sah seinen Vater fragend an, woraufhin dieser mit der Hand wedelte. »Nur zu, wir sehen uns später.«
»Wenn wir dich mit einer Pfeife im Mund erwischen, so wie das letzte Mal«, warf seine Mutter ein, »dann wirst du das Zeug aufessen, das garantiere ich dir.«
Eijeh zog nur die Augenbrauen hoch. Ihm war niemals irgendetwas peinlich, er war nie verlegen. Nicht einmal wenn die Kinder in der Schule ihn wegen seiner Stimme verspotteten, die höher war als die der meisten Jungen, oder weil er reich war – was einen in Hessa nicht gerade beliebt machte. Er gab auch keine Widerrede. Er hatte einfach das Talent, Dinge auszublenden und sie nur dann an sich heranzulassen, wenn er es wollte.
Jetzt fasste er Akos am Ellbogen und zog ihn mit sich hinter Ori her. Cisi blieb wie immer bei den Eltern zurück, während Eijeh und Akos Ori in die Halle der Prophezeiung folgten.
Ori schnappte nach Luft, und als Akos sich in der Halle umsah, tat er es auch. Unter der Kuppel hingen Hunderte von Laternen, und alle waren mit Rauschblüten überstäubt, um sie rot zu färben. Vom Scheitelpunkt der Kuppel bis hinunter zu den Außenwänden erstreckte sich ein Baldachin aus Licht. Sogar Eijehs Zähne glänzten rot, als er Akos angrinste. Mitten in der ansonsten leeren Halle lag eine Scheibe aus Eis von etwa einer Mannslänge Durchmesser. Darin wuchsen Dutzende Rauschblumen, deren Blüten noch geschlossen waren, sich aber bald öffnen würden.
Brennsteinlaternen, so groß wie Akos’ Daumen, säumten die Eisscheibe. Sie brannten weiß – vermutlich, um die Farbe der Rauschblüten noch besser zur Geltung zu bringen, die in einem so satten Rot erstrahlen würden, wie es keine Laterne hervorzubringen vermochte. Eine Farbe wie Blut, sagten manche.
Viele Menschen schlenderten in der Halle umher und alle waren festlich gekleidet. Sie trugen weite Gewänder, die nur Hände und Kopf freiließen und mit kunstvollen Glasknöpfen in allen erdenklichen Farben geschlossen wurden; dazu knielange, mit weichem Eltepelz gesäumte Westen und doppelt gewickelte Halstücher. Alles in dunklen, kräftigen Farben – Hauptsache, es unterschied sich von dem Weiß und Grau ihrer Mäntel. Akos’ Jacke war dunkelgrün, er hatte sie von Eijeh übernommen und an den Schultern war sie ihm noch etwas zu weit. Eijehs Jacke war braun.
Ori führte sie direkt zu den Speisen, wo ihre sauertöpfische Tante auf Platten angerichtete Leckerbissen anbot und Ori völlig ignorierte. Akos ahnte, dass Ori ihre Tante und ihren Onkel nicht mochte und deshalb mehr oder weniger bei den Kereseths lebte, aber er wusste nicht, was mit ihren Eltern passiert war. Eijeh stopfte sich gierig ein Brötchen in den Mund und verschluckte sich fast an den Krümeln.
»Vorsicht«, spottete Akos. »Tod durch Brot ist keine würdevolle Art zu sterben.«
»Zumindest werde ich bei etwas sterben, das ich liebe«, wandte Eijeh mit vollem Mund ein.
Akos lachte.
Ori schlang den Arm um Eijehs Hals und zog ihren Freund an sich. »Schau nicht hin. Neugierige Blicke von links.«
»Na und?« Eijeh spuckte Krümel, während er sprach. Akos hingegen spürte bereits, wie die Hitze seinen Hals hinaufkroch. Er riskierte einen Blick nach links. Dort standen ein paar Erwachsene, die sie stumm beobachteten.
»Man sollte meinen, du hättest dich inzwischen daran gewöhnt, Akos«, stellte Eijeh fest. »Schließlich passiert uns das andauernd.«
»Man sollte meinen, sie hätten sich inzwischen an uns gewöhnt«, erwiderte Akos. »Wir haben unser ganzes Leben hier verbracht, und wir hatten schon immer Schicksale, was gibt es da also noch zu sehen?«
Alle hatten eine Zukunft, aber nicht alle hatten ein Schicksal – zumindest behauptete ihre Mutter das. Nur Abkömmlinge »gesegneter« Familien hatten Schicksale, vorhergesagt im Augenblick ihrer Geburt, im Geheimen und zeitgleich von jedem Orakel auf jedem Planeten. Einstimmig. Wenn die Visionen kamen, rissen sie die Orakel aus dem tiefsten Schlaf, so mächtig waren sie.
Eijeh, Cisi und Akos hatten Schicksale, aber obwohl ihre eigene Mutter zu denjenigen gehörte, die sie gesehen hatte, wussten sie nichts Genaueres. Ihre Mutter war der Ansicht, sie bräuchte sie ihnen nicht mitzuteilen, denn das würde die Welt zur gegebenen Zeit für sie tun.
Es hieß, die Schicksale bestimmten die Zukunft der Welten. Wenn Akos zu lange darüber nachdachte, wurde ihm immer übel.
Ori zuckte die Achseln. »Meine Tante sagt, der Hohe Rat habe sich in letzter Zeit in den Nachrichten kritisch über die Orakel geäußert, und das geht wahrscheinlich immer noch allen im Kopf herum.«
»Kritisch?«, wiederholte Akos. »Wieso?«
Eijeh ging nicht auf die beiden ein. »Kommt, suchen wir uns einen guten Platz.«
Oris Miene hellte sich auf. »Ja, einverstanden. Ich will nicht wie letztes Mal irgendwo festsitzen, wo ich nur die Hintern anderer Leute vor mir sehe.«
»Über die Hintern bist du inzwischen hinausgewachsen«, entgegnete Eijeh prompt. »Jetzt bist du ungefähr auf mittlerer Rückenhöhe.«
»Na toll, dann habe ich dieses Kleid angezogen, wie es meine Tante wollte, damit ich jetzt lauter Rücken anstarren kann«, stöhnte Ori und verdrehte entnervt die Augen.
Diesmal bahnte Akos sich als Erster den Weg durch die Menge. Er duckte sich unter Weingläsern und weit ausholenden Gesten hindurch, bis er ganz vorn war, direkt an der Eisplatte mit den noch geschlossenen Rauschblumen. Keinen Augenblick zu früh. Ihre Mutter hatte bereits die Schuhe ausgezogen, obwohl es nahe der Eisplatte kühl war. Sie fand, sie war ein besseres Orakel, wenn sie den Boden unter den Füßen spürte.
Gerade hatte Akos noch mit Eijeh gelacht, aber als die Menge verstummte, wurde auch in Akos alles still.
Eijeh beugte sich zu ihm und flüsterte ihm ins Ohr: »Spürst du das? Der Strom summt hier drin wie verrückt. Es ist, als würde meine Brust vibrieren.«
Akos hatte es nicht bemerkt, aber Eijeh hatte recht – auch er hatte das Gefühl, als würde seine Brust vibrieren, als würde sein Blut singen. Aber bevor er antworten konnte, sprach ihre Mutter. Nicht sehr laut, doch das brauchte sie auch nicht, denn alle kannten die Worte auswendig.
»Der Strom fließt durch alle Planeten der Galaxie und schenkt uns sein Licht als Beweis seiner Macht.« Wie aufs Stichwort blickten alle zu dem Stromfluss auf, der durch das rote Glas der Kuppel zu sehen war. Zu dieser Zeit leuchtete der Stromfluss fast immer dunkelrot, genau wie die Rauschblüte. Es war das sichtbare Zeichen des Stroms, der sie alle durchfloss, jede lebende Kreatur. Er schlängelte sich durch die Galaxie und band alle Planeten zusammen wie Perlen an einer Schnur.
»Der Strom fließt durch alles, was Leben hat«, fuhr Sifa fort. »Er erschafft einen Raum, in dem Leben gedeihen kann. Der Strom fließt durch jedes atmende Wesen und kommt verändert durch das Sieb eines jeden Geistes wieder zum Vorschein. Der Strom fließt durch jede Blume, die im Eis blüht.«
Sie rückten zusammen – nicht nur Akos und Eijeh und Ori, sondern alle, die sich in der Halle versammelt hatten. Sie standen Schulter an Schulter, damit alle sehen konnten, was mit den Rauschblumen auf der Eisfläche geschah.
»Der Strom fließt durch jede Blume, die im Eis blüht«, wiederholte Sifa. »Er gibt ihr die Kraft, in der tiefsten Dunkelheit zu blühen. Die größte Kraft verleiht der Strom der Rauschblume, die unseren Zeitenlauf bestimmt und die sowohl Tod als auch Frieden spendet.«
Eine Zeit lang herrschte Schweigen, aber es war nicht unangenehm, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Es war vielmehr, als würden sie alle gemeinsam summen, brummen, singen und dabei die seltsame Macht spüren, die das Universum befeuerte, so wie Reibung die Brennsteine befeuerte.
Und dann – Bewegung. Ein bebendes Blütenblatt. Ein knirschender Stängel. Ein Schauder durchlief das kleine Feld von Rauschblumen. Niemand gab einen Laut von sich.
Akos schaute hinauf zu dem Baldachin aus Laternen an der roten Glaskuppel, einen Augenblick nur, und doch hätte er ihn beinahe verpasst – den Moment, in dem die Blumen aufplatzten. Wie auf einen stummen Befehl hin entfalteten sich die roten Blütenblätter, klappten über die Stängel und offenbarten ihre leuchtende Mitte. Die gesamte Eisschicht war wie mit Farbe überzogen.
Alle atmeten auf und applaudierten. Akos klatschte zusammen mit den anderen, bis seine Hände brannten. Sein Vater ging hinauf, um die Hände seiner Frau zu ergreifen und ihr einen Kuss zu geben. Für alle anderen war sie unantastbar: Sifa Kereseth, das Orakel, die Frau, deren Lebensgabe ihr Visionen der Zukunft schenkte. Aber sein Vater berührte sie immer, pikste mit der Fingerspitze in ihr Grübchen, wenn sie lächelte, schob widerspenstige Strähnen zurück in den Haarknoten und hinterließ gelbe Mehlfingerabdrücke auf ihren Schultern, wenn er Brotteig knetete.
Akos’ Vater konnte die Zukunft nicht sehen, aber er besaß die Gabe, nur mit der Berührung seiner Finger Dinge zu reparieren, etwa zerbrochene Teller oder den Riss in einem Wandschirm oder den ausgefransten Saum eines alten Hemds. Manchmal gab er einem das Gefühl, als könne er auch Menschen wieder in Ordnung bringen, wenn sie sich in Schwierigkeiten gebracht hatten. Akos war es daher nicht einmal peinlich, als sein Vater zu ihm kam und ihn in seine Arme zog.
»Kleinstes Kind!«, rief er und warf sich Akos über die Schulter. »Oh – gar nicht mehr so klein. Ich schaffe das jetzt ja gerade noch so.«
»Das liegt nicht daran, dass ich groß geworden bin, sondern daran, dass du alt geworden bist«, erwiderte Akos.
»Solche Worte! Von meinem eigenen Sohn«, rief sein Vater. »Mal sehen, welche Strafe eine solch scharfe Zunge verdient …«
»Bitte nicht …«
Aber es war zu spät, sein Vater hatte ihn bereits über den Rücken hinuntergleiten lassen, bis er ihn nur noch an den Fußgelenken festhielt. Akos, der nun kopfüber hing, drückte sein Hemd und seine Jacke an den Körper, aber er konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Aoseh ließ ihn ganz hinab und gab ihn erst frei, als Akos unversehrt auf dem Boden lag.
»Lass dir das eine Lehre sein, was Frechheiten angeht«, sagte sein Vater und beugte sich über ihn.
»Weil Frechheit einem das Blut in den Kopf schießen lässt?«, gab Akos zurück und blinzelte unschuldig zu ihm auf.
»Ganz genau.« Aoseh grinste. »Frohes Blütenfest!«
Akos erwiderte das Grinsen. »Dir auch.«
In dieser Nacht blieben sie alle lange auf, bis Eijeh und Ori schließlich am Küchentisch einschliefen. Akos’ Mutter trug Ori zum Sofa im Wohnzimmer, auf dem sie in letzter Zeit gut die Hälfte ihrer Nächte verbrachte, und sein Vater weckte Eijeh. Danach zogen sich alle zurück, bis auf Akos und seine Mutter. Die beiden waren immer die Letzten, die noch auf waren.
Sifa schaltete den Bildschirm ein und ließ die Nachrichten des Hohen Rates leise laufen. Im Hohen Rat waren neun Nationenplaneten vertreten. Doch das waren nur die größten oder wichtigsten. Formal war jeder Nationenplanet unabhängig, aber der Hohe Rat regelte Handel, Waffen, Bündnisse und Reisen und setzte dort seine Gesetze durch, wo keine anderen galten. Die Nachrichten des Hohen Rats berichteten nacheinander über alle Nationenplaneten: Wasserknappheit auf Tepes, medizinische Neuerungen auf Othyr, Piraten, die ein Schiff im Orbit von Pitha geentert hatten.
Akos’ Mutter öffnete Dosen mit getrockneten Kräutern. Zuerst dachte Akos, sie wolle einen beruhigenden Trank brauen, damit sie beide zur Ruhe kamen, aber dann ging sie an den Schrank im Flur, um den Krug mit Rauschblüten zu holen, der dort auf dem obersten, schwer erreichbaren Regalbrett stand.
»Ich habe mir für die heutige Lektion etwas Besonderes überlegt«, begann Sifa. Insgeheim nannte Akos seine Mutter immer beim Vornamen, wenn sie ihm etwas über Eisblumen beibrachte. Sie hatte sich vor zwei Zeitläufen angewöhnt, dieses spätabendliche Zusammenbrauen von Tränken scherzhaft als »Lektionen« zu bezeichnen, aber diesmal schien sie es tatsächlich ernst zu meinen. Schwer zu sagen bei einer Mutter wie dieser.
»Nimm dir ein Brett und schneide etwas Harvawurzel für mich«, bat sie und streifte sich Handschuhe über. »Wir haben schon einmal Rauschblüten benutzt, nicht wahr?«
»Ja, für ein Schlafelixier«, bestätigte Akos und tat wie ihm geheißen. Mit Schneidebrett, Messer und einer staubigen Harvawurzel stellte er sich an die linke Seite seiner Mutter. Die Wurzel war von einem fahlen Weiß und mit feinem Flaum bedeckt.
»Und für diesen Entspannungstrank«, fügte sie hinzu. »Wenn ich mich recht erinnere, habe ich dir damals gesagt, er würde dir eines Tages bei Partys nützlich sein. Wenn du älter bist.«
»Ja«, bestätigte Akos. »Und ja, du hast auch gesagt: ›Wenn du älter bist.‹«
Seine Mutter lächelte fast unmerklich. Mehr als das konnte man ihr meist nicht entlocken.
»Dieselben Zutaten, die du, wenn du älter bist, vielleicht zur Entspannung benutzen wirst, kannst du auch für ein Gift verwenden«, erklärte sie mit ernster Miene. »Indem du doppelt so viel Rauschblüte und nur halb so viel Harvawurzel nimmst. Verstanden?«
»Warum …«, fing Akos an, aber seine Mutter wechselte bereits das Thema.
»Also …« Sie legte ein Blütenblatt der Rauschblume auf ihr eigenes Schneidbrett. Das Blatt war noch rot, aber bereits verwelkt und ungefähr so lang wie ihr Daumen. »Was geht dir heute Nacht so durch den Kopf?«
»Nichts«, antwortete Akos. »Vielleicht, dass uns die Menschen beim Blütenfest im Tempel angestarrt haben.«
»Die mit einem Schicksal Gesegneten üben eine Faszination auf andere aus. Ich würde dir gern sagen, dass sie eines Tages aufhören werden, euch anzustarren«, seufzte Akos’ Mutter, »aber ich fürchte, dass man vor allem dich immer anstarren wird.«
Er hätte gerne gewusst, warum sie das »dich« betont hatte, aber er hatte gelernt, sich während Sifas Lektionen mit Fragen zurückzuhalten. Eine falsche Frage und sie beendete die Lektionen ganz plötzlich. Bei der richtigen Frage erfuhr man mitunter jedoch Dinge, die man gar nicht wissen durfte.
»Wie sieht es mit dir aus?«, erkundigte er sich. »Ich meine, was beschäftigt dich gerade?«
»Ah.« Seine Mutter hackte mit fließenden Bewegungen, das Messer tanzte bei ihr nur so übers Brett. Er selbst wurde auch immer geschickter darin, obwohl er noch manchmal etwas aus Versehen abschnitt. »Heute Nacht plagen mich Gedanken an die Familie Noavek.«
Ihre Füße waren nackt, die Zehen gekrümmt vor Kälte. Die Füße eines Orakels.
»Das ist die herrschende Familie von Shotet«, fügte sie erklärend hinzu. »Dem Land unserer Feinde.«
Die Shotet waren ein Volk, kein Nationenplanet, und sie waren für ihre Wildheit und ihre Brutalität bekannt. Sie ritzten sich Zeichen in den Arm für jedes Leben, das sie genommen hatten, und bildeten schon die Kinder in der Kriegskunst aus. Sie lebten auf Thuvhe, dem Planeten, den auch Akos und seine Familie bewohnten, allerdings nannten sie ihn nicht »Thuvhe« und sich selbst bezeichneten sie auch nicht als »Thuvhesi«. Das Gebiet der Shotet erstreckte sich jenseits einer großen Federgrassteppe. Auch vor den Fenstern des Hauses, in dem Akos’ Familie wohnte, wogte Federgras.
Seine Großmutter, die Mutter seines Vaters, war bei einer Shotet-Invasion gestorben – bewaffnet mit nichts als einem Brotmesser. So erzählte es jedenfalls sein Vater. Und die Stadt Hessa trug noch immer die Narben von Gewalttaten der Shotet – die in niedrige Steinmauern gemeißelten Namen der Gefallenen, die zerbrochenen Fenster, die nur notdürftig ausgebessert statt richtig repariert worden waren, sodass man immer noch die Risse sah.
Jenseits des Federgrases. Manchmal schien das so nah, als könne man die Hand ausstrecken und es berühren.
»Auch die Mitglieder der Familie Noavek sind mit einem Schicksal gesegnet, wusstest du das? So wie du und deine Geschwister«, fuhr Sifa fort. »Frühere Orakel haben noch keine Schicksale in dieser Familienlinie gesehen, es geschah erst zu meinen Lebzeiten. Damals verschaffte es den Noaveks die Möglichkeit, die Herrschaft über Shotet an sich zu bringen, die sie seither haben.«
»Ich wusste gar nicht, dass so etwas passieren kann. Ich meine, dass eine Familie plötzlich Schicksale bekommt.«
»Die Orakel bestimmen nicht darüber, wer ein Schicksal bekommt«, erklärte seine Mutter. »Wir sehen Hunderte von Zukünftenundes sind stets nur Möglichkeiten. Ein Schicksal ist etwas, das einer bestimmten Person widerfährt, und zwar in jeder Version der Zukunft, die wir sehen, und so etwas ist eher selten. Die Schicksale entscheiden darüber, welche Familien zu den Gesegneten gehören, und nicht andersrum.«
So hatte Akos es noch nie betrachtet. Die Leute redeten immer darüber, dass die Orakel Schicksale wie Geschenke an besonders wichtige Menschen verteilten, aber seiner Mutter zufolge war es genau umgekehrt. Erst die Schicksale verliehenbestimmten Familien Bedeutung.
»Also hast du ihre Schicksale gesehen. Die Schicksale der Noaveks.«
Sie nickte. »Nur die des Sohns und der Tochter. Ryzek und Cyra. Sie ist in deinem Alter, er ist etwas älter.«
Akos hatte ihre Namen schon einmal gehört, zusammen mit einigen lächerlichen Gerüchten. Geschichten darüber, dass sie Schaum vor dem Mund hätten oder die Augäpfel von Feinden in Krügen aufbewahrten oder Tötungsmale vom Handgelenk bis zur Schulter hatten. Wobei Letzteres vielleicht gar nicht so abwegig war.
»Manchmal ist es einfach zu sehen, warum Menschen zu dem werden, was sie sind«, sagte seine Mutter leise. »Ryzek und Cyra sind die Kinder eines Despoten. Lazmet, ihr Vater, ist der Sohn einer Frau, die ihre eigenen Brüder und Schwestern ermordet hat. Die Gewalttätigkeit wird von jeder Generation weitergegeben.« Sie nickte und fing an, sich vor und zurück zu wiegen. »Und ich sehe es. Ich sehe alles.«
Akos ergriff ihre Hand und hielt sie fest.
»Es tut mir leid, Akos«, murmelte sie. Er war sich nicht sicher, ob sie bereute, so viel gesagt zu haben, oder ob ihre Worte sich auf etwas anderes bezogen, aber es spielte eigentlich keine Rolle.
Beide standen eine Weile nur da und lauschten auf das Gemurmel der Nachrichtendurchsage. Die dunkelste Nacht war soeben noch dunkler geworden.
KAPITEL 2
AKOS
»ES GESCHAH MITTEN in der Nacht«, sagte Osno mit stolzgeschwellter Brust. »Ich hatte diesen Kratzer auf dem Knie und er begann zu brennen. Aber als ich die Decke zurückwarf, war er fort.«
Das Klassenzimmer hatte eine runde Außenwand und zwei gerade Wände. In der Mitte befand sich ein großer Ofen mit Brennsteinen, den die Lehrerin während des Unterrichts immer mit quietschenden Stiefeln umrundete. Manchmal zählte Akos, wie viele Runden sie während einer Stunde drehte. Es waren niemals wenige.
Rund um den Ofen standen Metallstühle, an denen vorne gläserne Bildschirme befestigt waren. Sie leuchteten, bereit, die Lektion des Tages anzuzeigen. Nur die Lehrerin fehlte noch.
»Dann lass mal sehen«, forderte ihn Riha, eine Klassenkameradin, auf. Als wahre Patriotin trug sie mit Vorliebe Schals, die mit der Landkarte Thuvhes bestickt waren, und sie vertraute nie dem Wort eines anderen. Wenn jemand etwas behauptete, rümpfte sie ihre sommersprossige Nase, bis der Betreffende den Beweis erbracht hatte.
Osno nahm eine kleine Taschenklinge und stieß sie in seinen Daumen. Blut quoll aus der Wunde, und selbst Akos, der weit weg von allen anderen saß, sah, dass sich die Haut über der Wunde bereits wieder zusammenfügte wie ein Reißverschluss.
Der Strom schenkte allen eine Lebensgabe. Man erhielt sie, wenn man älter wurde und der Körper sich verändert hatte, wenn man kein Kind mehr war. Da Akos mit seinen vierzehn Zeitläufen immer noch sehr klein war, würde er noch eine ganze Weile auf seine Gabe warten müssen. Manchmal lagen die Gaben in der Familie, manchmal nicht. Manchmal waren sie nützlich, manchmal nicht. Osnos Lebensgabe war nützlich.
»Toll«, sagte Riha. »Ich kann es gar nicht erwarten, dass meine Gabe sich zeigt. Hast du eine Ahnung, was es sein könnte?«
Osno war der größte Junge in der Klasse, und er baute sich immer dicht vor seinem Gegenüber auf, wenn er mit jemandem redete, damit derjenige das auch merkte. Das letzte Mal hatte er mit Akos vor einem Zeitlauf geredet, und Osnos Mutter hatte im Weggehen gesagt: »Für einen schicksalsgesegneten Sohn ist er nichts Besonderes, findest du nicht?«
Osno hatte erwidert: »Ach, er ist ganz nett.«
Aber Akos war nicht »nett«. Das sagten die Leute nur über jemanden, der still war.
Osno schlang den Arm um die Rückenlehne seines Stuhls und schnippte sich ein dunkles Haar aus den Augen. »Mein Vater meint, je besser man sich selbst kennt, umso weniger wird man von seiner Lebensgabe überrascht sein.«
Rihas Zopf glitt auf ihrem Rücken auf und ab, als sie zustimmend nickte. Akos wettete mit sich selbst, dass Riha und Osno bis zum Ende dieses Zeitlaufs ein Paar sein würden.
Plötzlich flackerte der Bildschirm an der Tür auf und wurde dann schwarz. Im ganzen Raum wurde es dunkel und auch die unter dem Türspalt hindurchscheinenden Ganglichter erloschen. Was immer Riha hatte sagen wollen, es kam nicht mehr über ihre Lippen. Akos hörte eine laute Stimme aus dem Flur. Und das Quietschen seines eigenen Stuhls, als er ihn zurückschob.
»Kereseth …«, raunte Osno warnend. Aber Akos fand nichts dabei, in den Flur zu spähen. Es würde ihn dort schon nichts anspringen und beißen.
Er öffnete die Tür gerade weit genug, um hindurchschlüpfen zu können, dann beugte er sich in den schmalen Flur hinaus. Das Gebäude war rund wie fast alle Gebäude in Hessa, mit den Büros der Lehrer in der Mitte, den Klassenzimmern am Rand sowie einem Flur, der beides voneinander trennte. Wenn die Lichter ausgeschaltet waren, wurde der Gang nur noch von den orangefarbenen Notlampen am oberen Treppenabsatz beleuchtet.
»Was ist los?« Akos erkannte die Stimme – es war Ori. Sie trat in den orangefarbenen Lichtkegel der Notbeleuchtung. Vor ihr stand ihre Tante Badha, so zerzaust, wie Akos sie noch nie gesehen hatte. Aus ihrem Haarknoten hatten sich Strähnen gelöst, die ihr wirr ins Gesicht fielen, und ihr Pullover war falsch zugeknöpft.
»Du bist in Gefahr«, stieß sie hervor. »Es ist Zeit, zu tun, was wir trainiert haben.«
»Warum?«, wollte Ori wissen. »Du kommst her, zerrst mich aus dem Unterricht und willst, dass ich weggehe und alles zurücklasse …«
»Alle mit einem Schicksal Gesegneten sind in Gefahr, verstanden? Ihr seid enttarnt worden. Du musst verschwinden.«
»Was ist mit den Kereseths? Sind sie nicht auch in Gefahr?«
»Nicht so sehr wie du.« Badha fasste Ori am Ellbogen und führte sie mit sich zum Absatz des östlichen Treppenhauses. Oris Gesicht lag im Schatten, daher konnte Akos ihre Miene nicht erkennen. Bevor sie um die Ecke bog, drehte sie sich noch einmal um. Das Haar fiel ihr übers Gesicht und ihr Pullover rutschte von der Schulter, sodass er ihr Schlüsselbein sehen konnte.
Er hätte schwören können, dass sie mit großen, ängstlichen Augen seinen Blick suchte, aber das war nur schwer zu sagen. Dann rief jemand nach Akos.
Cisi kam aus einem der zentralen Büros gerannt. Sie trug ihr schweres graues Kleid und schwarze Stiefel. Ihr Mund war eine schmale Linie.
»Komm mit«, forderte sie ihn auf. »Wir sind ins Büro des Direktors gerufen worden. Vater holt uns ab, wir können dort warten.«
»Was …«, begann Akos. Aber wie immer sprach er so leise, dass man ihm keine Beachtung schenkte.
»Komm.« Cisi verschwand wieder durch die Tür, die sie gerade erst geschlossen hatte. Akos’ Gedanken wanderten in ganz verschiedene Richtungen. Ori war mit einem Schicksal gesegnet. Alle Lampen waren aus. Sein Vater kam ihn und seine Schwester holen. Ori war in Gefahr. Er war in Gefahr.
Cisi verschwand aus dem orangefarbenen Lichtkegel, tauchte wieder auf und verschwand aufs Neue. Dann eine offene Tür, eine brennende Laterne. Und Eijeh, der sich zu ihnen umdrehte.
Der Direktor saß ihm gegenüber. Akos kannte seinen Namen nicht. Die Schüler nannten ihn einfach »Direktor« und bekamen ihn nur zu Gesicht, wenn er eine Ankündigung machte oder durch die Gänge lief. Akos beachtete ihn nicht weiter.
»Was ist los?«, fragte er Eijeh.
»Niemand will etwas sagen«, antwortete Eijeh mit einem vorwurfsvollen Blick auf den Direktor.
»Es gehört zu den Grundsätzen dieser Schule, in einer solchen Situation alles Weitere dem Ermessen der Eltern zu überlassen«, stellte der Direktor fest. Manchmal witzelten die Schüler, dass der Direktor nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Maschinenteilen bestünde und dass man Drähte finden würde, wenn man ihn aufschnitt. Zumindest redete er wie eine Maschine.
»Und Sie können uns nicht erklären, um was für eine Art Situation es sich handelt?«, fragte Eijeh ihn so, wie ihre Mutter es getan hätte, wäre sie da gewesen. Wo ist sie überhaupt?, dachte Akos. Ihr Vater würde sie holen, von ihrer Mutter war nicht die Rede gewesen.
»Eijeh«, murmelte Cisi beschwichtigend. Ihre leise Stimme gab auch Akos Halt. Es war beinahe, als spräche sie mit dem Summen des Stroms in ihm, um ihn zu beruhigen. Der Bann hielt eine Weile an. Der Direktor, Eijeh, Cisi und Akos warteten still.
»Es wird kalt«, bemerkte Eijeh schließlich. Ein Luftzug kroch unter der Tür hindurch und strich über Akos’ Knöchel.
»Ich weiß. Ich musste die Energie ausschalten«, erklärte der Direktor. »Ich werde sie erst wieder einschalten, wenn ihr sicher unterwegs seid.«
»Sie haben die Energie für uns ausgeschaltet? Warum?«, erkundigte Cisi sich honigsüß mit derselben einschmeichelnden Stimme, die sie benutzte, wenn sie länger aufbleiben oder eine zusätzliche Portion Nachtisch haben wollte. Bei ihren Eltern funktionierte es nicht, aber der Direktor schmolz wie eine Kerze. Akos erwartete fast, dass sich unter seinem Schreibtisch eine Wachspfütze bilden würde.
»Das ist die einzige Möglichkeit, während eines Notfallalarms des Hohen Rats die Bildschirme auszuschalten«, erklärte der Direktor leise.
»Es gab also einen Notfallalarm«, gab Cisi immer noch schmeichelnd zurück.
»Ja. Er wurde heute Morgen vom Vorsitzenden des Hohen Rats ausgelöst.«
Eijeh und Akos sahen sich an, während Cisi, die Hände über den Knien gefaltet, gelassen lächelte. Ihr gelocktes Haar umrahmte ihr Gesicht. Wie sie so in dem schummrigen Licht dasaß, war sie ganz und gar Aosehs Tochter. Ihr Vater konnte ebenfalls mit Lächeln und Lachen alles bekommen, was er wollte. Stets besänftigte er Menschen, Herzen, Situationen.
Eine schwere Faust hämmerte gegen die Tür und ersparte es dem Wachsmann, vollends zu zerschmelzen. Akos wusste, dass es sein Vater war, weil der Knauf beim letzten Klopfen herausfiel und die Platte des Türschlosses jetzt in der Mitte einen Sprung hatte. Sein Vater hatte sich nicht immer unter Kontrolle, und das drückte sich auch in der Gabe aus, die ihm der Strom verliehen hatte. Er brachte ständig Dinge in Ordnung, aber die Hälfte der Zeit tat er das, weil er sie zuvor kaputt gemacht hatte.
»Entschuldigung«, murmelte Aoseh, als er den Raum betrat. Er steckte den Türknauf wieder an seinen Platz und zeichnete den Sprung in der Platte mit der Fingerspitze nach. Der Riss fügte sich zusammen, ein wenig gezackt zwar, aber ansonsten war die Platte so gut wie neu. Akos’ Mutter war allerdings der Ansicht, dass ihr Mann nicht immer alles so reparierte, wie es sich gehörte. Ungleichmäßige Essteller und scharfkantige Tassenhenkel bei ihnen zu Hause dienten ihr als Beweis.
»Aoseh Kereseth …«, begann der Direktor.
»Vielen Dank, Direktor, dass Sie so schnell reagiert haben«, sagte Akos’ Vater ohne den Anflug eines Lächelns. Mehr als die dunklen Flure oder Oris schreiende Tante oder Cisis zusammengepresste Lippen erschreckte Akos dessen ernste Miene. Sein Vater lächelte immer, selbst wenn die Situation es nicht rechtfertigte. Ihre Mutter nannte sein Lächeln sogar seine allerbeste Rüstung.
»Kommt, kleines Kind, kleineres Kind, kleinstes Kind«, sagte Aoseh halbherzig. »Ab nach Hause.«
Er hatte kaum »nach Hause« gesagt, da waren sie bereits auf den Beinen und marschierten Richtung Ausgang. Sie gingen direkt zu den Mantelständern, um unter den identisch aussehenden grauen Pelzen nach ihren zu suchen. In die Kragen waren ihre Namen gestickt: Kereseth, Kereseth, Kereseth. Cisi und Akos verwechselten ihre Mäntel und mussten tauschen. Akos’ Mantel war etwas zu schmal für Cisis Arme, ihrer ein klein wenig zu lang für ihn.
Vor dem Haus wartete der Gleiter auf sie, die Tür stand weit offen. Er war größer als die meisten anderen, rund und kompakt und mit Schmutzstreifen auf der dunklen Metallhaut. Meist liefen in ihm die Nachrichten in Dauerschleife, aber diesmal waren die Wortkaskaden verstummt. Auch der Navigationsbildschirm war tot. Die drei Geschwister sahen, wie ihr Vater auf Knöpfe drückte und Hebel bediente, aber die Anzeigentafel verriet ihnen nicht, was genau er tat. Sie schnallten sich gar nicht erst an und Akos hätte es auch für reine Zeitverschwendung gehalten.
»Dad …«, begann Eijeh.
»Der Hohe Rat hat es heute Morgen für richtig befunden, die Schicksale der gesegneten Familien zu verkünden«, stellte ihr Vater fest. »Die Orakel haben dem Hohen Rat vor vielen Zeitläufen als Geste des Vertrauens und unter dem Siegel der Verschwiegenheit die Schicksale mitgeteilt. In der Regel wird das Schicksal einer Person erst nach deren Tod öffentlich gemacht und ist zu Lebzeiten nur dem Betreffenden und seiner Familie bekannt, aber jetzt …« Er sah nacheinander jedes seiner Kinder an. »Jetzt kennt jeder eure Schicksale.«
»Wie lauten sie?«, fragte Akos leise, während Cisi im selben Moment fragte: »Warum ist das gefährlich?«
Aoseh antwortete ihr, nicht ihm. »Nicht jeder, der ein Schicksal hat, ist in Gefahr. Allerdings sind einige Schicksale bedeutender als andere.«
Akos dachte an Ori. Daran, wie ihre Tante sie am Ellbogen zum Treppenhaus gezerrt hatte. Ihr seid enttarnt worden. Du musst verschwinden. Ori hatte ein Schicksal – ein gefährliches. Aber soweit Akos sich erinnern konnte, gab es auf der Liste der Gesegneten keine Familie »Rednalis«. Es war also nicht ihr richtiger Name.
»Was sind unsere Schicksale?«, fragte Eijeh, und in diesem Moment beneidete Akos seinen Bruder um seine laute, klare Stimme. Wenn sie länger als erlaubt aufbleiben wollten, versuchte Eijeh manchmal zu flüstern, aber stets tauchten nach kürzester Zeit ihre Mutter oder ihr Vater an der Tür auf und ermahnten sie, still zu sein. Ganz anders Akos: Er hielt Geheimnisse näher bei sich als seine eigene Haut. Deswegen hatte er seinen Geschwistern auch noch nichts von Ori erzählt.
Der Gleiter zischte über die ausgedehnten Eisblumenfelder, die ihr Vater bewirtschaftete. Unterteilt von niedrigen Drahtzäunen erstreckten sie sich meilenweit in alle Richtungen: gelbe Eifersuchtsblumen, weiße Reinheiten, grüne Harlaranken, braune Sendesblätter und zu guter Letzt, geschützt von einem Drahtkäfig, durch den Energie floss, rote Rauschblumen. Bevor sie den Drahtkäfig aufgestellt hatten, waren Leute, die ihr Leben beenden wollten, einfach in das Rauschblumenfeld gerannt, um dort unter den leuchtenden Blütenblättern zu sterben. Das Gift brachte binnen weniger Atemzüge einen schläfrigen Tod. Akos hielt es nicht für die schlechteste Art zu sterben. Umringt von Blumen wegzudämmern, über sich nichts als den weißen Himmel.
»Das werde ich euch sagen, sobald wir in Sicherheit sind«, erklärte Aoseh und bemühte sich, zuversichtlich zu klingen.
»Wo ist Mom?«, fragte Akos, und diesmal hörte sein Vater ihn.
»Eure Mutter …«, begann Aoseh zähneknirschend. Der Sitz, auf dem er saß, riss auf wie ein im Ofen aufplatzender Brotlaib. Fluchend strich Aoseh mit der Hand darüber, damit der Schlitz sich wieder schloss. Akos beobachtete ihn beunruhigt. Was hatte ihn so wütend gemacht?
»Ich weiß nicht, wo eure Mutter ist«, beendete sein Vater den Satz. »Aber ich bin sicher, dass es ihr gut geht.«
»Hat sie dich denn gar nicht gewarnt?«, hakte Akos nach.
»Vielleicht wusste sie es nicht«, flüsterte Cisi.
Aber allen war klar, dass das nicht stimmte. Sifa wusste immer, immer alles.
»Deine Mutter hat ihre Gründe für das, was sie tut. Manchmal erfahren wir sie nur nicht«, erwiderte Aoseh, der jetzt ein wenig ruhiger wirkte. »Wir müssen ihr vertrauen, selbst wenn es uns schwerfällt.«
Akos war sich nicht sicher, ob sein Vater das tatsächlich glaubte. Vielleicht sagte er es nur, um sich selbst davon zu überzeugen.
Aoseh lenkte den Gleiter in ihren Vorgarten hinab. Beim Landen drückte das Fahrzeug die gefleckten Halme der Grasbüschel platt. Hinter ihrem Haus erstreckte sich, so weit das Auge reichte, das Federgras. In der Grassteppe stießen den Menschen manchmal seltsame Dinge zu. Sie hörten Geflüster oder sahen dunkle Gestalten zwischen den Gräsern und oft kamen sie von ihrem Weg ab und wurden von der Erde verschluckt. Ab und zu hörte man Geschichten darüber oder jemand entdeckte vom Gleiter aus ein Skelett. Wenn man wie Akos so dicht am Federgras lebte, gewöhnte man sich daran. Mittlerweile ignorierte er die Gesichter, die von überallher kamen und seinen Namen flüsterten. Manchmal waren sie so deutlich, dass er sie sogar erkannte: die verstorbenen Großeltern; seine Mutter oder sein Vater mit verzerrten Leichenmienen; Kinder, die in der Schule gemein zu ihm gewesen waren und ihn verspottet hatten.
Aber als Akos jetzt aus dem Gleiter stieg und die Hand hob, um die Büschel zu berühren, fiel ihm auf, dass er diesmal nichts sah oder hörte.
Er hielt inne und suchte in den Gräsern nach irgendwelchen Anzeichen für Halluzinationen. Aber da war nichts.
»Akos!«, zischte Eijeh.
Eigenartig.
Er folgte Eijeh zur Haustür. Aoseh schloss auf, und sie traten in den Flur, um die Mäntel auszuziehen. Akos atmete die warme Luft ein. Aber irgendetwas roch nicht richtig. In ihrem Haus lag sonst immer der würzige Duft des Frühstücksbrots, das sein Vater in den kälteren Zeiten gern machte, aber jetzt roch es nach Motoröl und Schweiß. Akos spürte plötzlich einen Knoten im Magen.
»Dad«, rief er erschrocken, als Aoseh einen Schalter berührte und das Licht anmachte.
Eijeh schrie. Cisi gab einen erstickten Laut von sich. Akos wurde stocksteif.
In ihrem Wohnzimmer standen drei Männer. Einer war hochgewachsen und schlank, einer noch größer und breit gebaut und der dritte klein und dick. Alle drei trugen Panzer, die im gelblichen Brennsteinlicht so dunkel glänzten, dass sie beinahe schwarz wirkten, obwohl sie von einem tiefdunklen Blau waren. Die Fremden waren mit Stromklingen bewaffnet. Sie umklammerten das Metall mit ihren Fäusten und die schwarzen Fasern des Stroms schlangen sich um ihre Finger, sodass Waffe und Hand miteinander zu verschmelzen schienen. Akos hatte solche Klingen schon früher gesehen, allerdings nur bei Soldaten, die in Hessa Patrouille gingen. Hier, im Haus eines Bauern und eines Orakels, hatte man keinerlei Verwendung für Waffen.
Akos wusste plötzlich, dass die Fremden Shotet waren, aber er hätte nicht sagen können, woher. Thuvhes Feinde, ihre Feinde. Männer wie sie waren verantwortlich für all die Kerzen, die an der Gedenkstätte für die Gefallenen der Shotet-Invasion angezündet wurden. Sie waren in Hessas Häuser eingedrungen und hatten die Glasscheiben des Tempels zerbrochen, sodass darauf nur noch lückenhafte Bilder zu sehen waren. Sie hatten die Tapfersten, die Stärksten und die Grimmigsten erbarmungslos getötet und ihre Familien in ein Tal der Tränen gestürzt. Unter ihren Opfern war auch Akos’ Großmutter mit ihrem Brotmesser, wie sein Vater stets betonte.
»Was macht ihr hier?«, fragte Aoseh scharf. Das Wohnzimmer sah unberührt aus, die Sitzkissen waren immer noch um den niedrigen Tisch verteilt, und auch die Pelzdecke lag noch am Kamin, wo Cisi am Abend zuvor gelesen hatte. Vom Feuer war nur die schimmernde Glut übrig und die Luft war empfindlich kalt. Aoseh stellte sich breitbeinig hin, um seine Kinder vor den Fremden zu beschützen.
»Keine Frau«, stellte einer der Männer fest. »Wo mag sie sein?«
»Orakel«, antwortete einer der anderen. »Schwer zu fassen.«
»Ich weiß, dass ihr unsere Sprache sprecht«, begann Aoseh von Neuem, diesmal etwas strenger. »Hört auf zu reden, als würdet ihr mich nicht verstehen.«
Akos runzelte die Stirn. Hatte sein Vater die Bemerkung über ihre Mutter nicht gehört?
»Ziemlich frecher Kerl«, bemerkte der größte der drei. Er hatte goldene Augen, wie Akos jetzt feststellte. Sie sahen aus wie geschmolzenes Metall. »Wie hieß er noch gleich?«
»Aoseh«, antwortete der Kleinste. Sein Gesicht war kreuz und quer mit Narben überzogen. Die Wundränder des längsten Schnitts direkt neben seinem Auge waren wulstig. Aus seinem Mund klang der Name ihres Vaters unbeholfen.
»Aoseh Kereseth«, sagte der Goldäugige, und diesmal klang er … anders. Als spräche er plötzlich mit einem schweren Akzent. Zuvor hatte er keinen gehabt, warum also jetzt? »Ich bin Vas Kuzar.«
»Ich weiß, wer du bist«, entgegnete Aoseh. »Ich lebe nicht mit dem Kopf in einem Loch.«
»Ergreift ihn«, rief der Mann namens Vas, woraufhin sich der Kleinste sofort auf Aoseh stürzte. Cisi und Akos wichen zurück, als ihr Vater und der Shotet-Soldat miteinander rangen. Aoseh knirschte mit den Zähnen. Der Spiegel im Wohnzimmer zersprang, die Splitter flogen in alle Richtungen. Dann zerbrach der Rahmen auf dem Kaminsims mit dem Bild vom Hochzeitstag ihrer Eltern. Der Shotet hatte Aoseh inzwischen fest im Griff. Er schleifte ihn ins Wohnzimmer und ließ die drei Kinder allein zurück. Dann zwang er ihren Vater auf die Knie und drückte die Stromklinge an seine Kehle.
»Sorg dafür, dass die Kinder nicht abhauen«, sagte Vas zu dem Schlanken. Erst jetzt fiel Akos ein, dass sich direkt hinter ihm eine Tür befand. Er packte den Knauf und drehte ihn. Doch als er daran zog, schlossen sich grobe Hände um seine Schultern und der Shotet hob ihn mit einem Arm hoch. Akos’ Schulter tat höllisch weh, aber zumindest schaffte er es, dem Mann einen harten Tritt gegen das Bein zu versetzen. Der Shotet lachte nur.
»Kleiner, dünnhäutiger Junge«, zischte der Soldat. »Du und der Rest deiner jämmerlichen Art tätet besser daran, euch sofort zu ergeben.«
»Wir sind nicht jämmerlich!«, widersprach Akos. Es war eine dumme Bemerkung – etwas, das ein kleines Kind sagte, wenn es nicht wusste, wie es einen Streit gewinnen sollte. Aber aus irgendeinem Grund verharrten plötzlich alle wie angewurzelt. Nicht nur der Mann, der Akos’ Arm umklammert hielt, sondern auch Cisi und Eijeh und Aoseh. Alle starrten Akos an, und dann, verdammt noch mal, schoss ihm dieHitze ins Gesicht. Es war der ungünstigste Zeitpunkt, rot zu werden, den er sich überhaupt vorstellen konnte, und das wollte bei ihm einiges heißen.
Vas Kuzar lachte laut auf.
»Das jüngste Kind, nehme ich an«, sagte er zu Aoseh. »Hast du gewusst, dass er Shotet spricht?«
»Ich spreche kein Shotet«, warf Akos zaghaft ein.
»Gerade hast du es getan«, gab Vas zurück. »Also, ich frage mich, wie die Familie Kereseth zu einem Sohn mit Shotet-Blut kommt?«
»Akos«, flüsterte Eijeh staunend. Es klang wie eine Frage.
»Ich habe kein Shotet-Blut!«, blaffte Akos, und alle drei Shotet-Soldaten lachten gleichzeitig auf. Erst da hörte Akos es – er vernahm die Worte aus seinem eigenen Mund, wusste genau, was sie bedeuteten, hörte die harschen, stockenden Silben und die geschlossenen Vokale. Es war eindeutig Shotet, eine Sprache, die er nie gelernt hatte und die so ganz anders war als das anmutige Thuvhesisch, das eher dem Klang des Windes ähnelte, der Schneeflocken emporwirbelte.
Er sprach Shotet. Er klang genau wie die Soldaten. Aber wie – wie konnte er eine Sprache sprechen, die er nie erlernt hatte?
»Wo ist deine Frau, Aoseh?«, fragte Vas und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf ihren Vater. Er drehte die Stromklinge in der Faust, sodass schwarze Ranken über seine Haut glitten. »Wir könnten sie fragen, ob sie eine Affäre mit einem Shotet hatte, oder ob sie unsere vornehme Herkunft teilt und es nur nie für nötig erachtet hat, dir davon zu erzählen. Das Orakel wird ja wissen, wieso der jüngste Sohn die Sprache der Offenbarung so gut beherrscht.«
»Sie ist nicht hier«, erklärte Aoseh angespannt. »Wie euch vielleicht aufgefallen ist.«
»Der Thuvhesi hält sich wohl für besonders schlau?«, sagte Vas. »Ich denke aber, Gerissenheit Feinden gegenüber kann leicht zum Tod eines Mannes führen.«
»Ich zweifle nicht daran, dass du viele törichte Dinge denkst«, gab Aoseh zurück, und obwohl er auf dem Boden kniete, starrte er den Shotet so lange an, bis dieser den Blick abwandte. »Diener der Noaveks. Du bist nicht mehr als der Dreck unter meinen Fingernägeln.«
Vas schlug ihm so heftig ins Gesicht, dass Aoseh zur Seite kippte. Eijeh schrie auf und wollte zu seinem Vater eilen, wurde aber von dem Shotet abgefangen, der Akos immer noch am Arm festhielt. Jetzt hielt er beide Brüder mühelos fest, obwohl Eijeh mit seinen sechzehn Zeitläufen fast so groß war wie ein Mann.
Der niedrige Wohnzimmertisch zersplitterte genau in der Mitte in zwei Teile, die zur Seite fielen. Alles, was daraufgestanden und -gelegen hatte – ein alter Becher, ein Buch, Holzspäne von der Schnitzerei ihres Vaters –, verteilte sich über den Fußboden.
»Ich an deiner Stelle«, bemerkte Vas leise, »würde meine Lebensgabe besser unter Kontrolle halten, Aoseh.«
Aoseh schlug kurz die Hände vors Gesicht, dann packte er unvermittelt das Handgelenk des kleinen, vernarbten Shotet und drehte es so fest um, dass dieser loslassen musste. Er ergriff die Waffe des Soldaten am Heft, nahm sie ihm ab und richtete sie mit hochgezogenen Augenbrauen gegen ihn.
»Nur zu, töte ihn«, forderte Vas ihn auf. »Dort, wo er herkommt, gibt es Dutzende andere. Du hingegen hast nur eine begrenzte Anzahl an Söhnen.«
Aosehs Lippe war geschwollen und blutete, aber er leckte das Blut mit der Zungenspitze ab und blickte über die Schulter zu Vas.
»Ich weiß nicht, wo sie ist«, sagte er zu dem Soldaten. »Ihr hättet im Tempel nachsehen sollen. Dies ist der letzte Ort, an den sie kommen würde, wenn sie wüsste, dass ihr auf dem Weg hierher seid.«
Vas betrachtete lächelnd die Klinge in Aosehs Hand.
»Was soll’s«, sagte er auf Shotet, den Blick auf den Soldaten gerichtet, der Akos mit einer Hand festhielt und Eijeh mit der anderen gegen die Wand drückte. »Uns geht es vor allem um das Kind.«
»Wir wissen, wer der Jüngste ist«, antwortete der Soldat in derselben Sprache und zerrte an Akos’ Arm. »Aber wer ist der Zweitgeborene?«
»Vater«, sagte Akos verzweifelt. »Sie fragen nach dem kleineren Kind. Sie wollen wissen, wer von den beiden jünger ist …«
Der Soldat ließ Akos los, aber nur, um ihm mit dem Handrücken auf die Wangenknochen zu schlagen. Akos stolperte rückwärts und krachte gegen die Wand. Schluchzend beugte Cisi sich über ihren Bruder und fuhr mit der Hand über sein Gesicht.
Aoseh schrie auf und fletschte die Zähne. Mit einem Satz war er bei Vas und stieß mit der Stromklinge direkt unterhalb des Panzers zu.
Vas zuckte nicht mit der Wimper. Er lächelte nur schief, umfasste den Griff der Klinge und zog das Messer heraus. Aoseh war zu benommen, um ihn aufzuhalten. Blut quoll aus der Wunde und durchnässte Vas’ dunkle Hose.
»Du kennst meinen Namen, aber du kennst meine Gabe nicht?«, fragte Vas leise. »Ich fühle keinen Schmerz, schon vergessen?«
Er packte Aoseh am Ellbogen und riss seinen Arm hoch. Dann stieß er ihm das Messer tief in den Oberarm und zog es durch das Muskelgewebe. Aoseh stöhnte vor Schmerz, wie Akos ihn noch nie zuvor hatte stöhnen hören. Blut spritzte auf den Boden. Eijeh schlug schreiend um sich. Cisi hingegen verzog nur das Gesicht und gab keinen Laut von sich.
Akos konnte den Anblick nicht länger ertragen. Er sprang auf, obwohl sein Gesicht schmerzte und obwohl es völlig sinnlos war, denn es gab nichts, was er tun konnte.
»Eijeh«, raunte er leise. »Lauf.«
Dann warf er sich mit voller Wucht gegen Vas. Er wollte seine Finger in dessen Wunde graben, tiefer und tiefer, bis er ihm die Knochen herausreißen konnte und das Herz.
Schlurfen, Rufen, Schluchzen – alle Geräusche vereinten sich in Akos’ Ohren zu einer Stimme des Grauens. Er schlug vergebens auf Vas’ Rüstung ein. Von dem Schlag tat ihm nur die Hand weh. Das Narbengesicht war mit einem Schritt bei ihm, warf ihn wie einen Sack Mehl auf den Boden und drückte seinen Stiefel in Akos’ Gesicht. Akos spürte den Dreck auf der Haut.
»Dad!«, schrie Eijeh. »Dad!«
Akos konnte den Kopf nicht bewegen, aber als er den Blick hob, sah er seinen Vater auf dem Boden liegen, zwischen Wand und Tür. Sein Unterarm stand in einem unnatürlichen Winkel ab und eine Blutlache umgab seinen Kopf wie ein Heiligenschein. Cisi kauerte neben Aoseh, ihre zitternden Finger schwebten über dem Schnitt an seiner Kehle. Vas stand mit blutverschmiertem Messer über ihr.
Akos erschlaffte.
»Lass ihn aufstehen, Suzao«, befahl Vas.
Suzao – der Soldat, der seinen Stiefel in Akos’ Gesicht gedrückt hatte – hob den Fuß und zerrte Akos auf die Beine. Akos konnte den Blick nicht von seinem Vater abwenden: Aosehs Haut war aufgeplatzt wie der Tisch im Wohnzimmer, überall war Blut – wie kann ein Mensch so viel Blut haben? –, dunkles orange-rot-braunes Blut.
Vas hielt das blutbefleckte Messer von sich gestreckt. Seine Hände waren nass.
»Alles klar, Kalmev?«, fragte er den hochgewachsenen Shotet. Der grunzte nur als Antwort. Er hatte Eijeh gepackt und ihm Metallfesseln um die Handgelenke gelegt. Hatte dieser anfangs noch Widerstand geleistet, so gab er sich jetzt geschlagen. Wie betäubt starrte er Aoseh in der Blutlache auf dem Boden an.
»Danke, dass du meine Frage nach deinen Geschwistern beantwortet hast. Jetzt wissen wir, wen wir suchen«, sagte Vas zu Akos. »Es scheint, als müssten wir euch beide mitnehmen. Das hat man davon, wenn man mit einem Schicksal gesegnet ist.«
Suzao und Vas nahmen Akos in die Mitte und drängten ihn vorwärts. Aber im letzten Moment riss er sich los und fiel neben seinem Vater auf die Knie. Er berührte Aosehs Gesicht. Es fühlte sich warm und klebrig an. Seine Augen waren offen, wurden aber mit jeder Sekunde matter, das Leben floss aus ihm heraus wie Wasser aus einer Rinne. Sein Blick glitt zu Eijeh, den der Shotet schon halb durch die Vordertür geschoben hatte.
»Ich werde ihn wieder nach Hause bringen.« Akos bewegte behutsam den Kopf seines Vaters, damit Aoseh ihn ansah. »Das verspreche ich dir.«
Als sein Vater das Leben aushauchte, war Akos schon nicht mehr da. Er war im Federgras – in der Gewalt seiner Feinde.
TEIL 2
KAPITEL 3
CYRA
BEI MEINER ERSTEN Planetenreise war ich gerade mal fünf Zeitläufe alt.
Als ich das Haus verließ, erwartete ich, in helles Sonnenlicht getaucht zu werden. Stattdessen trat ich in den Schatten des Reiseschiffs, das die Stadt Voa – die Hauptstadt von Shotet – wie eine gewaltige Wolke bedeckte. Es war länger als breit und endete vorn in einer sanften Spitze, über die sich bruchsichere Glasscheiben wölbten. Die sich überlappenden Panzerplatten der Unterseite waren von mehr als zehn Zeitläufen Weltraumreisen stark mitgenommen. Nur einige Metallteile glänzten – diejenigen, die als Ersatz montiert worden waren. Schon bald würden wir in diesem Schiff zusammengequetscht sein wie durchgekautes Essen im Magen eines großen Tiers. Gleich neben den hinteren Triebwerken befanden sich die offenen Luken. Dort würden wir an Bord gehen.
Die Planetenreise war unser bedeutungsvollstes Ritual, und die meisten Shotet-Kinder durften sie zum ersten Mal mitmachen, wenn sie sieben Zeitläufe alt waren. Aber als Tochter des Herrschers, Lazmet Noavek, war ich zwei Zeitläufe früher für meine erste Reise zu den Planeten bereit. Wir würden dem Stromfluss am Rand der Galaxie folgen, bis er das dunkelste Blau annahm, und dann auf dem Planeten dort landen, um – das war der zweite Teil des Rituals – auf Beutezug zu gehen.
Es war Tradition, dass der Herrscher oder die Herrscherin mit der ganzen Familie als Erste an Bord des Schiffs ging. Zumindest war es das, seit Großmutter, die erste Shotet-Herrscherin aus der Familie Noavek, es dazu erklärt hatte.
»Mein Haar ziept«, beschwerte ich mich bei meiner Mutter und klopfte auf die zu straff gebundenen Zöpfe. An beiden Seiten des Kopfes war mein Haar fest zusammengedreht und zu mehreren Zöpfen gebunden, damit mir keine Strähnen ins Gesicht fielen. »Was ist an meiner normalen Frisur auszusetzen?«
Meine Mutter lächelte. Sie trug ein Kleid aus Federgras. Die Halme waren am Mieder verkreuzt und die Federbüschel standen wie ein hoher Kragen ab und umrahmten ihr Gesicht. Otega – meine Erzieherin und noch vieles mehr – hatte mir beigebracht, dass die Shotet zwischen sich und ihre Feinde, die Thuvhesi, einen Ozean aus Federgras gepflanzt hatten, um eine Invasion unseres Landes zu verhindern. Mit ihrem Kleid würdigte meine Mutter diese schlaue Tat. Alles, was meine Mutter tat, war ein bewusstes Aufgreifen unserer Geschichte.
»Heute«, sagte sie zu mir, »werden die meisten Shotet dich zum ersten Mal erblicken, ganz zu schweigen vom Rest der Galaxie. Wir wollen doch nicht, dass sie nur dein Haar und nicht dich sehen. Indem ich es auf diese Art frisiere, machen wir es unsichtbar. Verstehst du das?«
Ich verstand es nicht, beließ es aber dabei. Stattdessen betrachtete ich das Haar meiner Mutter. Es war dunkel wie meines, hatte aber eine andere Beschaffenheit – ihres war so dick, dass sich Finger darin verfingen, meines war gerade glatt genug, um ihnen zu entfliehen.
»Der Rest der Galaxie?« Natürlich wusste ich, wie riesig die Galaxie war. Sie hatte neun wichtige Planeten und ungezählte andere am Rand, dazu Raumstationen, die sich in die leblosen Felsen zerborstener Monde schmiegten, und im Orbit kreisende Schiffe, die fast so groß waren wie Nationenplaneten. Aber im Grunde genommen waren die Planeten für mich nur so groß wie das Haus, in dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht hatte.
»Mit Erlaubnis deines Vaters wird das Filmmaterial von der Prozession in den allgemeinen Nachrichten gezeigt werden, die allen neun Planeten zugänglich sind«, antwortete meine Mutter. »Alle, die neugierig auf unsere Rituale sind, werden zuschauen.«
Schon damals war mir klar, dass die Bewohner anderer Planeten nicht so waren wie wir. Ich wusste, dass wir einzigartig waren – niemand sonst folgte wie wir dem Stromfluss durch die Galaxie, niemand sonst war so wenig an Ort und Eigentum gebunden wie wir. Natürlich war man auf den anderen Planeten neugierig auf uns. Vielleicht sogar neidisch.
Seit es unser Volk gab, gingen wir stets einmal innerhalb eines Zeitlaufs auf Planetenreise. Otega hatte mir einmal erklärt, dass es bei der Reise um Tradition ging und bei dem anschließenden Beutezug um Erneuerung – Vergangenheit und Zukunft, vereint in einem einzigen Ritual. Aber ich hatte meinen Vater voller Bitterkeit sagen hören, dass wir »vom Müll anderer Planeten« lebten. Er hatte ein Talent dafür, den Dingen ihre Schönheit zu rauben.
Lazmet Noavek, mein Vater, ging vor uns her. Die Hand zum Gruß erhoben, trat er als Erster durch die großen Tore, die das Haus Noavek von den Straßen Voas trennte. Bei seinem Anblick brach die große, vor Leben vibrierende Menge in Jubel aus. Die Menschen hatten sich draußen vor unserem Haus versammelt und standen so dicht nebeneinander, dass ich weder Licht zwischen den Schultern der Personen vor uns sehen noch in der Kakofonie des Jubels meine eigenen Gedanken hören konnte. Hier in Voas Stadtzentrum, nur ein paar Straßen vom Amphitheater