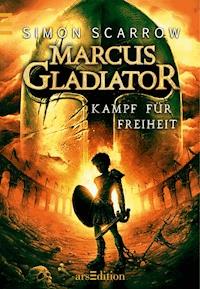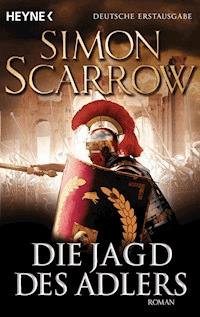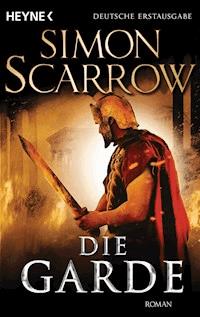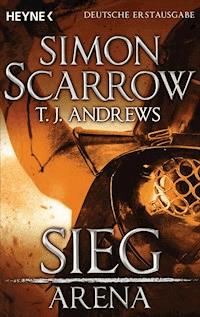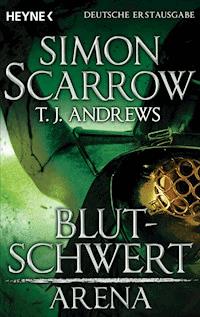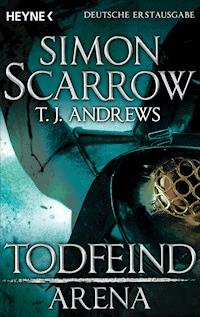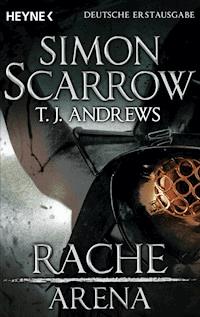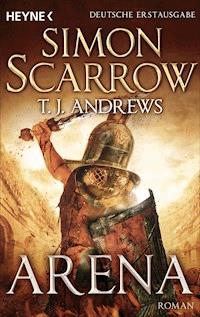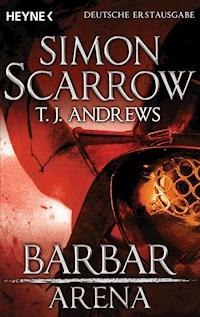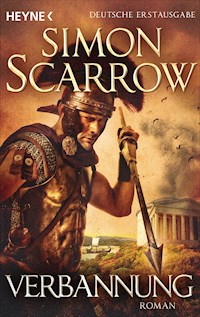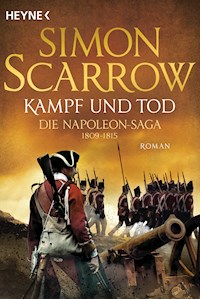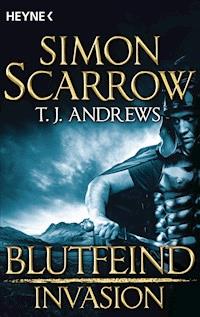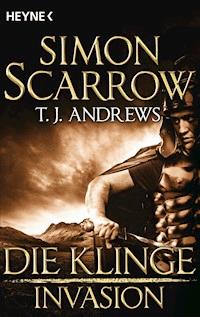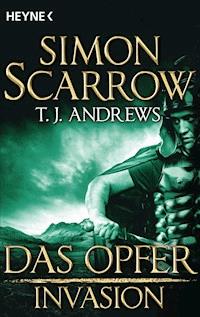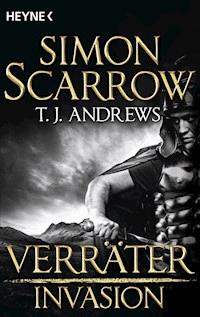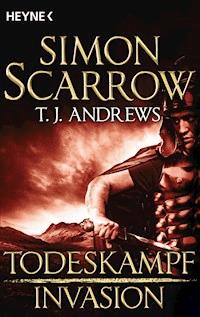10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rom-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die unter großer Mühsal eroberte Provinz Britannien ist ein Stachel im Fleisch des römischen Imperiums. Einheimische Rebellengruppen hören nicht auf, erbitterten Widerstand zu leisten, und schmieden Allianzen gegen ihren gemeinsamen Feind. Zugleich bereichern sich auf römischer Seite gierige Verwalter auf Kosten der darbenden Bevölkerung. In dieser aufgeheizten Stimmung entsendet das Imperium zwei seiner erfahrensten Soldaten: Erneut stehen Präfekt Cato und Centurio Macro den Rebellen Seite an Seite gegenüber. Können sie den Herrschaftsanspruch Roms behaupten oder wird es ihre letzte Schlacht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 696
Ähnliche
DAS BUCH
Der König starb kurz vor Tagesanbruch.
Vor seiner Hütte saßen seine Gefolgsleute still an einem großen Feuer. Normalerweise hätten sie bei einer solchen Zusammenkunft getrunken und sich gut gelaunt unterhalten, zwischendurch auch ein Lied gegrölt. Doch in dieser letzten Nacht des Königs war die Stimmung düster gewesen. Die leisen Gespräche hatten sich allein mit der Frage beschäftigt, wie es in ihrem Königreich weitergehen sollte, wenn Prasutagus nicht mehr bei ihnen war. Es war allgemein bekannt, dass er erst kurz vor seinem Tod sein Testament geändert und den römischen Kaiser Nero als Miterben neben seiner Gemahlin, der Königin, eingesetzt hatte. Für viele im Stamm kam das einem Verrat gleich …
DER AUTOR
Simon Scarrow wurde in Nigeria geboren und wuchs in England auf. Nach seinem Studium arbeitete er viele Jahre als Dozent für Geschichte an der Universität von Norfolk, bevor er mit dem Schreiben begann. Mittlerweile zählt er zu den wichtigsten Autoren historischer Romane. Mit seiner großen Rom-Serie und der vierbändigen Napoleon-Saga feiert Scarrow internationale Bestsellererfolge.
Besuchen Sie Simon Scarrow im Internet unter www.simonscarrow.co.uk
SIMON SCARROW
REBELLION
Roman
Aus dem Englischen übersetzt von Norbert Jakober und Martin Ruf
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe DEATH TO THE EMPEROR erschien 2022 in der Headline Publishing Group, London.
Deutsche Erstausgabe 06/2023
Copyright © 2023 by Simon Scarrow
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Rainer Schöttle
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Stephen Mulcahey, cosma, Michael Conrad) und Arcangel (Stephen Mulcahey)
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-30046-3V001
www.heyne.de
Zur Erinnerung an Glynne Jones, einen Gentleman in jeder Hinsicht. Nach einem langen, reichen Leben hinterlässt sein Tod eine riesige Lücke im Leben seiner Angehörigen und all jener, die das Privileg hatten, ihn einen Freund nennen zu dürfen. Leb wohl, Squire Jones. Mit großem Respekt und Zuneigung, The Varlet
PERSONEN
Centurio Macro: ein römischer Held
Präfekt Cato: Macros bester Freund, ein vorbildlicher Soldat
Petronella: Macros Gemahlin
Lucius: Catos Sohn
Claudia Acte: Catos Geliebte, ehemalige Geliebte von Kaiser Nero, der glaubt, sie wäre im Exil gestorben
Cassius: eine wild aussehende Promenadenmischung von Hund mit treuer Seele und gesundem Appetit
Parvus: ein stummer Junge
Apollonius: griechischer Freigelassener
Catus Decianus: Prokurator von Britannien
Suetonius Paulinus: Statthalter von Britannien
Portia: Macros Mutter
Gaius Hormanus: ein Sklaventreiber
Boudica: Königin der Icener
Bardea: Boudicas ältere Tochter
Merida: Boudicas jüngere Tochter
Syphodubnus: Boudicas Vetter
Bladocus: Druide
Pernocatus: trinovantischer Jäger
Attalus: Offizier, der Decianus’ Leibwache anführt
Fascus: Fußsoldat
Thrasyllus: Kommandant der Zehnten Gallischen Kohorte
ACHTE KOHORTE
Galerius
Minucius
Annius
Vellius
Decius
Flaccus
Tubero
Rubio
IN CAMULODUNUM
Ulpius
Vulpinus
Flaminius
Varius
Tertillius
Silvanus
Caldonius
Balbanus
Adrastus
Venutius
PROLOG
Britannien, im November 60 n. Chr.
Der König starb kurz vor Tagesanbruch.
Vor seiner Hütte saßen seine Gefolgsleute still an einem großen Feuer. Normalerweise hätten sie bei einer solchen Zusammenkunft getrunken und sich gut gelaunt unterhalten, zwischendurch auch ein Lied gegrölt. Doch in dieser letzten Nacht des Königs war die Stimmung düster gewesen. Die leisen Gespräche hatten sich allein mit der Frage beschäftigt, wie es in ihrem Königreich weitergehen sollte, wenn Prasutagus nicht mehr bei ihnen war. Es war allgemein bekannt, dass er erst kurz vor seinem Tod sein Testament geändert und den römischen Kaiser Nero als Miterben neben seiner Gemahlin, der Königin, eingesetzt hatte. Für viele im Stamm kam das einem Verrat gleich.
Mit welchem Recht hatte Prasutagus die Hälfte des icenischen Königreichs einem Despoten vermacht, der in einer fernen Stadt jenseits des Meeres lebte? Dazu kam, dass Nero der Herrscher des Reichs war, dessen Legionen erst vor wenigen Jahren einen Aufstand einer Gruppe von Icenern blutig niedergeschlagen und viele Stammeskrieger getötet hatten, als Scapula noch Statthalter der Provinz gewesen war. Römische Soldaten hatten Dörfer geplündert und Frauen vergewaltigt. Römische Veteranen aus der Kolonie in Camulodunum hatten gutes Ackerland und die Anwesen des einheimischen Adels in Besitz genommen, die im Grenzgebiet des Territoriums lagen, das die Veteranenkolonie von Camulodunum für sich beanspruchte. Ein schwerer Schlag für den stolzen Stamm der Icener. Sie bemühten sich, mit dieser Demütigung fertigzuwerden, indem sie sich nicht mit römischen Händlern abgaben und den Kontakt mit den Invasoren auf das Allernötigste beschränkten.
Die engsten Berater des Königs teilten zwar den Widerwillen der Stammesleute gegen dieses Testament, doch sie hatten sich ebenso wie Prasutagus damit abgefunden, dass die Icener eine tragfähige Übereinkunft mit Rom brauchten, um ihr Schicksal noch einigermaßen in der Hand zu haben. Das Problem war das Abkommen, das sie im Zuge der römischen Invasion vor siebzehn Jahren hatten schließen müssen. Darin hatten sie Rom als Schutzmacht akzeptiert, die das Recht hatte, den Nachfolger des Königs der Icener zu krönen. Die Römer hatten ihm versichert, dass es sich um eine reine Formalität handle, doch im Laufe der Jahre hatten Prasutagus und seine Berater einsehen müssen, dass die Macht dieser Klientelkönige, wie die Römer sie nannten, äußerst begrenzt war und Rom die Herrschaft über deren Reiche nach einer kurzen Übergangsphase meist direkt übernahm.
Der König und sein Rat hatten gehofft, Nero zu beschwichtigen, indem sie ihn als Miterben einsetzten und ihm damit zeigten, dass die Icener treue Verbündete der Römer waren. Manche hatten dem König prophezeit, dass diese Hoffnung sich nicht erfüllen würde, und darauf hingewiesen, wie es anderen Stämmen ergangen war, die ihr Schicksal zu eng mit Rom verknüpft hatten. Die Sorge der Icener wuchs durch eine Nachricht, die Prasutagus vom römischen Statthalter erhielt; dieser wies darauf hin, dass das Silber, das der König beim Vertragsabschluss bekommen hatte, kein Geschenk gewesen sei, sondern ein Kredit. Rom werde das Geld mit Zinsen zurückfordern, sobald Prasutagus sterbe. Ein großer Teil des Geldes war für Getreidekäufe verwendet worden, damit die Icener nicht hungern mussten, nachdem in den letzten beiden Jahren die Ernte ausgefallen war. Es war nicht mehr viel da, was man den Römern zurückgeben konnte.
Das alles lastete schwer auf den Gemütern derer, die sich um die Bahre mit dem Leichnam des Königs versammelt hatten. In den letzten zehn Tagen war Prasutagus schon zu geschwächt gewesen, um von seinem Krankenbett aufzustehen. Seine Gemahlin Boudica war nicht mehr von seiner Seite gewichen und hatte ihn nach Kräften gepflegt. Es war eine schmerzliche Zeit gewesen. Prasutagus war ein Krieger von imposanter Statur gewesen, mit einem breiten, gutmütigen Gesicht und wachen blauen Augen; ein Mann von überschäumender Lebensfreude, die alle mitriss, die das Vergnügen hatten, ihm zu begegnen. Die meisten Stammesangehörigen hatten ihn geliebt oder zumindest respektiert. Etwas über ein Jahr lang hatte ihn eine schwere Krankheit aufgezehrt, bis ihn selbst diejenigen, die ihm am nächsten standen, kaum noch wiedererkannten. Zuletzt war er nur noch Haut und Knochen gewesen, von entsetzlichen Schmerzen gepeinigt.
Boudica hatte nichts unversucht gelassen, doch auch die Druiden des Stammes hatten ihn nicht zu heilen vermocht. Sie hatte sogar ihre Abneigung gegen die Römer beiseitegeschoben und für teures Geld einen römischen Arzt aus Londinium in die Hauptstadt der Icener kommen lassen. Auch er war gegen die Krankheit machtlos gewesen. Am Ende hatte Boudica nur noch versuchen können, ihren sterbenden Gemahl zu trösten und den Göttern Opfer darzubringen, damit sie ihn im Jenseits gut aufnehmen würden.
Auch in dieser letzten Nacht hatte sie an seiner Seite ausgeharrt, bis sein flaches Atmen kaum noch zu hören war und schließlich ganz verstummte. Sie wartete einen Augenblick, dann drückte sie das Ohr an seine knochige Brust, doch es war kein Herzschlag mehr zu vernehmen. Mit einem Seufzer hob sie den Kopf und küsste zärtlich seine schlaffe Hand, ehe sie sie auf seine Brust legte und sich den anderen zuwandte – ihren Töchtern, ein paar anderen Angehörigen sowie einigen Aristokraten und Mitgliedern des königlichen Rats.
Sie richtete sich auf und verkündete: »König Prasutagus ist tot.«
Niemand sprach ein Wort, keiner rührte sich von der Stelle. Bis ihre jüngere Tochter Merida die Augen schloss, die Hände vors Gesicht schlug und zu schluchzen begann. Ihre zwei Jahre ältere Schwester war mit ihren sechzehn Jahren bereits mit einem Angehörigen des Stammesadels verlobt, der ein Anwesen an der Küste besaß. Sie trat zu ihrer Mutter und umarmte sie.
»Oh, meine liebe Bardea«, flüsterte ihre Mutter ihr ins Ohr. »Was soll jetzt aus uns werden? Was wird aus den Icenern?«
»Die Icener werden überleben, Mutter. Wir haben immer irgendwie überlebt.«
Boudica drückte ihre Tochter noch fester an sich, tief bewegt von ihrer Überzeugung und ihrem Glauben. »Gewiss.« Wenn sie wüsste, dachte die Königin. Unser Stamm steht kurz vor der Vernichtung. Wir haben unser Schicksal nicht mehr selbst in der Hand. Irgendwo im fernen Rom wird über unsere Zukunft entschieden. Das Königreich der Icener ist von den Launen des jugendlichen Kaisers Nero abhängig.
Sie hielt Bardea eine Armlänge von sich und betrachtete anerkennend das beherrschte Gesicht ihrer Tochter, die ihre Trauer nicht zu zeigen gewillt war. Ebenso wie die Königin selbst würde Bardea die Tränen erst später zulassen, wenn sie allein war. Vorher gab es noch einiges zu tun. Boudica deutete auf Merida und flüsterte: »Du musst deiner Schwester beistehen. Sie war immer der Liebling ihres Vaters, so wie du mein Liebling bist. Geh mit ihr nach Hause und tröste sie.«
»Ja, Mutter.«
»Ich komme nach, sobald ich mit dem Rat gesprochen habe.«
Sie tauschten einen kurzen Blick, und Bardea nickte. Sie waren auf diesen Augenblick vorbereitet, hatten erst vor einigen Tagen darüber gesprochen, was zu tun sei, als bereits klar gewesen war, dass dem König nicht mehr viel Zeit blieb.
Boudica sah ihren Töchtern nach, als sie den Raum verließen, das Herz voll Sorge beim Gedanken daran, was die Zukunft den beiden bringen würde. Nichts war mehr sicher. Es konnte sein, dass alle Traditionen, die seit jeher von einer Generation zur nächsten weitergegeben worden waren, mit einem Schlag weggefegt wurden, falls die Römer sich dazu entschlossen, den Icenern mit brutaler Gewalt ihren Willen aufzuzwingen. Was sollte aus Bardea und Merida werden, in einer Welt, die für zwei junge Prinzessinnen keinen Platz mehr hatte? Wer würde sie beschützen, wenn der königliche Haushalt aufgelöst wurde?
Als die beiden draußen waren, nickte Boudica dem Kommandanten der königlichen Leibwache zu; der befahl daraufhin den beiden wachhabenden Kriegern, die Tür zu schließen. Einige drehten sich nach dem dumpfen Geräusch der Holztür um, ehe sie sich der Königin zuwandten. Sie war eine stattliche Erscheinung, hatte breite Hüften und Schultern und verfügte über eine körperliche Präsenz, die ihrer starken Persönlichkeit entsprach. Sie war bereits in mittleren Jahren, ihr Gesicht nicht mehr frei von Falten, doch ihr Blick war klar und durchdringend. Mit ihrem langen roten Haar, das mit einem schlichten Lederband zurückgebunden war, hob sie sich von den anderen Frauen des königlichen Hofs ab.
Dank ihrer scharfen Intelligenz und der Ausbildung, die ihr Vater ihr durch einen gallischen Lehrer hatte zuteilwerden lassen, war Boudica eine der wenigen in ihrem Stamm, die Latein sprechen und schreiben konnten. Auch dadurch war sie König Prasutagus während seiner gesamten Regentschaft eine wertvolle Stütze gewesen. Und als seine Kräfte allmählich geschwunden waren, hatte sie die königliche Autorität übernommen, um sicherzustellen, dass die Icener klug und gerecht regiert wurden.
Sie hatte das Vertrauen ihres Volkes und der Mehrheit des Königshofs erworben, doch nun, da der König tot war, würden sich einige aus der Deckung wagen, die seinen Platz einnehmen wollten. Boudica wusste, vor wem sie sich in Acht nehmen musste; es waren durchweg Männer, die ihr nicht fähig erschienen, mit einer solchen Macht klug umzugehen, schon gar nicht in so schwierigen Zeiten. Wenn ein ehrgeiziger Vertreter der icenischen Oberschicht sich an die Spitze des Stamms stellte und dessen Interessen allzu entschieden durchzusetzen versuchte, würden die Icener möglicherweise den Zorn Roms zu spüren bekommen. Die Leichtigkeit, mit der die römischen Soldaten vor einigen Jahren den Aufstand einer Gruppe von Icenern niedergeschlagen hatten, war ihnen allen eine Lehre gewesen. Besonders demütigend war, dass die Stammeskrieger nach der Niederlage auch noch ihre Waffen hatten abgeben müssen. Alles, was man ihnen zugestand, waren Waffen, die für die Jagd benötigt wurden; die Rüstungen und Schwerter, die von Vater zu Sohn weitergegeben und mit Stolz gepflegt und getragen worden waren, hatten sie den Römern aushändigen müssen. Natürlich nicht alle. Einen Teil der Waffen hatten sie verstecken können; manche hatten sie unter den Hütten vergraben, andere in dem Sumpfland, in das die Römer sich nicht gern vorwagten. Es herrschte eine stille Übereinkunft, dass die icenischen Krieger eines Tages wieder zu den Waffen greifen würden. Doch jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt dafür, davon war Boudica überzeugt.
Sie musterte die Gesichter der icenischen Adligen, Krieger und Angehörigen des königlichen Rates, sah darin eine Mischung aus Respekt, Berechnung und Erwartung. Dann blickte sie wieder auf den Leichnam ihres Gemahls, des Mannes, den sie schnell liebgewonnen hatte, nachdem ihre Ehe vereinbart worden war. Sie vermisste ihn jetzt schon und lächelte traurig beim Gedanken an sein herzhaftes Lachen und seine Zuneigung, die er sie immer hatte spüren lassen, wenn sie sich außerhalb ihrer Rolle als Königspaar bewegt hatten. Sie schloss die Augen, atmete tief ein und schob die Gedanken an die Vergangenheit beiseite, um sich ganz auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, als sie sich den Anwesenden zuwandte.
»Wir haben unseren König verloren. Es gilt zu entscheiden, wer ihm nachfolgen soll. Auch wenn ich eure Königin bin, ist es alter icenischer Brauch, dass der königliche Rat und unsere Adligen das Recht haben, unser neues Oberhaupt zu bestimmen. Ich erkläre vor allen, die sich hier versammelt haben, dass es mir eine Ehre wäre, Prasutagus nachzufolgen. Ihr kennt mich und meine Fähigkeiten, die ich in diesem letzten Jahr bewiesen habe, als unser geliebter König durch die Krankheit geschwächt war, die ihn nun hinweggerafft hat. Es war sein ausdrücklicher Wunsch, dass ich ihn als Königin beerbe.«
»Neben dem römischen Kaiser«, warf eine Stimme ein.
Ihr Blick schweifte zu einem stämmigen Adligen ganz rechts im Kreis der Versammelten. Am Hals trug er einen goldenen Torques, einen offenen Halsring in der Form einer zweiköpfigen Schlange. Seine breiten Schultern und die bullige Statur machten seine mangelnde Größe wett. Seinen nahezu kahlen Kopf zierte ein blonder Haarkranz; ein Schnurrbart hing zu beiden Seiten der dünnen Lippen herunter, die sich in einem spöttischen Grinsen kräuselten.
»Mein Vetter Syphodubnus, du kennst die Gründe, warum wir Nero als Miterben eingesetzt haben. Du warst im Rat dabei, als das Testament beschlossen wurde.«
»Aber wie du weißt, habe ich nicht zugestimmt. Und ich war nicht der Einzige.« Syphodubnus schaute in die Runde, und einige nickten zustimmend.
»Der König hat darüber abstimmen lassen«, erwiderte Boudica unbeirrt, »und das Ergebnis war eindeutig. An diese Entscheidung sind wir nun gebunden.«
»Wer sagt das? Es wurde kein Eid vor einem Druiden geschworen. Somit sind wir nicht an dieses Testament gebunden. Prasutagus ist nicht mehr unter uns. Vielleicht wird sein Nachfolger beschließen, das Testament aufzuheben. Vielleicht hat er den Mut, Rom die Stirn zu bieten und die Ehre der Icener zu retten.«
Boudica spürte, wie Zorn und Abneigung in ihr hochkamen. Der Leichnam ihres Gemahls war noch nicht einmal kalt, und schon wagte es einer seiner Rivalen, ihn indirekt als Feigling und Verräter hinzustellen. Sie biss die Zähne zusammen, um ihre Wut zu beherrschen, und funkelte Syphodubnus einen Moment lang an, ehe sie antwortete.
»Ich nehme an, du hältst dich für würdig, den Platz meines Gemahls einzunehmen. Ist es so?«
Syphodubnus lächelte und sagte dann in gebührendem Ernst: »Wenn unser Volk mich zum König will, würde ich mein Leben dafür einsetzen, der Aufgabe gerecht zu werden. Ich würde es als meine heilige Pflicht betrachten, den Icenern ihre Würde zurückzugeben und unser Reich den Klauen der Römer zu entreißen.«
Mehrere Männer verliehen ihrer Unterstützung für seine Absichten Ausdruck, und Boudica erkannte auf einen Blick, dass es sich um Leute aus seinem engsten Kreis handelte, die ihn bei dem gescheiterten Aufstand vor einigen Jahren unterstützt hatten. Sie hatten es als heroischen Widerstand gegen die römischen Invasoren hingestellt – dabei war der Kampf von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Zu wenige hatten sich hinter Syphodubnus gestellt, als er seine Leute zu den Waffen rief. Statt mit seinem Anliegen vor Prasutagus hinzutreten und die Icener darüber abstimmen zu lassen, ging er mit seinen Gefolgsleuten eigenmächtig und überstürzt gegen die römische Armee vor.
Boudica hob die Hand, um Ruhe einzufordern, und senkte sie erst, als der letzte von Syphodubnus’ Anhängern verstummt war.
»Du redest von der Würde der Icener – dabei hast du selbst Schande über uns gebracht durch deine schmachvolle Niederlage. Die Römer mussten nicht einmal ihre Legionen einsetzen, um dich zu besiegen; ihre Hilfstruppen haben dazu völlig ausgereicht, und das sind keine erstklassigen Soldaten«, fügte sie verächtlich hinzu.
»Wir haben wenigstens gekämpft«, schoss Syphodubnus zurück. »Und damit die Ehre unseres Stammes gewahrt.«
»Die Ehre?« Boudica lachte bitter. »Was hast du denn damit erreicht? Ihr habt einige Gehöfte überfallen, eine Handvoll Villen niedergebrannt und ein paar Patrouillen niedergemacht. Als die Römer ihre Truppen zusammenzogen, um gegen euch vorzugehen, habt ihr Reißaus genommen und euch in einer Festung in den Sümpfen versteckt. Wie lange habt ihr tapferen Krieger denn Widerstand geleistet? Sag es uns …«
Syphodubnus funkelte sie wütend an, sein Gesicht bleich vor Zorn.
»Nun? Willst du es uns nicht sagen?«, stichelte Boudica. »Dann sage ich es dir. Genau zwei Tage habt ihr durchgehalten, dann war es vorbei mit eurer Tapferkeit. Zuerst wolltet ihr euch nicht ergeben, aber als die Römer die Festung stürmten, habt ihr sofort die Schwerter niedergelegt. Es war ein Glück, dass nur wenige von uns getötet wurden und der Statthalter Gnade walten ließ. Trotzdem hat es uns einen großen Teil unserer Waffen und Rüstungen gekostet. Außerdem mussten wir das zerstörte römische Eigentum ersetzen und zweihundert unserer besten jungen Männer an die römischen Hilfstruppen abgeben. Noch schlimmer ist, dass sie Außenposten errichtet haben, um unsere Grenzen zu bewachen.« Sie hielt einen Augenblick inne, um ihre Worte wirken zu lassen. »Und du hast die Frechheit, zu behaupten, du hättest die Ehre unseres Stammes wiederhergestellt? Pah!«
»Hätte der ganze Stamm sich auf unsere Seite gestellt, hätten wir gesiegt«, behauptete Syphodubnus. »Wenn Prasutagus den icenischen Kriegern befohlen hätte, zu kämpfen, hätten wir die römischen Hilfstruppen niedergemacht.«
»Aber ihr habt ihm ja nicht einmal die Möglichkeit dazu gegeben«, hielt sie dagegen. »Es war schon wieder vorbei, bevor der König auch nur den Stammesrat einberufen konnte. Und selbst wenn wir ihre Hilfstruppen schlagen könnten, wäre damit nichts gewonnen. Dann bekämen wir es mit ihren Legionen zu tun.« Sie schaute zu einigen älteren Männern in der Runde. »Nur wenige von uns haben die römischen Legionen kämpfen sehen. Die aber wissen, dass es töricht wäre, sich ihnen entgegenzustellen. Ihre Legionen würden uns ebenso vernichten, wie sie jeden Stamm vernichtet haben, der die Waffen gegen sie erhoben hat. Nicht einmal der große Kriegsherr Caratacus konnte sie besiegen. In Ketten haben sie ihn nach Rom gebracht. Du, Syphodubnus, hast das nicht miterlebt – dafür bist du nicht alt genug.«
»Vielleicht wird man im Alter feige«, spöttelte er. »Vielleicht ist es Zeit, dass Jüngere das Schwert in die Hand nehmen. Wenn ich zu Prasutagus’ Nachfolger bestimmt werde, schwöre ich, dass die Römer Grund haben werden, uns zu fürchten. Wir werden den anderen Stämmen ein leuchtendes Beispiel geben, damit sie sich ebenfalls erheben und die Eindringlinge vertreiben. Und wenn das geschafft ist, werden wir der mächtigste Stamm im ganzen Land sein.«
»Große Worte von einem, der schon beim ersten Schritt gestrauchelt ist«, höhnte Boudica. »Glaubst du nicht, dass mein Gemahl die gleichen Träume hatte wie du? Doch im Gegensatz zu dir wusste er genau, was möglich ist und was nicht. Ja, es wird der Tag kommen, an dem die anderen Stämme es leid sind, unter dem Joch der Römer zu leben, und sich gegen ihre Herrschaft erheben werden, aber dieser Tag ist noch fern. Bis dahin müssen wir unseren Zorn bezähmen und unsere Schwerter verstecken. Rom soll uns als treue Verbündete betrachten und es nicht für nötig erachten, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen, solange wir den geforderten Tribut bezahlen. Wenn wir uns erheben, bevor wir dazu bereit sind und bevor die anderen Stämme sich uns anschließen, können wir nicht siegen – und dann wird Rom sich nicht noch einmal so nachsichtig zeigen. Sie werden unsere Krieger abschlachten, unsere Gehöfte niederbrennen und uns alles wegnehmen, was wir besitzen. Die Überlebenden werden sie als Sklaven verkaufen. Dann wird der Name unseres Stammes bald vergessen sein. Wollt ihr das?« Boudica breitete die Arme aus und blickte in die Runde der Männer vor ihr, ehe sie sich wieder an Syphodubnus wandte. »Willst du das? Willst du unsere tapferen jungen Krieger in den sicheren Tod führen?«
Sie sah den Funken des Zweifels in seinen Augen aufblitzen, doch dann kehrte der trotzige, arrogante Ausdruck wieder zurück, und ihr war klar, dass sie ihn nicht hatte überzeugen können. Er war einfach zu jung und unerfahren für jede tiefere Einsicht. Also gut, dachte sie. Entscheidend war, dass er nicht der Nachfolger von Prasutagus wurde.
»Das Testament meines Gemahls ist eindeutig und wurde vom Stammesrat bestätigt. Ich bin eure Königin. Ihr seid mir gegenüber zur Treue verpflichtet.«
»Aber du bist eine Frau«, protestierte Syphodubnus. »Ein Stamm wie die Icener sollte von einem Krieger regiert werden.«
»Und wer sagt, dass eine Frau keine Kriegerin sein kann? Ich habe an der Seite meines Mannes gekämpft. Ich habe das Schwert geschwungen und das Blut unserer Feinde vergossen. Habe mein Leben aufs Spiel gesetzt und wurde oft genug verwundet. Kannst du das Gleiche von dir behaupten, junger Mann? Du hast keinen Blutstropfen im Kampf verloren – dafür hast du dich zu rasch ergeben.«
Syphodubnus verzog das Gesicht und knurrte bitter, während sie fortfuhr.
»Ich habe mich im Kampf bewährt. Das heißt, die Icener werden von einer Kriegerin regiert, so wie du es gefordert hast.«
»Das wird sich zeigen. Es ist mein gutes Recht, vor den Rat zu treten. Er soll entscheiden, ob das Testament rechtmäßig ist oder nicht.«
»Das kannst du gern tun, wenn der Rat das nächste Mal zusammentritt.«
»Aber das wird erst in einigen Monaten sein. Warum warten? Wir können es hier und jetzt entscheiden. Es gibt keinen Grund, es aufzuschieben.«
»Der Rat ist hier, um dem verstorbenen König die Ehre zu erweisen, einem Krieger, dessen Ansehen dir niemals zuteilwerden wird, Syphodubnus. Wir werden um ihn trauern und ihn begraben, danach werde ich ihm als Oberhaupt der Icener nachfolgen und so lange regieren, bis der Rat beschließt, dass ein anderer an meine Stelle treten soll. Und ein solcher Beschluss kann erst bei der Versammlung im Winter gefasst werden. Habe ich recht, meine Herren?«
Sie schaute zu einem von Prasutagus’ ältesten und angesehensten Beratern, dem Druiden Bladocus. Dieser nickte und atmete tief ein, ehe er das Wort ergriff und mit klarer Stimme sprach.
»So ist es. Bis dahin werde ich Königin Boudica die Treue halten, das schwöre ich bei unseren Göttern.«
»Ich ebenso!«, rief ein anderer aus, dann noch einer, bis die wenigen protestierenden Stimmen im Chor der allgemeinen Zustimmung untergingen.
Syphodubnus sah ein, dass er überstimmt war, und sein jugendliches Gesicht verfinsterte sich vor Bitterkeit. Als die Treuebezeugungen verstummten, wandte sich Boudica erneut an ihn.
»Die Icener haben gesprochen. Dir bleibt nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren.«
»Aber nur vorläufig.«
»Akzeptierst du es?«, drängte Boudica.
»Ja«, zischte er.
»Dann sag es. Schwöre deiner Königin den Treueeid.«
Syphodubnus verschränkte die Arme und zögerte einen Augenblick, ehe er mit tonloser Stimme sprach. »Ich schwöre bei allen Göttern unseres Stammes, der Königin treu zu sein.«
»Dann ist es entschieden«, verkündete Boudica. »Nun müssen wir unseren Leuten mitteilen, dass Prasutagus von uns gegangen ist und dass ich an seiner Stelle regieren werde.«
Sie gab den beiden Kriegern, die den Eingang bewachten, ein Zeichen, worauf diese die Tür öffneten und zu beiden Seiten in Position gingen. Die Angehörigen des königlichen Rates und die anderen Anwesenden traten in das weite Gelände hinaus, das von einer Palisade umgeben war. Die Stammesleute, die sich um die Lagerfeuer versammelt hatten, erhoben sich. Am östlichen Horizont zeigte sich der erste Schimmer der Morgenröte, ein leichter Regen benetzte die Umhänge, Tuniken und die Haare der Wartenden.
Boudica wartete, bis alle gegangen waren, schaute noch einmal auf ihren Gemahl hinunter und flüsterte: »Mein Lieber … ich fürchte, ich werde in meinem Leben nicht den Frieden finden, den du gefunden hast.«
Dann bedeckte sie sein Gesicht mit dem gewobenen Tuch und ging zur Tür. Trotz des erlittenen Verlusts blickte sie nach vorn. Sie hatte Syphodubnus’ Ambitionen abgewehrt, doch er würde zweifellos schon bald versuchen, gegen sie zu intrigieren, auch wenn er ihr die Treue geschworen hatte. Er war sicher nicht der Mann, in dessen Hände man das Schicksal des icenischen Stammes legen sollte. Doch er war schlau genug, um an die Sehnsucht der Icener nach einer Wiederbelebung des goldenen Zeitalters zu appellieren, von dem in Liedern und Legenden die Rede war. Boudica wusste, dass ihre Stammesleute, wie die meisten Kelten, lieber sentimentalen Träumen nachhingen, als sich der unangenehmen Realität zu stellen. Sie gab sich keinen Illusionen hin. Syphodubnus war der Feind im eigenen Lager, deshalb musste sie ihn im Auge behalten.
Zugleich gab es den Feind von außen. Trotz des Vertrags mit den Römern hatte es immer wieder Spannungen gegeben, die in letzter Zeit spürbar zugenommen hatten. Ihr eigenes Schicksal hing ebenso wie das ihrer Familie und des ganzen Stammes davon ab, wie die Römer auf die Nachricht von Prasutagus’ Tod reagieren würden. Boudica war von düsteren Vorahnungen erfüllt. Die Römer würden die Situation auf jeden Fall nutzen, um ihren Einfluss auf die Icener zu verstärken. Im schlimmsten Fall würden sie so weit gehen, das Stammesgebiet zu annektieren und der Provinz einzuverleiben, die sie auf der Insel etabliert hatten.
Als sie hinausging und auf den Streitwagen ihres Gemahls stieg, rief der Druide Bladocus der Menge zu: »Der König ist tot! Es lebe Boudica, die Königin der Icener! Mögen die Götter sie schützen und ihr im Frieden ebenso beistehen wie im Krieg!«
Krieg … mögen die Götter uns davor bewahren, betete Boudica im Stillen, aber von ganzem Herzen. Sie blickte in die Ferne, während die Stammesleute wieder und wieder ihren Namen riefen. Blickte in die Morgenröte und den stärker werdenden Regen, den der kalte Wind ihr ins Gesicht peitschte.
KAPITEL 1
Camulodunum
Die Schwertspitze nach oben, Himmel noch mal!«, brummte Centurio Macro, während er einen weiteren schwachen Hieb seines Gegners abwehrte und ihm einen kräftigen Schlag gegen die Schulter versetzte, zur Strafe für die unzulänglichen Versuche des jungen Burschen. »Wie willst du jemals ein Legionär werden, wenn du so kämpfst? Ich habe Katzenbabys gesehen, die haben bedrohlicher ausgesehen als du! Versuch’s noch mal, aber mit ein bisschen mehr Überzeugung.«
Er machte einen Schritt zurück und ging in die Hocke, um jederzeit vor oder zur Seite springen zu können, wie er es in seinen über dreißig Jahren als Soldat gelernt hatte. Er hob sein hölzernes Übungsschwert und ließ die stumpfe Spitze in der Luft kreisen.
»Jetzt, Lucius«, forderte er den Jungen auf. »Diesmal richtig.«
Der schmächtige Bursche, der ihm gegenüberstand, war gerade einmal acht Jahre alt und hatte dichtes lockiges Haar. Mit zusammengebissenen Zähnen machte er sich zum Angriff bereit. Die dunklen Augen zusammengekniffen, erwiderte er Macros finsteren Blick. Sie standen am kiesbedeckten Ufer des kleinen Teichs im Hof von Macros Haus. Zwei Frauen und ein Mann sahen ihnen von den Stühlen aus zu, die an einem Holztisch im Garten standen. Neben dem Mann hockte ein riesiger Hund mit struppigem braunem Fell, den langen Kopf zwischen den Vorderpfoten. Obwohl die brennenden Holzscheite in dem eisenumrahmten Korb ihnen Wärme spendeten, konnten sie nicht auf ihre Umhänge verzichten. Wie die meisten Römer, die sich in der noch jungen Provinz Britannien niedergelassen hatten, waren sie die kalten Winter auf der Insel nicht gewohnt. Macro und Lucius hingegen trugen nur ihre einfachen Tuniken und schwitzten bei ihren Schwertübungen im Hof.
»Gib’s ihm, Lucius!«, rief eine der Frauen gut gelaunt. Sie war kräftig gebaut, hatte ein freundliches rundes Gesicht, braune Augen und dunkles Haar.
Macro schaute stirnrunzelnd zu ihr. »Danke für die treue Unterstützung, meine liebe Frau.«
Petronella lachte mit einer wegwerfenden Geste.
Er wollte etwas erwidern, als der Junge mit einem schrillen Schrei auf ihn losging. Der Centurio parierte den Hieb spielerisch und konterte, auf die Brust des Jungen zielend. Dieser reagierte blitzschnell, wehrte Macros Angriff ab und sprang vor, um seinem Gegner das Holzschwert in die Magengrube zu stoßen. Trotz seines viel höheren Gewichts wich Macro geschickt aus, und das Schwert des Jungen stieß ins Leere. Macro wollte ihm noch einen Klaps auf die Schulter geben, als Lucius ihm, so fest er konnte, auf die entblößten Zehen des Führungsfußes trat.
»Au!«, rief der Centurio überrascht und humpelte einen Schritt zurück. »Du hinterhältiger kleiner Bastard …«
»Du sollst nicht fluchen!«, mahnte seine Gemahlin.
Bevor Macro etwas erwidern konnte, war Lucius einen Schritt zurückgewichen und visierte die Brust seines erfahrenen Gegners an. Die Holzspitze traf Macro knapp unterhalb des Brustkorbs, doch der Stich, den das Übungsschwert ihm versetzte, verletzte seinen Stolz nur für einen kurzen Augenblick, dann senkte er grinsend seine Waffe. »Das reicht für heute! Gut gemacht, Lucius!«
Das verbissene Gesicht des Jungen entspannte sich, und er wandte sich stolz dem bärtigen Mann zu, der am Tisch saß. Er war Mitte dreißig, schlank, und hatte die gleichen dunklen Locken wie sein Sohn. Sein Gesicht war von einer auffälligen Narbe gezeichnet, die sich von der Stirn über die rechte Wange zog, seinem guten Aussehen jedoch kaum einen Abbruch tat. Er erwiderte das Lächeln, dann öffnete er den Mund, um dem Jungen eine Warnung zuzurufen – aber zu spät. Macro schlug Lucius mit der Breitseite des Übungsschwerts aufs Handgelenk, gerade fest genug, dass der Bursche seine Waffe fallen ließ.
Er stieß einen spitzen Schrei aus und funkelte den Centurio vorwurfsvoll an.
»Du darfst deinem Feind nie den Rücken zukehren, solange er noch steht«, ermahnte ihn Macro. »Wie oft hab ich dir das schon gesagt?«
Seine Stimme klang sehr ernst, und Lucius senkte den Kopf und rieb sich das Handgelenk. »Das hat wehgetan.«
»Was glaubst du, wie weh es erst tut, wenn dein Gegner dir in einem richtigen Kampf das Schwert in den Rücken stößt.«
Lucius presste die Lippen aufeinander, und sein Kinn zitterte in verletztem Stolz. Macro sah, dass der Junge den Tränen nahe war, und beeilte sich, ihm liebevoll die Haare zu zausen. »Ist ja nichts passiert, Junge. In deinem Alter kann man sich noch ein paar Fehler erlauben. Du lernst ja gerade erst, mit dem Schwert umzugehen. Mir ist es genauso gegangen, als ich angefangen habe.« Er schaute zum Tisch und grinste. »Dein Vater war ein hoffnungsloser Fall, als er als junger Rekrut zur Zweiten Legion kam. Er war vor allem eine Gefahr für sich selbst und seine Kameraden und weniger für die grimmigen germanischen Krieger, mit denen wir es zu tun hatten. Stimmt’s nicht, Cato?«
Cato verzog das Gesicht. »Wenn du es sagst, mein Freund.«
»Und schau, was aus ihm geworden ist«, fuhr Macro fort. »Er hat sich von ganz unten hochgearbeitet, wurde Optio und später Präfekt und war sogar Tribun der Prätorianergarde. Für seine Tapferkeit wurde er schon öfter ausgezeichnet als die meisten Soldaten in ihrer ganzen Laufbahn. Er ist einer der besten Offiziere in der ganzen Armee. Also üb schön weiter, Lucius, dann kannst du eines Tages genauso viel erreichen wie dein Vater.«
Die blonde Frau an Catos Seite sah ihn mit einem warmen Lächeln an, dann beugte sie sich vor und küsste ihn zärtlich auf die narbige Wange. »Mein Held.«
»Genug, Claudia.« Cato wich stirnrunzelnd zurück. Es war ihm seit jeher unangenehm, gelobt zu werden. »Tu einfach dein Bestes, Lucius. Mehr kann niemand von dir verlangen.«
Der Junge kam zum Tisch, hockte sich neben den Hund und streichelte ihn. Das Tier wedelte dankbar mit dem Schwanz, hob den Kopf und schleckte dem Jungen das Gesicht ab.
»Nein, Cassius. Hör auf.« Lachend stand Lucius auf und setzte sich auf einen Hocker. Seine Füße reichten nicht einmal bis zum Boden. »Du bist so ein guter Soldat, Vater«, sagte er zu Cato. »Warum sind wir dann noch in Camulodunum? Solltest du nicht für den Kaiser gegen die Barbaren und die Druiden kämpfen?«
Die Erwachsenen wechselten kurze Blicke. Claudia war einst Neros Geliebte gewesen, ehe sie nach Sardinien ins Exil geschickt wurde. Sie war jedoch nicht auf der Insel geblieben, sondern hatte Cato in den entlegensten Winkel des Römischen Reichs begleitet, wo sie sich sicher fühlten. Die Veteranenkolonie von Camulodunum war ein ruhiger, abgelegener Ort; hier bestand kaum eine Gefahr, dass jemand sie erkennen könnte und nach Rom melden würde. Trotzdem mussten sie immer auf der Hut sein. Eine Vorsichtsmaßnahme bestand darin, dem Jungen nicht zu erzählen, warum sie hier waren, damit Lucius es nicht unabsichtlich verraten konnte.
»Dein Vater muss sich zwischen den Feldzügen auch einmal ausruhen«, erklärte Petronella. »Damit er bereit ist, wenn der Kaiser ihn braucht. Außerdem will er mehr Zeit mit dir verbringen. Es gefällt dir doch hier, nicht, Lucius?«
Der Junge überlegte einen Augenblick. In der Kolonie gab es genug Kinder in seinem Alter, mit denen er spielen konnte. Im Sommer konnte man im Fluss angeln und in den Wäldern auf die Jagd gehen. Er nickte. »Doch, schon, aber es wird schon wieder kalt.«
Macro seufzte. »Da hat er recht. Den verdammten Winter in dieser Provinz schicken uns die Götter, um uns zu prüfen. Diese ewige feuchte Kälte. Die Straßen voller Schlamm, und zu essen gibt es nur noch getrocknetes Fleisch und das bisschen Gemüse, das vom Sommer übrig ist.«
»Mach nur weiter so«, mahnte Petronella. »Du schaffst es wieder mal, den Jungen aufzumuntern.«
Cato griff nach seinem Becher mit gewärmtem Wein und nahm einen Schluck. »Ach, komm, Macro. Es ist doch wirklich nicht so schlimm hier. Du hast ja ein richtig behagliches Plätzchen gefunden.« Er deutete auf das Haus und den Hof. Früher hatte es einem Legaten als Quartier gedient, während eine Festung für die Legionen gebaut wurde. Die Arbeiten waren abgebrochen worden, als man beschloss, auf dem Gelände keine Festung, sondern die Veteranenkolonie zu errichten. Es waren noch einige Gebäude der ursprünglichen Militäranlage übrig, doch die Palisade war abgerissen, der Erdwall abgetragen und der Verteidigungsgraben zugeschüttet worden. Zwischen den bestehenden Gebäuden war einiges in Arbeit, unter anderem ein Theater, eine Arena sowie ein imposanter Tempel, der dem Kaiserkult geweiht war.
»Du hast das schönste Haus in der ganzen Kolonie, Macro, und dazu noch einen ertragreichen Bauernhof. Außerdem bist du der oberste Magistrat der Kolonie. Und als wäre das nicht schon genug, hast du auch noch das große Glück, mit Petronella verheiratet zu sein.« Cato erhob seinen Becher und deutete eine Verbeugung an. »Ich würde sagen, du hast es gut getroffen. Ein würdiges Ende deiner militärischen Laufbahn, wie du es dir verdient hast, mein Freund. Du kannst deinen Ruhestand in Frieden und Wohlstand genießen.«
Petronella lächelte, nahm den stämmigen Arm ihres Gemahls und drückte ihn.
»Da hast du schon recht«, gab Macro zu. »Obwohl ich an manchen Tagen das alte Leben ein bisschen vermisse.«
»Das ist ganz normal. Aber du kannst nicht ewig in der Armee dienen.«
»Ich weiß«, sagte Macro bedauernd.
Sie schwiegen einen langen Augenblick, bis Claudia sich räusperte. »Hier ist es zwar friedlich, aber wir wissen alle, dass sich das auch ganz schnell ändern kann.«
Cato wandte sich an seinen Sohn. »Willst du nicht mal nachsehen, ob deine Freunde Lust haben, zu spielen?«
Der Junge blickte zu den hölzernen Übungsschwertern, die auf dem Tisch lagen. »Kann ich die mitnehmen?«
»Nur, wenn du vorsichtig bist«, mahnte Cato. »Ich will nichts hören von gebrochenen Rippen oder blutigen Nasen. Verstanden? Und nimm Parvus mit.«
Bevor Cato es sich anders überlegen konnte, schnappte sich Lucius die Schwerter und eilte zur Küche im hinteren Bereich des Hauses. Wenige Augenblicke später kam er mit einem etwas älteren, schlaksigen Jungen heraus. Parvus war ein stummer Waisenjunge, den Macro und Petronella letztes Jahr bei ihrer Ankunft im Hafen von Londinium bei sich aufgenommen hatten. Die vier Erwachsenen sahen den beiden Burschen nach, die über den Hof rannten und in dem Durchgang verschwanden, der zur Vorderseite des Hauses führte. Macro lachte. »Ich glaube, da werden heute ein paar Jungs mit blauen Flecken nach Hause gehen.«
Cato nickte und lächelte schwach, ehe er sich an Claudia wandte. »Ich halte es für nicht so klug, gewisse Dinge vor Lucius anzusprechen. Er ist ein guter Junge, aber Kinder plappern nun mal gern aus, was sie hören.«
»Ich weiß. Tut mir leid.« Sie faltete die Hände. »Aber du weißt genauso gut wie ich, dass die Zukunft der Provinz völlig unsicher ist. Das habe ich Nero mehrmals sagen hören, als ich noch im Palast gewohnt habe. Er hasst die Insel. Sie kostet ihn viel Geld, das er lieber für öffentliche Spektakel ausgeben würde, um die Einwohner Roms bei Laune zu halten. Es dauert viel länger als erwartet, die Stämme zu unterwerfen, die die römische Herrschaft nicht anerkennen wollen. Jahr für Jahr benötigen die Legionen und Hilfskohorten frische Rekruten, um die erlittenen Verluste auszugleichen.« Sie zuckte mit den Schultern und schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wie lange er das noch akzeptiert.«
»Es wäre dumm von ihm, aus Britannien abzuziehen«, brummte Macro. »Wir haben für diese Provinz mit unserem Blut bezahlt. Zumindest wir Soldaten. Wenn Nero das alles wegwirft, werden viele hier in den Legionen und in der Kolonie finden, dass es Zeit ist für einen neuen Kaiser. Ausgerechnet jetzt, wo die Arbeit fast getan ist. Die Stämme im Tiefland sind keine Bedrohung mehr. Die sind längst besiegt und entwaffnet und haben Verträge mit Rom geschlossen. Die Briganten im Norden haben wir ebenfalls unter Kontrolle. Die Einzigen, die noch Widerstand leisten, haben sich in den Bergen im Westen verschanzt. Der neue Statthalter hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er mit ihnen aufräumen wird. Habe ich nicht recht, Cato?«
Der jüngere Mann nickte. »Das meldet jedenfalls unser Freund Apollonius aus Londinium. Suetonius zieht seine Truppen in Deva zusammen, um in den Bergen zuzuschlagen. Es wird nicht einfach. Macro und ich waren beim letzten Versuch dabei. Es ist nicht gut für uns ausgegangen.«
»Weil wir den Feldzug viel zu spät im Jahr begonnen haben«, wandte Macro ein. »Wäre uns das Wetter nicht in die Quere gekommen, hätten wir die Bastarde in den Bergen plattgemacht. Wir hätten auch die Insel Mona eingenommen und den Druiden ein für alle Mal das Handwerk gelegt.«
»Haben wir aber nicht«, entgegnete Cato. »Und jetzt, da sie uns schon einmal geschlagen haben, werden sie noch schwerer zu unterwerfen sein. Wenn es jemandem gelingt, dann Suetonius. Er hat Erfahrung mit der Kriegführung in gebirgigem Gelände. Vor einigen Jahren hat er in Mauretania hervorragende Arbeit geleistet. Wahrscheinlich haben sie ihn deswegen für diese Aufgabe gewählt.«
»Oder er hat sich freiwillig dafür gemeldet«, meinte Macro grinsend. »Um noch einen ruhmreichen Sieg zu erringen, bevor er sich zur Ruhe setzt. Du weißt ja, wie diese Aristokraten sind. Ein ruhmsüchtiges Pack; jeder will die Taten seiner Ahnen und seiner politischen Rivalen übertreffen.«
»Wird dieser Suetonius dafür auch die Reservisten einziehen?«, wollte Petronella wissen.
Macro nahm ihre Hand und drückte sie zärtlich. »Das glaube ich nicht. Wir sind zu wenige hier, als dass er auf uns angewiesen wäre. Außerdem werden wir hier gebraucht. Der Statthalter weiß, dass seine Veteranen in der Kolonie die hiesigen Stämme abschrecken. Wenn wir nicht mehr da wären, kämen sie vielleicht auf dumme Gedanken.«
Claudia lächelte verschlagen. »Hast du nicht gesagt, die Stämme im Tiefland wären keine Bedrohung mehr?«
»Sind sie auch nicht«, bekräftigte Macro. »Die Trinovanten hier in der Gegend sind lammfromm.«
»Kein Wunder«, meinte sie. »Angeblich wurden sie von den Veteranen der Kolonie ziemlich rüde behandelt. Man hat ihnen ihr Land weggenommen und einen Teil ihrer Männer zum Dienst in den Hilfskohorten gezwungen. Zudem wurden viele ihrer Frauen vergewaltigt.«
»So etwas passiert am Anfang immer«, erwiderte Macro. »Die Burschen in der Kolonie waren ihr Leben lang Soldaten. Es dauert ein paar Jahre, bis sie lernen, wie man sich als Zivilist benimmt.«
»Und bis dahin müssen die Stämme ihre Brutalität ertragen?«
»So ist es nun einmal«, sagte Macro. »Wir haben die Insel erobert, so wie wir die Länder bis zu den Wüsten im Osten erobert haben. Wenn sie sich erst einmal mit ihrem Schicksal abgefunden haben, werden sie erkennen, dass es auch seine Vorteile hat, zum Römischen Reich zu gehören.«
»Ich weiß nicht.« Claudia wandte sich fragend an Cato. »Was meinst du?«
Cato nahm sich einen Augenblick, um seine Gedanken zu sammeln. Er war nicht so überzeugt wie Macro, dass dieser Teil der Provinz wirklich so sicher und friedlich war. Die Ernte war in diesem Jahr schlecht ausgefallen, doch Rom würde das nicht berücksichtigen, wenn die Steuereintreiber die Stämme mit ihren Forderungen konfrontierten. Hunger und Armut schürten die Unzufriedenheit. Auch wenn die Trinovanten einen friedlichen Eindruck machten, war es schwer vorstellbar, dass das Leid und die Schmach, die ihre römischen Herren ihnen zugefügt hatten, nicht Hass und Bitterkeit hervorriefen, auch wenn sie es sich nicht anmerken ließen. Wenn Statthalter Suetonius und seine Legionen einen Feldzug am anderen Ende der Insel unternahmen, konnte es durchaus sein, dass die Heißblütigeren unter den Stammesleuten die Gelegenheit beim Schopf packen wollten. Macro und die Veteranen der Kolonie waren kampferprobt genug, um mit einem kleineren Aufstand fertigzuwerden, aber wenn alle Stämme aus der Gegend sich vereinigten, würden sie eine echte Gefahr für die römischen Bewohner von Camulodunum darstellen.
Cato überlegte noch einen Augenblick, ehe er Claudias Frage beantwortete. »Solange es Legionen in Britannien gibt, glaube ich nicht, dass wir in dieser Gegend ernste Schwierigkeiten bekommen werden. Die Icener haben erlebt, welche Konsequenzen es hat, sich Rom zu widersetzen. Sie werden es so schnell nicht wieder versuchen. Bei den Trinovanten bin ich mir nicht sicher. Ernsthafte Sorgen würde ich mir aber erst machen, wenn Nero die Legionen wirklich abzieht. Bis heute haben sich Zehntausende Römer und andere Landsleute hier niedergelassen. Die wären leichte Beute für angreifende Stämme. Dann stehen die Leute vor der Entscheidung, entweder hierzubleiben und zu versuchen, ihren Besitz zu verteidigen, oder ihre Häuser und alles andere zurückzulassen und übers Meer nach Gallien zu fliehen.«
Claudia wandte sich an Macro und Petronella. »Was werdet ihr tun, falls Nero die Legionen abzieht?«
Macro sah seine Frau an, doch sie wollte seinen Blick nicht erwidern. »Ich will das alles hier nicht aufgeben. Wir haben nicht nur das Haus und den Bauernhof hier, sondern auch die Hälfte des Gasthauses, das meine Mutter in Londinium führt. Ich weiß nicht, was dann wird. Ich kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt.«
»Darauf trinken wir«, bekräftigte Cato, um seinen Freund zu beruhigen. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nero Britannien wirklich aufgibt. Es wäre ein schwerer Schlag für den Ruf Roms in der Welt. Ihr könnt euch vorstellen, wie das Volk darauf reagieren würde, ganz zu schweigen von den Senatoren, die große Reden von der Unbesiegbarkeit Roms schwingen.«
»Siehst du?« Macro stupste Petronella mit dem Ellbogen an. »Der Junge bringt es auf den Punkt.«
»Es gibt noch einen Grund, warum Nero die Legionen kaum aus Britannien abziehen wird«, fuhr Cato fort. »Wenn er sie nach Gallien verschiebt, hätte der dortige Statthalter plötzlich viel mehr Soldaten unter sich. Wer über eine starke Armee verfügt, könnte auf die Idee kommen, sie für politische Zwecke einzusetzen. Also ist es allemal sicherer, die Legionen hier in Britannien zu lassen.«
»Du denkst nicht allzu gut von deinen Zeitgenossen«, meinte Macro. »Traust ihnen die schlimmsten Dinge zu.«
»Ich bin Realist«, betonte Cato achselzuckend. »Wir haben beide genug von der Welt gesehen, um zu wissen, wie es im Reich zugeht. Du weißt, dass ich recht habe.«
Macro griff nach seinem Becher. »Dieses Gerede über Politik macht mich durstig.« Er hob den Krug auf, doch als er sich einschenken wollte, rann nur ein dünner Strahl in seinen Becher. »Mist … ich hole Nachschub aus der Küche.«
Als er von seinem Hocker aufstand, drehte sich Petronella zur Küche, aus der sie auffällige Geräusche hörte. »Was ist denn da drin los?«
Macro runzelte die Stirn. Aus dem Haus drangen aufgeregte Stimmen in den Innenhof. »Ich sehe mal nach.«
Er trottete mit dem Krug in der Hand zur Tür und verschwand im Haus. Die anderen lauschten, während der Wortwechsel immer lauter wurde, bis er verstummte, als der Centurio energisch Ruhe einforderte.
»Klingt nach Streit unter den Bediensteten«, meinte Claudia.
Petronella schüttelte den Kopf. »Die kommen gut miteinander aus. Wir haben zwei icenische Mädchen, und der Stallbursche ist aus der Gegend. Ich habe noch nie ein lautes Wort zwischen ihnen gehört. Wir werden gleich wissen, was da los ist, wenn Macro zurückkommt.« Während sie auf ihn warteten, wechselte Petronella das Thema. »Bald sind die Saturnalien. Werdet ihr dann noch da sein? Ihr seid jedenfalls herzlich willkommen.«
»Wir bleiben noch eine Weile«, bestätigte Cato. Er hatte eine bescheidene Villa in Südlage gemietet, sodass sie jedes bisschen Sonne genießen konnten, das dieser Provinz beschieden war. Hier lebten er und Claudia ruhig und beschaulich und kümmerten sich gemeinsam um Lucius. Für die Ausbildung des Jungen sorgte ein Mann, der von sich behauptete, ein griechischer Gelehrter zu sein, der aus Gallien gekommen war, um eine kleine Schule zu leiten. Er sprach mit einem Akzent, den Cato noch nie bei einem Griechen gehört hatte, doch er war ein fähiger Mann, der Lucius Lesen und Schreiben sowie den grundlegenden Umgang mit Zahlen beibrachte. Eine vertiefende Ausbildung würde der Junge dann in Rom erhalten, sobald Cato die Rückkehr in die Hauptstadt als sicher erachtete.
Sie hatten vereinbart, dass Apollonius sie warnen würde, falls er mitbekam, dass die Kunde von Claudias Anwesenheit nach Londinium gelangte. Bevor er Cato begegnet war, hatte der griechische Freigelassene als Spion für Rom gearbeitet. Die beiden Männer schätzten und respektierten einander. Macro hatte den Griechen nie besonders leiden können und begegnete ihm mit einem gewissen Misstrauen, doch Apollonius hatte Catos Vertrauen gewonnen und einen überaus nützlichen Posten im Palast des Statthalters gefunden.
»Hier ist es ruhig und abgeschieden«, fuhr Cato fort. »Genau das Richtige für uns.«
»Wir verbringen die Saturnalien gern bei euch«, sagte Claudia lächelnd. »Du musst mir sagen, was wir zum Fest beitragen können.«
Das Geräusch von Schritten auf dem Kies unterbrach ihr Gespräch, und alle drehten sich zu Macro um. Der Centurio sah besorgt drein und hatte auch keinen vollen Weinkrug mitgebracht.
»Was ist passiert?«, fragte Cato.
»Schlechte Neuigkeiten.« Macro setzte sich auf seinen Hocker. »Morgatha ist eben vom Markt zurückgekommen. Sie ist einem icenischen Fellhändler begegnet, der aus der Hauptstadt des Stammes kommt. Prasutagus ist gestorben.«
Cato schüttelte betrübt den Kopf. Er und Macro hatten den icenischen König gut gekannt. Sie hatten kurz nach der Invasion an seiner Seite gekämpft, als die Icener sich als zuverlässige Verbündete Roms erwiesen hatten. Auch seine Königin Boudica betrachteten sie als gute Freundin. Als sie sich vor nicht ganz einem Jahr zum letzten Mal begegnet waren, war Prasutagus bereits von der Krankheit gezeichnet gewesen und nur noch ein Schatten des mächtigen Kriegers, der er gewesen war.
»Das ist nicht alles«, fuhr Macro fort. »Angeblich hat er in seinem Testament Boudica und Nero als Erben eingesetzt. Ich fürchte, das wird für die Icener nicht gut ausgehen.«
»Warum?«, fragte Claudia.
»Nero scheint mir nicht der Mann zu sein, der sich mit der Hälfte zufriedengibt, wenn er alles haben kann.«
»Aber für die Provinz ist es doch eine gute Nachricht. Es wird Neros Interesse an Britannien stärken. Umso mehr Grund für ihn, die Legionen hierzulassen.«
»Oder er beschließt, das icenische Königreich zu plündern und sich dann von der Insel zurückzuziehen.«
Claudia wandte sich an Cato. »Was meinst du?«
»Ich bin mir nicht sicher, was es zu bedeuten hat«, räumte Cato ein. »Es wird eine Weile dauern, bis die Nachricht vom Tod des Königs nach Rom gelangt und bis Nero sich überlegt hat, wie er vorgehen soll. Bei günstigem Wetter wird Suetonius die Entscheidung des Kaisers Anfang nächsten Jahres erhalten. Zu dieser Zeit werden die Icener und die anderen Stämme ihren Treueeid gegenüber dem Kaiser und Rom erneuern. Dann werden sie vielleicht schon erfahren, was Nero vorhat.«
»Und was glaubst du, wie er sich entscheidet?«, hakte Claudia nach.
»Ich sehe es so wie Macro. Der Kaiser wird alles wollen, auch wenn in Prasutagus’ Testament etwas anderes steht. Das wäre schlecht für den Frieden im Land. Wir kennen die Icener.« Er nickte Macro zu. »Sie sind ein stolzes Volk und hängen sehr an ihren Traditionen. Hervorragende Krieger. Es war ein Glück für uns, sie als Verbündete zu gewinnen. Ebenso, dass sich nur eine kleine Gruppe von ihnen gegen Rom erhob, als Scapula noch Statthalter war. Wenn Nero nicht aufpasst, wird er einen Riesenaufstand provozieren. Die Icener werden wie die Löwen kämpfen, um ihr Land zu verteidigen. Ich fürchte, dann wird es ein Blutbad geben.«
KAPITEL 2
Sie hatten ihre Beute den ganzen Vormittag verfolgt. Die Mittagssonne stand tief am grauen Himmel, der Horizont war von Schneegestöber getrübt. Nicht weit von Macro und Cato entfernt erkundete ein trinovantischer Jäger mit einem Fellumhang über der braunen Tunika und den Beinlingen das Gelände. Cato hielt die Zügel seines Pferdes, während sie beobachteten, wie der Jäger sich duckte und eine Lücke im Gebüsch begutachtete. Im Schnee waren verschiedene Tierspuren zu sehen, sodass es nicht einfach war, sie auseinanderzuhalten und zu erkennen, von welchem Tier sie stammten.
»Vielleicht haben wir ihn verloren«, murmelte Macro, legte den dicken Schaft des Jagdspeers auf die Sattelhörner und langte nach seiner Feldflasche. Er zog den Pfropfen heraus, nahm einen Schluck und bot die Flasche Cato an.
Catos Blick war auf den Jäger fixiert, der die Spuren im Schnee zu lesen versuchte. Er nahm einen Schluck, gab die Feldflasche zurück und nahm den Speer in die freie Hand. »Ich weiß nicht. Pernocatus scheint etwas entdeckt zu haben.«
Der Jäger fuhr mit den Fingern über den Schnee, dann über den dunklen Zweig eines Ginsterbuschs und betrachtete seine Fingerspitze. Er drehte sich zu seinen römischen Begleitern um und hielt die Hand hoch, damit sie den roten Fleck sehen konnten.
»Blut. Der Keiler ist hier vorbeigekommen«, verkündete er in kehligem Latein.
Pernocatus stellte seine Fähigkeiten schon seit der Gründung der Veteranenkolonie in den Dienst römischer Jäger und hatte sich deren Sprache so weit angeeignet, dass er sie flüssig sprechen konnte. Die Veteranen schätzten ihn als Fährtenleser, und wenn es darum ging, das Beutetier zu erlegen, ging er so geschickt mit Speer und Bogen um wie ein Bestiarius in einer römischen Arena.
Der drei Mann starke Jagdtrupp hatte das Wildschwein bei Tagesanbruch aufgespürt, aber nicht schnell genug zu den Speeren greifen können, sodass das aufgeschreckte Tier zwischen ihnen hindurchgestürmt und im Wald verschwunden war. Cato hatte den Keiler mit einem Speerstoß an der Schulter verletzen können, sodass er Blut verlor und ihnen eine Spur hinterließ. Die Blutflecken waren nach und nach seltener geworden, als das Blut in der Wunde gerann, und sie hatten die Jagd fast schon aufgegeben, als sie erneut ein paar Tropfen im Schnee entdeckten, nahe dem Pfad, der zu den Ginsterbüschen führte. Cato ärgerte sich über sich selbst. Nur ein schlechter Jäger verletzte sein Beutetier und ließ es entkommen, sodass es unnötig leiden musste. Er war es dem Tier schuldig, es zu finden und die Jagd zu Ende zu bringen.
Macro deutete auf das Dickicht vor ihnen. »Falls der Bastard da drin ist, kommen wir nicht an ihn heran.«
Cato schaute sich um. Die Ginsterbüsche erstreckten sich über fünfzig Schritte in beide Richtungen und reichten bis zu einem Kiefernwäldchen. Der Pfad, der durch das Gebüsch führte, war zu schmal, um durchzureiten. Und wenn sie es zu Fuß versuchten, würden sie mit dem Umhang an den dichten Zweigen hängen bleiben. Wenn der Keiler in diesem Moment angriff, würden sie ihm kaum ausweichen können. Es gab jedoch einen Trick, mit dem sie versuchen konnten, das Tier zu reizen.
»Pernocatus, du bleibst hier. Der Centurio und ich reiten um das Gebüsch herum; vielleicht finden wir die Stelle auf der anderen Seite, wo der Pfad herausführt. Dann gebe ich dir ein Signal, und du bläst kräftig in dein Horn und machst so viel Lärm wie möglich. Falls der Keiler davonläuft, erwarten wir ihn.«
Der Jäger legte skeptisch den Kopf schief, nickte aber. »Wie der Präfekt befiehlt.«
Er sagte es in einem seltsam unterwürfigen Ton, der für ihn untypisch war. Cato fürchtete, dass er den Mann mit seinem brüsken Befehl beleidigt hatte. Manchmal vergaß er, dass im zivilen Leben ein anderer Ton angemessen war als auf dem Schlachtfeld.
»Gut, versuchen wir’s«, meinte Macro und nahm seinen Speer zur Hand. »Bevor der Bursche Angst kriegt und sich verkrümelt.« Er ließ sein Pferd lostraben und ritt um das Gebüsch herum. Cato reichte Pernocatus mit einem Kopfnicken die Zügel dessen Pferdes, die er gehalten hatte, und ritt seinem Freund hinterher.
Wie er gedacht hatte, war das Gebüsch nicht allzu breit; das andere Ende war durch eine Schneise vom Waldrand getrennt. Sie fanden ohne Mühe die Stelle, wo der Pfad aus dem Gebüsch herausführte. Cato beugte sich aus dem Sattel, konnte aber keine Blutspuren erkennen.
»Er ist noch drin.«
Die beiden Römer hielten im dichten Unterholz nach einer Bewegung Ausschau und lauschten nach irgendeinem Geräusch, das den Keiler verraten mochte, doch es blieb still. Cato hielt seinen Speer bereit, und Macro tat es ihm gleich, als sie zu beiden Seiten des Pfades in Stellung gingen.
»Bereit?«, fragte Cato.
Macro nickte.
»Pernocatus!«, rief Cato. »Fang an!«
Der schrille Ton des Jagdhorns zerriss die kalte Luft und schreckte ein paar Vögel auf, die mit schrillem Gezwitscher aus dem Gebüsch aufflogen und sich in den Kiefernwald flüchteten. Nach einigen weiteren Horntönen stieß der Jäger laute Rufe aus. Dann hörten sie es – ein Schnauben und durchdringendes Quieken irgendwo zwischen ihnen und Pernocatus. Im nächsten Augenblick das Rascheln und Knacken von trockenen Sträuchern, als das Wildschwein auf dem Pfad heranstürmte.
»Da kommt er!«, rief Macro mit weit aufgerissenen Augen und senkte die breite Eisenspitze seines Speers, um jederzeit zustoßen zu können. Auch Cato hielt seinen Speer bereit, während er mit der anderen Hand die Zügel hielt und die Schenkel an den Sattel drückte.
Der Keiler brach aus dem Dickicht hervor, und beide Männer ritten auf ihn zu. Es war ein riesiges Tier mit dunklen Borsten entlang des Rückens bis hinauf zum breiten Kopf mit den gebogenen Hauern. Macro reagierte als Erster, beugte sich vor und stieß dem Wildschwein den Speer in die Flanke. Das Tier stieß einen Schmerzensschrei aus, strebte von Macros Speerhand weg und stieß gegen die Hinterbeine des Ponys. Macro verlor das Gleichgewicht, ließ den Speer los und hielt sich an den Sattelhörnern fest, um nicht abgeworfen zu werden. Sein Pony taumelte zwischen dem wütenden Keiler und Cato, sodass dieser seinen Speer nicht einsetzen konnte.
»Mist, verdammter!«, zischte Cato mit zusammengebissenen Zähnen, zog die Zügel an und versuchte sein Pferd herumzureißen, um an den Keiler heranzukommen. Dieser machte jedoch kehrt, verschwand im Gestrüpp und stürmte den Pfad entlang auf Pernocatus zu. Augenblicklich war Cato klar, welche Gefahr auf den Mann zukam, und er drehte sich rasch zu Macro. »Nimm deinen Speer und komm mit!«
Ohne auf eine Antwort zu warten, trieb er sein Pony in den Galopp und ritt am Rand der Büsche entlang, während das Blut in seinen Ohren pochte. Die Jagd war immer mit einem gewissen Risiko verbunden, besonders wenn man es mit einem so gefährlichen Beutetier wie einem wilden Keiler zu tun hatte. Deshalb nahmen es die Allerwenigsten allein mit einem solchen Tier auf. Während er am dornigen Gestrüpp entlangpreschte, hörte er Pernocatus einen überraschten Ruf ausstoßen.
»Er ist hier!«
Cato ritt an ein paar Büschen vorbei und erblickte den Jäger etwa hundert Schritte entfernt. Mit dem Dolch in der Hand stand er dem riesigen Keiler gegenüber, der vor Anstrengung keuchend zwischen Pernocatus und dessen Pferd stehen blieb. Cato trieb sein Pferd an, doch der Keiler ging bereits zum Angriff über und wirbelte den Schnee auf, als er auf Pernocatus zustürmte. Das Pony des Jägers bäumte sich auf und wandte sich zur Flucht. Tief geduckt wartete Pernocatus ab, wich im letzten Moment zur Seite aus und stieß mit seinem Dolch auf das vorbeistürmende Tier ein. Trotz seiner Größe – der Keiler war mehr als anderthalb Meter lang und reichte dem Mann bis zur Taille – war das Tier erstaunlich flink, kam schlitternd zum Stehen und wirbelte herum, um aufs Neue anzugreifen.
Cato umklammerte den Speer noch fester, doch im nächsten Augenblick stolperte sein Pferd. Der Himmel und die weiße Winterlandschaft begannen sich um ihn herum zu drehen, als Mann und Pferd im Schnee landeten. Der Aufprall presste ihm die Luft aus der Lunge, er ließ den Speer los und rollte sich zur Seite ab.
Als er keuchend aufsprang, sah Cato, dass Pernocatus den Dolch hatte fallen lassen und den Keiler an den Hauern gepackt hatte. Verzweifelt rang er mit dem Tier, um zu verhindern, dass er aufgespießt wurde. Doch es war ein ungleicher Kampf. Der Keiler warf sich energisch hin und her, um den Jäger abzuschütteln. Cato blickte sich im wadentiefen Schnee um, konnte seinen Speer jedoch nirgends finden.
In diesem Augenblick hörte er das Schnauben von Macros Pony, als der Centurio an ihm vorbeipreschte und sich vorbeugte, um mit dem Speer zuzustoßen. Mit einem wütenden Ruck schleuderte der Keiler den Jäger von sich weg. Pernocatus flog durch die Luft und landete drei Meter entfernt im Schnee. Das wütende Tier schwenkte den Kopf hin und her, erblickte seine Beute und stürmte mit gesenkten Hauern los, während Pernocatus auf allen vieren zu entkommen versuchte.
»Nein, lass das!«, brüllte Macro. Seine donnernde Stimme und die plötzliche Bewegung am Rande seines Sichtfelds ließen das Wildschwein zögern und sich der neuen Bedrohung zuwenden. Für einen Moment war die Flanke des Keilers ungeschützt; Macro beugte sich vor, zog die Zügel an, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und rammte dem Tier die breite Speerspitze in die Schulter. Der wuchtige Stoß riss das Wildschwein von den Beinen – es landete seitlich im Schnee, und Macro musste den Speer loslassen. Verzweifelt wand sich der Keiler, und sein Blut rann in den Schnee.
Macro schwang sich vom Pferd, sprang vor, packte den Speer mit beiden Händen und setzte sein ganzes Gewicht ein, um das schnaubende, quiekende Tier zu Boden zu drücken. Pernocatus war aufgesprungen, eilte mit dem Dolch in der Hand herbei und versuchte, dem Tier die Kehle durchzuschneiden. Cato war ebenfalls wieder auf den Beinen, fand seinen Speer im Schnee und schnappte ihn sich, um seinen Freunden zu Hilfe zu eilen.
Als er hinkam, war es schon vorbei. Der Keiler schlug noch einmal mit den Beinen aus, ehe er mit einem letzten Zucken zusammensackte, während das Blut aus seinen Wunden pulsierte. Er tat noch zwei, drei Atemzüge, ehe er erschlaffte und im blutigen Schnee liegen blieb. Macro hielt den Speer noch einen Augenblick fest und drückte mit seinem ganzen Gewicht zu. Pernocatus stand auf der anderen Seite des Keilers, den blutverschmierten Dolch in der Hand. Cato verfolgte besorgt das Geschehen, bis er feststellte, dass beide Männer unverletzt waren. Alle drei atmeten schwer.
Als Macro sich sicher war, dass das Tier tot war, zog er den Speer aus der Wunde und schüttelte den Kopf. »Scheiße, das war knapp.« Er atmete tief durch und lachte aufgewühlt, aber erleichtert. Seine Begleiter stimmten mit ein, ehe sie sich dem toten Tier zuwandten.
»Ein prächtiger Bursche«, meinte Cato. »Das größte Wildschwein, das ich je gesehen habe.« Er sah zu dem Jäger. »Wir haben noch mal Glück gehabt.«
Pernocatus zögerte einen Augenblick, dann trat er vor und streckte Macro den Arm entgegen. »Du hast mich gerettet, Centurio.«
Sie fassten einander an den Unterarmen, und Macro blies die Backen auf. »Ich hatte einfach Glück, mein Freund. Einen Augenblick später, und …« Er strich mit dem Finger quer über seinen Hals.
Der Jäger verzog das Gesicht, sah ihm in die Augen und beugte den Kopf. »Ich verdanke dir mein Leben …«
»Ich war einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das ist alles«, erwiderte Macro grinsend. »Du hättest umgekehrt das Gleiche getan.«