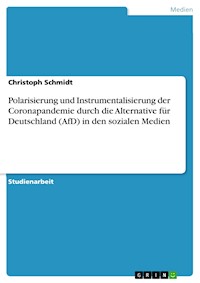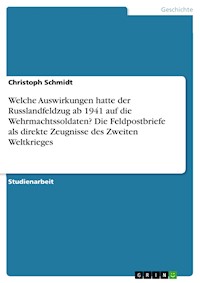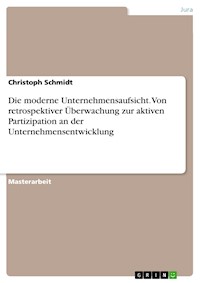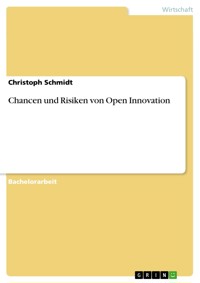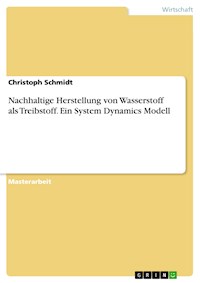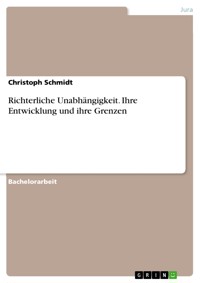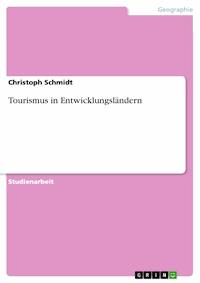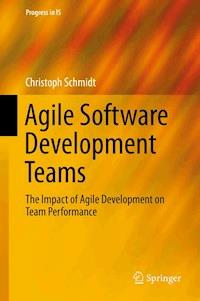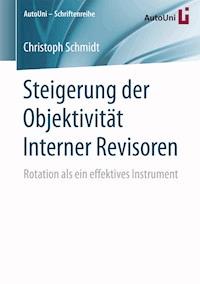Unterwegs mit Christoph SchmidtOrientiert in RegensburgStadt und StadtviertelSightseeing-HighlightsEssen und AusgehenWege durch RegensburgTour 1: Zu Herzogshof und RömertorTour 2: Verschlungene Wege zum DomTour 3: Vom Dom zur DonauTour 4: Von der Steinernen Brücke zum BismarckplatzTour 5: Im ruhigen WestenUnbekanntes RegensburgAusflugsziele im OstenAusflugsziele im SüdwestenNachlesen & NachschlagenGeschichteRegensburg kulinarischKultur- und NachtlebenVeranstaltungenEinkaufenRegensburg mit KindernRegensburg (fast) umsonstÜbernachtenRegensburg in StichwortenRegensburg kompaktAlle MuseenAlle RestaurantsAlle Shopping-AdressenÜber dieses BuchÜbersichtskarten und PläneIndex
Die Parks um die AltstadtAufbruch in neue ZeitenJüdisches Leben in RegensburgStraßennamenDie DomspatzenDer Immerwährende Reichstag (1663–1803)Emanuel Joseph d’Herigoyen (1746–1817)Die Steinerne Brücke – fast 900 Jahre GeschichteHerausragend: die GeschlechtertürmeAlbertus Magnus: Universalgelehrter, Kirchenlehrer, Heiliger (und Frauenverächter?)Familie von Thurn und TaxisSchotten oder doch Iren?Gemeinnützige Krankentransporte in den TodBaierwein: dem König schmeckt’s nichtWandern und/oder per Schiff: Befreiungshalle und Kloster Weltenburg im DoppelpackDie Kaufleute, die neue MachtKarl Theodor von Dalberg(1744–1817)Die Regensburger Praline und eine andere Köstlichkeit
Tour 1: Zu Herzogshof und RömertorTour 2: Verschlungene Wege zum DomTour 3: Vom Dom zur DonauTour 4: Von der Steinernen Brücke zum BismarckplatzTour 5: Im ruhigen WestenAusflugsziele im OstenAusflugsziele im SüdwestenÜbernachten in RegensburgZeichenerklärungRegensburg Übersicht
Tour 1: Zu Herzogshof und RömertorKern der Tour sind der Alte Kornmarkt mit seinen prachtvollen Gebäuden wie Herzoghof und Alte Kapelle und das Nordtor des Römerlagers Castra Regina, dem die Stadt ihre Existenz verdankt. Tour 2: Verschlungene Wege zum DomZiel ist der Dom St. Peter, doch bevor man dort ist, passiert man u. a. die erste evangelischen Pfarrkirche der Stadt und das Jüdisches Gemeindezentrum. Als Ausgleich zur „schweren Kultur“ lockt das bunte Treiben in der Oberen Bachgasse. Tour 3: Vom Dom zur DonauWir kommen zum Fluss und damit zur berühmten Steinernen Brücke, die sich seit Jahrhunderten über die Donau spannt – was kann schöner sein? Am anderen Ufer Stadtamhof, eine Welt für sich.Tour 4: Von der Steinernen Brücke zum BismarckplatzArchitektonische Hingucker dieser Tour sind die Stadtpaläste mit ihren hoch in den Himmel ragenden Geschlechtertürmen: Statussymbole der mittelalterlichen Patrizierfamilien.Tour 5: Im ruhigen WestenDurch mittelalterliche Gassen geht’s erneut zur Donau mit einer ihrer Stadtinselchen. Danach wird’s grün: im ruhigen Herzogpark und im weitläufigen Stadtpark. Und zum krönenden Schluss: das berühmte Schottentor.
Sightseeing-Highlights
Das wahre Highlight? Die Altstadt als Gesamtensemble - mittelalterlich und lebendig zugleich. Aber bei fast 1000 denkmalgeschützten Bauwerken muss man doch ein bisschen auswählen: Versuch einer Entscheidungshilfe.
Bestens gerüstet!
Die Atmosphäre der Stadt muss man erlaufen, um sie zu spüren. Denken Sie an bequeme Schuhe, das Pflaster hat es in sich! Pause machen kann man aber immer: in einem der vielen Cafés und an so mach schönem Plätzchen zwischendrin.
Und für Fotografen: tolle Motive, schwierige Verhältnisse! Zoom und Weitwinkel nicht vergessen.
Die Wahrzeichen der Stadt
♦ Dom Sankt Peter: Klein im Vergleich zu anderen, aber ein Schmuckstück. Die einzige gotische Kathedrale östlich des Rheins, im Mittelalter vollendet. Allein die Glasfenster sind einen Besuch wert
♦ Steinerne Brücke: Eine der ältesten erhaltenen Steinbrücken, ein Wunderwerk ihrer Zeit. Die Aussicht auf Donau und Stadt ist fantastisch.
♦ St. Emmeram: 1000 Jahre Geschichte und das größte bewohnte Schloss Europas. Fürstliche Repräsentation vom 18. bis 21. Jh.
♦ Altes Rathaus: Der Stolz der Bürgerstadt beeindruckt mit seiner Architektur, besonders mit dem Reichssaal, Tagungsort des Immerwährenden Reichstags.
♦ Geschlechtertürme: Einmalige Zeichen mittelalterlicher Bürgermacht. Die wichtigsten gibt es in einem Spaziergang.
Museen
♦ Haus der Bayerischen Geschichte: Auch wenn es nicht direkt mit der Stadt zu tun hat, ein Muss. Zumindest der Film: kurzweilige Einführung in die Geschichte der Stadt.
♦ Kunstforum Ostdeutsche Galerie: Der Ort für moderne Malerei schlechthin, vor allem aus Osteuropa.
Kirchen im Wandel der Stile
♦ Schottenkirche St. Jakob: Im Kern sind viele Kirchen romanisch, aber so pur wie hier bekommt man den Stil selten. Und das Schottenportal ist einzigartig.
♦ Dominikanerkirche St. Blasius: Neben dem Dom sind es die Kirchen der Bettel-orden, die die gotische Stadt prägen. St. Blasius beeindruckt mit seiner monumentalen Strenge und seiner Höhe.
♦ Dreieinigkeitskirche: Die frühbarocke Saalkirche war die erste evangelischen Predigtkirche in Bayern. Sie besticht durch die Höhe, Weite und Eleganz des Innenraums. Der Friedhof birgt Perlen barocker Grabkultur.
♦ Alte Kapelle: Eine der ältesten Kirchen der Stadt, aber seit dem 18. Jh. ein Rokoko-Rausch in Weiß und Gold. Hier wird der Triumph, die Herrlichkeit der (katholischen) Kirche gefeiert!
Regensburg von unten
2000 Jahre Geschichte sind begehbar: Im frei zugänglichen document Legionslagermauer steigt man zu den Römern hinab, im document Niedermünster zu den Anfängen der christlichen Stadt und im document Neupfarrplatz ins zerstörte jüdische Ghetto.
Der grüne Gürtel
♦ Fürst-Anselm-Allee: Das schönste Stück der Allee, die Fürst Anselm von Thurn und Taxis Ende des 18. Jh. angelegt hat, führt vom Bismarckplatz zum Milchschwammerl (Tour 1), an einem Stück der Stadtmauer entlang, vorbei an einem neuen und einem alten Tor und der Prunkfassade von Schloss Emmeram (Tour 5).
♦ Herzogspark: Der kleine Park ganz im Westen ist für mich der schönste. Das Gelände umfasst den Stadtgraben und eine Bastion. Mit den Resten eines Torturms und der Stadtmauer, schön ange-legten Gärten und Ausblicken auf die Donau ist der Park eine echte Oase der Entspannung.
Die Donau und die Inseln
♦ Bootstouren: Es muss keine Fahrt nach Weltenburg sein, aber eine Strudelfahrt, auf der man die Stadt, die Steinerne Brücke und den Fluss aus anderer Perspektive sieht. Und dann auch erfährt, was es mit den Strudeln auf sich hat ... → Regensburg in Stichworten
♦ Oberer Wöhrd: Egal, ob Sie auf dem Damm beim Eisernen Steg stehen, über den „Hammerbeschlächt“ (Tour 3) schlendern oder im Biergarten sitzen - Stadt und Fluss präsentieren sich immer von ihrer besten Seite
♦ Unterer Wöhrd und Jahninsel: Trumpf dieser beiden Inseln sind die nahezu endlosen Liegewiesen zur nördlichen Donau hin. → Tour 3
Stadtamhof
Wenn man aus dem engen Gassengewirr über die Steinerne Brücke geht, wird sofort klar, dass Stadtamhof mit seiner breiten, kerzengeraden Hauptstraße eine andere Welt war und ist. → Tour 3
Essen und Ausgehen
Bei der Frage, wie man den Abend verbringt, hat man in der Altstadt und in Stadtamhof die Qual der Wahl. Kinos und Bühnen, ob für Theater oder Musik, gibt es reichlich und die Zahl der Restaurants, Kneipen und Bars tendiert ins Unendliche.
Ausführliche Restaurantbeschreibungen befinden sich am Ende jeder Tour.
Eine Liste aller Restaurants bieten wir Ihnen ab Link.
Alle Kneipen und Klubs sowie Theater- und andere Bühnen finden Sie im Kapitel Kultur- und Nachtleben ab Link.
Regensburg kulinarisch
Natürlich findet man in Regensburg alles, was man mit bayerischer Küche verbindet. Wer aus ferneren Teilen des Landes oder aus dem Ausland kommt und genau das erwartet, wird nicht enttäuscht, keine Sorge.
Aber das ist eben nicht alles: Drei Restaurants mit einem Michelin-Stern gibt es, darunter das deutschlandweit wahrscheinlich beste Sushi-Restaurant. Außerdem moderne Fusions- und klassische französische Küche, „Italiener“ sowieso, aber auch der Rest der Welt ist gut vertreten, durch alle Preisstufen. Es gibt fast keine Geschmacksrichtung, die es nicht gibt - na ja, Fischlokale vielleicht. Aber eine Austernbar gibt es, im Dezember im „Orphée“.
Anhänger der süßen Fraktion werden auf alle Fälle verwöhnt. Fündig wird man eher im Zentrum und in Stadtamhof, das Café Pernsteiner nahe dem Ostentor, also am östlichen Rand der Altstadt, ist da eine Ausnahme.
5 Einkehrtipps
♦ Roter Hahn: Maximilian Schmidt leitet die Küche des Familienbetriebs, der 2021 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Serviert werden leichte, moderne Kreationen mit asiatischen und nordischen Einflüssen. Angenehme Atmosphäre und annehmbare Preise für ein Mittagsmenü empfehlen den Roten Hahn als Einstieg in die Sterneküche.
♦ Sticky Fingers: Anton Schmaus, der Sternekoch von „Storstad“ und „Aska“ (beide im Goliathhaus), kann auch eine Etage tiefer: Keine Sterne, deswegen bleiben auch die Preise unter Sterneniveau. Für die internationale Fusionsküche, die hier geboten wird, Küche gilt das nicht. Die bewegt sich auf Topniveau.
♦ Alte Linde: Ein Biergarten muss sein. Und bitte: Das ist kein Geheimtipp! Jeder findet ihn. Im Trubel der Hauptsaison sucht man sich vielleicht was Stilleres. Aber die Lage und die Aussicht sind einmalig, das Bier steht außer Zweifel, und gut essen kann man auch - im Winter drinnen.
♦ Meier. Ein Lokal: „Kennt jeder“, kann man nicht sagen, zumindest nicht außerhalb von Stadtamhof. Sollte man aber: Eine alte Schankstube, eine originelle, häufig wechselnde Speisekarte, regionale Zutaten. Da passt alles.
♦ Café Prinzess: Café-Tipps sind schwierig, sind doch alle so unterschiedlich. Ich entscheide mich für dieses und damit für die Lage und fürs klassische Kaffeehaus: bürgerlich, gediegen, hervorragende Torten, in bester Lage vis-à-vis dem Alten Rathaus. Vergleichbare Kategorie: das Café Goldenes Kreuz am Haidplatz.
Kultur- und Nachtleben
Regensburg ist nicht nur Standort von Zukunftstechnologien und mehreren Hochschulen, sondern auch Zentrum eines großen, überwiegend ländlichen Gebiets. Entsprechend breit gefächert ist das kulturelle Angebot, selbst ohne die regelmäßig stattfindenden Kulturevents. Es reicht vom klassischen Theater über experimentelle und Kleinkunstbühnen bis hin zu den Clubs und Techno-Höhlen, die sich am Wochenende füllen, wenn gefühlt das halbe Umland in die Stadt kommt. Auch die Kinos bieten ein Programm, das man so schnell sonst nicht findet.
Ein spürbarer Mangel an Kneipen und Bars, mit oder ohne Musik, besteht nicht. Und das Spektrum ist breit: Zwischen die „Apotheke“ und die „Barock Bar“ passen Welten.
5 Tipps für 5 Abende
♦ Theater Regensburg: Das Mehrspartenhaus hat an seinen verschiedenen Spielstätten viel zu bieten: Oper, Theater, Ballett. Von klassisch bis modern.
♦ Filmgalerie: Das Programmkino im Leeren Beutel ist alles außer Standard. Filmklassiker, Feministisches, Politisches und Internationales. Es lohnt sich, ins Programm zu schauen.
♦ Ka5per: Für heute ist genug? Den Tag voller Eindrücke mit einem feinen Cocktail in der Hand ausklingen lassen? Im passenden Ambiente? Hier zum Beispiel!
♦ Vinyl: Kleine Bar, gute Stimmung. Musik meist funkig, egal ob Platte oder vom PC. Am frühen Abend auf ein Schwätzchen und einen Drink, später steigt die Stimmung (und die Lautstärke).
♦ Alte Filmbühne: Wem das Vinyl noch zu still war und wer mehr Bewegung braucht, kann es hier versuchen. Auch ohne Livemusik ist hier zu später Stunde immer was los.
Wege durch Regensburg
Auf zu den Anfängen
Tour 1
Dieser Spaziergang führt zu den Wurzeln der Stadt, zu römischen Legionären und bajuwarischen Herzögen. Dabei geht es in den Untergrund und zu gut aufbereiteten Ausstellungen, die Einblicke in die Geschichte und Geschicke der Stadt geben. Und Sie erhaschen einen ersten Blick auf die Donau.
Alte Kapelle, eine der schönsten Rokokokirchen Bayerns
document Niedermünster, durch fünf Meter Stadtgeschichte
Haus der Bayerischen Geschichte, gelungene Selbstdarstellung
Prunk, Parks und Ruinen
Zu Herzogshof und Römertor
Regensburg versteckt seine baulichen Schätze hinter einem Parkgürtel, der die Altstadt umgibt und seit Ende des 18. Jh. sukzessive entstanden ist (Link). Einen kleinen Eindruck davon bekommt man bereits auf dieser Tour. Sie startet am Bahnhof, führt ein kurzes Stück durch die Maximilianstraße (ein nicht ganz so erfolgreiches Straßenprojekt des 19. Jh., Link) und macht dann einen kleinen Umweg durch den Regensburger Grüngürtel - Ziel bleibt aber die Altstadt.
Am dortigen Alten Kornmarkt, einst Machtzentrum der bayerischen Herzöge, warten die ersten Highlights der Tour: ein kurzer Blick auf den Dom, doch der muss warten bis Tour 2 - die Alte Kapelle und der Römerturm gehen zunächst vor. Unter dem Niedermünster geht es in die Vergangenheit, danach passiert man eines der zwei erhaltenen römischen Stadttore Deutschlands und folgt dem Lauf der römischen Stadtmauer. Zwei große Museen gehören auch zum Besichtigungsprogramm.
Endpunkt der Tour ist der Dachauplatz, der über der östlichen Römermauer gebaut wurde. Zu deren Besichtigung geht es dort in den Keller - in den Keller eines Parkhauses!
Spaziergang
Vom Bahnhof führt die Maximilianstraße bis tief in die Innenstadt. Der südliche Teil bis zum Parkhotel ist ein Verkehrsknotenpunkt und nicht der schönste Abschnitt. Hier ist der Parkstreifen, der sich um die Altstadt zieht, schon jetzt am stärksten zerschnitten. Aber es wird wohl noch einmal draufgesattelt: Seit 2021 bereitet die Stadt das Areal für die Anforderungen der kommenden Jahrzehnte vor. Ein Interims-ZOB liegt jetzt zwischen Maximilianstraße, Ernst-Reuter-Platz und Albertstraße, auf dem inzwischen verkehrsberuhigten Bahnhofsvorplatz soll 2024 mit dem Bau einer Tiefgarage begonnen werden. Die komplette Umgestaltung des Areals in eine Fußgängerzone wird noch Jahre dauern.
Der Weg durchs Regensburger Grün wird noch lange der verlockendere bleiben, und auch wir schlagen ihn ein: Es geht also nicht geradeaus in die Stadt, sondern vom Bahnhof aus wenige Schritte nach links in den Park. Dann noch über die Albertstraße, die den Park quert, und schon steht man vor der ersten kleinen Sehenswürdigkeit (jawohl, steht unter Denkmalschutz!), dem Milchschwammerl. Der Pilzkundige wird das putzige Häuschen sofort als Fliegenpilz identifizieren. Schwammerl heißt Pilz, so weit klar, wieso aber Milch? Der Kiosk ist einer der letzten Überlebenden einer „Trinkt-Milch“-Kampagne aus den 1950ern: 40 solcher Pilze einer Allgäuer Firma wurden in Bayern aufgestellt. Milch gibt es heute auch noch, aber mehr im Kaffee: Seit 2007 ist das Schwammerl ein Stehcafé, beliebter Treffpunkt für hastige Passanten und solche, die mehr Zeit haben (Mo-Sa 8-16 Uhr, So ab 10 Uhr).
Gegenüber dem „Schwammerl“ erhebt sich links zwischen zwei Brunnenbecken ein Obelisk: das Denkmal für den Stifter der Allee, ausgeführt 1805 vom Fürstlichen Baumeister Emanuel Joseph d’Herigoyen im Auftrag des Fürsten von Dalberg. Weiter gen Stadt erhebt sich rechts ein kleines Tempelchen: das Kepler-Denkmal.
Berühmter Sohn der Stadt
Kepler-Denkmal
Der Physiker Johannes Kepler wurde nach seinem Tod 1630 auf dem Petersfriedhof begraben. Doch schon drei Jahre später wurden im Dreißigjährigen Krieg Friedhof und Grabmal völlig zerstört. 1806 veranlasste Dalberg ein Monument und 1808 wurde der dorische Monopteros (Rundtempel) nach Plänen von Emanuel Joseph d’Herigoyen eingeweiht. Keplers Büste von Friedrich Döll hält sich eng an ein zeitgenössisches Bild des Physikers, das Original steht im Keplerhaus. 1809 hätte leicht das Ende des Denkmals bringen können, wurde doch das Umfeld stark zerstört (→ Geschichte), aber es überstand den Krieg an seinem Standort. Erst dem Fortschritt musste das Monument weichen: Als 1859 die Maximilianstraße, die ja auf das Monument ausgerichtet war, zum Bahnhof verlängert wurde, wanderte es nach Westen auf seinen heutigen Platz.
Essen & Trinken
4 Taverna Stefanos
Cafés
2 Cafés am Römerturm 7 Café/Konditorei Pernsteiner
Shopping
1 Carakess 8 Regensburg Arcaden
Letztlich ein Rätsel
Predigtsäule
Am Ende des Fußweges steht die etwa 8 m hohe Predigtsäule. Sie zeigt auf mehreren Etagen biblische Szenen und ist von einer Kreuzigungsszene gekrönt.Die Säule entstand wohl Ende des 13. Jh. im Zusammenhang mit Weih Sankt Peter, dem ersten Schottenkloster hier. Es gibt viele Geschichten über die Säule und über das Kloster, das Petrus persönlich (!) geweiht haben soll, aber was die Darstellungen eigentlich bedeuten (Jüngstes Gericht?), welche Funktion die Säule hatte und wo sie stand - dazu wird viel vermutet und gerätselt. Hier jedenfalls steht sie seit 1806, wie der Obelisk, das Kepler-Monument und andere Denkmäler der Allee als Dekoration. Ihr heutiges Erscheinungsbild ist das Ergebnis der letzten Restaurierung um 1856.
Regensburg im Kasten
Die Parks um die Altstadt
Der Ursprung der Parkanlagen ist die Fürst-Anselm-Allee. Karl Anselm von Thurn und Taxis, Generalerbpostmeister der Kaiserlichen Reichspost und Prinzipalkommissar des Kaisers beim Immerwährenden Reichstag, wollte als aufgeklärter Fürst der Stadt und ihren Bürgern Gutes tun (dass er auch seinen Nachruhm im Sinn hatte und das auch offen eingestand, macht ihn eher sympathisch). Er ließ in den Jahren 1779 bis 1781 auf eigene Kosten eine doppelte Baumreihe im Stil eines englischen Gartens anlegen, etwa 50 m vor der damals noch voll erhaltenen Stadtmauer. Sie führte vom Prebrunntor im Westen bis zum Ostentor, mit einer Lücke vor dem Peterstor im Süden. Dazu wurde das Gelände der längst verfallenen Vorwerke entlang der Stadtmauer eingeebnet und neugestaltet. Anfangs nur schmal, als Viehweide und als Platz zum Wäschetrocknen zweckentfremdet, wurde die Allee unter der Herrschaft des Fürsten Karl Theodor von Dalberg ab 1803 erweitert und ausgebaut, das große Gartengelände von St. Emmeram wurde zum botanischen Garten, die Lücke vor dem Peterstor wurde durch die Umwandlung der großen Bastion in einen Park geschlossen. Nach den Zerstörungen in den Napoleonischen Kriegen wurden die Alleen weiter ausgebaut und erweitert, entlang der Parks entstanden Villen reicher Bürger. Viele sind inzwischen verschwunden oder verändert.
Heute sind es von West nach Ost: der Herzogspark auf der westlichsten Bastion an der Donau, die Prebrunnallee, der Stadtpark (alle Tour 5), der Dörnbergpark, die Fürst-Anselm-Allee, die im Süden weite Strecken am leider nicht öffentlichen Park von Schloss Emmeram entlangführt (Touren 1 und 5), die Ostenallee und der Villapark.
Bayerisches Willkommensgeschenk
Durch die Maximilianstraße
Das nur wenige Schritte von der Predigtsäule entfernte Parkhotel Maximilian (Maximilianstr. 28) - schon durch die Bäume zu erspähen - wurde ab 1888 am Eingang zur Altstadt auf den Fundamenten der inzwischen abgerissenen Stadtmauer erbaut. Dabei zerstörte man die westliche Säulenhalle des erst 70 Jahre zuvor von Karl von Fischer erbauten Maxtors. Das 1891 eröffnete „Maximilian“ ist ein wirklich repräsentatives Entree in die Altstadt: ein breit gelagerter, prunkvoller Bau im Stil des Neorokoko mit Mittelrisalit und Eck-Erkern. Bauherr war der Regensburger Brauer Franz Josef Bergmüller, Architekt Julius Poeverlein. 1945 wurde das Hotel für mehrere Jahre das Hauptquartier der US Army, danach begann der Niedergang. 1970 wurde das Gebäude von der Stadt auf Abriss gekauft, aber während man noch verschiedene Pläne wälzte, kam das Haus unter Denkmalschutz: kein modernes Einkaufszentrum an dieser Stelle! Stattdessen wurde es aufwendig renoviert und dient seit 1980 als Hotel wieder seinem ursprünglichen Zweck. Die andere Straßenseite hatte nicht solches Glück: In den 1950er mussten die Reste des Tores einem modernen Hochhausbau weichen.
Die nördliche Maximilianstraße, an deren Anfang man beim Hotel steht und der wir eine Weile folgen, war das Willkommensgeschenk des Königreichs Bayern an die eben erbeutete Stadt Regensburg (→ „Aufbruch in neue Zeiten“). Nach der Königsstraße, die ebenfalls nach 1810 angelegt wurde und die Maximilianstraße in der Mitte teilt, sind auf der linken Straßenseite einige schöne Geschäfts- und Wohnhäuser aus dem frühen 20. Jh.: die Hausnummern 10 und 12, beide 1910 von Karl Frank erbaut, die Nr. 8, im Kern 1. Hälfte des 19. Jh., später aufgestockt und 1924 (!) von Karl Frank mit einer sehr späten Jugendstilfassade vollendet. Am eindrucksvollsten ist sicher Hausnummer 6, der Fürstenhof mit seiner aufwendig gestalteten Fassade: Als Tanzlokal erbaut, jetzt ist das Café Fürstenhof im ersten Stock, einst das Kaffeehaus Regensburgs schlechthin. Im Erdgeschoss gibt es „geistige Genüsse“, denn vor einigen Jahren ist dort eine der vielen Regensburger Buchhandlungen eingezogen. Jetzt sind es, nach dem „Kunstschaufenster“ links, nur noch wenige Meter geradeaus zum ersten Highlight der Tour, dem Alten Kornmarkt.
Regensburg im Kasten
Aufbruch in neue Zeiten
1809 waren Stadt und Mauer im Südosten großflächig zerstört worden (Link) und mit dem Wiederaufbau ab 1810 wollte man ein Zeichen der neuen Zeit setzen. 1810 war das Mittelalter noch nicht „romantisch“, sondern schlicht rückständig. Also legte man ohne Rücksicht auf Besitzverhältnisse und historische Straßenverläufe eine 800 m lange, kerzengerade und breite Straße an, vom Ende der Speichergasse beim Alten Kornmarkt bis zur südlichen Stadtmauer. Der verantwortliche Freiherr von Weichs schwärmte, die Straße sei „wegen ihrer Offenheit und Schönheit zweckmäßig“ und pries sie als ideal für Gewerbe und Wohnungsbau an, da sie nicht „finster und winkelhaft“ sei - das war die damalige Sicht auf das Gassengewirr der Altstadt.
Auch wenn sie den Namen des Königs trug, es wurde nichts Rechtes mit der Prachtstraße: Die Bürger bauten lieber an den Alleen und auch sonst ging es nicht recht voran. Erst nach 1900 entstanden im Nordteil einige wenige schöne, aufwendigere Bauten, oft in barockisierendem Jugendstil. In den 1960ern durchaus noch als Regensburgs „Flaniermeile“ gesehen, verlor die Maximilianstraße zunehmend an Anziehungskraft. Man war unzufrieden: Ende der 1980er wurden die Bürger befragt und die Neugestaltung geplant. Es folgten 2003 eine Umwandlung in eine verkehrsberuhigte Zone, eine durchgehende Neupflasterung mit großen Platten (als Kontrast zum Kopfstein der Altstadt) ohne Trennung von Fahrbahn und Gehsteigen, eine neue Lichtführung, aber - man blieb unzufrieden. Die vielen Leerstände, das sehr gemischte Warenangebot, die Bausünden verschiedener Zeiten, alles etwas kahl, charmant ist anders. Aber die Stadt gibt nicht auf: Ein neues modernes Hotel verbindet Alt mit Neu, edlere Geschäfte siedeln sich an, Baulücken werden geschlossen - es wird.
Historische Gebäude noch und noch
Alter Kornmarkt
Wenn man bei der Alten Kapelle links um die Ecke biegt, hebt sich der Vorhang zu einer der schönsten und markantesten Ansichten der Stadt: dem Ensemble um den Römerturm, überragt von den Spitzen der Domtürme - deswegen ist man hierhergekommen! Wenn man den Blick wieder senkt, wird die Freude etwas getrübt, denn leider ist der Platz immer noch hauptsächlich Durchgangsstraße und Parkplatz. Nur samstags tobt hier auf dem Wochenmarkt das Leben.
Hier nun war für 700 Jahre das Machtzentrum des bayerischen Herzogtums und für nahezu ein Jahrhundert (bis 887) der Sitz der ostfränkischen Könige. Alte Kapelle,Herzogshof und Römerturm sind die bedeutendsten Zeugen dieser Zeit.
Der Kornmarkt ist einer der drei großen historischen Plätze der Stadt. Er war Teil der ersten bajuwarischen Herzogspfalz, die die Agilolfinger im 6. Jh., vielleicht unter Ausnutzung des spätrömischen Binnenkastells, hier eingerichtet haben. Ganz sicher, wo genau die Anfänge lagen, ist man sich nicht. Nach der Absetzung der Agilolfinger durch die Karolinger wurde sie fränkische Kaiserpfalz (→ Geschichte). Nach dem Ende der Pfalz als Herzogsresidenz 1245 geriet der Platz an den Rand, auch weil sein westlicher Teil gar nicht zur Stadt, sondern zu Bayern gehörte. Das führte immer wieder zu absurden Situationen: 1786 hatte es die Stadt gewagt, einige Bäume vor der Alten Kapelle zu ersetzen. Der bayerische Herzog ließ sie entfernen, da sie auf seinem Herrschaftsbereich standen, nur um sie sofort durch „bayerische“ Bäume zu ersetzen.
Der Alte Kornmarkt war Turnier- und Festplatz, aber eben auch Kornmarkt, die Kornschranne bestand vom 15. Jh. bis 1830. Die große Brunnenanlage des späten 19. Jh. wurde im Zweiten Weltkrieg durch den Bau eines riesigen Löschwasserteiches zerstört.
Rokoko-Juwel
Alte Kapelle
Die Alte Kapelle oder, genauer gesagt, das Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle liegt an der Südseite des Kornmarktes, etwas hinter einer Baumreihe und einer Mauer versteckt. Von außen scheint sie ihren Namen zu bestätigen: Es dominieren der romanische Turm, das strenge Schiff und der stark hochgezogene gotische Chor. Nur die Fensterformen verraten, dass die Alte Kapelle eine der schönsten Rokokokirchen Bayerns ist.
Bauphasen: Die Alte Kapelle beansprucht für sich, die älteste aller bayerischen Kirchen zu sein. Die Rupertuskapelle (in der Vorhalle rechts, nicht zugänglich) soll der Ursprung sein: Hier taufte der Sage nach Bischof Rupertus aus Salzburg den Agilolfinger Theodo. Aber wahrscheinlich fallen ihre Anfänge mit dem karolingischen Neubau der Pfalz 850 zusammen. 1002 wird unter König Heinrich II. die Kirche auf den bestehenden Grundmauern als dreischiffige Basilika mit östlichem Querschiff neu errichtet. Seit dem 12. Jh. steht der verbliebene südliche Turm des karolingischen Westwerks isoliert. Um 1450 folgt ein hochgotischer Chor, im 17. Jh. eine barocke Neuausstattung, die außer in der Gnadenkapelle kaum Spuren hinterlassen hat. Die Rokoko-Ausstattung erfolgte ab 1747, 1797 war sie mit der Vollendung der Orgel abgeschlossen. Nach vielen Eingriffen im Zeitgeschmack erstrahlt sie heute, nach der akribischen Restaurierung der Jahre 1993-2002, im originalen Glanz.
Das dazugehörige Kollegiatstift, das Heinrich II. wieder eingerichtet hat, besteht ohne Unterbrechung seit 1002 und ist somit das älteste in Bayern.
Rundgang: Man betritt die Kirche durch eine Vorhalle mit barocker Fassade. Die gotische Maria über dem Tor und die je zwei romanischen Löwen und Nischenfiguren betonen das ehrwürdige Alter der Kirche. Nach der noch sehr altertümlichen Vorhalle beeindruckt den Besucher der helle Kirchenraum umso mehr: Das strahlende Weiß der Wände bietet nur den Hintergrund für die überschäumende Fülle von vergoldetem Stuck um die Wand- und Deckengemälde. Schöpfer dieses Kunstwerks waren der Wessobrunner Anton Landes (Stuck) und die Maler Christoph Thomas Scheffler (Schiff und Querschiff) und Gottfried Bernhard Göz (Chor), beide aus Augsburg. Man kann die mittelalterlichen Formen noch erkennen, die Rundbogenarkaden auf quadratischen Pfeilern, das schmälere Querschiff und den etwas höher gelegenen gotischen Chor, aber durch einheitliche Gewölbe und Fenster wurde ein neuer, überwältigender Raum geschaffen, den man erst als Ganzes in sich aufnehmen muss. Leider muss man als Besucher hinter dem Gitter bleiben.
Die Alte Kapelle erstrahlt wieder in altem Glanz
Die Wandmalereien und die Ausstattung haben drei Programme: Langhaus und Querschiff erzählen Wunder und Ereignisse aus dem Leben der Stifter Heinrich II. und Kunigunde, der Chor hat die Apokalypse als Thema, die Verherrlichung Mariens steht über allem.
Der Hauptaltar, um 1770, der die ganze Raumhöhe ausfüllt, ist von Regensburger Künstlern: Die Figuren stammen von Simon Sorg, Ausführung und Fassung von Carl Heinrich und Georg Caspar Zellner aus Stadtamhof - also eigentlich keine Regensburger, aber dazu später mehr (→ Tour 3). Im Zentrum des Altars steht die heilige Maria als apokalyptische Frau auf der Mondsichel, vor ihr das Jesuskind. Am Rand stehen die Stifterfiguren Heinrich II. und Kunigunde. Über dem Gebälk thronen Gottvater und Heiliger Geist, bereit, Jesus aufzunehmen. Flankiert werden sie von Johannes, dem Schöpfer des Buchs der Apokalypse, und vom Evangelisten Lukas, dem Maler des Marienbildes - zu diesem Bild später mehr.
Das Programm des Chores ist die irdische Welt und ihr Ende: Die beiden Oratorien zeigen die vier Weltteile, Vasen stellen die vier Elemente dar, das Deckengemälde darüber ist das Ende, die Apokalypse. Dem Chor gegenüber ist die prachtvolle Orgel, fast 10 m hoch, in ihrem Rokoko-Gehäuse mit klassizistischen Elementen, der Figurenschmuck ist wie beim Altar von Simon Sorg. Die Orgel selbst, die Papst-Benedikt-Orgel, wurde 2006 geweiht. Mit ihr war die Wiederherstellung der Innenausstattung vollendet.
Das Motiv des Deckengemäldes im Mittelschiff, die Übergabe eines Marienbildes an Kaiser Heinrich, verweist auf die Gnadenkapelle im Süden, die diesem Bild geweiht ist. Der kreuzgewölbte Raum der Kapelle wurde 1693 barock stuckiert: Der Unterschied zwischen diesen Barock- und den Rokoko-Stuckaturen des Kirchenraumes ist auffällig. Das Gnadenbild über dem Altar wurde der Legende nach vom Evangelisten Lukas gemalt und 1014 dem Kaiser von Papst Benedikt VIII. geschenkt, der es der Alten Kapelle vermachte. Seit dem 14. Jh. gab es eine Wallfahrt, im 17. Jh. wurde es wegen der Wunder zum Gnadenbild erhoben. Das Bild, Maria mit dem Kind vor goldenem Hintergrund, sieht aus wie eine byzantinische Ikone, ist aber eine Regensburger Kopie von ca. 1220.
Tägl. 6.30 Uhr bis zur Dämmerung. Alter Kornmarkt 8, Tel. 0941-57973, www.alte-kapelle.de. Programm der festlichen Messen und Konzerte → Website. Tickets in der Tourist-Info im Alten Rathaus, Tel. 0941-5074410. Führungen: Infos und Tickets im Informationszentrum Domplatz 5, Tel. 0941-5971662, domplatz-5.de.
Bayerisches Machtzentrum
Herzogshof
Der Herzogshof an der Westseite des Alten Kornmarkts ist der verbliebene Ostflügel der Herzogspfalz. 1180 waren die Wittelsbacher bayerische Herzöge geworden und begannen bald mit dem Umbau. Das Gebäude ist also das älteste Profangebäude der Stadt. 1245 mussten die Herzöge auf die Stadt als Residenz verzichten, die Pfalz blieb aber bayerisches Hoheitsgebiet und beherbergte verschiedene Ämter. Die Rückkehr Regensburgs nach Bayern 1810 verhalf der Pfalz nicht zu neuem Glanz, das Gebäude verkam. 1930 wurde es auf Abbruch an die Post verkauft, die ihr neues Gebäude südlich des Doms (→ Tour 2) erweitern wollte. Da man u. a. romanische Fenster fand, blieb der Ostflügel erhalten und wurde gründlich wieder „mittelalterlich“ hergerichtet, 1937 der Schwibbogen zum Römerturm rekonstruiert. Prunkstück ist der spätromanische Herzogssaal von 1220, ein monumentaler Festsaal von 10 auf 20 m, fast 5 m hoch. Er gehört, wie das ganze Gebäude, heute zum Achat Plaza Hotel und kann gemietet, aber nicht besichtigt werden.
Wuchtiges Bollwerk
Römerturm
Der wuchtige Römer- oder Heidenturm dominiert den Alten Kornmarkt, seine Wirkung wird durch den Kontrast zu den fragilen Turmspitzen des Doms noch betont. Auf einer Fläche von 14 mal 14 m erhebt sich der ehemalige Wohn- und Fluchtturm der herzoglichen Pfalz in eine Höhe von 28 m. Die fast 4 m starken Mauern der Untergeschosse aus großen Buckelquadern haben dem Turm seinen Namen gegeben, aber er ist jünger, möglicherweise karolingisch. Die oberen vier Geschosse sind aus dem 14. Jh., das Pyramidendach ist jünger: Noch Ende des 16. Jh. hatte der Turm einen geraden Abschluss. In den 1940ern wurden die unteren Geschosse mit einer 2 m dicken Stahlbetondecke über dem dritten Stock versehen und als Schutzraum für die Glasfenster des Doms genutzt. Der Turm gehört heute zur Dombauhütte und ist nicht zugänglich.
Der Römerturm versteckt sich
Neben der Strenge des Römerturms wirken die bunten barocken Giebelhäuser nördlich daneben richtig fröhlich, umso mehr, weil es vier Cafés (und ein Hotel) sind: die einzige Stelle des Platzes, an der man draußen sitzen kann. Alle Gebäude, auch die zwischen dem Turm und dem ersten Haus verkeilte alte Schmiede, sind im Kern mittelalterlich und haben mehr oder weniger echte barocke Fassaden - das Orlando hatte 1901 noch keinen Giebel.
Den auffälligen Abschluss der Platzseite bildet das große neugotische Internatsgebäude der Armen Schulschwestern von 1857 mit dem Treppenturm der Schule von 1903 (Architekt Josef Koch).
So viel Auswahl
Vier Cafés direkt nebeneinander? Aber sie sind ganz unterschiedlich: gleich am Turm die „Cupcakery“ für den Fan kleiner süßer Kuchen, das „La Chapelle“, Bistro und Café, das „Orlando di Lasso“, traditionelles Café mit Aussichtsbalkon, und schließlich, neben dem Hotel „Elements“, das „Rinaldo“, eher die italienische Bar. Da sollte sich was finden lassen.
Prunkvoller Hochbarock
Karmelitenkirche St. Josef
Die östliche Seite des Alten Kornmarkts bietet einen völligen Kontrast zur mittelalterlichen Süd- und Westseite: Hier prunkt Hochbarock mit italienischen Einflüssen. Die großartige Fassade der Klosterkirche St. Josef der Unbeschuhten Karmeliten ist im Vergleich zu den italienischen Vorbildern etwas bescheidener, schließlich waren die Karmeliten ein Bettelorden - und Geldsorgen begleiteten das ganze Projekt.
Niedermünster: strenge Romanik und zarter Barock
St. Josef wurde in den Jahren 1641-1667 erbaut, als Architekt wird Carlo Lurago vermutet. Erst wenige Jahre vorher waren die Karmeliten, ein Orden der Gegenreformation, auf Wunsch von Kaiser Ferdinand II. in die Stadt gekommen, gegen den Widerstand der evangelischen Stadt. 1812 wurde das Kloster säkularisiert, 1836 aber wiedereingesetzt. Dazwischen diente die Kirche als Mauthalle.
Der untere Teil der Fassade ist von sechs Pilastern gegliedert, die das mächtige Gesims tragen. Über dem von Säulen gerahmten Portal steht in einer Nische Josef mit dem Christuskind. Der obere Teil ist von großen Voluten gerahmt (Sie erinnern sich an Lakritzschnecken? Richtig!), die Figuren von Heinrich II. und Kunigunde tragen, den Stiftern der Alten Kapelle.
St. Josef ist nach römischem Vorbild eine tonnengewölbte Wandpfeilerkirche mit Seitenkapellen. Der strenge Innenraum ist durch Pilaster gegliedert und schlicht weiß und grau gehalten, nur die Kapitelle der Pilaster sind farbig abgesetzt. Dem vom Goldrausch der Alten Kapelle noch mitgenommenen Betrachter kann das langweilig vorkommen - oder beruhigend. Auch hier wird der Unterschied zwischen Barock und Rokoko deutlich. Die Altäre stammen aus anderen Regensburger Kirchen, der beeindruckende Hauptaltar von 1690 ist z. B. aus dem Dom.
Eine Anekdote am Rande: Das Kloster wurde zwar 1812 aufgelöst, zwei Brüder aber durften bleiben. Der beliebte und begehrte klösterliche Melissengeist musste weiter produziert werden - und wird es bis heute.
Mo-Sa 6.30 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit, So ab 7.30 Uhr. Alter Kornmarkt 7, Tel. 0941-585330, www.karmelitenkloster-stjoseph.de.
Man verlässt St. Josef in Richtung Römerturm, biegt nach wenigen Metern rechts in die Niedermünstergasse ein und steht vor dem gleichnamigen Stift.
Stadtgeschichte zum Anfassen
Niedermünster und document Niedermünster
Das Niedermünster war kein Kloster, sondern ein adliges Damenstift (→ Kasten). Anfang des 9. Jh. bestand es wohl schon, eine erste Kirche, in der der hl. Erhard (→ Geschichte) bestattet wurde, bereits im Jahr 700. Mitte des 10. Jh. folgte ein Neubau, eng verbunden mit dem Herzogshaus: Heinrich I. von Bayern und seine Frau Judith waren die Erbauer und sind hier begraben. 1002 wurde das Niedermünster durch Kaiser Heinrich II. reichsunmittelbar, d.h., die Äbtissin war Reichsfürstin. Das Ende des Stifts kam 1803, die Kirche wurde 1821 Dompfarrkirche, die Stiftsgebäude bischöfliches Ordinariat.
Die heutige Kirche ist eine romanische Pfeilerbasilika mit zwei Westtürmen und einer Vorhalle und etwa ab 1150 erbaut: Ein Stadtbrand hatte den Vorgänger zerstört. Man betritt durch das üppige barocke Portal die Vorhalle. Sie zeigt auf einen Blick die gesamte Baugeschichte: von den halb freigelegten romanischen Arkaden an der rechten Seitenwand bis zum barock stuckierten Gewölbe von 1730. Ein romanisches Stufenportal führt in das schmale, hohe Kircheninnere, das nur sehr dezent barockisiert ist: Um 1620 zog man ein flaches Gewölbe ein mit zarten Malereien. 100 Jahre später wurde die Decke weiß übermalt und ein eleganter Stuckrahmen eingezogen. Seit der letzten Renovierung sind beide Dekorationen neben- und übereinander sichtbar: Nur wer genau hinsieht, bemerkt, dass sie sich überschneiden. Im nördlichen Seitenschiff findet sich eine einzigartige dreifache steinerne Baldachinanlage aus dem 15. Jh. Sie ist die Grab- und Gedenkstätte für den heiligen Erhard und befindet sich genau über seinem Grab. Seine Verehrung ist ganz wesentlich für das Niedermünster. Seine Liegefigur ist von 1300, die des Albert von Cashel, Freund und Weggefährte, von 1310. Die Figur ganz links ist eine Ergänzung aus dem 17. Jh., die Bemalung der Baldachinanlage stammt aus der Zeit um 1520, ist aber stark ergänzt. Es lohnt sich, weiterzugehen. Unter einer romanischen Doppelarkade kommt man in den Chor. Der barocke Hochaltar von 1763 ist einen Blick wert (Altarbild von 1879), unbedingt sehenswert ist aber das monumentale Holzkreuz mit den Bronzefiguren von Georg Petel (1601-1634): Die in verzweifelter Trauer hingesunkene Maria Magdalena ist ein Meisterwerk.
Im wahrsten Sinne hingegossen
Gleich neben dem Eingang in der Kirche ist der Zugang zum document Niedermünster. In den Jahren 1964-1968 wurden auf der ganzen Fläche der Kirche Ausgrabungen durchgeführt. Die Funde waren so fantastisch, anhand von ihnen konnte vieles nachgewiesen werden, was vorher als Sage galt, wie z. B. die Gräber des hl. Erhard und des bayerischen Herzogspaars. Und so beschloss man, die Ausgrabung zugänglich zu machen. Vor einigen Jahren dann wurde museumspädagogisch richtig aufgerüstet, und so kann man heute in einer 75-minütigen anregenden Führung eine der größten archäologischen Ausgrabungsstätten Deutschlands begehen. Unter der Kirche sind 2000 Jahre Siedlungsgeschichte zu erleben, verständlich gemacht durch 3-D-Rekonstruktionen, Filme und eine raffinierte Lichtführung. Absolut sehenswert.
Nach Verlassen des Niedermünsters geht es im Bogen rechts bergab. Beim „Colonialwaren, Mehl, Tabak Vinzenz Huber“ (heute ein Tattooladen) biegt man links in die Straße Unter den Schwibbögen.
Kirche: tägl. von 7 Uhr bis zur Dämmerung. Niedermünstergasse 4.
Mittagsmusik „5nachzwölf“: Sa 12.05 Uhr. Eintritt frei. www.5nachzwölf.de.
document Niedermünster: So, Mo und Feiertag 14.30 Uhr. Eintritt 8 €, erm. 5 €, unter 16 J. frei, Tickets: Infozentrum Domplatz, Domplatz 5, Mo-Sa 10-16 Uhr, So 13.30-14.30 Uhr, Tel. 0941-5971662.
Alte Handels- und Hauptstraße
Unter den Schwibbögen
Die Straße hat ihren Namen von drei Schwibbögen - Stützbögen zwischen zwei Häusern -, die nicht mehr existieren. Sie war Teil der wichtigsten Handelsstraße und Hauptstraße des mittelalterlichen Regensburgs. Von Passau kommend, führte sie über die Ostengasse direkt nördlich am römischen Lager vorbei über Rathausplatz und Haidplatz nach Westen zum heutigen Arnulfplatz. Sehen Sie sich um: Diese für uns enge Gasse war eine mittelalterliche Hauptstraße.
100 m weiter steht man schon vor der Porta Praetoria.
Römische Hinterlassenschaft
Porta Praetoria und Legionslagermauer
Die Porta Praetoria, das Nordtor des Römerlagers Castra Regina (→ Geschichte