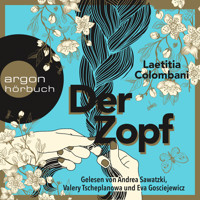3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hierophant Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
An einem fernen Ort, dessen Name im späteren Verlauf des Romans als Mutterstadt bekannt wird, bricht eine Katastrophe aus. Heftige Winde reißen den Ortsbewohnern ihre Lebensgrundlage fort. Als es zur Evidenz wird, dass es keine Rettung mehr gibt, brechen sie zu unbekannten Horizonten auf. So gelangen sie an einen Ort namens Innenstadt und siedeln sich dort an. Doch ein Unterschied zwischen dem Wahrnehmungsvermögen der Neusiedler und dem der Ortsansässigen macht die Lebensgemeinschaft zwischen beiden Parteien zu einer Zerreißprobe, welche im weiteren Verlauf in einer überraschenden Regression in der Evolution gipfelt. Regression – ein metaphorischer, gesellschaftskritischer Roman, der den Leser zum Nachdenken, Beobachten und Fragen stellen auffordert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Ähnliche
REGRESSION
Souleymane Pepouna
Originalausgabe:
Souleymane Pepouna – Regression
ISBN 978-3-940868-71-8
© copyright 2010 Souleymane Pepouna
© copyright 2010 Hierophant-Verlag
© Coverillustration: Siemaja Sue Lane
Cover: Torsten Peters
1. Auflage 2010
Hierophant-Verlag
Im Bollerts 4 - 64646 Heppenheim
http://www.hierophant-verlag.de
Alle Rechte, auch der fotomechanischen Vervielfältigung und des auszugsweisen Abdrucks, vorbehalten.
Hinweis an den Leser:
Die Suche in der nachfolgenden Erzählung nach Similaritäten mit Erfahrungen aus dem sozialen Alltag verspricht nur mäßigen Erfolg, umso vielversprechender ist dafür allerdings die Suche in der Gesellschaft nach Gleichartigkeiten mit Erscheinungen aus den hier geschilderten Ereignissen.
1
Es war ein recht windiger Abend. Eigentlich untypisch für Wetterverhältnisse im September. Die Trockenzeit schien dieses Jahr außergewöhnlich früh Einzug halten zu wollen. Die dunstige und staubige Luft sowie der schon seit Tagen von für die Trockenzeit charakteristischen Wolkenstreifen überzogene Himmel gab zu dieser Vermutung Anlass. Die Bäume, deren Laub in dem heftigen Wind mit kratzigem Geräusch raschelte, schienen auch zu ahnen, dass sie den sonst in den November hineinreichenden Flüssigkeitsüberfluss dieses Jahr wohl schon früh entbehren müssten. Sie hatten nämlich bereits den jedes Jahr erst bei bevorstehender Trockenzeit zu beobachtenden Zerfall der Pigmente in den Blättern eingeleitet, um einen rationellen Flüssigkeitsverbrauch einhalten zu können, der sie durch die Zeiten der Knappheit durchbringen würde. Die mit gemächlichen Flügelschlägen am Himmel vorbeiziehenden Zugvogelschwärme schienen auch die Bäume in ihrem Timing zu bestätigen. Denn man beobachtete die Schwärme sonst erst im November.
»Ein Jahr des Untypischen«, murmelte Samuel Bellami vor sich hin.
Er stand auf der Veranda und stützte sich mit beiden Ellenbogen auf dem Sims des gitterartigen Betongeländers auf. Sein zugleich verblüffter, trauriger und nachdenklicher Blick war auf die mit Mangobäumen gesäumte Auffahrt gerichtet. Unter den Bäumen beiderseits des Schotterweges standen massige, in grüne Planen gewickelte Pakete. Eigentlich ein vertrauter Anblick für Samuel. Die Pakete kannte er schon von Kindesbeinen an. Sie kamen nicht nur hier unter den Bäumen vor, sondern überall und auch außerhalb der Wohnsiedlungen. Sie hatten sich so in das Landschaftsbild integriert und waren zu einer solchen Selbstverständlichkeit geworden, dass man sie kaum noch bewusst wahrnahm. Sie waren geradezu ein integraler Bestandteil des Landschaftsbildes geworden. Man nannte sie „Heuballen“. Warum sie so hießen, vermochte kaum einer zu sagen. Aber so war es nun einmal. Und es war auch nicht wichtig, wie sie zu diesem Namen gekommen waren. Hauptsache war, dass sie die an sie gehegten Erwartungen zu erfüllen imstande blieben. Doch allem Anschein nach waren sie nicht mehr lange dazu in der Lage.
»Das ist kein gutes Zeichen!«
Samuel war bei dem Anblick in einen Monolog verfallen und hatte seine Frau Elisa nicht bemerkt, die sich gerade in den Türrahmen hinter ihm gestellt hatte.
»Was ist kein gutes Zeichen?«, fragte sie und schien gleich die Überflüssigkeit ihrer Frage selbst einzusehen.
Denn ihrem auf den atmosphärischen Tumult gerichteten erschrockenen Blick war anzumerken, dass sie keine Antwort erwartete.
Er zuckte zusammen und fuhr herum.
»Gott! Hast du mich erschreckt!« Er sagte es in einem Ton des Vorwurfs.
Sie wusste um die Schreckhaftigkeit ihres Mannes Bescheid und pflegte in Situationen, in denen sie nicht gleich in sein Blickfeld kam und sich eher auditiv bemerkbar machen musste, ein leichtes Hüsteln von sich zu geben. Aber heute tat sie es nicht. So eilig hatte sie es gehabt zu erfahren, was kein gutes Zeichen war.
»Was kein gutes Zeichen ist?«, fragte er rhetorisch und sah seine Frau mit einem Blick an, aus dem Furcht und Tatendrang herausschrieen.
Seine Stimme zitterte noch unter dem Effekt des Schreckens, den er gerade erlitten hatte. Als es ihm endlich gelang, diese wieder unter Kontrolle zu bekommen, fragte er noch einmal.
»Siehst du etwa nicht, was gerade mit unseren Heuballen passiert?«
Elisa blickte die Auffahrt hinunter, dann auf den jenseits des Tals liegenden Berghang und wieder auf ihren Mann zurück, der auf ihre Antwort zu warten schien.
»Alles, was ich sehen kann, ist, dass es heute so windig und stürmisch ist wie sonst nie zuvor. Ansonsten finde ich unsere Heuballen so üppig wie immer«, gab sie zurück.
»Üppig nennst du das? Siehst du denn nicht, dass der Wind sie mitzureißen droht? Unsere Heuballen waren noch nie so leicht, so angreifbar und so inhaltslos.«
Elisa sah wieder hin und ihr fiel auf, dass einige Ballen durch den immer heftiger werdenden Wind ständig angehoben und wieder fallen gelassen wurden. So etwas hatte man in all den Jahren weder schon mal erlebt noch hatte man jemals damit gerechnet.
»Du hast recht«, bestätigte sie ihren Mann.
»Na also«, seufzte er mit einer solchen Erleichterung, als wäre die anfangs fehlende Einsicht seiner Frau das einzige Problem gewesen.
»Was ist denn mit dem Inhalt der Ballen passiert, sodass sie so angreifbar geworden sind?«, fragte seine Frau und schaute verständnislos drein.
»Unsere Heuballen schwinden«, antwortete er.
»Wie können sie denn so schwinden? Schließlich gehen wir mit ihnen nicht verschwenderisch um. Außerdem gibt es jedes Jahr Nachschub.«
»Von wegen Nachschub! Wir können noch so sparsam mit ihnen umgehen. Wir sind nicht die einzigen Nutznießer«, antwortete er in einer Mischung aus Resignation und ohnmächtiger Wut. »Und gerade darin liegt das Problem.«
»Wer sonst ist am Verbrauch beteiligt?«, fragte sie wieder.
»Das wissen wir nicht genau. Aber sicher ist, dass wir nicht alleine daran sind.«
»Es sind aber unsere Heuballen. Sie stehen nur uns zu«, protestierte sie, als gälte es, sich gegen ihren Mann zur Wehr zu setzen.
»Ja, sie stehen nur uns zu. Aber das verhindert nicht die Möglichkeit für fremde Hände, sich daran zu vergreifen!«
Sie waren durch das immer leidenschaftlicher werdende Gespräch vom tosenden Geschehen nahezu abgelenkt, als unter einem Mangobaum ein Ballen vom Boden abhob.
»Neiiiiiin!«, schrie Samuel und sprang aus der Veranda ins Freie.
Der Ballen wurde vom Geäst des Mangobaumes abgefangen und wieder zu Boden zurückgeschleudert. Es war, als hätte dieser eine Ballen ein Lied angestimmt, in welches nun alle anderen Ballen einfielen. Die Ballen fingen alle an zu hüpfen. Wie von Geisterhand. Aber das war nur vom stürmischen Wind.
»Unsere Heuballen sind leer!«
»Unsere Heuballen schwinden!«
»Sie sind deshalb so angreifbar geworden!«
»Wir sind verloren!«
»Was wird aus unseren Kindern!«
»Wir müssen unsere Kinder fortschicken. Dann sind zumindest sie gerettet. Aus uns kann sowieso nichts mehr werden.«
So pflanzte sich der hysterische Schrei von Haus zu Haus fort und alle machten sich daran, von den Ballen das zu retten, was noch gerettet werden konnte. Mit aus Rinder- und Ziegenhaut angefertigten Riemen machten sie sich, da sie nie mit dem Eintritt eines solchen Zustandes gerechnet hatten, erst daran, an den hüpfenden Paketen Halterungen anzubringen. Sie rannten dabei förmlich hinter den Ballen her. Durch den aufgewirbelten Staub hatte sich in der ohnehin schon dunstigen Luft die Sichtweite fast auf Armeslänge reduziert. In der so entbrannten Betriebsamkeit konnte man noch nur undefinierbare Gestalten ausmachen. An manchen Ballen machten sich gleich zwei zu schaffen, während sich an anderen nur eine Gestalt abmühte. An den Halterungen wurde ein Ende des Riemens befestigt, das andere an dem jeweils nächststehenden Baum.
Die Ballen blieben bis in die frühen Morgenstunden – da der Sturm genauso lange anhielt – in der Schwebe und fielen erst bei herannahendem Morgengrauen unter den wachsamen Augen der aufgrund des Ereignisses keinen Schlaf findenden Dorfbewohner wieder zu Boden. Dann gingen die inzwischen vor Schläfrigkeit taumelnden Gestalten zu Bett. Doch es war am folgenden Tag nicht mehr alles so, wie es einmal war. Als Samuel und Elisa aufstanden und, wie sie es jeden Morgen vor der Inangriffnahme ihrer täglichen Verrichtungen zu tun pflegten, auf die Veranda traten, war der Ort wie ausgestorben. Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen und über den vom verheerenden Sturm unverständlicherweise verschont gebliebenen Dächern lag eine gespenstische Stille, die nur dann und wann vom Gezwitscher einiger Vögel zerrissen wurde, die sich an der nach dem Sturm wieder eingekehrten Windstille zu erfreuen schienen. Der große Platz, wo man sich nach jedem einschneidenden Ereignis zu treffen pflegte, lag verlassen da.
»Es ist verwunderlich, dass der Sturm an den Dächern keinen nennenswerten Schaden angerichtet hat«, staunte Elisa.
»Der Sturm hatte es anscheinend auf nichts Anderes abgesehen als auf unsere Heuballen.«
Samuel wandte seinen Blick von den Dächern ab zu den am Boden ruhenden Ballen hin. Dabei beschäftigte ihn mehr als alles Andere die Frage nach dem Verbleib der Ortsbewohner. Eiligen Schrittes lief er auf den verlassen da liegenden Versammlungsplatz zu, hielt die Hände trichterförmig vor den Mund und pfiff in die Runde. Aber niemand erschien. Nur Elisa, die wie versteinert unter dem Dachvorsprung der Veranda stand, starrte ihn an. Inzwischen hatte sich Felix, ihrer beider zehnjähriger Sohn, neben sie gestellt.
»Sie haben uns verraten!«, sagte Samuel und atmete flach. Er war wieder auf die Veranda zu Frau und Kind gerannt.
»Sie haben uns nicht verraten«, protestierte Elisa. »Sie haben sich gerettet.«
»Von wegen gerettet«, empörte sich Samuel. »Nennst du das Rettung? Muss man andere unbenachrichtigt lassen, wenn man sich rettet? Wo bleibt unsere Solidarität?«
»Sie ist auf der Strecke geblieben. Sie war sowieso nie da gewesen. Sie war immer ein sinnentleertes Lippenbekenntnis. Wenn sie tatsächlich da gewesen wäre, wären unsere Heuballen nicht so dramatisch am Schwinden. Die Lückenhaftigkeit unseres Solidaritätsverständnisses ist jedenfalls das, was unsere Heuballen so angreifbar machte.«
»Wovon redest du da?«, fragte Samuel.
»Natürlich ist der Schwund unserer Heuballen der Preis, den wir für den fehlenden Zusammenhalt zahlen müssen!«, erwiderte Elisa.
Sie war nicht sonderlich besorgt über die vorherrschende Lage und schien eher den Triumph auszukosten, ihrem Mann endlich einmal etwas beibringen zu dürfen. Sie wunderte sich auch, dass er bis dahin den fehlenden Zusammenhalt zwischen den Ortsbewohnern nicht gemerkt hatte.
Er pflichtete ihr bei.
»Das hatte ich nie so gesehen. Aber du hast Recht.«
»Hätten wir gleich von Anfang an die Ballen aneinander gekettet, hätten sie für den Sturm viel weniger Angriffsflächen aufgewiesen. Und es wäre nicht zu dem gekommen, was wir gerade sehen«, sprach sie weiter.
»Gut, aber jetzt ist das bisschen, was uns an Heuballen übrig bleibt, vor jedem noch so starken Sturm sicher.«
»Ich würde das an deiner Stelle nicht so laut sagen«, versuchte sie, ihren Mann in seinem Optimismus zu bremsen. »Wir müssen nämlich erst abwarten. Denn ich fürchte, wir werden für unsere anfängliche Lässigkeit jahrelang büßen müssen.«
»Wenn es überhaupt etwas gibt, das ich dir gerne austreiben würde, dann deinen Hang zum Pessimismus«, sagte er in einem Ton des Vorwurfs und des Neckens.
Doch sie ging eher auf den Vorwurf ein als auf das Necken.
»Wenn du realistische Einstellung mit Pessimismus verwechseln willst, dann bitte.«
Sie drehte sich dabei auf dem Absatz, um sich ins Hausinnere zu begeben. Doch bevor sie über die Türschwelle kam, packte sie Samuel vor Felix’ weit aufgerissenen Augen ganz schonungslos an den Schultern und presste sie gegen die Wand.
»Du scheinst über alles Bescheid zu wissen, was! Nun sag es mir! Wo sind die anderen? Warum ist es so leer hier?«, fragte er und presste sie so fest gegen die Wand, als hoffte er, dadurch aus ihr so viel heraus zu quetschen, wie er sich wünschte.
»Ich kann mich nicht rühmen, alles zu wissen«, antwortete sie mit ruhiger Stimme, obwohl sie gleichzeitig versuchte, sich aus seinem Griff zu befreien. »Ich versuche nur, über die Dinge nachzudenken.«
»Dann sollst du auf der Stelle darüber nachdenken, warum und wohin sie alle verschwunden sein könnten!«
Er hatte wieder von ihr abgelassen. Nach seinem Atemrhythmus zu urteilen, schien er sich bei dieser kurzen körperlichen Druckausübung regelrecht verausgabt zu haben. Seine Frau nahm seinen Kopf zwischen die Hände und gab ihm einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. Regungslos hatte ihnen Felix dabei nur zugeschaut.
»Willst du wissen, warum sie fort sind?«, fragte sie dann.
»Nicht nur warum, sondern auch wohin«, antwortete er.
»Immer eins nach dem anderen«, lächelte sie.
»Gut, was glaubst du, warum sie fort sind?«, fragte er und blickte sie hoffnungs- und erwartungsvoll an.
»Aus einer vorsorglichen Maßnahme heraus sind sie fortgezogen«, antwortete sie.
»Vorsorgliche Maßnahme? In welcher Hinsicht denn vorsorglich?«
»Der nächste Sturm wird sicher verheerender ausfallen und unsere durch einen unaufhaltsamen Schwund immer angreifbarer werdenden Heuballen einfach fortreißen. Wenn es soweit ist, sind die anderen schon über alle Berge.«
»Es wird sicher nicht so weit kommen«, meinte Samuel und suchte das Gesicht seiner Frau nach einer Bestätigung ab.
»Das wollen wir hoffen«, erwiderte sie.
Samuel verzichtete absichtlich auf die Antwort auf seine Frage, wohin sämtliche Ortsbewohner hingezogen sein mochten. Dies war nicht mehr von Belang. Schließlich schwebte ihnen kein Fortgang vor. Jedenfalls noch nicht.
Tagelang änderte sich an den fast schon zum Alltag gewordenen neuen Gegebenheiten nichts mehr. Das einzige, was keine Konstanz mehr zu erlangen vermochte, war die Konsistenz der Heuballen. Diese schwanden und schwanden. Unaufhaltsam. Obwohl sich die Anzahl der Verbraucher auf drei Köpfe reduziert hatte. Die Bellamis waren entschlossen zu bleiben. Doch dieser Entschluss änderte sich rasch, als Samuel, Elisa und Felix eines Morgens nach dem Aufwachen vor dem Nichts standen.
Die Nacht davor hatte es wieder wie wild gestürmt. Aufs heftigste. Sie hatten sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Schließlich gab die einwandfreie Absicherung der Ballen keinen Anlass zu der Befürchtung, sie könnten doch fortgerissen werden. Zu ihrer schlimmsten Enttäuschung hingen jedoch, als sie an dem Morgen aufstanden und vor die Tür traten, nur noch die Befestigungsschnüre an den Bäumen. Alle Ballen waren fortgerissen worden. Einige schwebten zwar noch am Himmel, aber es gab kein Zurück mehr. Bald würden sie auch verschwunden sein.
»Es bleibt uns wohl nichts Anderes übrig als von hier wegzuziehen, solange wir dazu noch in der Lage sind. Sonst ist irgendwann zu spät für uns. Dann wären wir verloren. Und unser Felix auch«, sprach Elisa auf ihren Mann ein, der sprachlos dastand und kein Wort über die Lippen bekam.
»Meinst du nicht, wir könnten bleiben und von vorne anfangen?«, schlug Samuel vor.
»Ein Neustart ist nur auf der Grundlage von Altem möglich! Wie stellst du dir einen Neubeginn unter diesen Bedingungen vor?«
Ohne die Antwort ihres Mannes abzuwarten, rannte sie ins Haus und machte sich daran, die wenigen Habseligkeiten zu packen, die sie im Ungewissen nicht entbehren zu können glaubte. Samuel tat ihr gleich. Doch plötzlich hielt er inne und fragte:
»Und wo wollen wir jetzt hin?«
»Ich habe keine Ahnung, wo wir hin können. Aber wir müssen hier weg«, antwortete sie.
Sie sprach in einem gebieterischen Ton, ohne jedoch ihre Verrichtung zu unterbrechen.
»Bevor wir aufbrechen, müssen wir zuerst nachdenken, wo wir hingehen können. Sonst riskieren wir einen Sprung aus der Bratpfanne ins Feuer«, verlieh Samuel seinen Bedenken Ausdruck.
»Wir müssen der Windrichtung folgen«, meinte Elisa. »Dort sind die Ballen hingeflogen. Sie können nicht ewig in der Schwebe bleiben. Irgendwie und irgendwo werden sie herunterfallen. Und dort, wo sie herunterfallen werden, wollen wir hin!«
»Hoffentlich rennen wir damit nicht ins Verderben.«
»Gibt es ein schlimmeres Verderben als das, in dem wir gerade stecken?«, entgegnete Elisa.
»Wir haben leider keine Vergleichsmöglichkeit«, erwiderte Samuel. »Außerdem haben wir hier noch die Möglichkeit, in Würde zu sterben.«
»Was uns beide angeht, würde ich ohne Bedauern sterben. Denn wir haben sozusagen unser Leben gelebt. Aber unser Felix hat seins noch vor sich. Daher wollen wir ihn nicht hier verrecken lassen«, äußerte Elisa ihre Meinung.
Samuel bückte sich und packte weiter. Im Handumdrehen waren sie fertig. Als Felix versuchte, sich gegen den Aufbruch zu stemmen, zerrte ihn Elisa gewaltsam aus dem Haus; er gab seinen Widerstand erst dann auf, als sie die Auffahrt hinunter liefen und das Gefälle des Weges seiner ihn unerbittlich hinter sich herzerrenden Mutter zum Vorteil gereichte.
Um die Ecke, bevor ihr Haus aus dem Blickfeld verschwand, blieben sie alle drei stehen und drehten sich um, um sich noch einmal vom Ergebnis jahrelangen Schuftens zu verabschieden. Die Tür- und Fensterflügel fingen trotz mittlerweile wieder eingetretener Windstille an, auf- und zuzuklappern. Sie legten das als Abschiedsgeste ihres Hauses an sie aus.
Als allen drei Tränen die Wangen herunter zu kullern begannen, drehten sie sich wieder um und setzten den erst beginnenden Marsch fort.
»Wir haben keine Zeit für Gefühlsduselei«, sagte Samuel und beschleunigte den Schritt.
2
Ihr Wohnort lag noch keine Stunde zurück, als sich ihnen vier Greisinnen in den Weg stellten.
»Was macht ihr da?«, fragte Samuel und versuchte dabei, die von den Jahren gezeichneten Gestalten zu umgehen, um seinen Marsch fortzusetzen.
Ganz verstohlen versetzte ihm Elisa einen Rippenstoß und wandte sich, während er sich vor Schmerz die Rippen hielt, an die zerlumpten Wesen.
»Womit können wir euch behilflich sein?«
Daraufhin fing eine der Greisinnen an, sie in einem flehentlichen Ton zu bitten.
»Nehmt uns bitte mit! Lasst uns bitte nicht zurück! Die anderen haben uns wegen unseres Alters im Stich gelassen. Ihr seid unsere letzte Hoffnung.«
»Wie könnt ihr in uns eure letzte Hoffnung sehen, wo wir für euch nur eine Zufallsbegegnung sind?«, fragte Samuel.
Er hatte sich anscheinend schon von dem Schmerz in den Rippen erholt.
Die zweite von den Frauen antwortete: »Man kann doch auch von Zufallsbegegnungen profitieren, wenn sie sich als profitabel erweisen, oder? Außerdem haben wir auf euch gewartet.«
Dabei stellte sie sich vor Erschöpfung auf alle Viere.
»So eine haltlose Behauptung«, meinte Samuel und fragte: »Woher wollt ihr gewusst haben, dass wir kämen?«
»So etwas spricht sich doch schnell herum«, mischte sich das älteste von den vier Weibern ein.
»Ja, so ist es nun einmal hier. Auch wenn niemand mehr da ist, spricht sich jedes in der noch so tiefen und geborgenen Ecke des Herzens gefasste Vorhaben wie ein Lauffeuer herum«, sagte Elisa vielmehr zu sich selbst als in die Runde. »Wir hätten selbst rechtzeitig wissen sollen, dass sie hier auf uns warten. Wir hätten eine andere Route nehmen sollen.«
»So außerordentlich es uns leid tut, wir sind nicht in der Lage, euch mitzunehmen. Ihr seid zu viert und wir zu dritt«, versuchte Samuel ihnen die Zahlenverhältnisse zu erklären.
»Alles was jetzt zählt, ist der Wille. Alles Andere hat keinen Stellenwert hier«, erwiderte eine der Alten.
»Beim besten Willen können wir euch in keiner Weise helfen«, pflichtete Elisa ihrem Mann bei.
»Dann müsst ihr euch für uns etwas einfallen lassen«, entgegnete wieder eine der Greisinnen.
»Wollt ihr uns etwa zum Unmöglichen zwingen oder was?«, fragte Samuel verdrießlich.
»Nein, wir wollen euch keinesfalls zu irgendetwas zwingen, sondern nur um etwas bitten«, antwortete eine der Greisinnen.
»Worum wollt ihr uns denn bitten? Mit euch zu bleiben, bis es irgendwann für uns alle zu spät ist?«, fragte Samuel.
Seine Frau sagte nichts mehr. Sie beschränkte sich darauf, Felix so fest an sich zu drücken, als drohte er, ihr aus den Armen zu entwischen.
»Wir wollen euch darum bitten, uns die letzte Ehre zu erweisen«, antwortete dieselbe Stimme, die allem Anschein nach auserkoren worden war, für die anderen zu sprechen.
Samuel und Elisa sahen sich verständnislos an.
»Euch die letzte Ehre erweisen?«, kam es einstimmig aus beider Munde.
»Ja, indem ihr unserem Ableben beiwohnt«, erläuterte das alte Weib.
»So viel Zeit haben wir leider nicht«, empörte sich Samuel, wieder kurz davor, die Beherrschung zu verlieren.
»Alles ist schnell geschehen. Und dann könnt ihr euren Weg fortsetzen«, beruhigte ihn die Alte in einem flehentlichen Ton.
Dann machte sie eine Handbewegung und zeigte so in eine Richtung, in die die Bellamis die ganze Zeit nicht geschaut hatten.
Ihnen fielen erst dann vier hüfthohe Holzgerüste am Wegesrand auf; auf jedem lastete ein Riesenstein. Die Gerüste standen dicht beieinander und waren aus in die Erde gerammten gabeligen Baumästen und Lianen zusammengeschnürt worden. Die Weiber hatten also ihre letzte Körperkraft an den Bau ihres eigenen Hinrichtungsinstruments verschwendet, vermutete Elisa und verwarf diese Annahme aufgrund dessen wieder, dass den Damen von der körperlichen Verfassung her eine solche Verrichtung nicht zuzutrauen war. Ihnen war sicher – von wem auch immer – dabei geholfen worden.
Alle vier Weiber krochen wie verabredet jede unter ein Gerüst und legten sich auf den Rücken. Als sich alle vier in diese Position gebracht hatten, hüstelte eine von ihnen. Dann zog jede an einer über ihrem Gesicht hängenden Schnur und in der Sekunde darauf lastete das ganze Gewicht des Steinbrockens auf ihrem Kopf. Eine von ihnen, bei der sich der Mechanismus mit Verzögerung ausgelöst hatte, machte, nachdem sie Zeuge geworden war, wie ihre Schicksalsgenossinnen unter der Last des Riesenbrockens zappelten und sich aufbäumten, noch einen Versuch, aus dem Gerüst heraus zu kriechen. Doch es war bereits zu spät. Der Stein traf sie nun eher im Brustbereich und sie musste bei vollem Bewusstsein spüren, wie ihr die zerbrochenen Rippen die Haut durchstießen. Mit letzter Kraft versuchte sie noch, das tödliche Gewicht auf den Kopf zu rollen. Aber vergeblich. Auch aus dem Versuch, noch ein paar Worte an die Bellamis zu sagen, wurde nichts. Aber die drei Zeugen dieses Spektakels glaubten, von ihrem letzten Blick ablesen zu können, sie sollten ihren Weg fortsetzen und sie ihrem Schicksal überlassen. Möglicherweise redeten sie sich das nur ein, um ruhigen Gewissens der leidenden Frau den Rücken kehren zu können.
3
So schwer es ihnen im weiteren Verlauf ihres Weges auch fiel, den Vorfall mit den vier Weibern aus dem Kopf zu schlagen, so gelang es ihnen doch, sich über das bevorstehende Ungewisse Gedanken zu machen.
»Welche Richtung wollen wir nun einschlagen?«, fragte Samuel, als die erste Kreuzung kam.
»Laufen wir einfach geradeaus«, antwortete Elisa.
»Und wie können wir sichergehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind?«, zweifelte Samuel.
»Einfach geradeaus. Es wird sich irgendwann später herausstellen«, drängte Elisa.
Bei diesem kurzen Wortwechsel waren sie einen Augenblick stehen geblieben. Nun marschierten sie wieder los. Auf dem inzwischen breiter gewordenen und noch immer breiter werdenden Weg waren einige andere Gestalten erschienen. Die einen einsam, die anderen begleitet. Ab und zu wurde gegrüßt. Aber das Ziel des Marsches ließ man mit keinem Sterbenswörtchen verlauten. Obwohl jeder ahnte, was die anderen vorhatten, vermied man es, das Thema anzuschneiden. Dass man gerade auf dem Weg ins Ungewisse war, stand jedem im Gesicht geschrieben.
Je weiter man vorankam, desto geringer wurde der Abstand zwischen den in einer Richtung migrierenden Gestalten, und umso größer wurde bei jedem Teilnehmer auch die Gewissheit, nicht auf dem falschen Weg zu sein.
Am späten Nachmittag hatten sich so viele angeschlossen, dass das ganze Gebilde eher an eine Trauerprozession erinnerte. Plötzlich durchlief ein lauter Aufschrei die ganze Menschenkolonne.
»Innenstadt!«
»Innenstadt!«
So pflanzte sich der Aufschrei über die ganze Kolonne fort.
»Was ist los?«, fragte Samuel ahnungslos.
»Schau mal«, sagte Elisa und wies mit dem Finger nach vorne.
Als er aufblickte, sah er ein Riesenschild, auf dem mit großen Buchstaben das Wort INNENSTADT prangte. Das Schild zeigte nach links. An dem hohen Pfahl hingen zwei weitere Schilder, an denen kaum ein Buchstabe noch zu erkennen war.
»Da müssen wir hin«, erklärte Elisa ihrem Mann. »Nach Innenstadt.«
»Warum hast du das nicht gleich am Anfang gesagt?«, fragte er sie in einem Ton des Vorwurfs.
»Als ob ich das selbst gewusst hätte!«
Gleich hinter der Ausschilderung herrschte dichter Nebel. Die ganze Kolonne marschierender Gestalten schritt links am Schild vorbei und wurde gleich darauf vom Nebel verschluckt.
4
Die Ankunft in Innenstadt lag bereits Wochen zurück. Die Ankömmlinge waren in alle Windrichtungen verstreut. Felix und seine Eltern hatten nach den anfänglichen Schwierigkeiten ein Dach über dem Kopf bekommen und trauten sich noch kaum, vor die Tür zu gehen, so orientierungslos waren sie. Sie konnten sich nicht einmal mehr erinnern, wer sie in die Wohnung gebracht hatte, in der sie sich befanden, zumal sich die Person seit dem Tag nicht mehr hatte blicken lassen.
Draußen war es bitter kalt und es schneite unablässig. Was ihnen bei ihrer Ankunft als erstes aufgefallen war, waren die schneebedeckten Berge, die sich vielerorts auftürmten. So groß ihre Ungeduld war, die Umgebung zu erkunden, so empfindlich waren sie auch gegen die Kälte. Deshalb beschlossen sie, erst nach der Schneeschmelze eine Erkundungstour vorzunehmen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!