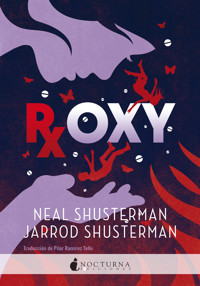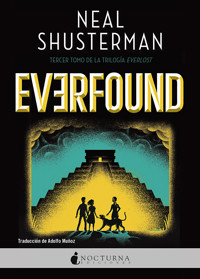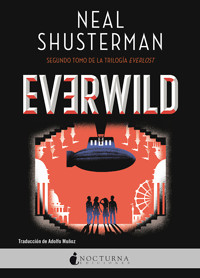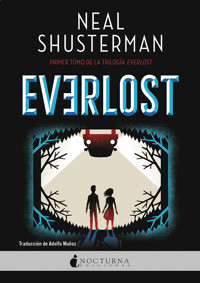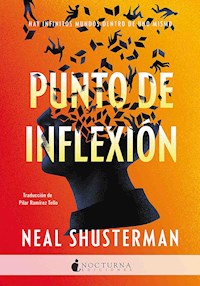9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Als Isaac der überirdisch schönen Roxy begegnet, zieht sie ihn sofort in ihren Bann. Er fühlt sich lebendig wie nie, alles ist leicht und nichts scheint unmöglich. Isaac ahnt nicht, dass Roxy kein normales Mädchen ist, sondern eine Droge, hergestellt in einem Labor, um die Menschen von ihrem Schmerz zu befreien. Und Millionen Menschen lieben sie dafür. Doch das ist Roxy nicht genug. Sie will beweisen, wie tödlich sie ist. Neal und Jarrod Shustermans neuer Fantasy-Thriller über ein hochaktuelles Thema: die im wahrsten Sinne toxische Liebesgeschichte zwischen Mensch und Droge - schillernd & gefährlich.Erzählt aus der Perspektive der Droge - Stell dir vor, Drogen wären Menschen wie du und ich ... Was würden sie fühlen, denken und wovon würden sie heimlich träumen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Ähnliche
Neal Shusterman | Jarrod Shusterman
Roxy
Ein kurzer Rausch, ein langer Schmerz
Aus dem Englischen von Pauline Kurbasik und Kristian Lutze
FISCHER E-Books
Inhalt
1Naloxon
Ich bin kein Superheld. Aber ich kann dich vor denjenigen retten, die das von sich behaupten.
Ich bin kein Zauberer. Aber ich habe die Macht, die Toten wieder auferstehen zu lassen.
Manchmal zumindest.
Und nie oft genug.
Ich bin im Grunde vielleicht nur deine letzte Chance – deine letzte Hoffnung, wenn sämtliche Hoffnung am seidenen Faden hängt und das nicht nur dich fertigmacht, sondern auch alle, die dir nahestehen.
Nun sind wir also hier, du und ich. Es ist passiert, was passieren musste. Niemals das Gleiche, doch immer ähnlich:
Heute befinden wir uns im Zimmer eines Hauses in einer Straße, die gebaut wurde, als eine topmoderne, blitzende Einbauküche noch ein Lebenstraum war und Autos wie Schiffe ohne Meereszugang waren, deren Anschnallgurte aus lauter Stolz nie umgelegt wurden.
Das war früher einmal die Vorstadt, doch schon vor langer Zeit wurde sie von einem urbanen Tsunami verschlungen. Die Nachbarschaft erlebt Tiefen, manchmal aber auch Höhen. Und diese Straße? Diese Straße ist tot. Sie wurde dem Allgemeinwohl geopfert.
Die Bäume zu beiden Seiten sind bereits gefällt, ihre Stämme zu Feuerholz verarbeitet, ihre Äste zerhäckselt. Die meisten Türen und Fenster wurden rausgerissen – die Häuser mit toten Augen und weit geöffneten, stummen Mündern zurückgelassen. Über fast eine Meile hinweg. Und gleich dahinter Bulldozer und Bauschutt, und dahinter ragen Betonpfeiler in den Himmel wie die Säulen eines antiken Tempels.
Ein neuer Freeway wird gebaut. Eine sechsspurige Autobahn wird das Viertel durchschneiden, genau an dieser Straße entlang – ein brutaler Initiationsritus namens Enteignung.
Wenn die Nacht hereinbricht, wird diese todgeweihte Straße stärker von der Dunkelheit verschlungen als jeder andere Ort der Stadt.
Und dort befindest du dich. Im fünften Haus auf der linken Seite.
Du kommst nicht aus diesem Viertel, hast das Haus dennoch irgendwie aufgespürt, wurdest von der Dunkelheit angezogen, die so dicht wirkt, als könntest du dich wie in eine Decke in sie einhüllen.
Nun bietet sich im Schein der Taschenlampen ein vertrautes Bild: ein Officer, zwei Sanitäter. Und ich.
Eine Sanitäterin beugt sich über dich – fühlt mit einem Finger an deinem Hals. »Schwer, den Puls zu finden«, sagt sie. »Wenn überhaupt ist er sehr schwach.«
Dieser Raum war mal ein Schlafzimmer. Jetzt steht hier allerdings kein Bett mehr, keine Kommode. Nur noch ein windschiefer Schreibtisch und ein kaputter Stuhl, die niemand mitnehmen wollte. Du liegst auf einem Teppich mit Schimmelflecken, die sich wie ein blauer Fleck von einer Wand zur anderen ausbreiten. Das Epizentrum der verlorenen Hoffnung.
»Keine Atmung. Reanimation!«
Mit Ratten wäre die Szene perfekt, doch die Schädlingsbekämpfer waren bereits mit meinen brutaleren Cousins hier, um die Viecher zu vernichten. Gegen die Kakerlaken haben sie keine Chance, da können sie machen, was sie wollen. Sie sind die Herrscher der Welt. Wahrhaftig unbezwingbar.
Du hingegen bist bezwungen. Wie sehr, das wird sich noch zeigen.
Dreißigmal drücken, Herzdruckmassage, zweimal beatmen. Wiederholen.
Der andere Sanitäter bereitet mich auf meinen Einsatz vor, während der Officer dich über sein Funkgerät beschreibt. Sie wissen nicht, wer du bist. Ich weiß auch nicht, wer du bist – doch bald schon werden wir uns sehr nah sein. Ich werde in deinem Inneren sein. Eine solche Intimität will niemand von uns, doch wir brauchen sie beide. Das ist schließlich meine Bestimmung. Und was ist mit dir? Du hast keine Wahl.
»Verabreichung des Naloxons.«
»Pass auf, dass du den Muskel triffst.«
»Ich treffe immer.«
Die Nadel dringt tief in deinen linken Oberschenkel – und ich ströme durch dein Muskelgewebe auf der Suche nach Kapillaren, die mich zu immer größeren Blutgefäßen bringen. Und ja – du lebst noch! Ich höre deinen Herzschlag! Langsam und schwach, aber vorhanden!
Ich gleite dank deines schleppenden Herzschlags in deine Herzkammern und wieder raus, weiter nach oben zu deinem Gehirn. Nur dort kann ich dich retten. Ich werde dich aus ihren Fängen reißen.
Sie.
Die anderen. Denen du wichtig bist, solange sie dich fest umschlungen halten, als wärst du bloß ein abgewetztes Kuscheltier. Sie wissen nicht, was Liebe ist – sie kennen nur Besitz. Sie versprechen dir Erlösung und belohnen dich … hiermit:
Dreißigmal drücken, zweimal beatmen. Und mit mir.
Du gehörst dazu und Menschen, die so ähnlich sind wie du, die ihnen Macht verliehen haben und ihnen Tag für Tag immer mehr Macht geben. Denn nur du allein kannst genug Strom erzeugen, um die hell aufblitzenden Lichter ihrer ewigen Party weiter leuchten zu lassen. Warum erkennst du nicht, dass die anderen – meine brutalen Cousins – Krebsgeschwüre sind, die Verführung verheißen? Die Leerstelle in deinem Verlangen sind. Sie empfinden sich als Götter, aber letztendlich sind sie genau wie ich. Nur Chemikalien. Vielleicht in komplexen Kombinationen, mag sein, dennoch sind sie lediglich Tinkturen, Destillationen und mickrige Pharmazeutika. Chemikalien, die von der Natur oder vom Menschen erschaffen wurden, um deine chemischen Prozesse zu optimieren.
Sie existieren nur, weil du ihnen das Leben schenkst. Sie können dein Leben nur mit deiner Hilfe beenden. Und wenn sie andere Rollen als die ihnen zugeteilten einnehmen, dann nur, weil du ihnen die Bühne dafür gibst.
Also wurde die Bühne errichtet. Das Publikum ist cool und leidenschaftslos – es will unterhalten werden, ist aber zu abgestumpft, um das überhaupt noch für möglich zu halten.
Doch wir müssen es versuchen, nicht wahr?
Deshalb erledige ich hier – zwischen dreißigmal drücken bei der Herzdruckmassage und den lebenserhaltenden Beatmungen – meine Aufgabe, versuche, dein Schicksal den kapriziösen »Gottheiten« zu entreißen.
Ich bin kein Superheld. Ich bin kein Zauberer. Aber ich kann dich retten. Obwohl es zu fünfzig Prozent nicht klappt. Häufig komme ich zu spät. Triumph und Trauerspiel werden auf dieser Bühne bis in alle Ewigkeit miteinander ringen.
Und heute steht das Trauerspiel aufrecht im schwindenden Rampenlicht.
Dein Herz beginnt zu flimmern. Dann krampft es sich zusammen, wie eine wütende Faust … und schließlich lässt es los. Die Welle ist weg. Ich kann meine Arbeit nicht verrichten, wenn ich dein Gehirn nicht erreiche. Die Sanitäter machen mit der Wiederbelebung weiter, doch das wird nichts daran ändern, dass du dein Leben in einem abgeranzten Zimmer eines heruntergekommenen Hauses verloren hast, in einer Straße, die es bald nicht mehr geben wird.
Sie hängen dir einen Zettel an den Zeh, auf dem der Nachname von deinem Perso und die Initiale deines Vornamens stehen:
Ramey, I.
Und dann schieben sie dich raus, und mir bleibt nichts anderes übrig, als in deinen Adern zu verharren – eine weitere Chemikalie, die bei der Autopsie gefunden wird.
Ich verfluche die anderen.
Meinen seelenlosen Clan, der dich auf die Party gelockt und dann an diesem desolaten Ort liegen gelassen hat, wo selbst diejenigen, die dich retten wollten, zu abgeklärt sind, um auch nur eine einzige Träne zu vergießen.
Wenn ich sprechen könnte, ich schwöre dir, dass ich deine Geschichte erzählen würde. Zumindest so viel davon, dass ich mir ein Bild davon machen kann, wer du bist.
2Isaac, Ivy und der komplette Verlierer
Zwei Monate zuvor …
Ivy muss hier irgendwo sein, denkt Isaac Ramey, während er den Sündenpfuhl betritt und nach seiner Schwester sucht. Völlig klar, das ist eine Party nach Ivys Geschmack. Das Haus stinkt nach Kotze, Hormonen und Bier, und Isaac zuckt zusammen, als er durch das Wohnzimmer watet. Er geht an Gammlern, Ausgebrannten und Drogies vorbei – die alle viel zu high sind, um zu bemerken, dass Freak-Dancing zu Techno wie ein gespielter Krampfanfall wirkt, zumindest für einen annähernd Nüchternen. Was noch schlimmer wäre: ein echter Krampfanfall beim Tanzen – was ein zutiefst trauriger Tod wäre –, das Publikum würde einfach langsam klatschen, während man sich in Richtung Jenseits krümmt und windet.
Isaac muss sich konzentrieren. Er kämpft sich durch den Morast. Ein Mädchen mit halbrasiertem Kopf. Ein Typ, der sich ganz eindeutig in die Hosen gepinkelt hat. Ein Kerl, der zu alt für diese Party ist und mit einem Mädchen spricht, das zu jung dafür ist. Das alles überrascht Isaac nicht. Und wenn es an diesem Abend so zugeht wie an jedem anderen Freitag, wird er Ivy hier finden. Ivy ist ein Jahr älter als Isaac, doch er hat häufig das Gefühl, ihr älterer Bruder zu sein.
Er geht eigentlich ganz gerne auf Partys. Als Elftklässler war er schon bei etlichen Feten gewesen, wo Dinge passierten, von denen seine Eltern nichts erfahren sollten … Aber er geht nicht zu solchen Feiern wie seine Schwester. Wo zwielichtige Dinge nicht in Hinterzimmern, sondern völlig ungeniert vor den Augen aller stattfanden – wo die Traurigen und die Verzweifelten ihre Hirne in Hydraulikpressen stecken würden, nur um ihre Endlichkeit zu vergessen.
Er geht raus. Im überwucherten Innenhof entdeckt er einen amöbenförmigen Pool, der zu klein für Schwimmzüge ist und in dem man sich wegen der Größe nur treiben lassen oder heimlich reinpinkeln kann. Weswegen das Wasser wahrscheinlich trüb und grünlich ist und an ein Versuchsobjekt für Bioterrorismus erinnert.
Schnell entdeckt Isaac seine Schwester – ihr schlumpfblaues Haar ist nicht zu übersehen. Ivy und Craig, ihr kompletter Verlierer-Freund, der hier wohnt, sind am Pool. Er ist der personifizierte Albtraum ihrer Eltern: abgeknabberte Fingernägel, geschmacklose Tattoos und ein Man-Bun, der ihm wie ein Tumor aus dem Kopf wuchert.
»Ivy«, ruft Isaac, als er in der Nähe ist. Er muss sie dreimal rufen, bis sie ihn hört.
Sie ist überrascht, ihn zu sehen.
»Mom und Dad wissen, dass du abgehauen bist, und sie werden bald völlig ausrasten.«
»Deswegen haben sie dich losgeschickt?«
»Sie haben keinen blassen Schimmer, wo du bist, und wissen auch nicht, dass ich losgefahren bin, um dich zu suchen.«
Ivy dreht sich um und geht weg – so reagiert sie auf alles, was ihr nicht gefällt. Besonders wenn sie getrunken hat. Isaac folgt ihr und packt sie, damit sie nicht ins Gebüsch stolpert.
»Wenn sie von der Party Wind bekommen und dich hier in diesem Zustand antreffen, bekommst du jede Menge Probleme. Morgen wirst du mir dankbar sein.«
Inzwischen hat Craig seine beiden Gehirnzellen aktiviert und Isaac bemerkt.
»Hey, macht der Typ dich blöd an?«, fragt er Ivy.
»Maul, Craig. Das ist mein Bruder, den du schon mindestens sechsmal gesehen hast.« Jetzt wendet Ivy sich wieder an Isaac. »Ich bin nicht bekloppt. Du musst mich nicht retten. Geh nach Hause und lerne, oder was du halt sonst an einem Freitagabend machst.«
»Genau«, pflichtet ihr Craig bei, »hör, was sie sagt. Sie will mit mir Party machen.«
Da entdeckt Isaac das Drogentütchen in Craigs Hand, das wie ein kleines Skrotum mit geheimem Inhalt hin und her baumelt. Der Anblick reicht, um etwas Animalisches in Isaac zu entfachen, das ihn Craig das Tütchen aus der Hand schlagen lässt – es landet im Pool.
»Ups, tut mir leid«, sagt Isaac. Er ist niemand, der Streit sucht, aber manchmal führt kein Weg daran vorbei.
»Bist du völlig irre …« Craigs Schock verwandelt sich in Wut, und er stürzt sich auf Isaac. Sie fangen an zu raufen, was schnell in einer richtigen Prügelei endet. Einige bekiffte Zombies kommen und gaffen – so wird die Schlägerei zum Zentrum der Partygänger mit begrenzter Aufmerksamkeitsspanne.
Isaac, der stärker ist, landet einige Treffer, Craig hat sich jedoch einen Pappbecher geschnappt und ihm etwas Hochprozentiges in die Augen geschüttet. Der Vollpfosten hat den eindeutigen Vorteil, dass er sich sehr gut mit schmutzigen Tricks auskennt.
Und nun schlägt Craig immer wieder auf Isaac ein, der gegen das Brennen in seinen Augen ankämpft. Hammerschläge auf Kopf und Körper. Alle Verletzungen, die Craig ihm zufügen kann, bevor Isaac seine volle Sehkraft zurückerlangt. Ivy versucht, dazwischenzugehen – vergeblich.
Schließlich hat sich Isaac ein wenig berappelt und schlägt Craig fest auf die Nase, bricht sie vielleicht, doch noch ehe Craig Schmerz verspürt, schubst er Isaac mit aller Kraft zu Boden.
Ivy eilt zu Isaac und hilft ihm hoch. Er blickt zu Craig auf, der jede Obszönität hören lässt, die ihm bekannt ist, während er seine stark blutende Nase umklammert.
»Hast du völlig den Arsch offen?«, schreit Ivy Craig an.
»Er hat angefangen!«, brüllt Craig zurück.
Das lässt Ivy nicht gelten. »Verpiss dich einfach!«
Craig dreht sich direkt um und zeigt damit, wie unwichtig ihm das alles ist. »Gut. Egal. Du und deine Familie seid eh Psychos.« Dann geht er zum Pool, stiert in das trübe Wasser und trauert seinem kleinen Plastikskrotum nach.
Erst als bei Isaac das Adrenalin nachlässt, bemerkt er den Schmerz in seinem Knöchel. Nein – er schmerzt nicht nur; er pocht. Das ist keine gewöhnliche Verstauchung, sondern ein Schmerz tief im Knochen. Isaac spürt schon, dass das eine langwierige Sache wird. Als seine Schwester sieht, dass er humpelt und das Gesicht verzieht, hilft sie ihm durch den Hof, und zusammen schaffen sie es zur Straße.
Bei Isaacs altem silbernem Sebring am Straßenrand angekommen, lehnt Isaac sich dagegen, atmet aus und bemerkt, dass er fast die ganze Zeit die Luft angehalten hat. Dann, als er die Autotür öffnet, tritt er zu fest auf den verletzten Knöchel auf und geht fast zu Boden. Vom Schmerz wird ihm schwarz vor Augen. Dann sieht er immerhin wieder etwas – doch der Schmerz lässt nur ein kleines bisschen nach. Schließlich wird Isaac klar, dass die vermeintlich einfache Aufgabe, nach Hause zu fahren, gar nicht mehr so leicht ist.
»Ich kann mit dem Knöchel nicht fahren …«
»Ach, wozu hast du denn zwei Füße?«
Isaac denkt darüber nach, doch dann schüttelt er den Kopf. »Ich fahre mit dem rechten Fuß. Ich weiß nicht einmal, ob ich das mit dem linken kann.«
»Gut. Dann fahre ich.« Sie streckt ihm die Hand entgegen und will die Schlüssel nehmen, aber Isaac gibt sie ihr nicht.
»Nein. Du bist betrunken. Oder Schlimmeres.«
Sie funkelt ihn an. »Von wegen Schlimmeres.«
»Sicher? Es sah so aus, als würde es darauf hinauslaufen.«
»Spar dir deine Moralpredigt!«
Isaac hält sich zurück. Er weiß, dass das fies war. »Ich rufe uns ein Uber«, sagt er. »Ich kann mein Auto morgen holen.«
Die App sagt, dass der Fahrer in drei Minuten da sein wird, und das heißt – wie immer –, dass es zehn Minuten dauert. Sie beobachten das Kommen und Gehen der Menschen ins und aus dem Haus. Nachbarn linsen wütend aus den Fenstern. Einer kommt auf die Terrasse und schreit Isaac und Ivy an, als wären sie die Veranstalter der Party, weil sie am Straßenrand warten.
»Wenn das nicht aufhört, rufe ich die Polizei!«
»Mach doch, Doofi«, sagt Ivy, und Isaac knufft sie, damit sie ruhig ist. Das Uber soll endlich kommen.
Schließlich ist es da, sie steigen hinten ein, Isaac tritt schon wieder zu fest auf und wimmert vor lauter Schmerz.
»Du hast mich nicht gerettet, weißt du«, erklärt Ivy ihm beim Losfahren. »Ich wäre auch allein gegangen. Irgendwann.«
Isaac nickt und entscheidet sich, ihr zu glauben, wünscht sich nur, das wäre müheloser möglich.
Jetzt sitzen sie in seltsamer Stille da und gehen wieder ganz normal miteinander um.
Ivy grinst. »Das Gesicht, das Craig gemacht hat, als du sein Zeug weggeworfen hast, war echt cool. Als hättest du ihm in die Fruit Loops gekackt.«
Trotz der Schmerzen muss Isaac lächeln. Ivy lehnt sich zu ihm, legt ihm den Kopf auf die Schulter und schließt die Augen.
»Es tut mir leid«, sagt sie.
Und er spürt, dass sie es ehrlich meint. Obwohl keiner der beiden weiß, was genau ihr leidtut.
Ivy glaubt fest daran, dass sie auch alleine gegangen wäre. Obwohl sie noch nie eine Party verlassen hat, bevor der Rausschmeißer kam und alle verscheuchte. Etwas zu glauben, von dem man weiß, es ist nicht wahr – das ist Ivys Superpower.
Als sie zu Hause ankommen, will sie vor Isaac durch die Tür gehen. Sie schaltet das Licht an und rechnet fest damit, dass ihre Eltern im Dunkeln auf sie warten. So ist das in diesem Haus. Der Verlauf ist vierstufig. Erste Stufe: Ihre Eltern explodieren, nachdem sie bemerkt haben, dass sie durchs Fenster abgehauen ist. Zweite Stufe: Sie machen die Erziehungsfehler des anderen Elternteils sieben bis zwölf Minuten lang für die Missetat verantwortlich. Dritte Stufe: Eine Stunde einsames Grübeln, bei dem ihr Vater sich vor seinen Computer zurückzieht, während ihre Mom Aufgaben im Haushalt erfindet, die es eigentlich nicht gibt – wie beispielsweise Gewürze alphabetisch sortieren oder die Strümpfe von anderen Menschen zusammenlegen. Stufe vier: Mindestens einer von ihnen wird im Wohnzimmer im Dunkeln sitzen, auf jedes Geräusch und jeden vorbeifahrenden Scheinwerfer lauern, bis Ivy nach Hause kommt.
Weil Isaac seine Schwester recht früh eingesammelt hat, sitzen die Eltern noch nicht im abgedunkelten Wohnzimmer. Stattdessen kommt ihr Vater aus der Küche. Er hat sich schon ordentlich in seine Wut hineingesteigert, und an seinem Blick kann Ivy erkennen, dass er bald explodiert.
»Guten Abend, Vater«, sagt Ivy und versucht, ironisch und unbeschwert zu klingen, kommt jedoch schnippisch rüber. Na ja, je eher sie ihn zum Schreien bringt, desto schneller ist das alles vorbei.
Ihre Mutter kommt aus dem Badezimmer. Ah – das ist also ein Hinterhalt. Das einzige nicht anwesende Familienmitglied ist Grandma, die seit einem Jahr bei ihnen wohnt. Sie ist klug genug, sich nicht einzumischen.
»Wie wäre es mit einer Erklärung?«, fragt Ivys Mutter, blickt aber stattdessen Isaac an. Ihn kann man einfacher lesen als sie.
Ivy legt sich eine Antwort zurecht, doch noch ehe sie die Gelegenheit dazu hat, platzt Isaac heraus: »Ich war auf dem Rückweg von Shelby und dachte mir, ich hole Ivy aus dem Kino ab.«
Diese Lüge ist recht glaubhaft. Also zumindest, wenn Ivy nicht immer noch sturzbetrunken schwanken würde. Sie fragt sich, ob die Eltern das Uber vor der Tür gesehen haben. Oh weh, das würde etliche Erklärungen nach sich ziehen.
Isaac versucht, sich sein Humpeln nicht anmerken zu lassen, als er durchs Zimmer geht, doch er stolpert fast. Ihr Vater kommt und stützt ihn. »Alles okay?«
»Ich … ich habe mir heute Nachmittag beim Training den Knöchel verstaucht. Nicht schlimm.«
Aber wenn Ivy eins weiß, dann: Ihre Eltern durchschauen immer, wenn man lügt. Selbst dann, wenn man nur sich selbst anlügt.
Deswegen will Isaac beweisen, dass mit seinem Knöchel alles so weit in Ordnung ist, er tritt wieder auf und geht fast umgehend zu Boden. Ivy fragt sich im Stillen, ob es ihren Freund auch nur annähernd so schlimm getroffen hat.
»Das sieht wirklich böse aus …«, sagt ihr Vater.
»Mir geht es gut, Dad«, erklärt Isaac mit genau dem richtigen Grad an Gereiztheit. »Ich hole Eis, okay?«
Dann blickt die Mutter auf Isaacs Stirn. »Ist das Blut?«
Und obwohl ein Teil von Ivy froh ist, dass nun nur Isaac im Fokus ist, ist sie auch genervt, weil seine Wehwehchen dafür gesorgt haben, dass sie völlig ignoriert wird.
»Ich war auf einer Party«, sagt Ivy, ohne mit der Wimper zu zucken. »Isaac hat mich abgeholt. Er ist in diesem Zustand, weil er Craig zusammengeschlagen hat.«
Wenn sie schon die Wahrheit sagt, kann sie dabei auch Isaac in einem guten Licht dastehen lassen und ihrem Vater die Genugtuung verschaffen, dass auch Craig von seinem Sohn zusammengeschlagen wurde.
Und nun richtet sich die negative Aufmerksamkeit wieder auf Ivy. Ihre Mutter hält eine Predigt über gebrochene Versprechen und wiederholt schlechtes Benehmen, bis sie sich leer geredet hat und traurig den Kopf schüttelt. Das ist der Gesichtsausdruck, den Ivy am schlimmsten findet. Dieser Du-enttäuschst-uns-schon-wieder-und-weißt-du-was?-Das-überrascht-uns-nicht-Blick.
»Ivy, ich weiß wirklich nicht, was wir mit dir machen sollen«, sagt sie.
»Warum müsst ihr überhaupt etwas machen? Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen?«
Doch das können sie nicht. Sie weiß, dass sie das nicht können. Das ist schließlich ihre Aufgabe als Eltern.
Dann lässt ihr Vater die Bombe platzen. »Wir haben beschlossen, für dich einen Termin bei Dr. Torres zu vereinbaren.«
»Nein!«, entgegnet Ivy. »Ich bin kein kleines Kind – ich werde nicht zu einem Kinder-Seelenklempner gehen!« Ivy wusste selbst gut genug, womit sie sich fertigmachen konnte, dafür brauchte sie die Eltern nicht. In Dr. Torres Praxis hing ein Bild von Pu der Bär in einem Apothekerkittel.
»Aber du musst mit einem Fachmann sprechen. Diese ganze Selbstmedikation tut dir nicht gut.«
Selbstmedikation. Ivy fragt sich, wann aus Trinken mit den Freunden etwas Medizinisches geworden war. Sie findet es unerträglich, einen Termin bei einem luschigen »Fachmann« mit Pullunder zu machen, dessen Diplom in einem billigen Rahmen an der Wand hängt. Aber wenn sie nur so noch Schlimmeres verhindern kann? Sie kennt jemanden, der jemanden kennt, der mitten in der Nacht aus dem Haus gezerrt und in eins dieser Arbeitslager für Teenager außer Rand und Band verfrachtet wurde. Würden ihre Eltern ihr auch so etwas antun? Sie weiß es gerade nicht.
Isaac ist aus dem Zimmer geschlichen. Sie hört, dass er sich in der Küche Eis holt, aber der Eiswürfelspender des Kühlschranks führt ein Eigenleben und spuckt die Würfel überall hin. Sie geht zu Isaac und sieht, dass er Schmerzen hat, weil er die Eiswürfel auf den Knien aufsammelt. Sie hilft ihm dabei und steckt die übrigen Würfel in einen Gefrierbeutel.
»Du hättest zerstoßenes Eis nehmen sollen«, sagte sie. »Oder einen Beutel mit tiefgefrorenen Erbsen.«
»Zerkleinertes Eis macht noch mehr Schweinerei, und Erbsen wären Lebensmittelverschwendung – und du weißt, dass Mom das in letzter Zeit fuchsteufelswild macht.«
»Ja«, sagt Ivy. »Das schaffe sonst nur ich.«
Sie hofft, dass sie Isaac damit ein Lächeln entlocken kann – vergeblich. Vielleicht hat er einfach zu starke Schmerzen. »Morgen früh sind sie darüber hinweg«, sagt er. »Sie mussten nur Dampf ablassen.«
Das mag sein. Aber Ivy weiß nicht, ob sie morgen darüber hinweg sein wird. Und damit meint sie nicht nur den Kater.
3Roxy hat sich nicht im Griff
Ich bin gerade so was von heiß. Und jeder weiß es. Es ist so, als würde mir die Welt gehören. Sie hat einfach keine Wahl, sie kann sich meiner Anziehungskraft nicht entziehen.
Als ich die Party betrete, drehen sich alle Köpfe zu mir um – oder wollen es zumindest, kämpfen aber dagegen an. Musik dröhnt mir entgegen. Laut und heftig. Sie erfasst meinen ganzen Körper. Die Blitzlichter hypnotisieren, und der Herzschlag gleicht sich an den Beat an, zwingt einen zum Tanzen. Wir sind die Schrittmacher, und im Augenblick bin ich diejenige, die den Takt angibt. Es gibt keine bessere Zeit, um ich selbst zu sein.
Al grüßt mich an der Tür, er hält in jeder Hand ein Glas Champagner. Er war schon immer derjenige, der jeden begrüßt – kein Neuankömmling entgeht ihm. Al ist älter als der Rest von uns, aber er hat sich gut gehalten.
»Meine Güte, Roxy, du siehst heute Abend aber gut aus!«
»Willst du damit sagen, dass ich gestern nicht gut aussah?«
Er kichert. »Meine Liebe, du wirst von Tag zu Tag unwiderstehlicher.«
Er lallt. Es hört sich fast wie ein Akzent an, so sehr hat er es perfektioniert. Konsonanten und Vokale verschwimmen miteinander. Wörter in einem Wasserfall. Er reicht mir eine Sektflöte, und ich nehme sie. So schüttelt man sich hier die Hände.
»Aber wo ist dein Plus-Eins?«, fragt Al und schaut hinter mich.
»Ich bin heute Abend allein hier, Al.«
»Allein?«, wiederholt er, als hätte ich etwas in einer fremden Sprache gesagt. »Das ist schade – was mache ich denn dann mit diesem zweiten Glas Champagner?«
Ich grinse. »Ich bin mir sicher, dass du dafür schon Verwendung finden wirst.«
»Auf jeden Fall.« Dann lehnt er sich zu mir und flüstert: »Vielleicht könntest du dir eine Begleitung von jemand anderem klauen.« Er blickt zu einer Gruppe Partygäste, die sich Addison ausgesucht haben. Er ist schrill gekleidet, als wäre er Mitglied eines Yachtclubs, der seinem Vater gehört. Strotzend vor Prestige und Privilegien. Doch wir wissen alle, dass er damit seinen Stammplatz an der Peripherie überkompensiert. Er ist auf der Party, aber die Party dreht sich nicht um ihn.
»Addi ist heute ganz schön eingebildet«, sagt Al. »Er hat länger an seiner Begleitung festgehalten als sonst – du solltest sie dir schnappen, bevor es jemand anderes macht.«
»Du sorgst immer für Probleme, Al.«
Er zieht eine Augenbraue in die Höhe. »Ich liebe einfach ein bisschen Drama.«
Addison steht an der Bar und starrt eine junge Frau an, die wiederum von seinem hypnotischen Blick in ihren Bann gezogen wird. Er erzählt ihr, wie viel besser er ihr Leben machen wird. All die Ziele, die sie mit seiner Hilfe erreichen wird, bla, bla, bla. Und jetzt prahlt er immer noch mit seiner überragenden Fähigkeit, den Unkonzentrierten Fokus zu verleihen. In manchen Momenten beneide ich ihn um seinen beschränkten Aufgabenbereich. In anderen tut er mir leid, weil er nie so großartig sein wird wie der Rest von uns. Wie ich.
Addison und ich sind zusammen aufgewachsen. Wir gehören zu unterschiedlichen Familienzweigen, aber unsere Umstände waren ähnlich. Wir wurden dazu geboren, anderen zu helfen und nicht uns selbst. Addisons Problem ist, dass er diesen einengenden Idealismus nie hinter sich gelassen hat. Ich vermute, weil er hauptsächlich mit Kindern und jungen Erwachsenen arbeitet, hält er noch ganz naiv an der Aufgabe fest, für die er erschaffen wurde. Sicher, auch ich erledige meine Aufgabe, wenn ich muss – beruhige aufgebrachte Nervenenden auf streng klinischer Grundlage –, aber das ist nur ein winziger Ausschnitt aus meinem neuen Wirkungskreis. Ich werde als Schmerzmittel bezeichnet, doch das greift viel zu kurz. Ich kann noch viel unterhaltsamere Dinge bewirken und solche, die Macht verleihen.
Als Al mein schwaches Grinsen bemerkt, sagt er: »Oh, wie gern ich sehe, wie du etwas ausheckst, Roxy.«
Ich zwinkere ihm zu und eile zu Addison. Ich werde ihm das Mädchen nicht abspenstig machen – ich habe kein Problem damit, heute allein hier zu sein. Schließlich braucht man von Zeit zu Zeit einen Gaumenreiniger.
Trotzdem macht es unheimlich Spaß, Addison zu ärgern.
Ich gehe zur Bar und dränge mich an den Stammgästen mit dem stumpfen Blick vorbei. Al hat längst ihre leeren Bierflaschen durch elegantere Flüssigkeiten in Kristallgläsern ersetzt, die die Leber herausfordern. Martini mit viel Gin. Gereifter Scotch. Sag Al dein Lieblingsgift, und er wird es dir besorgen.
Ich tauche in Addisons blindem Fleck auf und stehle ihm die Show. »Hi, ich bin Roxy«, sage ich zu dem Mädchen und unterbreche den Blickkontakt. Sie wirkt angespannt und fahrig. Als würde sie gerade durch einen Stromschlag hingerichtet, wüsste es aber noch nicht. Zu viel Addison macht das mit jedem.
»Hi! Tolles Kleid!«, sagt sie. »Welche Farbe ist das?«
»Welche Farbe soll es denn haben?«
Addison dreht sich empört zu mir um. »Wärst du nicht lieber woanders, Roxy? Würdest du nicht gerne jemand anderen mit deiner Anwesenheit beglücken?« Er blickt sich um. »Was ist denn mit Molly? Sie sieht gerade so aus, als könnte sie eine Freundin gebrauchen.«
Molly sieht wirklich elend aus. Tropfnass und geknickt. »Er war mir schon verfallen«, höre ich, wie Molly sich beschwert. »Ich hatte ihn – und dann hat mich irgendein Idiot in den Pool geschmissen!«
»Da wäre ich auch nicht gerade vor Freude in Ekstase!«, witzele ich. Dann lächele ich das Mädchen an, mit dem Addison geflirtet hat. »Molly ist eine Meckerziege – ich hänge viel lieber mit euch beiden rum.«
Addisons Gereiztheit gefällt mir – und kurz spiele ich mit dem Gedanken, mir das Mädchen unter den Nagel zu reißen … doch das wäre die Mühe nicht wert. Addison ist geradezu besessen von dem Gedanken, immer besser zu sein als andere. Wenn ich sie weglocke, wird er keine Ruhe geben, bis er denkt, er hätte mich wieder übertrumpft. Armer Addison. Er versucht, so zu sein wie ich, aber er klebt immer noch zu stark am Banalen, um jemals eine große Nummer zu sein.
Und wie zum Beweis teilt sich die Menge, und jemand mit einer gewaltigen Präsenz kommt auf uns zu. Das Oberhaupt von Addisons Familie. Er ist zweifelsohne der Übervater seines Familienzweiges. Ich trete einen kleinen Schritt zurück, weil ich weiß, dass mich das nichts angeht.
»Crys … alles zu deiner Zufriedenheit?«, fragt Addison seinen Boss.
Ich sehe, wie Addison in sich zusammensackt, doch er tut sein Bestes, um die Fassade aufrechtzuerhalten.
Aus der Ferne wirkt Crys klein und unscheinbar, doch bei näherer Betrachtung ist er überlebensgroß. Dadurch schüchtert er einen viel zu schnell ein. Auf Uneingeweihte kann das befremdlich wirken.
»Und was haben wir hier?«, fragt Crys und schaut zu dem Mädchen. Er lächelt finster, funkelt irgendwie. Vielleicht ist es aber auch nur der Glitzer auf seinen Fingernägeln. »Addison, möchtest du uns nicht vorstellen?«
Addison seufzt leise. »Crys, das ist … Das ist …«
»Catelyn«, erinnert ihn das Mädchen.
»Ja, genau. Catelyn.« Addison wird den Namen wieder vergessen, sobald sie außer Sichtweite ist. Genau wie ich. Das ist das Gute daran, wenn man im Augenblick lebt.
»Sehr erfreut«, sagt Crys. Dann nimmt er die schmale Hand des Mädchens und umschließt sie mit den Fingern wie eine fleischfressende Pflanze eine Mücke. »Tanze!«, sagt Crys und zieht sie auf die Tanzfläche. Sie sträubt sich nicht – und selbst wenn, sie hätte keine Chance. Crys bekommt immer seinen Willen.
Addison schaut ihnen hinterher, als sie gehen, schürzt die Lippen und schluckt all das hinunter, was er gern zu seinem Vorgesetzten gesagt hätte. »Er hätte mir etwas mehr Zeit mit ihr geben können.«
»So ist er nicht«, erinnere ich ihn.
Unter den flackernden Lichtern beginnen Crys und das Mädchen mit ihrem Tanz. Für sie wird das nicht gut enden. Denn vor dem Ende der Nacht wird Crys sie in die VIP-Lounge gelockt haben. Dort ist es intim. Und tödlich. Der Ort, an dem sie alles bekommt, was sie jemals wollte – und ganz viel, was sie nicht wollte. Die VIP-Lounge ist der Ort, wo die eigentlich wichtigen Ereignisse der Party stattfinden. Das Mädchen sollte sich glücklich schätzen, weil Crys der funkelnde Juwel seines Familienzweiges ist. Etwas Besseres als ihn gibt es nicht.
Addison schüttelt den Kopf. »Crys’ Stil gefällt mir nicht. Ich wünschte, ich hätte deinen Boss.«
»Nein, das tust du nicht.«
»Willst du mich verarschen? Hiro verlässt nie das Backoffice. Er lässt dich dein Plus-Eins zu ihm bringen, wenn du bereit bist.«
Ich streite mich nicht mit ihm. Niemand weiß, wie es ist, unter den Fittichen von jemand anderem zu stehen.
»Wirst du wieder rausgehen und dir jemand Neuen suchen?«, frage ich ihn.
»Warum? Damit mir die auch wieder weggenommen wird?«
»Vielleicht ist das einfach nicht deine Party, Addison.« Und obwohl es als aufrichtiger Hinweis von einer Freundin gemeint ist, versetzt es ihm offensichtlich einen Stich.
»Alles verändert sich ständig, Roxy. Crys wird nicht immer der Anführer meines Familienzweiges sein. Jemand Kluges kann die Leiter erklimmen.«
Mir ist fast zum Lachen zumute, aber ich erspare ihm meinen Spott. Davon bekommt er in seiner Familie schon genug ab. »Du meinst jemand, der so klug ist wie du?«
»Möglich.«
»Aber du hast noch nie jemanden in die VIP-Lounge mitgebracht. Du warst nie bis zum Ende mit jemandem zusammen. Das liegt dir nicht.«
Er blickt mich finster an. »Nur weil ich es noch nicht getan habe, bedeutet das nicht, dass ich es nie tun werde«, sagt er und zischt empört ab.
Als er weg ist, gehe ich auf die Dachterrasse, um etwas Luft zu schnappen. Der Club liegt sehr weit oben und bietet einen phantastischen Ausblick auf die Welt – die vielen funkelnden Lichter der Stadt. Jeder Stadt – hier funkeln die Lichter immer, weil immer Nacht herrscht. Das Datum verändert sich, das Bild bleibt dasselbe. Die Bar schließt nie. Der DJ hört nie auf, einen Song in den anderen übergehen zu lassen. Dieser Ort existiert in diesem goldenen Moment, wenn der Bass einsetzt.
Ich gehe zu Al, der sich auch gerade eine kurze Auszeit nimmt, am Geländer steht und auf alles hinabblickt. Die Turbulenzen und die Spannung. Die Winde, die zugleich Auftrieb verleihen und zerstören.
»So viele Partys da unten«, sage ich.
»Es gibt nur eine Party«, erklärt Al. »Beim Rest handelt es sich um matte Abklatsche von dieser hier. Die Menschen spüren es, greifen danach, können sie aber nicht finden. Nicht ohne Einladung.«
Und dann höre ich eine Stimme zu meiner Linken. »Wünschst du dir manchmal, wir könnten es besser machen?«
Ich drehe mich um, und vor mir steht eine kleine Gestalt in einem Batikkleid. Ihr Gesichtsausdruck ist schwer zu deuten, und um ihren Hals hängt eine schwere Diamantkette, die ganz und gar nicht zu ihrem Stil passt. Wenn man es überhaupt Stil nennen kann.
»Es besser machen?«, fragt Al, den der Gedanke belustigt. »Wie denn, Lucy?«
»Weißt du«, sagt Lucy, als wäre es ganz offensichtlich, »indem wir herausfinden, was wir eigentlich hätten sein sollen. Im Grunde unseres Wesens.«
»Na dann«, sagt Al mit seinem süffisanten Grinsen. »Viel Glück dabei.«
»Wir sind eben, wie wir sind, Lucy«, sage ich, um sie zu unterbrechen. »Das wird sich nicht ändern, deswegen könntest du es genauso gut hinnehmen.«
»Nun«, sagt sie, »man wird ja wohl noch träumen dürfen.« Dann geht sie wieder rein und streckt die Arme zu den Seiten aus, als hätte sie gerade entschieden, ein Flugzeug zu sein.
»Ich mochte sie noch nie«, sagt Al. »Irgendwas an ihrem Blick ist total abstoßend.« Dann geht er wieder rein, um die Neuankömmlinge zu begrüßen und allen einen frischen Drink zu holen.
Ich bleibe draußen und schaue auf das Lichtermeer.
Wünschst du dir manchmal, wir könnten es besser machen?
Die Frage wurmt mich. Ich bin besser. Ich bin auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit, werde von den Menschen geliebt, die wichtig sind, und die Unwichtigen hassen mich, weil sie sich danach sehnen, so zu sein wie ich.
Addison mag verbittert sein, ich aber nicht. Es ist an der Zeit für mich, wieder rauszugehen und mir jemand Neuen zu schnappen. Ich bin bereit für mein nächstes Plus-Eins.
4Die Krümmung der Erde
Isaac
»MIT, Stanford, Princeton oder Caltech«, erklärt Isaac seinem akademischen Betreuer. »Diese Unis bieten die besten Studiengänge für Raumfahrttechnik im ganzen Land an.«
Mr. Demko verzieht die Lippen zu einem ironischen Grinsen, das auch irgendwie von oben herab ist. »Du möchtest also Astronaut werden.«
»Nein«, sagt Isaac und versucht, etwas weniger herablassend zu wirken als Demko, der genauso falschliegt wie alle anderen, denen er davon erzählt hatte. »Ich will die Raumschiffe entwerfen, mit denen die Astronauten ins All fliegen. Ich werde Triebwerksingenieur.«
»Oha, verstehe«, Demko tippt gleich irgendwas auf seinem Computer und versucht ganz offensichtlich, sich schnell über Studiengänge für Triebwerksingenieure zu informieren. Es ist nicht so, dass Isaac Mr. Demko nicht leiden kann, aber es nervt ihn, dass er ein Teil der Lernkurve seines Tutors ist.
»Also … willst du irgendwann einmal für die NASA arbeiten?«
»Strahlantriebslabor«, erklärt Isaac ihm. »Das gehört zur NASA. Die tüfteln den Raketenantrieb aus, wissen Sie? Bevor das Raumschiff dann tatsächlich ins Weltall geschossen wird.«
Isaacs Freund Chet hat einen Onkel, der mal für JPL gearbeitet hat, deswegen hat er zumindest einen Kontakt. Isaac erhofft sich insgeheim, dass er eines Tages als Ingenieur mit Bachelorabschluss bei JPL arbeitet und dann von einem Headhunter von SpaceX oder einem anderen bahnbrechenden Raumfahrtunternehmen abgeworben wird, das bis dahin führend in dieser Branche sein wird. Er weiß, dass der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus der erste Schritt ist, dorthin zu kommen. Man muss kein Astronaut sein, um die Erdkrümmung zu sehen.
»Es gibt viele Unis mit exzellenten Programmen für Antriebstechnik«, sagt Mr. Demko. Dann grinst er, als er sich die Liste mit den Unis anschaut, die er zusammengestellt hat. »MIT, Stanford, Princeton und Caltech – genau, wie du gesagt hast … Aber vielleicht möchtest du dich noch ein wenig weiter umschauen. Ich will damit nicht sagen, dass du dort nicht angenommen wirst, aber schau dir mal die Zulassungspunktzahl am MIT an, sie liegt bei 4,18.«
»Ich weiß, und ich habe nur 3,77 – aber bis ich mich bewerben muss, kann ich 3,93 schaffen, und ich weiß ganz sicher, dass das MIT letztes Jahr einige Freshmen mit weniger als 4,0 Punkten angenommen hat.«
Mr. Demko blickt noch mal auf seine Tabelle. »Hier steht, du spielst Fußball?«
»Ja …«
»Bist du gut?«
Isaac zuckt die Schultern und weiß, worauf Demko damit hinauswill. »Also, ich bin Mannschaftskapitän … und so gut wie jeder denkt, dass er wegen Fußball ein Stipendium bekommt, aber niemand bekommt eins.«
Demko schnieft daraufhin. »Du bist realistisch. Damit hast du einen Vorteil gegenüber den meisten anderen Schülern, mit denen ich hier spreche.« Dann beugt er sich über den Tisch. »Aber die Sache ist die: Ein einfaches Kopfnicken von einem Talentscout könnte dir den Weg ebnen. Sogar ohne ein Stipendium könnte dieses Nicken aus den 3,77 eine 4,0 machen …«
Isaac hatte zwar selber darüber nachgedacht, es aber aus dem Mund seines Beraters zu hören, macht es greifbarer. Stipendien sind Luftschlösser … aber Kopfnicken? Das passiert ständig.
Demko gibt Isaac noch Infos zu finanziellen Hilfen und Studienkrediten, die er wegen der Geldprobleme seiner Eltern definitiv brauchen wird.
Als Isaac das Büro verlässt, versucht er, trotz des Schmerzes in seinem Knöchel nicht das Gesicht zu verziehen. Er hat sich geschworen, dass ihn das nicht aufhalten wird. Er wird alles dafür tun, damit ihn seine Verletzung nicht bremst. Und jetzt kann er erst recht nicht zulassen, dass sie ihn auf dem Feld beeinflusst.
Er weiß, was er dagegen machen kann – er hat gestern Abend die bekannte Prozedur wiederholt. Drei Ibuprofen – eine mehr als empfohlen, aber weniger als die Höchstdosis. Dann zwanzig Minuten Eis – so kalt, wie er es gerade noch aushalten konnte, gefolgt von Wärme und dann wieder Eis, drei Wiederholungen. Morgens ist er früh aufgestanden, um es noch einmal zu machen. Allerdings war er nach wie vor empfindlich und humpelte, sein Knöchel war so geschwollen, dass er seine Schnürsenkel den ganzen Tag lang nicht binden konnte.
»Als ich in deinem Alter war, war das in Mode«, hatte ihm sein Vater gesagt. »Niemand hat sich die Schuhsenkel gebunden.«
Seine Fußballmannschaft hat heute Abend von sieben bis neun Training. Wenn er das verpasst, wird er dieses Wochenende nicht spielen. Doch das kommt nicht in Frage. Deswegen hat er den ganzen Tag über, immer wenn es möglich war, die Schuhe ausgezogen und sich den Fuß massiert, den Punkt gesucht, wo es am meisten weh tat, und dort den Blutfluss aktiviert. Blutfluss bedeutet Heilung.
»Vielleicht solltest du … weiß nicht … zum Arzt gehen oder so?«, schlägt seine Irgendwie-Freundin Shelby vor. Shelby ist eine Meisterin im Verklausulieren. Wenn sie etwas sagt, legt sie sich nie richtig fest. Das ist eine ihrer vielen liebenswerten Eigenschaften und wird sie vielleicht eines Tages zu einer guten Politikerin machen – denn das möchte sie werden. Obwohl sie den Begriff »Politikerin« hasst. Sie sagt lieber »Staatsdienerin«.
Das Problem mit Ärzten ist aber, dass sie alle Sportler über einen Kamm scheren. Egal, wie er sich seine Verletzung geholt hat, er würde für zwei Monate so einen Darth-Vader-Schuh verpasst bekommen – und weg wäre sie, seine Position im Team, ebenso wie sämtliche Hoffnungen, von einem Talentscout entdeckt zu werden. Das schmerzt mehr als ein pochender Knöchel.
»Wie ist das passiert?«, fragt Shelby.
»Bin mit dem Freund meiner Schwester aneinandergeraten«, erklärt Isaac ihr. »Ist schon okay – ich hab ihm auch ordentlich eine verpasst.« Nur dass Craig gerade nicht in seinem Haus rumhumpelt, an dessen Tür eigentlich ein Schild mit der Aufschrift »Vorsicht, Biogefährdung« hängen müsste. Isaac kann sich vorstellen, dass seine Nase schon verheilt, während er high wird und Videospiele auf seinem Wasserbett spielt. Ivy beschwert sich immer über sein dämliches Wasserbett. Es missfällt Isaac, dass Ivy wahrscheinlich Zeit darin verbracht hat.
»Ich hab gehört, dass Ivy vielleicht auf eine andere Schule geschickt wird«, sagt Shelby.
Isaac denkt an seine Schwester, und einen Augenblick lang scheint sein Knöchel noch mehr zu schmerzen. Er weiß, dass das reine Kopfsache ist. Er würde so gerne etwas für Ivy tun, doch sie nimmt es ihm immer übel, wenn er sie und ihre saudummen Entscheidungen kritisiert. Nicht dass Isaac nur hervorragende Entscheidungen trifft – jedoch lernt er meistens aus ihnen. Leider vermutet er, dass bei seiner Schwester nur auf die harte Tour etwas hängenbleibt.
Ivy
Ivy verbringt die Mittagspause mit ihren Freunden. Obwohl die Bezeichnung Freunde nicht richtig passt. Sie reden immer nur über sich selbst. Oder über die Partys, die sie schmeißen. Oder darüber, wer einen Handstand auf einem Bierfass gemacht hat und danach einen Filmriss hatte und wo man das auf Social Media bewundern kann.
»Du glaubst einfach nicht, wer meinen Post gelikt hat«, sagt TJ und hält das Bild hoch, auf dem er sich die Zähne mit Photoshop kühlschrankweiß gezaubert hat.
»Rembrandt?«, fragt Ivy trocken.
»Ist das ein Influencer?«, fragt Tedd.
»Nee, eine Zahnpastamarke«, antwortet Ivy sarkastisch.
Niemand lacht, doch nun schneidet Tess das heiß diskutierte Thema an, ob das Schlucken von Zahnpasta Hirnschäden verursacht. Tess und TJ sind ein Paar. Sie sind ganz eindeutig Seelenverwandte.
Es ist schwer, echte Freunde zu haben, wenn niemand deinen Humor versteht. Deswegen konzentriert Ivy sich wieder auf ihr mitgebrachtes Mittagessen; denn das Schulessen ist eklig, seitdem ein Staatsbeschluss sämtliche Aromen verboten hat, um es weniger ungesund zu machen. Nicht gesund, nur weniger ungesund. Ivy beschwert sich nicht, weil es total öde ist, über das Essen zu schimpfen. Als Senior darf sie den Campus zum Essen verlassen, doch das lohnt sich irgendwie nicht.
Sie betrachtet die einzelnen Gruppen, bei denen es sich – ganz anders als in Fernseh-Highschools – weniger um Cliquen als um Rettungsboote handelt. Diejenigen, die in keins einsteigen können, werden zwar nicht unbedingt gemobbt, sondern erfrieren eher im eisigen Wasser, weil sich niemand um sie kümmert.
Man kann die Leute nie eindeutig in beliebte Kids oder Drogies oder Checker-Computerkids einteilen – weil die Band-Kids, die früher nur eine musikalische Kakophonie zum Besten gegeben haben, inzwischen Talent erkennen lassen, und die Checker-Kids gerade immer beliebter werden und es allen dämmert, dass smart gut ist und es tatsächlich eine Zukunft gibt.
Isaac sitzt mit seinen eigenen Freunden an einem Tisch gegenüber der Cafeteria. Sie stammen aus allen sozialen Schichten, nichts Greifbares verbindet sie, und dennoch sind sie einander treue Freunde. Isaac sagt etwas. Die anderen lachen. So sollte es unter Freunden sein.
Zur selben Zeit spielen Ivys Freunde gelangweilt Was magst du lieber?.
»Glatte oder geriffelte Pommes?«
»Bier oder Wodka?«
»Ketchup oder Ranch-Dressing?«
Ignorieren. Ignorieren. Ignorieren. Nichts findet Ivy schlimmer als öde Unterhaltungen. Das und Shelby Morris – Isaacs hochnäsige Freundin. Sie lebt in ihrer eigenen Welt eingebildeter moralischer Überlegenheit, und Ivy weiß nicht, wie die Menschen in ihrer Umgebung das ertragen. Niemandem, der mit seiner Familie einen Luxusurlaub in Afrika verbringt, ein gestelltes Foto mit einem unterernährten Elefanten macht und es zwei Jahre lang als Profilbild nimmt, ist zu trauen. Ivy weiß nicht einmal, was Isaac an ihr findet. Das ist nur eins von vielen Dingen, bei denen sie nicht einer Meinung sind. Obwohl es an Geschwisterliebe nicht mangelt, sind Isaac und Ivy in vielen Bereichen nicht auf einer Wellenlänge. Ivy kommt besser klar mit Menschen wie Craig. Mit fröhlichen, sorglosen Verlierern. Sie fragt sich, ob sie deswegen auch eine Verliererin ist.
In der Zwischenzeit machen ihre Freunde weiter mit ihren Gegenüberstellungen:
»Filter oder filterlos?«
»Hund oder Katze?«
»Biggie oder Tupac?«
An dem Punkt steht Ivy auf, sie hat jetzt genug.
»Wohin gehst du?«, fragt Tess.
»Mars oder Mond«, antwortet Ivy und schnappt sich ihr Mittagessen. Für ihre Freunde könnte sie ebenso gut die Erde verlassen. Sie befindet sich so oder so nicht mehr in ihrem Universum.
In Ivys Kopf schwirren in letzter Zeit Tausende Gedanken umher. Sie hat ihren Eltern versprochen, dass sie sich Hilfe suchen würde. Das ist jedes Mal dasselbe, seit Ivys Kindheit – zuerst Spieltherapie, dann Gesprächstherapie, dann Verhaltenstherapie und natürlich Medikamente, die sie nie konsequent eingenommen hat.
ADHS. So heißt ihre Krankheit – ohne das H, aber ADS hört sich total veraltet an. Ivy lacht über den Gedanken, sie könnte eine Aufmerksamkeitsstörung haben; sie kann sich gut konzentrieren, wenn sie allein ist – sie muss es nur wollen. Ihre Noten sind schlecht, weil sie sich nicht konzentrieren will. Das redet sie sich zumindest ein.
Ivy steigt in einen Bus. »Fährt der in die Stadt?«, fragt sie.
»Nur wenn du ihn entführen willst«, entgegnet der Busfahrer fröhlich.
»Das habe ich nicht vor.« Ivy zeigt ihre Fahrkarte. »Aber wer weiß, was heute noch alles passiert.«
Bei Schulschwänzausflügen hat Ivy sich sonst immer Isaacs Auto ausgeliehen, doch dieses Mal hat es sich nicht richtig angefühlt, ihn danach zu fragen – nach dem, was gestern Abend los war. Sie sollte ihn nicht immer in diese schwierigen Situationen bringen.
Ivy setzt sich, aus den Kopfhörern dröhnt Wutever Werx, ihre Lieblingsband – der perfekte Soundtrack zum Schuleschwänzen. Schließlich kommt der Bus an der vorletzten Haltestelle an. Ihrem Lieblingsort auf der ganzen Welt.
Dem City Art Museum.
Kunst war immer schon Ivys Ding. Kunst tröstet sie. Es ist das Einzige, das sie gut kann. Sie hatte Kunst an der Highschool belegt, aber es wurden nur die Schüler zu den anspruchsvolleren Kursen zugelassen, die den Kunstlehrern in den Hintern krochen.
Lehrer mögen Ivy nicht. Sie weiß, dass es nicht persönlich gemeint ist, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Ivy steht für sie für einen bestimmten Typ Schüler. Und diese Art von Schüler erschwert ihnen das Leben auf erstaunlich vielfältige Weise.
Das ist okay. Ivy kann Lehrer auch nicht leiden. Vielleicht käme sie mit Lehrern auf einer anderen Schule besser zurecht. Einer Kunstschule oder so. Aber das ist natürlich nur ein Hirngespinst. Ihre Eltern würden so etwas nie bezahlen. Die Chance, dass sich die Investitionen rentieren, ist einfach zu gering.
Die harsche Realität sieht so aus, dass sie kurz davor ist, ihr Senior Year nicht zu schaffen. Dann müsste sie dieses Halbjahr im Herbst wiederholen oder einfach akzeptieren, dass sie die Highschool nicht beenden wird. Sie weiß schon, dass sie – falls sie im Herbst wiederholen müsste – es nicht hier machen würde. Dazu würde man sie auf eine andere Schule schicken.
»Dafür muss man sich nicht schämen«, hatte Mr. Demko ihr erklärt. »Du brauchst einfach eine neue Bildungserfahrung.« Was für ein Bullshit.
Der Bus hält am Museum. Ivy weiß, dass diesen Monat eine Wanderausstellung von van Gogh gezeigt wird. Er ist einer ihrer Lieblingskünstler. Seine Probleme schienen unüberwindbar, und dennoch hatte er nicht deswegen, sondern trotzdem Erfolg. Sämtliche großartigen Kunstwerke erschuf er, als es ihm gut ging, und nicht, als er kurz davor war, verrückt zu werden. Häufig benutzte er satte Blautöne. Damals fing Ivy an, ihr Haar Voodoo-Blau zu färben. Die meisten dachten, dass sie es aus einer Art Teenager-Rebellion heraus tat, doch das Gegenteil war der Fall. Für sie war es eine Verbindung mit etwas, das ihr wichtig war. Es brachte ihr die Person näher, die sie wirklich war.
Ivy schnappt sich ihr eingepacktes Mittagessen und setzt sich auf eine Bank inmitten von so lebhaften Kunstwerken, dass sie die wilden Pinselstriche fast schon in ihrem Gehirn spüren kann. Chaos, dem Form und Struktur verliehen wurden. Ihr Lieblingsbild ist jedoch eines, das neben den grell leuchtenden Nachbarn fast untergeht. Vase mit Nelken. Es ist dafür berühmt, nicht berühmt zu sein. Ivy weiß alles darüber, weil es sie fasziniert, seitdem sie es zum ersten Mal gesehen hat. Das Gemälde stammt aus van Goghs Geht-so-Periode. Nur eine Studie zu Licht und Farben. Es war Jahrzehnte lang verschwunden, nachdem es eine jüdische Familie verkauft hatte, um mit dem Geld aus Deutschland vor den Nazis zu fliehen. Jahre später tauchte es in Hollywood auf, hinter einer Kinoleinwand im Wohnzimmer eines Filmmoguls, dann verschwand es wieder jahrelang in einem Museumslager. Ungeliebt. Unbeachtet. Bis jemand irgendwo entschied, dass diese Nelken ein wenig Licht verdienten. Ivy kann das gut nachvollziehen.
Sie atmet tief ein und spürt, wie van Goghs Inspirationen – und auch seine trivialeren Gemälde – ihre sorgenvollen Gedanken beruhigen. Wenn Ivy das braucht, um ihr Hirn zu überlisten, dann tut sie das eben. Doch irgendwann wird sie die breiten Pinselstriche ihres eigenen Lebens malen müssen.
Es gibt nur drei Möglichkeiten: andere Schule, abbrechen oder in die Gänge kommen und sich von Grund auf verändern. Und wenn sie sich nicht jetzt für Option Nummer drei entscheidet, bleiben nur die ersten beiden. Aber Ivy weiß, sosehr sie den Gedanken auch verabscheut, dass sie diese Veränderung nur mit ein wenig Hilfe bewerkstelligen wird.
Ich geh zu Torres und hole mir die richtigen Medikamente, redet sie sich ein, während sie in ihr Sandwich beißt und auf die Blumen starrt, die schlechte Behandlung erfahren haben, aber nie gewelkt sind. Ritalin, Adderall, egal, was er verschreibt, ich werde es nehmen. Ich werde es regelmäßig einnehmen und mein Leben auf die Reihe bekommen.
Ivy isst ihr Mittagessen auf, allein – ohne Lärm, ohne Ablenkung, nur sie und van Gogh. Er erinnert sie an leichtere Zeiten, als sie einfach ein kleines Mädchen bei einer Exkursion war, wo Hasenbrote immer ein wenig besser schmeckten.
5Der Prinz der Aufmerksamkeit
Addison
Ich sitze mit meiner älteren Schwester Rita bei einem Klavierkonzert. Verbissen strickt sie an einem Schal, der bereits zweimal um die Welt reicht.
Auf der Bühne spielt ein Fünfzehnjähriger Rachmaninows Klavierkonzert No. 3 – ein Stück, an dem viele gestandene Pianisten scheitern. Ich will die Musik genießen, doch es gelingt mir nicht. Wie ironisch, dass sich der sogenannte Prinz der Aufmerksamkeit nicht konzentrieren kann.
»Du denkst zu viel, Addison«, erklärt Rita mir in dem für sie typischen wertenden Tonfall. »Hör auf, nachzudenken, und mach einfach.« Obwohl uns niemand hören kann, flüstert Rita, weil wir schließlich bei einem Konzert sind.
Von mir aus kann sie weiter eine Reihe nach der anderen stricken und Schränke sortieren, wie sie lustig ist. Ich will nicht so sein.
»Ich bin es leid, für andere zu arbeiten«, erkläre ich ihr. »Die Höhergestellten in unserer Familienhierarchie machen, was sie wollen, und kommen immer damit durch. Ich bin es leid, mich an die Regeln zu halten … bin es leid, bloß gewöhnlich zu sein.«
Ich denke an Crys, der alles haben kann, was er will und wann immer er will – oder, noch schlimmer, die Zwillinge Dusty und Charlie, mit ihren weißen Seidenanzügen und dem funkelnden Schmuck, die in privaten Logen rumhängen, so tun, als würde ihnen die ganze Welt gehören und als sorgten sie dafür, dass die Party zu ihnen kommt. Hauptsächlich denke ich aber an Roxy – die meint, sie sei inzwischen so viel besser als ich. Das hört nie auf weh zu tun.
»Hedonismus sollte man nicht beneiden«, sagt Rita in ihrem erhabensten Tonfall. »Alles, was Crys, die Coke-Brüder und unsere missratenen Cousins anfassen, verkommt – und sie hinterlassen immer eine Spur der Verwüstung …«
»Die sie nicht sehen«, erkläre ich, »weil sie nie zurückblicken.«
»Wir sind aber besser als sie. Wir haben die Macht, die Welt zu verändern; sie können sie nur zerstören. Wir sind wie Gärtner, Addison.«
»Ja, aber sie fressen sich mit dem voll, was wir anbauen.«
Rita zuckt nur die Schultern. »Was sie machen, ist nicht unser Problem.« Dann strickt sie noch eine Reihe ihres Schals, der immer konstant blassgelb bleibt und noch nie grün vor Neid geworden ist.
Auf der Bühne spielt der Junge fehlerlos. Den meisten Anwesenden ist nicht klar, welcher Kraftakt dahintersteckt – doch ich weiß es. Vor Jahren hätten die Eltern des Jungen bei der Vorstellung gelacht, dass er irgendwann einmal auf der Bühne stehen wird. Doch ich habe mich klammheimlich in sein Leben geschlichen und ihn beruhigt. Ihn zentriert. Ihm dabei geholfen, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Und dann hat er das Klavier entdeckt.
»Du siehst das alles völlig falsch, Addi«, sagt Rita. »Schau mal, was du hier geleistet hast. Da kannst du ganz schön stolz drauf sein.«
»Er wird den Applaus bekommen, nicht ich.«
Missmutig dreht Rita sich zu mir. In diesem Zustand finde ich sie schrecklich. »Du bist wirklich zum Miesepeter mutiert, nicht wahr? Zu eitel, das tut dir nicht gut. Ich glaube, du hast zu viel Zeit mit Roxy verbracht – sie hat einen schlechten Einfluss auf dich.«
Das bringt mich zum Lachen. »Du bist nur neidisch, weil ich Freunde in Machtpositionen habe.« Dann füge ich gewollt heiter hinzu: »Ich gehe sogar manchmal hoch auf die Party.«
Ich dachte, das würde sie aus der Fassung bringen. Rita ist jedoch weder schockiert noch beeindruckt.
»Ich war da auch schon mal«, erklärt sie. »Das ist nichts für mich. Ist es denn wirklich was für dich, Addison?«, fragt sie. »Gefällt es dir, oder tust du nur so?«
Die Frage trifft mich mehr, als sie sollte. Denn ein Teil von mir kennt die Antwort darauf.
»Warum bist du überhaupt hier?«, frage ich sie. »Der Junge auf der Bühne ist mein Zögling, nicht deiner.«
Rita legt ihr Strickzeug zur Seite. »Siehst du das kleine Mädchen vor uns? Sie kann kaum still sitzen. Ich wurde vor kurzem um Hilfe gebeten.«
Total typisch, dass man Rita bei so einem kleinen Problem direkt ruft. »Nur weil sie nicht still sitzen kann, heißt das nicht, dass sie dich braucht.«
Rita seufzt. »Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Entscheidung zu treffen, sondern unseren Zöglingen zur Seite zu stehen, sobald die Entscheidung getroffen wurde.«
»Unsere Zöglinge«, spotte ich. »Sogar unsere Sprache zeigt, wie banal wir sind.«
»Die Sprache bildet nicht unsere Banalität, sondern unser Verantwortungsbewusstsein ab«, sagt Rita. »Der Begriff erinnert uns daran, dass wir hier sind, um zu helfen und uns zu kümmern. Und die anderen auf der Party? Sie sehen Menschen als Opfer an, die man sich aneignen und dann dominieren muss. Ihre sogenannten Zielpersonen.« Dann zeigt sie auf die Bühne. »Willst du dieses Schicksal für den jungen Mann, für den du so viel auf dich genommen hast?«
»Natürlich nicht«, erkläre ich ihr. Aber ich weiß auch, dass es andere gibt, die älter sind – cleverer und abgestumpfter –, die den Unterschied zwischen Konsum und Missbrauch gut kennen. Ich hätte kein Problem damit, sie als Zielpersonen zu betrachten und sie mit der ganzen Kraft meines laserähnlichen Fokus zu beschießen.
Das Mädchen vor uns – Ritas Zögling – windet sich nun auf seinem Stuhl, Rita lehnt sich nach vorn und legt der Kleinen einen Teil ihres Schals über die Schultern.
»Es reicht«, sagt Rita sanft und bestimmt.
Das Mädchen wird ganz steif. Dann entspannt es sich, und Rita strickt zufrieden weiter.
»Siehst du? Jetzt ist alles besser.«
Ich könnte weitersprechen, aber wozu? Mit Rita ist es so, als würde man mit einem Fließbandroboter reden. Sie macht nur eine Sache, die aber sehr gut.
Bin ich etwa auch nur so etwas? Nur ein weiteres Werkzeug über einem Förderband, das immer dieselbe menschliche Form ausstanzt?
Auf der Bühne ist das Stück beendet, und der Junge, mit dem ich so hart gearbeitet habe, um diesen Moment zu erreichen, steht auf und verbeugt sich unter tosendem Applaus. Und obwohl ich wirklich gern vor Stolz strahlen würde, entscheide ich mich dazu, mich selbst zu verleugnen. Heute sträube ich mich dagegen, etwas anderes als gekränkt zu sein.
6Genaues Wissen, wie man etwas repariert
Isaac
Isaachat sich dazu entschieden, seinen verstauchten Knöchel zu ignorieren, damit dieser sein Leben nicht aus der Bahn wirft. Er hat sich selbst beigebracht, wie man mit dem linken Fuß fährt, und als an diesem Abend Training ist, legt er sich eine Stützbandage aus Neopren an, die von seinem Strumpf versteckt wird, wärmt sich fürs Fußball-Training auf und eilt aufs Feld.
Aber heute Abend läuft er noch langsamer als die Ersatzmannschaft. Die Bandage hilft nämlich gar nicht, und es dauert nicht lange, bis sie dem Trainer auffällt und er ihn aus dem Training nimmt. Er erklärt Isaac, er solle sich einige Tage lang ausruhen, damit der Knöchel heilen kann. Als Isaac protestiert, sagt er, er würde ihn beim Spiel aufs Feld lassen, wenn er dann wieder auf der Höhe sei – was auch immer das heißen mag.
Und deswegen – auch wenn er sich innerlich dagegen sträubt – fährt Isaac auf dem Nachhauseweg bei der Notaufnahme vorbei. Er erzählt seinen Eltern nicht davon – sie werden es erst erfahren, wenn sie den Bericht von der Versicherung bekommen, und dann werden sie sich streiten.
Er kommt an, kurz bevor sie schließen, und obwohl nur ein Patient vor ihm dran ist, fühlt sich die Wartezeit wie eine Ewigkeit an. Als er im Behandlungszimmer ist, merkt er, dass sowohl die Krankenschwester, die seine Vitalfunktionen überprüft, als auch der Arzt, der ihn untersucht, den Tag im Geiste schon für beendet erklärt haben. Der Arzt rattert die Standardfragen runter, dann wirft er einen Blick auf Isaacs Knöchel. Isaac versucht, nicht das Gesicht zu verziehen, als er auf den schmerzenden Punkt drückt.
»Es ist ein wenig gelb«, bemerkt er. »Haben Sie das schon länger?«
»Erst seit ein paar Tagen«, erklärt Isaac ihm.
»Sie sollten geröntgt werden, aber das Personal ist schon nach Hause gegangen. Kommen Sie morgen wieder, Sie müssen dann auch nicht warten.«
»Und das war es jetzt?«, fragt Isaac. »Kommen Sie morgen wieder?«
Der Arzt zuckt sehr professionell mit den Schultern. »Wir können hier leider nicht zaubern. Kommen Sie morgen, dann röntgen wir Sie.«
Eine Trainingspause hat auch ihre guten Seiten: Man kann ein wenig mehr Zeit mit seinen Freunden verbringen.
Am nächsten Tag hängen sie nach der Schule bis abends in der Garage seines Freundes Ricky ab, die er in ein Spaßzimmer umfunktioniert hat. Einer der wenigen Orte, die diese Bezeichnung tatsächlich verdienen. Es gibt einen Pool-Tisch, einen Spender für Soft Drinks und sogar ein paar antike Flipper-Automaten. Rickys Onkel gehört ein Schrottplatz, deswegen kommt ungefähr jeden Monat ein neues exzentrisches Stück dazu, das die Garage in ein Allheilmittel gegen Langeweile verwandelt. Die aktuellen Neuanschaffungen sind eine hundert Pfund schwere Großleinwand von der Jahrhundertwende und eine Spielekonsole, für die man einen speziellen Adapter braucht, weil es die Anschlüsse nicht mehr gibt.
»Dieses alte Nintendo ist jetzt wertvoller als damals, als es hergestellt wurde«, erklärt Ricky ihnen. »Und die Spiele sind sogar noch mehr wert als die Konsole.«