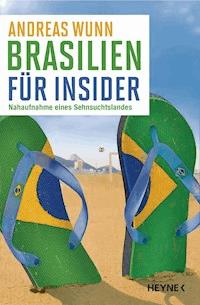16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die dramatische Geschichte einer Unternehmerfamilie und ein großer Vater-Sohn-Roman.
Als Jakob Auber erfährt, dass sein Vater im Sterben liegt, macht er sich auf ins Zuhause seiner Kindheit, an der Mosel. Dort beginnt er, sich mit der Vergangenheit seiner Familie zu beschäftigen. Sein Großvater Theodor Auber war im Wirtschaftswunder-Deutschland eine schillernde Figur. Er erfand ein Waschpulver, mit dem er ein reicher Mann wurde, bis er unter ungeklärten Umständen alles verlor. Seine Spurensuche führt Jakob bis nach Rio de Janeiro. Dort trifft er die Tochter des jüdischen Besitzers der Drogerie, in der die Karriere seines Großvaters einst begann. Jakob erfährt, was hinter Aufstieg und Fall des Familienimperiums steckt.
In seinem Roman erzählt Andreas Wunn eine große Geschichte von Vätern und Söhnen, Schuld und Sprachlosigkeit zwischen den Generationen und dem Glück einer Familie, das in den Händen zerrinnt wie Pulver.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Ähnliche
Über das Buch
Als Jakob Auber erfährt, dass sein Vater im Sterben liegt, macht er sich auf ins Zuhause seiner Kindheit, an der Mosel. Dort beginnt er, sich mit der Vergangenheit seiner Familie zu beschäftigen. Sein Großvater Theodor Auber war im Wirtschaftswunder-Deutschland eine schillernde Figur. Er erfand ein Waschpulver, mit dem er ein reicher Mann wurde, bis er unter ungeklärten Umständen alles verlor. Seine Spurensuche führt Jakob bis nach Rio de Janeiro. Dort trifft er die über 90-jährige Bella, Tochter des jüdischen Besitzers der Drogerie, in der die Karriere seines Großvaters einst begann und erfährt, was hinter Aufstieg und Fall des Familienimperiums steckt.
In »Saubere Zeiten« erzählt Andreas Wunn eine große Geschichte von Vätern und Söhnen, von Schuld und Sprachlosigkeit zwischen den Generationen und einer Liebe, die nicht gelingen will. Ein grandioser Vater-Sohn-Roman und die dramatische Geschichte einer Unternehmerfamilie – herausragend lebendig erzählt.
Über Andreas Wunn
Andreas Wunn, geboren 1975, wuchs in Trier auf und studierte Politikwissenschaften in Berlin. Für das ZDF berichtete er als Südamerika-Korrespondent sechs Jahre lang aus Rio de Janeiro. Heute leitet er das ZDF-Morgenmagazin und -Mittagsmagazin. Für seine journalistische Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. »Saubere Zeiten« ist sein Romandebüt. Er lebt in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Andreas Wunn
Saubere Zeiten
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Prolog
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Dritter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
An den Leser und die Leserin:
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für Noah
Prolog
Irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre besser gewesen, wenn meine Mutter früher gestorben wäre. Oder später. Aber nicht ausgerechnet ein paar Monate, nachdem ich eingeschult wurde.
Meine letzte Erinnerung an sie ist der Moment, in dem sie mir meine Schultüte überreichte. Es war Spätsommer. Wir standen vor dem mächtigen Schulgebäude aus rotem Backstein, das bestimmt schon hundert erste Klassen gesehen hatte. Die Sonne stand tief. Eine Eiche spendete Schatten. Meine Mutter roch nach Vanille. Sie zupfte meine Jacke zurecht. Sie gab mir einen Kuss, wischte mir danach den Lippenstift von der Wange und strich mir übers Haar. Sie trat ein paar Schritte zurück und schoss mit ihrer Polaroidkamera ein Foto von mir, zog das Bild aus dem Apparat und wedelte. In diesem Moment war sie wie eine Prinzessin mit Fächer. Dann beugte sie sich über mich, zeigte mir das fertige Foto, sah mir in die Augen und zog mich an ihre Hüfte und hielt mich. Mit dem Foto winkte sie meinen Vater, der lächelnd abseits stand, an meine andere Seite, drückte einer anderen Mutter die Kamera in die Hand und reckte sich ihr ausgelassen entgegen. Es ist das letzte Bild von uns. Wir lächelten alle drei.
Es hatte in den Monaten danach noch unzählige gemeinsame Momente gegeben. Aber ich kann mich nicht an sie erinnern. Es gibt keine Fotos davon. Eingebrannt in meinen Kopf hat sich der Augenblick, als Herr Fegedank an mein Pult trat. Er sagte, dass mein Vater auf mich wartete. Herr Fegedank war unser Klassenlehrer. Ein hagerer Mann mit warmer Stimme, strengem Blick und kalten Händen. Das wussten wir, weil er uns an den Ohren zog. Jetzt aber legte er mir eine Hand auf die Schulter. Die Hand war schwer. Ich spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Ich spürte es in meinem Bauch und in meinem Brustkorb. Mein Atem ging hektisch und flach. Die anderen sahen zu, wie ich mein Heft und mein Federmäppchen zusammenpackte. Die Schulsekretärin, die in der Tür stand, nahm mich bei der Hand und brachte mich ins Lehrerzimmer. Dort kniete sich mein Vater vor mich hin und sagte mir, was passiert war.
Das Flugzeug war am Vorabend in Frankfurt gestartet. Es sollte nach Kanada fliegen. In Kanada wohnte Mamas Onkel Hermann. Irgendwo über dem Atlantik verschwand die Maschine. Mein Vater hörte es an jenem Morgen in den Radionachrichten. Deutsches Flugzeug auf dem Weg nach Toronto abgestürzt. Vermisst über dem Nordatlantik.
An die Tage danach kann ich mich nicht erinnern. Von der Beerdigung habe ich nur schattenhafte Bilder im Kopf. Tanten, die ich kaum kannte, und besorgte Nachbarn in Schwarz. Feuchte Taschentücher in der Hosentasche. Sahniger Kuchen in meinem Mund.
Schon auf der Beerdigung kämpfte ich vergeblich gegen das Verschwinden meiner Mutter aus meinem Kopf. Ich konnte mich plötzlich nicht mehr an ihr Lachen erinnern, an ihre Stimme. Wäre sie später gestorben, so dachte ich irgendwann, und wäre ich älter gewesen – alle Erinnerung an sie hätte ein Fundament und einen sicheren Platz in mir gehabt. Wäre sie aber früher gestorben, wären der Schmerz und der Verlust nicht so brennend gewesen. Denn vielleicht hätte ich mich dann gar nicht an sie erinnert.
Doch so geriet ich immer wieder in Panik, weil ich sie zu vergessen begann. Noch konnte ich ihr Gesicht sehen. Ich konnte sehen, wie sie im Wohnzimmer in ihrem Lesesessel saß und las. Sie liebte ihren Lesesessel, er war schlicht, aber elegant und in einem Dunkelgrün gepolstert, das ich wunderschön fand, und stammte aus ihrer Studienzeit. Ich konnte mich an sie in ihrem Lesesessel erinnern. Ich konnte sehen, wie sie ihr Buch hielt. Sie las immer. Mich sah ich zu ihren Füßen oder auf ihrem Schoß. Manchmal blickte sie auf und lächelte mich an.
Ich habe mich nie wieder jemandem so nah gefühlt.
All die Bilder von ihr, sie verblichen vor meinen Augen. So wie ein Polaroid von Zauberhand ein Bild zeigte, erlosch umgekehrt die Erinnerung an meine Mutter. Ich wuchs mit der Gewissheit auf, dass meine Mutter und meine Bilder von ihr für immer verloren waren.
Kurz vor ihrer Abreise nach Kanada hatte sie mir ein knallrotes Plastikflugzeug geschenkt.
Mit so einem Flugzeug fliege ich zu Onkel Hermann, hatte sie mir erklärt. Ich liebte dieses Flugzeug und spielte in diesen Tagen oft damit. Ich startete auf meinem Bett und ahmte die Turbinengeräusche nach. Ich flog durch den Flur in die Küche, dann ins Wohnzimmer, die Fensterbank mit den Blumentöpfen entlang. Hinter dem Fernsehsessel begann ich mit dem Landeanflug und setzte schließlich auf dem Sofa auf, wo Kanada lag. Am Tag nach dem Absturz war mein Flugzeug verschwunden. Ich trauerte um meine Mutter, aber ich trauerte auch um mein Flugzeug. Und ich hasste mich dafür. Ich glaube, ich wusste schon damals, dass mein Vater es genommen hatte. Aber ich habe ihn nie danach gefragt.
Jetzt sitze ich hier und schreibe. Das Fenster ist geöffnet. Draußen dröhnt der Verkehr. Doch ich höre auch das Meer, das Tosen und Schäumen der Wellen.
Wenn ich heute an meine Mutter denke, denke ich auch an mein knallrotes Plastikflugzeug. Und an meinen Vater. Und ich spüre, dass ich schon damals begann, auch um ihn zu trauern. Denn nicht nur meine Mutter war in den Tiefen des Atlantiks versunken. In den Wochen und Monaten und Jahren danach fühlte es sich an, als wäre auch mein Vater in einem dunklen Ozean verschollen.
Erster Teil
1
Der Anruf kam nach der Spätkonferenz. Ich musste noch einen Text redigieren, das würde mich höchstens dreißig Minuten kosten. Die Nachrichtenlage war mau. Aber ich hatte inzwischen nichts gegen ruhige Tage. Mein Büro war ein Würfel aus Glas, ein Einzelbüro inmitten des geschäftigen Großraums. Ich starrte in den Computer und dachte über meinen Rücken nach, der schmerzte, weil ich zu viel saß. Mein Smartphone war auf lautlos gestellt und lag neben der Tastatur. Als es vibrierte, stellte ich mir vor, dass es sich wie von Geisterhand und in Zeitlupe Richtung Schreibtischkante bewegte, wie im Film. Nummer unbekannt. Ich ging nicht sofort ran, sondern wartete. Dann schubste ich das Handy über die Kante, fing es mit einer Hand auf und tippte mit dem Zeigefinger der anderen aufs Display.
»Hallo?«, sagte ich. Ich setzte mich gerade und streckte den Rücken. Ich meldete mich nie mit Namen, was meinen Vater jedes Mal halb verrückt machte.
»Spreche ich mit Jakob Auber?«
»Ja.« Manchmal ruft jemand an, und man weiß sofort, dass etwas passiert ist.
»Tut mir leid, Ihnen schlechte Nachrichten zu übermitteln. Ihr Vater ist bei uns auf die Intensivstation eingeliefert worden.«
»Was ist passiert?«
Als ich auflegte, hörte ich nur noch das Grundrauschen des Redaktionsraums. Tastengeklapper, Telefonklingeln, gedämpftes Lachen. Ich roch den Kaffee und schmeckte die trockene Luft der Klimaanlage. Ich starrte durch das Glas in den Großraum und sah das Gesicht meines Vaters. Seit Monaten hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihm. Nach meinem letzten Besuch hatte ich mir geschworen, ihn vorerst nicht mehr zu besuchen. Zwar hatte er nur noch mich. Aber ich war jetzt Ende dreißig und hatte keine Lust mehr, mich für meinen Beruf zu rechtfertigen.
Ich nahm die Tram Richtung Schönhauser Allee. Beim Aussteigen dachte ich darüber nach, ob das Gelb von Tram und U‑Bahn die Farbe Berlins ist oder doch das Grau des Winters. Zu Hause packte ich für den nächsten Tag ein paar Sachen.
Am Vormittag stieg ich am Hauptbahnhof in den ICE und saß Stunden später in der Regionalbahn und fuhr durch Rheinland-Pfalz. Nach Hause zu fahren, war eine Weltreise. Trier lag am Rande Deutschlands. Früher war es mir so vorgekommen, als läge Trier am Rande der Welt. Der Zug fuhr die Mosel entlang. In der Dämmerung sah ich die steilen Weinberge vorüberziehen, davor mein Spiegelbild in der Scheibe.
»Endstation Trier für Sie?«, fragte die Schaffnerin.
Ich nickte nur.
Es war zu spät, um direkt ins Krankenhaus zu fahren. Ich hatte einen Schlüssel zum Haus meines Vaters, zu meinem Elternhaus. Meinem Vaterhaus.
In diesem Reihenhaus konnte ich mich blind bewegen. Ich musste das Licht nicht einschalten. Ich wusste, wo jedes einzelne Möbelstück seinen Platz hatte. Ich wusste, dass die Wanduhr stand, weil meinem Vater das Ticken auf die Nerven ging. Ich wusste, dass die vorletzte Treppenstufe ins Dachgeschoss, wo wir als Kinder Schatzsuche gespielt hatten, knarrte (später hatte ich sie immer ausgelassen, wenn ich nachts nach Hause kam und oben noch bei offenem Dachfenster eine rauchen wollte).
Es roch wie immer. Nach Büchern und Beständigkeit. Hier hatte sich nichts verändert, seitdem ich nach dem Abitur ausgezogen war. Als ob die Zeit eingefroren war. Das fand ich abschreckend und rührend zu gleich. Abschreckend war für mich immer die bleierne Schwere dieses Hauses gewesen und das laute Schweigen darin. Nach dem Tod meiner Mutter ist es ein Trauerhaus geblieben, das habe ich meinem Vater zum Vorwurf gemacht. Davon spürte ich jetzt fast nichts mehr. Vielleicht weil mein Vater nicht hier war.
Ich machte Licht und ließ die Rollläden herunter. Auf dem Wohnzimmertisch lag eine Ausgabe des Trierischen Volksfreunds. Mein Vater las darin immer zuerst die Todesanzeigen. Die Zeitung war aufgeschlagen, das Kreuzworträtsel ausgefüllt. Ich blätterte zur Seite eins. In den Schlagzeilen ging es um den Klimawandel, den trockenen Sommer und dessen Auswirkungen auf die Weinlese.
Im Bücherregal gab es ein Fach für Familienfotos, direkt neben dem Stuhl am Kopfende des Tisches. Das war der Stuhl meines Vaters. Ich glaube, ich hatte noch nie dort gesessen. Jetzt nahm ich Platz und zündete mir eine Zigarette an. Heute würde ich einfach im Wohnzimmer rauchen. Ich blies den Rauch in die Mitte des Raumes und sah durch die Schwaden am anderen Ende des Wohnzimmers den dunkelgrünen Lesesessel meiner Mutter. Ich meinte, sie darin sitzen und lesen zu sehen. Ich starrte in den Rauch und wandte irgendwann den Blick ab, betrachtete die gerahmten Fotos, die im Bücherregal leicht schräg Spalier standen.
Ich sah meine Mutter, jung und strahlend, mit ihren dunklen langen Haaren. Mit mir als Baby im Arm. Es gibt nicht viele Fotos von uns beiden. Ich sah ein Foto von meinem Vater und mir. Wir stehen vor einem Restaurant in Berlin. Wir haben meinen Uni-Abschluss gefeiert und wirken beide müde und bemüht zugleich. Und ich sah ein Kindheitsfoto meines Vaters mit seinem Vater, meinem Großvater, keines dieser alten gestellten Bilder, vom Fotografen in Szene gesetzt, sondern ein schwarz-weißer Schnappschuss aus einem Sommerurlaub: Strand, Südfrankreich. Meine Großmutter hat das Foto gemacht. Es zeigt meinen kleinen Vater in Kniestrümpfen. Er hat Schuhe an und wirkt wie ins Bild geschoben. Er kann nicht weglaufen, denn sein Vater hält ihn an der Hand. Mein Großvater hat sein Jackett nicht ausgezogen, es spannt über seinem Bauch. Die Anzughose ist hochgekrempelt. Er ist barfuß. Mein Großvater schaut nicht in die Kamera, sondern darüber hinweg. Ein Mann mit Vision. Er steht im Sand, als gehöre der Strand ihm.
2
Mein Großvater war ein genialer Tüftler, aber konnte nicht mit Geld umgehen, sagte mein Vater über ihn. Die Rezepte sprudelten nur so aus ihm heraus. Die Ideen kamen ihm zu jeder Tages- und Nachtzeit. Auf seinem Nachtschrank lagen Ringblock und Bleistift. Mehrmals in der Woche tastete er schlaftrunken nach dem Schalter der Nachttischlampe, nahm Brille und Block und schrieb die Ideen auf, die ihm im Traum gekommen waren. Mein Großvater war ein dicker und stolzer Mann. Im Laufe seines Lebens hat er Brausepulver, Kaugummi, einen Traubenzucker-Riegel, ein Herzmedikament, Instant-Knödel, eine Faltencreme, ein Haarwasser, Getränkesirup und eine Kräuterlimonade erfunden.
Und das Waschmittel.
Als kleiner Drogist hatte er angefangen. Sein Pulverwaschmittel machte ihn reich. Bescheiden, wie er war, nannte er dieses Waschmittel einfach nach sich selbst: Auber. Und meine Großmutter, eine elegante und ehrgeizige Frau, auf Fotos stets mit schmalem Lächeln und pompösen Hüten, soll den Werbeslogan dazu erfunden haben (der vielleicht auch irgendwie auf der Hand lag): »Auber macht sauber!«. Dieser Spruch, graphisch garniert mit einem handgemalten Bild einer glücklichen Hausfrau, prangte in den fünfziger Jahren in ganz Wirtschaftswunder-Deutschland. Auf Litfaßsäulen, Bussen und Lastwagen, in Zeitungsannoncen und auf Werbeblättern.
Ich war acht Jahre alt, als mein Großvater starb. Er wohnte mit meiner Großmutter in einem kleinen Haus in der Eifel, dessen Garten mir damals riesengroß vorkam. Das Haus lag auf einem Hügel, und hinter dem Gartenzaun, den mein Großvater mit Stacheldraht gesichert hatte, ging es steil nach unten. Ich erinnere mich, dass mein Großvater sehr laut war, wenn wir im Garten Monster spielten. Er war ein gutes Monster. Ich erinnere mich, dass wir in der Küche gemeinsam Spiegelei mit Schinken brieten. Er wollte niemanden in der Küche haben außer mir. Er brachte mir Schach und Backgammon bei, machte mit mir Liegestützwettbewerbe und mixte mir Limonade, wann immer ich welche wollte. Wenn er ein Vollbad nahm, ließ er so viel Wasser und Schaum ein, dass es das vollste Vollbad war, das ich je gesehen hatte. Er zeigte mir seine Krawatten und Hüte und erlaubte mir, mich damit zu verkleiden. Er ließ mich in seinem roten Opel Manta Cabrio vorne sitzen. Damals hatte er sein Geld und die Häuser lange verloren, aber für mich war er der reichste Mann der Welt.
Ich erinnere mich auch, wie sich mein Vater und mein Großvater anschrien, wenn wir zu Besuch waren. Dass wir überstürzt abreisten. Dass meine Großmutter auch dann lächelte, wenn sie traurig war.
Sie war es, die meinen Großvater im Keller unter seiner Reckstange fand. Es war wohl ein Herzinfarkt. Am Tag nach der Beerdigung zeigte mir mein Vater, wo genau sie ihn gefunden hatte. Die Treppe war aus glattem Stein und sehr steil. Im Keller war es kühl. Ich stand unter der Reckstange, blickte nach oben und stellte mir vor, wie mein Großvater hier zusammengebrochen war. Dann fiel mein Blick in die vordere Ecke des Kellers, bei der Tür. Hier lagen Sprudelflaschen aufgestapelt, darin die Probeproduktion einer neuartigen Kräuterlimonade. Die Flaschen hatten kein Etikett, die Flüssigkeit darin war fast braun.
»Darf ich probieren?«, fragte ich meinen Vater.
»Nein«, antwortete er und sah weg.
In der Nacht schlich ich mich hinunter in den Keller und gab dabei auf jede Stufe acht. Ich öffnete eine der Flaschen und trank. Die Limonade schmeckte würzig und süß. Lange saß ich an die klammen Ziegel gelehnt auf einer Holzpalette in der Dunkelheit und trank Schluck für Schluck die ganze Flasche aus. Dann ging ich in den Garten und warf die leere Flasche über den Stacheldrahtzaun. Ich hörte, wie sie den schwarzen Hang hinunterrollte.
Noch heute weiß ich, wie die Kräuterlimonade meines Großvaters schmeckte. Und selbst wenn ich irgendeine Industrie-Kräuterlimonade trinke, denke ich an Theodor Auber, meinen Großvater.
3
In dieser Nacht schlief ich im Gästezimmer. Lange hatte ich in diesem Haus nicht mehr übernachtet, selbst wenn ich mal zu Besuch war. Bis heute weiß ich nicht, warum ich nicht gleich am ersten Abend einen Blick in mein früheres Zimmer geworfen habe.
Ich frühstückte nicht. Ich rief mir ein Taxi und fuhr zum Krankenhaus. Mein Vater war nicht bei Bewusstsein, als ich in sein Krankenzimmer trat. Schläuche in seinem Mund und Arm. Leises Rauschen der Maschinen. Noch leiseres Piepsen.
Das Gesicht meines Vaters war grau. Es war eingefallen und schmaler, als ich es in Erinnerung hatte. Er sah zehn Jahre älter aus als bei unserer letzten Begegnung, die immerhin etliche Monate her war. In diesem Moment wurde mir bewusst, dass er sterben könnte.
»Es war ein Schlaganfall«, sagte der Arzt im Hereinkommen. Ich drehte mich um und sah zu ihm auf. Er war größer und etwas jünger als ich, was sich merkwürdig anfühlte.
»Ist es ernst?«, fragte ich.
»Ja.«
»War er bei Bewusstsein?«
»Nur kurz. Er hat nach Ihnen gefragt.«
»Was hat er gesagt?«
»Er war sehr schwach und konnte kaum sprechen, verlangte nach Zettel und Stift.« Er drückte mir einen Briefumschlag in die Hand. »Von Ihrem Vater«, sagte er und ließ mich allein.
Ich setzte mich auf den Stuhl an seinem Bett. Erst jetzt nahm ich den Krankenhausgeruch wahr. Licht drang durch die Löcher der Jalousie und warf Streifen auf die Bettdecke. Ich öffnete den Briefumschlag. Auf dem karierten Notizzettel mit dem Logo des Krankenhauses standen nur zwei Wörter. Sie waren in unsicheren, dünnen Strichen gezeichnet, als ob er mit letzter Kraft oder der falschen Hand geschrieben hätte.
Drempel.
Bis zu diesem Moment war ich nicht sicher gewesen, ob es dieses Wort überhaupt gab. Ich hatte es immer nur aus dem Mund meines Vaters gehört. Mein Vater mochte alte Wörter und schlug sie gerne in alten Lexika nach. Ich hatte es noch nie geschrieben gesehen. Ein Drempel war der schräge Stauraum eines ausgebauten Dachgeschosses. In unserem Haus führte vom Dachzimmer aus eine niedrige Holztür mit Magnetschloss dorthin. Seit Jahren hatte ich nicht hineingeschaut. Man musste sich ducken, um sich durch die Tür zu zwängen. Unterhalb der Dachschräge konnte man sich nur auf allen vieren bewegen. Als Kind hatte ich mich manchmal dort oben versteckt oder Schatzsuche gespielt.
Kiste.
Das zweite Wort war kaum zu entziffern, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es Kiste lautete.
Ich wollte noch nicht nach Hause. Ich starrte meinen Vater an und stellte mir vor, dass er plötzlich die Augen aufschlug. Ich war mir nicht sicher, was ich fühlen sollte. Ich glaube, ich wollte nicht, dass Drempel und Kiste die letzten Worte meines Vaters an mich waren. Ich aß in der Krankenhaus-Kantine. Dann rief ich mir ein Taxi und ließ mich auf Umwegen nach Hause fahren. Ich sagte dem Taxifahrer, er solle die Landstraße durch die Weinberge nehmen. Ich legte mich hin, um etwas zu schlafen.
Als ich aufwachte, lag ich eine Weile nur da und starrte an die Decke. Dann hastete ich die Treppe hoch ins Dachgeschoss, die vorletzte Stufe knarrte verlässlich, und öffnete die Tür zum Drempel. Ein staubiger Dschungel ausgemusterter Dinge auf altem PVC-Boden empfing mich. Ein paar Umzugskartons standen dort, darin wahrscheinlich noch Sachen von mir, außerdem Tüten und Taschen. Eine alte Bohrmaschine in Originalverpackung. Eine Reisetasche, vollgestopft mit alten Kleidungsstücken meines Vaters und drei leere Lederkoffer unterschiedlicher Größe. Bücherkisten. Zwei Stehlampen mit bräunlich verfärbten Schirmen. Zerbeulte Töpfe und eine alte Pfanne. Ich war auf Knien und arbeitete mich voran. Mein Handy strahlte an die silberne Dachisolation. Staub tanzte im Lichtschein. Mir wurde schnell heiß, die Luft war unangenehm trocken. Ganz hinten stand eine schlichte Holzkiste mit zwei Griffen aus Seil. Der Deckel ließ sich problemlos abheben.
Das Innere der Kiste roch nach Leder und Papier und Vergangenheit. Doch sie war leer. Bis auf ein schmales Lederetui auf dem staubigen Grund. Kein wertvolles, sondern ein billiges Autoschlüsseletui. Ein Werbegeschenk aus dem Autohaus unten am Moselufer. Dort brachte mein Vater seit Jahrzehnten seinen Golf zur Reparatur. Dort kaufte er alle zehn Jahre einen neuen Golf. Der Name des Autohauses war silbern auf der Rückseite des Etuis gedruckt. Autohaus Schopf. Ich zog den kurzen Reißverschluss auf. Ein Schlüssel. Er war nicht am Metallring des Etuis eingeklinkt, sondern lose.
Und es war kein Autoschlüssel.
4
Ich setzte mich auf den Platz meines Vaters am Kopfende des Esszimmertisches und legte den Schlüssel neben das Whiskyglas vor mir. Es war eines der schweren Gläser meines Großvaters, sie hatten einen Goldrand und hatten die Pleite irgendwie überdauert. Mein Vater hatte mir früher verboten, daraus zu trinken. Er wollte den Goldrand schonen. Mein Vater trank keinen Whisky. Er trank Wein.
Die Whiskyflasche hatte ich vorletzte Weihnachten mitgebracht. Ich weiß noch, ich war an der Mosel entlang rüber nach Luxemburg gefahren, weil dort die Auswahl größer ist. Ich kaufte einen guten Whisky. Als ich ihm erzählte, dass der Whisky fünfzig Euro gekostet hatte, fand er das zu teuer. Er probierte ihn nicht, sondern trank seinen Weißwein. Trotzdem stand meine Whiskyflasche prominent in der Auslage des Wohnzimmerschranks, auf dem goldenen Tablett mit den Gläsern mit Goldrand.
Es war Abend, und ich hatte noch nichts gegessen. Der Whisky fühlte sich warm an in Hals und Magen. Er versetzte mich in einen angenehmen Schwebezustand. Ich hatte die Terrassentür einen Spalt aufgelassen, obwohl es draußen kühl war. Wie immer, wenn ich aus Berlin hergekommen war, nahm ich die Stille überdeutlich wahr.
Der Schlüssel kam mir bekannt vor. Es war ein Türschlüssel der älteren Sorte, grob und schwer. Mein Vater musste betrunken oder verwirrt gewesen sein, anders konnte ich mir diese Aktion nicht erklären.
Eine Sprachnachricht von Sophie. Ich zog das Handy zu mir her und machte es mir zur Herausforderung, mit geschlossenen Augen und dem kleinen Finger der linken Hand den Pfeil auf dem Display zu treffen, um die Nachricht abzurufen. Es war nicht ihre Stimme, die ich hörte, sondern das Kinderplappern von Oskar.
»Papa«, sagte er. »Wann kommst du denn, Papa? Gute Nacht, Papa!«
Das mit Oskar bekamen wir gut hin. Sonst eigentlich nichts. Sophie wusste nicht, dass ich bei meinem kranken Vater in Trier war. Ich musste ihr für das kommende Wochenende absagen. Auch in der Redaktion musste ich Bescheid geben. Seit Wochen sprachen Sophie und ich nicht mehr über uns, vielleicht waren es schon Monate. Wir sprachen über Oskar. Eigentlich sprachen wir gar nicht, sondern schickten uns Nachrichten. Ich schrieb fast immer. Sophie sendete lieber Sprachnachrichten. Ich mochte immer noch den Klang ihrer Stimme und ihren behaglichen Dialekt. Sie sprach nicht wirklich Bayerisch, es war nur eine leichte Färbung. Ihre Stimme klang warm und freundlich und gab mir ein gutes Gefühl. Wir verständigten uns über Abholzeiten und Kleinkind-Essgewohnheiten. Aber nicht mehr über uns.
Es gibt viele Dinge, die ich heute anders machen würde. Ich würde mehr kämpfen. Aber vielleicht hätte ich sie am Ende trotzdem verlassen.
Ich trank aus, löschte das Licht im Esszimmer und ging die Treppe hinauf. Den Schlüssel ließ ich auf dem Esstisch liegen. Das Reihenhaus hatte im ersten Stock drei Zimmer und ein Bad. Im Gästezimmer verstaute ich die Sachen aus meiner Reisetasche im Schrank. Auf dem Weg ins Bad warf ich einen Blick in das Schlafzimmer meines Vaters. Alles akkurat aufgeräumt, das Bett gemacht. An der Wand neben dem Ehebett das Hochzeitsfoto meiner Eltern. In den ersten Jahren nach dem Tod meiner Mutter schlich ich mich oft in dieses Zimmer, wenn ich nicht einschlafen konnte. Mein Vater saß unten auf dem Sofa und schaute Fernsehen. Ich saß oben im Schneidersitz auf dem Fransenläufer neben seinem Bett und betrachtete mit schräg gelegtem Kopf das Hochzeitsfoto. Meine Mutter lächelte mich an. Mein Vater schaute ernst und wichtig und wirkte mit der Krawatte wie verkleidet. Er trug einen dunklen Anzug, meine Mutter ein dunkelgrünes Kleid aus Samt. Sie wollte unbedingt heiraten, aber nicht in Weiß, hatte mir mein Vater mal erzählt.
Jetzt stand ich auf eben diesem Läufer und fühlte die weichen Fransen an meinen bloßen Füßen. Ich betrachtete das Foto von oben, nicht von unten, wie früher als Kind. Aus diesem Winkel wirkte es fremd auf mich. Meine Eltern wirkten fremd auf mich. Ich erinnerte mich, dass ich als kleiner Junge an vielen Abenden hier saß und still zu diesem Foto aufblickte. Wenn ich hörte, dass mein Vater den Fernseher ausschaltete, schlich ich mich schnell zurück in mein Zimmer, sprang ins Bett und stellte mich schlafend. Für den Fall, dass er noch mal nach mir sah.
Ich ging ins Bad und putzte mir die Zähne. Im Bad hingen in niedriger Höhe immer noch meine Kinder-Handtuchhalter, eine gelbe Hand und ein grüner Fuß. Ich erinnerte mich daran, wie ich als Kind schlaftrunken vor dem Heizöfchen auf den braunen, runden Badfliesen kauerte und langsam aufwachte, während mein Vater in der Dusche stand und meine Mutter unten das Frühstück machte. Mein Vater malte für mich Strichmännchen auf die vom Wasserdampf beschlagene Duschwand. Er malte immer drei Strichmännchen: Vater, Mutter, Kind. Nach dem Flugzeugabsturz hörte er damit auf.
Ich ging zurück ins Gästezimmer und setzte mich auf das schmale Bett. Ich nahm mein Handy und wischte mich durch die E‑Mails aus der Redaktion. Ich überlegte, ob ich noch etwas lesen sollte. Ich hatte ein Buch von Hemingway dabei, 49 Depeschen, Zeitungsberichte und Reportagen von ihm als jungem Journalisten, als er schon in Europa lebte. Dann stand ich auf und trat in den Flur. Das dritte Zimmer, direkt neben dem Bad, war mein Zimmer. Mein Vater hatte mein Zimmer genau so gelassen, wie es war, als ich zum Studium ging. Mit meinen alten Jugendmöbeln und den Postern und den Dingen, die ich nicht mehr brauchte. Ich drückte die Klinke herunter. Abgeschlossen.
Ich verstand sofort. Ich lief die Treppe hinunter ins Wohnzimmer, nahm den Schlüssel vom Tisch, stürmte die Treppe wieder hoch und nahm dabei zwei Treppenstufen auf einmal. Oben angekommen, war ich außer Atem. Ich ärgerte mich über das Theater, das mein Vater mir aufzwang: Drempel, Kiste, Schlüssel, Zimmer.
Ich steckte den Schlüssel ins Schloss, drehte ihn und öffnete die Tür. Ich blickte in schwarzes Dunkel. Der Rollladen musste komplett heruntergelassen sein. Abgestandene Luft schlug mir entgegen. Ich drückte auf den Lichtschalter, doch das Licht funktionierte nicht. Also nahm ich mein Handy und leuchtete.
Keine Spur von meinen Möbeln und Sachen. Stattdessen wirkte der Raum wie ein vergessenes Privatarchiv. Mein Handylicht streifte zunächst über eine Fotowand. Schwarz-Weiß-Bilder, dicht an dicht auf die Tapete geklebt. Manche waren auf DIN-A4 vergrößert. Ich entdeckte Fotografien, die meinen Großvater zeigten, andere meinen Vater, meine Großmutter. Alte Familienfotos, Szenen aus dem Alltag, dem Familienleben, aus einer Fabrik. Ein paar Schwarz-Weiß-Fotos zeigten eine junge Frau, die ich nicht kannte, sie wirkten sehr alt und waren größer als die anderen. Dazwischen auch Farbfotos aus meiner Kindheit. Auch einige mit meiner Mutter.
Die ganze Wand hing voller Fotos, von der Fußbodenleiste bis unter die Decke. Auf der gegenüberliegenden Seite standen einfache Holzregale, gefüllt mit nummerierten Aktenordnern. Auf dem obersten Bord ein paar Pappkisten. Die Mitte des Zimmers nahm ein Schreibtisch mit einer Schreibtischlampe ein. Ich knipste sie an. Ein Lesesessel schälte sich aus der Dunkelheit. Neben der Balkontür ein Stehpult, darauf ein aufgeschlagenes Buch. Ich ging hinüber. Es war von Stefan Zweig: Brasilien. Ein Land der Zukunft. In der anderen Ecke stand auf einem halbhohen Büroschrank wie auf einem Altar ein Magnetophon 203 von Telefunken. Es war ein kompaktes Reisetonbandgerät mit Henkel, groß wie zwei Schuhkartons, aber schwer wie eine Bücherkiste. Ich wandte mich wieder dem Regal zu und entdeckte, dass es nicht nur Aktenordner enthielt, sondern auch hohe, schlanke Lederkladden und dazwischen Plastikhüllen mit Tonbändern von Agfa. Ich drehte mich neben dem Lichtkegel der Lampe langsam und ungläubig um mich selbst und kam mir vor wie in einer Kulisse. So als hätte Steven Spielberg all dies hier für eine Filmszene drapieren lassen.
Damals wusste ich noch nicht, dass die Lederkladden die Tagebücher meines Großvaters waren. Damals wusste ich noch nicht, dass mein Vater viele Stunden lang auf diese Tonbänder gesprochen hatte. Dass er in den Aktenordnern Seiten über Seiten Material zusammengetragen hatte. Damals begriff ich noch nicht, dass ich eigentlich nichts wusste. Über meinen Großvater nicht und nicht über die Schuld, die er auf sich geladen hatte. Über die Nöte meines Vaters. Über mich selbst.
Ich schreibe jetzt alles auf und schreibe immer weiter, auch wenn es hier, weit weg von zu Hause, nachmittags fast unerträglich heiß wird. Alles, was ich zu Papier bringe, basiert auf dem, was ich in meinem alten Jugendzimmer vorgefunden habe. Auf den Erinnerungen, die mein Vater mir hinterlassen hat. Als ich vor diesem Erinnerungsschatz stand, in meinem alten Zimmer, fühlte ich mich, als breche ein Damm. Würde mich das alles überrollen? Würde es mich befreien? Ich brauchte einen Drink. Mein Vater hatte mir nie etwas erzählt von sich. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, dass mein Vater mit mir spricht.
5
Ich begann mit den Tonbändern.
Als ich das Tonbandgerät einschaltete, rauschte es. Ich hatte Mühe, die Plastikräder einzuklinken und die Bänder anzulegen. Es hatte etwas Museales, an diesem alten Gerät mit den silbernen, schwer klickenden Tasten herumzufingern. Aber es fühlte sich tausendmal bedeutender an, als mit einem Fingerstreich auf Handyglas einen Podcast zu starten. War es ja auch. Ich setzte mich in den Lesesessel. Ich schloss die Augen und lauschte der Stimme meines Vaters.
Er sprach langsam und bedacht. In den ersten Minuten etwas überbetont. So wie alte Leute auf Anrufbeantworter sprechen. Er sprach nicht zu sich selbst. Seine Stimme klang, als sei er sich bewusst, dass ihm zugehört werden würde. Er wolle ganz am Anfang beginnen, sagte er. Am Anfang seiner Kindheit stünde das Glockengeläut des Kirchturms. Den Kirchturm konnte er, wenn er auf den Küchenschemel stieg, vom Fenster aus sehen, in der Ferne zwar, aber nah genug, um das Schwingen der Glocken zu beobachten.
Mein Vater ist in St. Ingbert im Saarland aufgewachsen. Er war weder besonders gläubig noch besonders musikalisch. Jetzt aber sprach er lange vom Läuten der Kirchenglocken, den beruhigenden Schlägen zur vollen und zur halben Stunde. Die Geborgenheit des Geläuts vor der Messe. Zur Messe gingen sie fast jeden Sonntag. Seine Mutter genoss den Auftritt.
Und dann plötzlich gab es kein Glockenläuten mehr. Stattdessen Sirenen, hektisch und schrill. Sie verströmten keine Geborgenheit, sondern zogen den donnernden Lärm der Flieger nach sich.
»Hans, komm, schnell!«, rief meine Großmutter in sein dunkles Zimmer.
Die Sirenen hatten Hans aus dem Schlaf gerissen. Er war damals vielleicht acht, neun Jahre alt. Jetzt holte ihn seine Mutter aus dem Bett. Sie wohnten in einem dreistöckigen Mietshaus mit sechs Parteien. Mein Großvater war seit vielen Monaten an der Front. Seine Frau führte die Drogerie weiter. Dutzende Male schon hatten sie sich nachts in den Keller geflüchtet. Aber bisher war ihre Straße immer verschont geblieben.
»Die Flugzeuge kommen wieder! Mama, die Flugzeuge!«, rief Hans. Er war voller Angst. Seine Mutter nahm ihn auf den Arm, stürmte durch die Wohnungstür und eilte die Treppe hinunter.
Der Keller war dunkel und feucht und kalt. Er roch nach Staub und Kohle. Hans’ Mutter legte sich jeden Abend die grobe Arbeitshose ihres Mannes auf dem Stuhl im Schlafzimmer zurecht, ein altes Hemd von ihm und seinen Mantel. Sobald die Sirenen losgellten, sprang sie aus dem Bett und schlüpfte in die Kleider ihres Mannes, die nicht nur praktischer waren als ein weißes Baumwollnachthemd, sondern ihr auch Stärke verliehen. Hans musste mit Socken schlafen und wurde in eine Decke gehüllt. Dann saßen sie im Keller und warteten.
Hans musterte die anderen Gesichter. Von den Nachbarn erinnerte er sich vor allem an Frau Taler aus dem ersten Stock. Die mit dem immerzu müden Gesicht und den mageren Kindern. Sie wimmerte, in seiner Erinnerung stundenlang, während beide Kinder keinen Laut von sich gaben. Regungslos starrten sie auf die Ziegelwand. Als das Schluchzen von Frau Taler zu laut wurde, herrschte Hans’ Mutter sie an. Darauf verstummte Frau Taler.
Mein Vater erzählte mit monotoner Stimme von dem alten Herrn Stock, dem das linke Bein fehlte und der immer als Letzter in den Keller gehumpelt kam. Er setzte sich neben meinen Vater und zog zwei Streichholzschachteln aus der Tasche seiner Joppe. Zusammen bauten sie zwischen sich einen Turm aus Streichhölzern, und wenn er in sich zusammenfiel, fingen sie wieder von vorne an. Die Kinder von Frau Taler beobachteten sie stumm.
Erst Stille, das Geräusch von Angst. Dann das Stakkato der Flak. Dann das Heulen der Motoren. Dann der Donner. So viel Donner wie nie. Der Kellerboden bebte, die Wände schienen sich zu bewegen. Jemand schien an der Tür zu rütteln. Die Wände zitterten. Die Kerze flackerte. Herr Stock hielt inne und sah Richtung Decke. Frau Taler schrie. Ihren Kindern stand Entsetzen in den Gesichtern. Hans’ Mutter nahm ihn auf den Schoß und weinte leise. Er hörte ihr Weinen vor lauter Dröhnen nicht, er sah es auch nicht, er spürte nur das Zittern ihres Körpers an seiner Wange, hatte die Augen geschlossen und dachte an den Samstagvormittag vor ein paar Wochen, als seine Mutter ihn Milch holen geschickt hatte. Es war warm, und er trug seine kurze Hose. Herr Kiesing, der Milchmann, hatte einen runden Bauch, große Hände und immer eine Schirmmütze auf dem Kopf. Er zitierte gerne Goethe, kannte aber nur drei Gedichte von ihm. Er besaß ein Pferd namens Perle. Er füllte die Blechkanne mit frischer Milch und bestellte Grüße an seine Mutter. Er gab Hans etwas Heu, das er Perle mit flacher Hand hinhalten durfte. Mein Vater erinnerte sich an das feuchte Schlecken von Perle, den erdigen Geruch ihres Atems. Er fragte sich, warum ihn Pferde beruhigten, während Menschen ihn unsicher machten. Er erinnerte sich, dass er auf dem Nachhauseweg an Perle dachte, dann hatte er die Idee, den Milchschwung auszuprobieren. Er hatte es bei den großen Jungs gesehen. Er war schon fast zu Hause, als er die Kanne auf dem Bürgersteig abstellte und den Deckel beiseite legte. Er nahm die offene Kanne und begann den Schwung mit ausgestrecktem Arm. Er spürte gleich, dass er sich nicht traute, aber er ließ den Schwung trotzdem immer höher werden. Er schwang die Kanne vor und zurück. Bis Schulterhöhe und dann wieder nach hinten. Die Milch presste sich an den Boden der Kanne. Er musste sich einen Ruck geben. Er musste sich trauen. Er wollte die Kanne einmal rundum schwingen, aber er konnte sich nicht entscheiden, wann und auf welcher Seite. Dann setzte er an und katapultierte die Kanne nach oben. Doch auf halbem Weg verließ ihn der Mut. Er zog den Schwung nicht durch, sondern brach ab. Milch ergoss sich über seinen Arm und seine rechte Schulter. Erschrocken riss er die Kanne nach unten. Außer Atem setzte er sich auf die Bordsteinkante, tupfte Milchtropfen von seinen Knien und leckte sich die Finger ab. Zu Hause schlug ihm die Mutter auf die Hände. Drei Tage lang bekam er keine Milch. Sie werde sich noch eine andere Strafe für ihn überlegen, hatte sie gesagt. Jetzt fragte er sich, ob das hier seine Strafe war.
»Ist es vorbei?«, jaulte Frau Taler.
»Wir warten noch«, antwortete Herr Stock.
»Ich glaube, diesmal war es schlimm«, sagte Hans’ Mutter.
»Haben die Flugzeuge viel kaputt gemacht?«, fragte er.
Niemand sagte ein Wort.
Irgendwann stiegen sie die schrägen Stufen nach oben und traten hintereinander zurück in die Welt, die jetzt eine andere war.
Auf dem Tonband schilderte mein Vater diese Szenen mit vielen Pausen, wurde leiser und langsamer, bis er nur noch zu sich selbst zu sprechen schien. Immer wieder hielt er inne. Ich hörte ihn atmen und hörte das Reiben des Tonbands am Tonkopf der Maschine.
Lisbeth Auber nahm ihren Sohn Hans an die Hand und trat auf die Straße. Es sah aus wie ein Stummfilm. Noch hörte er die Schreie nicht. Es war heiß, und da war Feuer. Wie zeitversetzt wurde der Ton eingeblendet. Lautes Chaos. Menschen schrien. Mehrere Häuser in seiner Straße lagen in Trümmern. In den Trümmern verstreut waren Möbel und Menschen. Lisbeth Auber ließ Hans’ Hand los. Er schaute an ihr hoch und sah, wie sie regungslos dastand, die Hand vor dem Mund. Menschen irrten umher. Viele Gesichter kannte er eigentlich, aber jetzt waren sie verzerrt und entstellt. Mit einem Ruck kniete sich seine Mutter vor ihn und umarmte ihn und drückte ihn hart. Sie stemmte ihn auf ihre Hüfte und lief langsam los. Sie hielt ihm die Augen zu. Doch durch ihre Finger hindurch sah er die Toten und die Verletzten und das Blut. Er wusste nicht, was er denken sollte. Er hatte keine Angst und war nicht traurig. Er fühlte nichts.
Plötzlich hörte er einen Schrei, der anders war als die vielen Schreie ringsum, markiger und ziehender, tiefer und lauter. Er riss die Hand seiner Mutter von seinen Augen und sah das braune Fell und das Blut und die zuckenden Hufe. Er sah Herrn Kiesing. Seine Schirmmütze war weg. Er sah das Gewehr in seinen Händen und hörte den Schuss und hörte und sah, wie der Schrei aufhörte und das Zucken.
Dann hörte er noch einen Schrei, wie er ihn nie zuvor gehört hatte. Ihm war plötzlich kalt trotz des vielen Feuers, und seine Mutter sah ihn entsetzt an, stellte ihn auf den Boden und nahm seinen Kopf in beide Hände. Dann erst bemerkte er, dass dieser Schrei, den er noch nie in seinem Leben gehört hatte, sein eigener war.
»Da bricht meine Erinnerung ab«, sagte mein Vater fast lautlos auf dem Tonband.
Ich stand aus dem Lesesessel auf und stellte mich direkt vor das Tonbandgerät und starrte auf das Band, das über den Tonkopf lief.
»Ich weiß nicht, wie ich nach Hause kam. Ich weiß nicht, wie wir danach weitermachten«, sagte die Stimme meines Vaters. »Ich kann mich nicht erinnern, was meine Mutter zu mir sagte. Wie sie mir erklärte, was passiert war. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir je darüber sprachen. Ich weiß nur noch, dass wir nicht lange danach evakuiert wurden und unsere Wohnung verließen und auf den Bauernhof mussten.«
Dann sagte er noch, dass er später entdeckte, dass die Glocken aus dem Kirchturm der Stadt verschwunden waren. Und dass seine Mutter auf seine Frage, wer die Glocken denn mitgenommen habe und in welchem Kirchturm und in welcher Stadt sie denn jetzt läuten würden, nur geantwortet hatte, dass die Glocken gar nicht mehr läuteten.
Sie seien jetzt eine Kanone.
6
Ich schlief lange und traumlos in dieser zweiten Nacht zu Hause. Um kurz nach neun Uhr klingelte es Sturm an der Haustür. Ich ging ins Schlafzimmer meines Vaters, das im ersten Stock zur Straße lag, und blickte aus dem Fenster. Ich sah einen Mann mit Basecap und fünf angeleinten Hunden. Ich zog mir den alten Morgenmantel meines Vaters über. Während ich die Treppe nach unten ging, klingelte es wieder. Mürrisch öffnete ich die Tür.
»Hunde zu verkaufen!«, rief der Mann, und seine Stimme überschlug sich fast. »Sie sind süß und sauber und gut erzogen und der beste Freund des Menschen. Machen auch Sie Gebrauch von diesem einzigartigen Angebot an Ihrer Haustür! Schlagen Sie zu, und erwerben Sie noch hier und jetzt eines dieser Prachtexemplare!«
Ich lächelte. »Was machst du denn hier, Ben?«, fragte ich.
Ben trug einen Dreitagebart, der ihn alt und jung zugleich aussehen ließ. Ben war fast einen Kopf größer als ich. Er war fast zwei Meter groß, und früher, wenn er bei uns klingelte, hatte ich ihn immer schon an seiner riesigen Silhouette erkannt, die durch das geriffelte Glas unserer Haustür schimmerte. An seinen Schultern sah ich, dass er trainierte.
»Habe gehört, du bist in town, Mr. Auber«, sagte er und breitete die Arme aus.
»Bin ich.«
»Ja«, sagte er und wurde kurz ernst. »Habe es gehört.«
Wir machten unseren Handschlag, umarmten uns und klopften uns auf die Schultern. Dabei ließ Ben die Leinen los. Die Hunde nutzten die Gelegenheit und stoben davon.
»Nein! Stopp! Alle Mann stopp! Alle Mann zurück!«, rief er übertrieben laut und streng, lief den Hunden nach und griff nach den Leinen.
»Was ist mit den Hunden?«, fragte ich.
»Mein neuer Job!« Jetzt hob er die Leinen hoch und drehte sich im Trippelschritt einer Ballerina unter ihnen hindurch.
»Echt jetzt?«
»Jawohl. Hundesitter. Bin immer an der frischen Luft. Und auch wenn ich Hunde nicht besonders mag, ist das jedenfalls besser, als in irgendeinem Büro von irgendwelchen Menschen zugetextet zu werden.«
»Verstehe«, sagte ich. »Komm rein. Aber die Hunde bleiben draußen.«
»Oder …«, Ben hob seinen Zeigefinger, »… oder sie dürfen in euren kleinen Garten.« Er nahm ihnen die Leinen ab und scheuchte sie durchs Wohnzimmer. Ich lief hinterher und öffnete schnell die Terrassentür.
»Kommt, ihr Lieben«, flötete Ben. »Ihr dürft natürlich nicht im Wohnzimmer von Richter Auber bleiben. Schön in den Garten auf den Rasen. Und da dürft ihr dann machen, was und wohin ihr wollt …«
»Na ja …«, sagte ich.
Ben musterte mich. »Wie siehst du eigentlich aus?«, fragte er.
»Wieso?«
»Du siehst aus wie dein Vater.«
»Nett von dir.«
»Ich gebe zu, ich verdiene nicht überwältigend viel Geld als Chefhundesitter des Mosellandes. Aber für einen neuen Bademantel würde es reichen. Ich kaufe einen und schenk ihn dir!«
»Der ist von meinem Vater«, sagte ich und sah an mir herunter.
»Eben!«
»Schon klar.«
Wir lachten und sagten einen Moment lang nichts.
»Wie geht es ihm?«, fragte Ben.
»Schlaganfall. Ist in der Klinik. Nicht bei Bewusstsein.«
»Scheiße.«
»Ja.«
»Und du schläfst diesmal hier?«, fragte Ben.
»Ja, er ist ja nicht da.«
»Okay. Aber kannst auch immer zu mir, weißt du ja.«
»Ja, weiß ich.«
Wir nickten uns stumm an.
»Und bei dir so?«, fragte ich Ben, als ich uns einen Kaffee gekocht hatte und wir in der Herbstsonne auf der Terrasse saßen.
»Bei mir?« Er strahlte übertrieben und breitete wieder die Arme aus. »Läuft super, Alter, läuft super!«
Ben war mein bester Freund. Wir kannten uns aus der Grundschule. Auch im Gymnasium waren wir in derselben Klasse und gingen morgens gemeinsam durch den Wald zur Schule. Seine Eltern wohnten bis heute zwei Straßen weiter hier im Neubaugebiet, das längst keines mehr war. Sein Vater unterrichtete an unserer Schule Englisch und Französisch, was Ben immer unangenehm gewesen war. Wenn wir keine Lust hatten, zur Schule zu laufen, fuhren wir mit seinem Vater in dessen Audi 100. Dann aber stiegen wir fünfzig Meter vor dem Schulparkplatz aus und liefen den Rest zu Fuß.
Wir wuchsen auf zwischen Weinbergen, Tennisplätzen, Bushaltestellen und Hobbykellern. Hatten erst Fahrräder, dann Mopeds. Haben zusammen meinen neuen Amiga 500 ausgepackt und seine neue VHS-Kamera. Haben mit den Mädchen aus der Parallelklasse auf Grillhütten geknutscht. Haben erst Viez, dann Bier, dann Wein, dann Schnaps getrunken. Sind im Winter in die Eisbahn-Disko am anderen Moselufer, um Schlittschuh zu laufen. Und im Sommer ins Freibad. Im Tennis habe ich nur einmal gegen ihn gewonnen.
Inzwischen wohnte er wieder im Haus seiner Eltern, in der Einliegerwohnung. Ich weiß nicht, wann er aufgehört hat, zu suchen. Ich wollte immer schreiben oder berichten oder beides und nach Berlin und fing dort nach dem Abitur an zu studieren. Er hatte keine Ahnung, was er wollte. Er kiffte sich durch den Zivildienst und machte aus Langeweile eine Banklehre in Luxemburg. Dort blieb er ein paar Jahre und verdiente ganz gut. Er spielte mit dem Gedanken zu studieren. Mal sollte es Ethnologie sein, mal Biochemie. Er war klug, hatte ein gutes Abi und hätte alles werden können. Als er einen vierwöchigen Roadtrip in die USA machen wollte, bekam er keinen Urlaub von seiner Bank und kündigte. Das musste bald zehn Jahre her sein. Seitdem hatte Ben nie wieder gearbeitet, lebte von Hartz IV. Zwischendurch saß er am Laptop und zockte ein wenig an der Börse und legte das Geld seiner Eltern ziemlich erfolgreich an. Er las viel und machte Sport, war eigentlich immer mit einer gut aussehenden Frau zusammen. Von seinen Plänen, entweder einen Weinladen in der Innenstadt oder einen Campingplatz in der Algarve aufzumachen, hatte ich lange nichts mehr gehört. Wir hatten nicht viel Kontakt, oft monatelang nicht. Er war wie ein Boot ohne Segel. Auf einem Meer, das er nicht mochte.
»Ich muss dir was zeigen«, sagte ich. Ich öffnete die Tür zu meinem früheren Zimmer.
»Alter …!«, stieß Ben aus.
Ich erzählte ihm, was geschehen war und was ich bisher wusste.
»Im Drempel?«, rief Ben mit hochgezogenen Augenbrauen. »Ich weiß noch, dass wir da oben Schatzsuche gespielt haben und so, und dein Vater hat uns belegte Brote gebracht. Das war eigentlich ganz nett von ihm, aber den Camembert habe ich nie gemocht.«
Er verzog das Gesicht. Ich lächelte.
»Ihr habt ja nie richtig geredet«, sagte Ben dann. »Und jetzt so ein Rätsel. Passt irgendwie gar nicht zum alten Richter Auber.«
Ich schüttelte den Kopf.
Wir gingen wieder runter ins Wohnzimmer. Auf halber Treppe drehte Ben sich um und sah hoch zu den Gemälden an der Flurwand. Er sagte: »Ich fand diese Bilder schon immer krass, Alter.«
»Warum sagst du eigentlich immer ›Alter‹?«, fragte ich. »Du bist doch keine dreiundzwanzig mehr.«
»Meine neue Freundin schon«, antwortete er.
»Echt? Dreiundzwanzig?«
»Na ja, fast vierundzwanzig.«
»Rund fünfzehn Jahre jünger?«
»Jawohl, Alter!«
»Schon klar …«
»Ist auch gut fürs Ego«, sagte Ben zufrieden. Er wies mit dem Kopf auf das größte Gemälde an der Wand, das meine Großmutter in Lebensgröße zeigte. Es war viel zu groß für diesen engen Flur. Es war viel zu groß für so ziemlich jedes Haus, es sei denn, das Haus war ein Schloss.
»Dir ist schon klar, dass deine Oma auf diesem Bild jünger ist als wir heute? Sah gut aus, die Oma Auber. Würde sagen: Sie war eine Neun. Fast eine Zehn.«
Ich lachte.
»So krass, Alter!«
»Ja, Alter.«
Ich schob ihn nach unten. »Und jetzt die Hunde mitnehmen und Abflug. Ich muss ins Krankenhaus.«