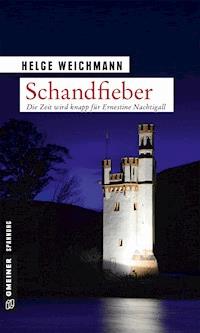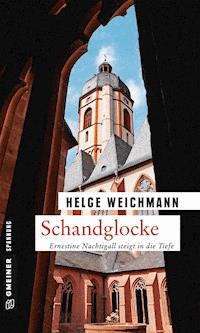Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Historikerin Tinne Nachtigall
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Eine tote Wissenschaftlerin, Fachfrau für die Mainzer Stadtgeschichte. Ein Bilderdiebstahl im Landesmuseum. Eine Klosterhandschrift, die unbeachtet im Archiv schlummert. Die Historikerin Ernestine „Tinne“ Nachtigall wird in den Strudel dieser Ereignisse hineingezogen, gerät erst unter Mordverdacht und schließlich in Lebensgefahr. Gemeinsam mit dem Lokalreporter Elvis setzt sie alle Hebel in Bewegung, um die Wahrheit zu finden. Die beiden kommen einem Geheimnis auf die Spur, das zurückreicht bis in die Zeit der Pestepidemien …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helge Weichmann
Schandgrab
KRIMINALROMAN
Zum Buch
Tod im Tunnel Eine Wissenschaftlerin, Fachfrau für die Mainzer Stadtgeschichte, liegt ermordet im Park. Ein unscheinbares mittelalterliches Gemälde wird aus dem Landesmuseum gestohlen. Ein Baulöwe setzt sich über den Denkmalschutz hinweg und plant eine Appartementanlage auf uraltem Grund und Boden. Die chaotische Historikerin Ernestine Nachtigall, genannt „Tinne“, wird in den Strudel dieser Ereignisse hineingezogen und entdeckt einen verborgenen Zusammenhang. Gemeinsam mit dem Lokalreporter Elvis beginnt sie zu recherchieren und taucht immer tiefer in die Stadtgeschichte von Mainz ein. Die beiden kommen einem Geheimnis auf die Spur, dessen Wurzeln zurückreichen bis in die Zeit der großen Pestepidemien des Mittelalters. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Plötzlich steht Tinne unter Mordverdacht und wird von der Polizei verfolgt. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie ein 500 Jahre altes Rätsel lösen und gerät dabei in tödliche Gefahr …
Helge Weichmann, Jahrgang 1972, ist gebürtiger Pfälzer und lebt seit mehr als 25 Jahren in der Diaspora in Rheinhessen. Während seines Studiums jobbte der promovierte Kulturgeograph als Musiker und Kameramann, bevor er sich als Filmemacher selbstständig machte. Heute betreibt er eine Medienagentur, arbeitet als Moderator und hat sich mit Mainzer Krimis einen Namen gemacht. Die Pfalz trägt er jedoch immer im Herzen, deshalb sind die „Elwetritsche“-Bücher seine ganz persönliche Wertschätzung der wunderschönen Region zwischen Neustadt und der französischen Grenze. Neben Kultur und gutem Essen kommt darin auch die berühmte Schlitzohrigkeit der Pfälzer nicht zu kurz. Ajoh!
Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Schatzsuche mit Elwetritsch (2022)
Mörderjagd mit Elwetritsch (2020)
Schandflut (2019)
SOKO Ente (2019)
Schandfieber (2018)
Schandglocke (2017)
Schwarze Sonne Roter Hahn (2017)
Schandkreuz (2016)
Schandgold (2014)
Schandgrab (2013)
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ebenso sind die genannten Firmen, Institutionen, Universitäten, Museen und Forschungseinrichtungen fiktiv oder, falls real existierend, in fiktivem Zusammenhang genutzt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Stanley Rippel – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4202-5
Wohnen auf dem Jakobsweg
PROLOG
Mittwoch, 5. Mai 1480
»… nam ex quo sunt omnia entia et ex quo fiunt primo et in quod corrumpuntur in fine, substantia quidem manente passionibus vero mutata, hoc est elementum …«
Die monotone Stimme von Magister Bartellmeß ließ Jergs Augenlider schwer werden, seine Hand mit dem Federgriffel sank nach unten. Mit schierer Willensanstrengung riss er sich zusammen, tauchte die Feder ins Tintenfass und ließ sie über das raue Pergament kratzen. Fast hätte er den Anschluss verloren, denn die schmale Gestalt auf der cathedra war schon zwei Sätze weiter und murmelte pausenlos vor sich hin. Die Metaphysik des Aristoteles war heute aber auch ein widerspenstiges Thema!
Jerg gab seine Mitschrift endgültig auf und lugte stattdessen vorsichtig unter seiner Gugel, der kapuzenartigen Kopfbedeckung, nach rechts und links. Neben ihm saß im Halbdunkel ein gutes Dutzend junger Männer auf dem kargen Boden. Ebenso wie er hatten sie ein Schreibbrett auf den Knien, darauf balancierten sie Pergament und Tintenfässchen. Und genau wie sein eigener Federkiel hingen die Federn von Nickel und Utz untätig in der Luft, während die Übrigen eifrig kratzend die Worte des Magisters mitschrieben. Jerg fing einen Blick vom dicken Utz auf, unmerklich nickte er ihm zu. Er wusste, dass Utz und Nickel genau wie er selbst in Gedanken weit weg von der lectio waren – und mindestens ebenso müde.
Denn gestern Abend hatten sie nach der vespera zur neunten Stunde ein geheimes Treffen mit Magister Frencklein gehabt, einem Lehrer, den alle Scholaren respektierten und bewunderten. Magister Frencklein war nämlich nicht kleingeistig oder wankelmütig wie die meisten anderen Lehrer, oh nein, er hatte zu jeder Frage eine kluge Antwort und eine feste Meinung, und mehr als einmal hatte er bereits in der Stadt einen Streit vom Zaun gebrochen mit engstirnigen Adligen oder naseweisen Pfaffen.
Am gestrigen Abend, während alle anderen bereits schliefen, hatte Magister Frencklein sie heimlich in seine Stube geführt, die Kerze auf den Boden gestellt und ihnen wispernd eine schier unglaubliche Geschichte erzählt. Mit großen Augen hatten die drei jungen Männer ihm zugehört, schüchtern einige Fragen gestellt und allmählich die Tragweite der Ereignisse begriffen. Um letzte Zweifel zu zerstreuen, war der Magister schließlich zu seinem schmalen Schrank getreten und hatte ein schweres Etwas herausgeholt, sorgsam in Wachstuch eingeschlagen. Sein wertvollster Besitz auf Erden.
Wie im Flug war die Zeit vergangen, und als die drei Scholaren schließlich in den Schlafraum zurückgehuscht waren, stand der Mond bereits hell am Himmel. Am anderen Morgen begann der Tag wie immer mit dem gemeinschaftlichen Wecken zur vierten Stunde. Den fehlenden Schlaf merkte Jerg nun überdeutlich. Doch der Gedanke an das, was heute Nacht bevorstand, vertrieb die Müdigkeit und ließ ihm einen Schauer über den Rücken laufen.
Raschelnder Stoff und gemurmelte Worte rissen ihn aus seinen Gedanken. Die lectio war vorüber, die Scholaren standen vom Boden auf und reckten ihre Glieder. Magister Bartellmeß entließ die jungen Männer mit seinem üblichen Sermon, er ermahnte sie, anständig zu bleiben und stets die Regeln der universitas zu beachten.
Jerg schnaufte, während er seine Pergamente einrollte und das Tintenfass verschloss. Natürlich gab es Regeln, strenge sogar … das Singen, Kartenspielen, Raufen und Saufen waren verboten, das Tragen von Waffen, das Mitbringen von Weibsleuten, spätes ein und aus Gehen, sogar der Gebrauch der deutschen statt der lateinischen Sprache. Aber wie überall auf der Welt gab es auch hier Mittel und Wege, die Regeln zu biegen oder sogar zu brechen.
Und überhaupt – hatte Jerg nicht erst vorgestern den Magister Bartellmeß hinten im Küchentrakt gesehen, als er mit der Köchin Elspeth Dinge trieb, die wohl kaum in den Schriften des Aristoteles zu finden waren?
Die Scholaren traten in den Innenhof. Die universitas besaß ein eigenes Gebäude innerhalb der Meintzer Stadtmauern, den Hof zum Algesheimer in der Christoffelsgass. Jerg wusste, dass das ehemalige Patrizierhaus ein Gründungsgeschenk von episcopusDietherr von Isenburg war, dem Bischof, der vor knapp drei Jahren die universitas mit dem Segen von papa Sixtus IV. ins Leben gerufen hatte.
Seither war der Algesheimer Hof eine Burse, ein Haus, in dem das universitäre Leben stattfand. Die Scholaren, aber auch die Magister wohnten, schliefen und aßen hier, außerdem wurden Lehrveranstaltungen, disputationes und Prüfungen in den Räumen abgehalten. Der Hof war im Laufe seiner Entstehungsgeschichte immer weiter verbaut worden, sodass heute mehrere verschiedene Einzelgebäude aneinandergefügt waren, große Kammern, winzige Schlupflöcher, dazwischen zahllose Ecken, Türmchen, Erker und Balustraden. Diese Aufteilung machte es leicht, genügend Räumlichkeiten für die Belange der jungen universitas zu finden.
Jerg genoss die Mittagssonne, die in den offenen Innenhof fiel. Obwohl es im Mai tagsüber schon regelrecht heiß werden konnte, hielt sich die klamme Feuchtigkeit des Winters hartnäckig in den dunklen Räumen der Burse. Und da die Scholaren sommers wie winters während der lectio auf dem nackten Boden saßen, taten die Sonnenstrahlen besonders gut. Er lupfte seine Gugel, schloss die Augen und streckte das Gesicht zur Sonne. Eine Minute lang lauschte er den Geräuschen der Burse und der sie umgebenden Stadt, murmelnde Stimmen, Hämmern, Wiehern, Schimpfen und Lachen.
»Werden wir’s wagen heute Abend?«
Selbst mit geschlossenen Lidern erkannte Jerg die leise Stimme von Nickel, einem seiner engsten Freunde. Er öffnete die Augen. Nickel und Utz waren an ihn herangetreten. Nickel, Sohn eines Kaufmanns, war groß, fast vier Ellen, hatte eine gerade Nase und blaue Augen. Die Frauenzimmer liefen ihm nach, wann immer er in der Stadt unterwegs war. Im Gegensatz dazu sah der dicke Utz aus wie ein Fässchen auf Beinen, seine sommersprossigen Pausbacken und die kleine Schweinsnase machten ihn nicht hübscher. Beide steckten in typischen Scholarenkleidern: eine Joppe aus Barchent, die dunkle Gugel über Schopf und Schultern, an den Füßen Trippen, Schuhe aus Holz und Leder.
»Natürlich wagen wir’s«, antwortete Jerg genauso leise. »Oder habt ihr die Hosen voll?«
Untereinander redeten die Freunde deutsch, wenngleich das innerhalb der Burse verboten war. Aber erstens war Utzens Latein so fürchterlich, dass er sich kaum verständlich machen konnte, und zweitens wollten sie sich nicht von griesgrämigen Magistern die eigene Sprache verbieten lassen. Nur leise mussten sie sein, damit keiner von den anderen Scholaren sie hörte. Denn manchmal war ein lupus darunter, ein Verräter, der Regelübertretungen brühwarm an die Magister weitererzählte und die Missetäter damit dem Karzer oder, schlimmer noch, dem Rohrstock auslieferte.
»Ich habe das Werkzeug holen können. Es liegt im Kabuff neben dem Tor.«
Utz deutete mit dem Kopf zum Hauptportal des Hofes. Jerg nickte zufrieden. Es war Utz also gelungen, hinter dem Rücken von Anthenius, dem bedellus, Schaufel und Meißel aus der kleinen Werkstatt im Haupthaus mitgehen zu lassen. Beides würden sie heute Nacht gut brauchen können.
Eine kleine Glocke begann zu bimmeln und rief die Scholaren zum Mittagessen. Als die drei auf dem Weg zum Gebäude mit ihren Kommilitonen zusammentrafen, wechselten sie sowohl Sprache als auch Thema. Nickel und Jerg disputierten auf Latein angeregt über Wesen und Ursachen der aristotelischen Metaphysik, während Utz ahnungslos, aber voller Überzeugung mit dem Kopf nickte.
Zehn Minuten später erfüllte ein enormer Geräuschpegel das triclinum, wie der Speisesaal der Burse in Anlehnung an die römischen Vorbilder genannt wurde. Zwar waren die Scholaren gehalten, während des Essens Ruhe zu bewahren und sich gesittet zu betragen, doch meist flogen Neuigkeiten, Spottworte und anzügliche Bemerkungen von Tisch zu Tisch. Hier wurde ein griechischer Vers deklamiert, dort ein Kommilitone wegen einer Wissenslücke aufgezogen. Die Magister saßen an einem separaten Tisch und taten so, als ginge sie der Wirrwarr nichts an. Nur wenn die Lautstärke allzu unerträglich wurde, stand einer von ihnen auf und ging mit deutlich sichtbarem Rohrstock eine Runde durch das triclinum.
Jerg löffelte seine halica, eine gesüßte Grütze, und spülte hin und wieder mit einem kräftigen Schluck covent nach, mit Wasser verdünntem Bier. Der dicke Utz hatte seinen Napf wie immer innerhalb weniger Wimpernschläge leer gefuttert. Utz war der Sohn vom Fleischhauer Magin in der Grebengass, seine Eltern hatten ihn von Kindesbeinen an tüchtig herausgefüttert. Jerg fragte sich, wie sein Kumpan trotz der eher bescheidenen Portionen hier in der Burse seine Leibesfülle behielt. Er hegte den heimlichen Verdacht, dass Utzens Mutter ihrem Sohn hin und wieder ein kleines Paket zusteckte mit allerlei Leckereien darin, Rinderzunge vielleicht, Magen oder fettiger Schwarte.
Eine solch schmackhafte Sonderbehandlung gab es für Jerg nicht. Sein Vater Eberhardt war Kupferschmied, er betrieb eine kleine Werkstatt in der Gaugass. Nun ja, ganz so klein war die Werkstatt nicht mehr, der Herr Vater hatte mittlerweile vier Burschen angestellt, die ihm zur Hand gingen. Denn das Ebenmaß seiner Werkstücke und sein gutes Auge für Proportionen hatten sich herumgesprochen in Meintz, er war häufig für die Adelspaläste am Diethmarkt tätig, inzwischen kamen sogar Kuriere von ganz weit her, von Dambstadt und sogar von Frankenfort, um Schmuck bei ihm zu bestellen.
Dieses florierende Geschäft ermöglichte es dem Herrn Vater, seinen ältesten Sohn an die neu gegründete universitas zu schicken. Jerg war einer von 54 Scholaren, die von 14 Magistern unterrichtet wurden. Der Fächerkanon der Meintzer alma mater war reich, die durcheinander schallenden Stimmen der Scholaren warfen Worte und Inhalte aus den verschiedensten Wissensgebieten in den Raum: aus der Theologie, der Medizin, dem kirchlichen und römischen Recht und natürlich aus den septem artes liberales, den Sieben Freien Künsten – Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik.
Laurentz und Matthes vom Brandt, zwei rothaarige Brüder von höchstens 13 Lenzen, saßen Jerg gegenüber, schlenkerten ihre Holzlöffel und redeten wie zwei Wasserfälle auf ihn ein. Mit der Begeisterung der Jugend versuchten sie ihm klarzumachen, dass mithilfe eines einfachen Rechensystems das Verhältnis der guten und schlechten Säfte im Inneren des Menschen ausgeglichen und dadurch jede Krankheit geheilt werden könne. Jerg nickte, doch er hörte nur mit halbem Ohr hin. Er wusste, dass er heute Nachmittag nicht wie am Morgen wegdösen und seinen Gedanken folgen konnte. Es standen nämlich repetitiones und disputationes auf dem Lehrplan, Wiederholungen und Diskussionen. Dabei musste jeder Scholar zeigen, dass er die Vorlesungen des Vormittags verstanden hatte und in freier Rede wiedergeben konnte. Argumente für und gegen die einzelnen Thesen wurden gesammelt, abgewogen und bewertet. Das Ergebnis stand freilich schon von vornherein fest: Das klassische Wissen, allen voran die Erkenntnisse des Aristoteles, war unverbrüchlich, Weisheit konnte nur durch Auswendiglernen und Wiederholen erlangt werden.
Es wäre Jerg niemals eingefallen, diesen Grundsatz infrage zu stellen. Wer war er denn, dass er sich gegen diese göttlich vorgegebene Ordnung auflehnte? Er kannte nur einen Menschen, der es wagte, immer und immer wieder gegen dieses Gesetz der Wissenschaft zu verstoßen: Magister Frencklein.
Er warf einen Blick zum Tisch der Lehrer. Magister Frencklein überragte alle anderen um Haupteshöhe, er leerte gerade einen Krug Dünnbier und fuchtelte mit der freien Hand in der Luft herum. Seine Augen waren aufgerissen, sein wallender Bart und das volle Haupthaar ließen ihn wie eine Urgewalt aussehen. Alle anderen Magister redeten gleichzeitig auf den großen Mann ein, offensichtlich hatte er einmal mehr eine gewagte These aufgestellt und konnte sie auch noch überzeugend vertreten.
Die helle Glocke erklang erneut und läutete das Ende des Mittagsmahls ein. Hastig schlang Jerg die letzten Löffel seiner halica herunter, während Magister Linhartt, der Lehrer für Theologie, ein Dankgebet sprach. Wie immer schloss er in das Gebet papa Sixtus ein, imperator Friedrich III., den Heiligen Albanus als Schutzpatron von Meintz, den Heiligen Hieronymus als Schutzpatron der Gelehrsamkeit, den Heiligen Godehard von Hildesheim, dessen Gedenken am heutigen Tage gefeiert wurde, und natürlich episcopus Dietherr von Isenburg.
Während Jerg gemessenen Schrittes über den sonnigen Innenhof zur repetitione ging und die jüngeren Semester aufgeregt an ihm vorbei rannten, weilten seine Gedanken noch immer bei episcopus Dietherr. Er hatte den alten Mann mit den strengen Falten um den Mund bereits einige Male bei Prozessionen in der Stadt gesehen oder im Dom des Heiligen Martinus, einmal sogar hier in der von ihm gestifteten Burse. Damals hatten alle Scholaren und Magister Spalier gestanden, zahllose Meintzer Bürger waren dabei und schwenkten ihre Hüte.
Doch Jerg wusste, dass ein Teil der Bevölkerung schlecht auf den Isenburger zu sprechen war. Nicht nur, dass er im letzten Jahr den Ketzerprozess gegen den allseits beliebten ehemaligen Dompfarrer Johann von Wesel vorangetrieben hatte. Nein, viele Adlige und Bürger machten den episcopus für den stetigen Niedergang der Stadt während der letzten 20 Jahre verantwortlich. Längst schon war sie keine freye statt mehr, viele der fähigsten Handwerker und Kaufleute waren weggezogen oder vertrieben worden. Schuld daran, so hatte Jergs Vater ihm hinter verschlossenen Türen erklärt, war der Pfaffkrieg: Erst hatte sich Dietherr, damals noch Domkustos, für viel Geld von papa Pius II. in Amt und Würden bringen lassen, als episcopus nämlich. Dann konnte er das Geld aber nicht zurückzahlen und paktierte auch noch mit den falschen Leuten. Sein Widersacher, Adolphus II. aus Nassau, nutzte die Gelegenheit und ließ sich vom papa als neuer episcopus bestätigen. Dietherr dachte aber gar nicht daran, seinen Platz zu räumen, und die meisten Bürger der Stadt hielten damals zu ihm. Da ließ Adolphus in einer dunklen Nacht seine Männer über das Gautor klettern und in die Stadt einfallen. In dieser schrecklichen Nacht, so knurrte der Herr Vater, seien mehr als 500 Männer in den Gassen von Meintz totgeschlagen worden und viele Häuser verbrannt. Dietherr, seine Anhänger und einige Freie flohen über den Rhein aus der Stadt. Am nächsten Tag zog Adolphus als rechtmäßiger episcopus ein und hielt Gericht auf dem Diethmarkt: Zahlreiche Adlige, Bürger und sogar der Stadtrat hätten gegen papa und imperator gehandelt. Sie verloren ihren Besitz und mussten Meintz verlassen. 1463, im Jahr von Jergs Geburt, wurde der Pfaffkrieg endlich beigelegt. Das war nun 17 Jahre her. Er schüttelte den Kopf. Welch ein Wirrwarr um diesen Pfaffenkram! Dabei drehte sich der Spieß zwölf Jahre später, 1475, schon wieder komplett um: Der greise Adolphus ernannte seinen einstigen Widersacher Dietherr zum Nachfolger, sodass der Isenburger mit seinem Tross wieder in Meintz einzog und zum zweiten Mal episcopus wurde. Verrückte Welt!
Während der repetitione des Nachmittags und den lectiones in vesperis am Abend beantwortete Jerg mechanisch alle Fragen und leierte die auswendig gelernten Argumentationen des Aristoteles und des Thomas von Aquin herunter. Nach der vespera verzog er sich mit Utz, Nickel und 14 anderen Burschen ins Schlafgemach der älteren Semester. Die Kommilitonen schliefen nacheinander ein, seufzten im Schlaf und schnarchten leise, doch die drei Freunde bekamen kein Auge zu. Der Mond schien von einem nahezu unbewölkten Himmel und zeichnete einen langen Lichtfinger durch die schmale, hohe Fensteröffnung. Nach einer Wartezeit, die ihm unendlich vorkam, warf Jerg leise seine Decke zurück und erhob sich vom Lager. Schemenhaft erkannte er, dass Nickel und Utz es ihm gleichtaten. Die drei schlüpften in ihre Kleidung und huschten nach draußen. Der Algesheimer Hof lag still wie ein Friedhof im silbernen Mondlicht.
»Wo ist er denn?«, wisperte Utz. Jerg wollte gerade etwas erwidern, als sich aus der Dunkelheit eine Hand auf seine Schulter legte. Er fuhr erschrocken herum und sah zu seiner Erleichterung die große Gestalt von Magister Frencklein aus dem Schatten treten. Der bärtige Mann roch nach Wein, er hielt einige Decken und grobe Schnüre in der Hand. Über seiner Schulter lag ein besticktes Tuch von augenscheinlich guter Qualität.
»Kein Wort hier. Erst, wenn wir draußen sind.«
Die dunkle Stimme des Magisters trug weit, obwohl er nur flüsterte. Zu Jergs Überraschung sprach er Deutsch mit ihnen.
Die drei Freunde nickten stumm und folgten Magister Frencklein, der einen Umweg nahm, um stets im Schatten der Umfassungsmauer zu bleiben. Der große und bullige Magister konnte sich überraschend leise bewegen, die drei Scholaren klangen dagegen trampelig wie eine Armee. Das Herz klopfte Jerg bis zum Hals, er rechnete jeden Augenblick damit, dass einer der Magister oder der bedellus schreiend und polternd aus dem Gebäude gerannt kam. Doch nichts passierte, alles blieb still bis auf die nächtlichen Geräusche der Stadt, Hunde jaulten, ein Pferd wieherte, Holz knarrte, irgendwo greinte ein Kind. Vor dem großen Haupttor trat Utz gebückt in eine kleine Kammer, kam mit Schaufel und Meißel wieder heraus und blickte ratlos auf das mächtige Portal. Jerg fragte sich ebenfalls, wie sie aus dem Algesheimer Hof herauskommen sollten. Schließlich war die Burse rund um die Uhr verschlossen, jeder Ausgang und jeder Besuch musste beim bedellus angemeldet werden.
Zu seiner Verwunderung holte der Magister einen langen Eisenschlüssel aus seiner Rocktasche und öffnete damit das Schloss. Jerg wusste, dass bedellus Anthenius diesen Schlüssel hütete wie seinen Augapfel. Der Herr mochte wissen, wie Magister Frencklein daran gekommen war! Knarrend öffnete sich einer der gewaltigen Eichenholzflügel, die Gerüche der schlafenden Stadt drangen ungehindert in die Nasen der vier Männer: Pferdemist, Fäkalien, brackiges Wasser, Holzfeuer, gegerbtes Leder und vieles mehr.
Der Mond heftete den vier Gestalten lange Schatten an, als sie über das unebene Pflaster der Christoffelsgass liefen. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach, jeder war sich der Ungeheuerlichkeit ihrer Tat bewusst. Was sie vorhatten war … Frevel, Sünde. Und doch, sie wussten, dass ihr Plan gut und richtig war. Sogar der dicke Utz, den der Herrgott nicht gerade mit herausragenden Geistesgaben gesegnet hatte, begriff: Sie würden heute Nacht Geschichte schreiben.
Dienstag, 30. März 1982
Professor Friedhelm Schnaitteisen hieb mit den flachen Händen auf die Platte seines Schreibtisches, sodass die zahllosen Bücher, Briefe und Stifte sowie seine Kaffeetasse auf und nieder hüpften.
»Verdammt und zugenäht, das gibt’s doch wohl nicht!«
Der Professor war ein mageres Männlein von gerade einmal 1,70 Meter, das eine riesige Hornbrille auf der Nase trug, doch seine Energie und sein Arbeitseifer reichten aus, um die gesamte Physikalische Abteilung der Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Atem zu halten.
Doktor Harald Melb duckte sich und verzog das Gesicht. Er hasste es, seinem Chef schlechte Nachrichten überbringen zu müssen, aber leider war er nun mal Leiter des AMS-Projektes und damit schon seit Wochen auf schlechte Nachrichten spezialisiert.
»Wir, eh, wir haben alles noch mal kalibriert und auch neue Proben genommen und alle neu ionisiert. Also, irgendwas stimmt da nicht.«
Der Professor sprang auf und wieselte um den Tisch herum. Sein Laborkittel flatterte, als er durch die Tür lief.
»Na, kommen Sie schon, Harald, kommen Sie!«, rief er Melb über die Schulter zu. Dieser fragte sich zum hundertsten Mal, wie ein so kleiner Mensch so viel Elan haben konnte. Der Professor schien niemals zu essen oder zu schlafen, stets rannte er in den Labors herum, wusste über alles Bescheid, hatte bei jedem Problem eine gute Idee parat und schaffte es ganz nebenbei, die Forschungsgelder und die Spenden für die Senckenberg-Gesellschaft sprudeln zu lassen. Seit er vor sieben Jahren die Leitung des Physikalischen Instituts übernommen hatte, waren zahllose neue Leute eingestellt und sündhaft teure Geräte angeschafft worden. Die Einrichtung verfügte inzwischen über neue Gaschromatografen, einen Umlaufkryostat, ein Rasterkraftmikroskop sowie mehrere Flüssigszintillationsspektrometer. Dazu kam, dass in fast jedem Labor ein nigelnagelneuer IBM Personal Computer mit passendem 9-Nadel-Drucker stand.
Schnaitteisens neueste Errungenschaft aber war das Beschleuniger-Massenspektrometer, dessen Funktionsweise nach dem englischen Accelerator Mass Spectrometry als AMS-Technologie bezeichnet wurde. Melb sah das gesamte System aus Röhren, Kabeln und gewaltigen Tanks vor sich, als er hinter Schnaitteisen die hell erleuchteten Kellerräume des klassizistischen Gebäudes in der Frankfurter Senckenberg-Anlage betrat. Die allermeisten Menschen kannten nur den Museumstrakt des Gebäudes und bestaunten im Erdgeschoss und in den Obergeschossen mit offenem Mund die Dinosaurierskelette. Doch hier unten im Keller schlug das wissenschaftliche Herz der Gesellschaft für Naturforschung, hier wurde gearbeitet, analysiert, geforscht und entwickelt.
Der größte Kellerraum, die Soemmering-Halle, war für das aktuelle AMS-Projekt reserviert. Die Halle wurde von einer gewaltigen blauen Röhre dominiert, an der Hunderte Schläuche, Kabel und Messgeräte angeschlossen waren. Melbs Mitarbeiter standen an verschiedenen Messpunkten und überprüften Listen, hackten Zahlenkolonnen in klobige Tastaturen oder inspizierten die Kabelstränge am Tandembeschleuniger. Grelles Neonlicht tauchte die Halle in Helligkeit, das Summen und Piepen von Aggregaten war allgegenwärtig. Der Professor lief bereits auf einen der Assistenten zu und half ihm beim Kalibrieren.
Von hinten zupfte jemand an Melbs Laborkittel.
»Herr Doktor, was ist denn los? Klappt etwas nicht?«
Er unterdrückte ein Stöhnen und drehte sich herum. Zwei Jugendliche standen da, beide in zu großen weißen Kitteln mit angesteckten Besucherausweisen. Hardy und Bernd waren zwei Neuntklässler vom Goethe-Gymnasium, die sich für ihr 14tägiges Berufspraktikum ausgerechnet das Institut für Physik ausgesucht hatten. Bernd war ein pummeliger Junge mit fliehendem Kinn, Hardy hatte eine Bohnenstangen-Figur und blinzelte durch eine kleine Brille. Heute war ihr zweiter Tag, und Melb verfluchte das Schicksal, das die beiden ausgerechnet in dieser schwierigen Phase ins Labor geführt hatte.
»Eh, ja, nein, also, alles in Ordnung soweit, wir, hm, müssen nur die Maschine neu einstellen«, murmelte er. ›Die Maschine neu einstellen‹ – war das überhaupt das richtige Vokabular für Neuntklässler? Er hatte keine Ahnung, was Schüler heutzutage im Physik- und Chemieunterricht lernten, und es war ihm auch schnurzpiepegal. Er war schließlich ans Senckenberg-Institut gekommen, um richtige Forschung zu betreiben und nicht um als Lehrer Lämpel begriffsstutzigen Schülern die Welt zu erklären!
Ungerührt fragte Bernd:
»Was macht die Maschine eigentlich?«
Genau diese Frage hatte er befürchtet. Er bückte sich über die Ergebnisse einer Dünnschicht-Chromatografie und brummte:
»Eh, also, das ist nicht so einfach. Ich glaube, das ist zu kompliziert für euch. Vielleicht erkläre ich es euch in den nächsten Tagen.«
»Lassen Sie nur, Harald, ich kümmere mich um die beiden.«
Erschrocken fuhr Melb hoch. Professor Schnaitteisen war zurückgekehrt, nickte freundlich und führte die zwei Jungs ein paar Schritte in den Raum hinein. Er fing an, einen der Arbeitstische abzuräumen und lud sie ein, ihm zu helfen. Gemeinsam packten sie Laborzubehör, Reagenzgläser, Unterlagen und Petrischalen zur Seite. Dann wischte der Professor mit dem Ärmel seines Kittels über die Tischplatte, alle drei hockten sich darauf. Melb drehte die Augen zum Himmel. Gestern hatte er den Schülern als Allererstes eingetrichtert, nichts anzufassen, nichts wegzustellen und sich nirgendwo hinzusetzen, außer er würde es ihnen ausdrücklich erlauben. Und nun saßen sie gemeinsam mit seinem Chef auf einem Arbeitstisch wie die Lausejungen und ließen die Beine baumeln.
Der Professor beugte sich vor.
»So, jetzt stellt euch mal vor, ihr findet eine Holzkiste mit Gold drin, und ihr wollt wissen, wie alt der Schatz ist. Wie könnt ihr das machen?«
Bernd überlegte, aber Hardy kam sofort darauf.
»Ich schaue mir die Goldmünzen an, wann sie geprägt worden sind.«
Schnaitteisen nickte lächelnd.
»Sehr gut. Aber wenn keine Goldmünzen drin sind, sondern Schmuck und eine Krone?«
Diesmal dauerte es etwas länger, bis Hardy eine Antwort fand.
»Dann schaue ich mir genau an, wie die Sachen aussehen. Und dann suche ich andere, ähnliche Sachen, im Museum vielleicht, von denen ich weiß, wie alt sie sind. Und dann weiß ich, wie alt meine Sachen sind.«
Melb tat so, als wäre er in einen Auswertungsbogen vertieft und schüttelte leicht den Kopf. Konnten die Schüler von heute nicht mal anständig reden? Es zeugte ja nicht gerade von einem hohen Sprachniveau, wenn jeder Satz mit ›und dann‹ anfing.
Doch sein Chef nickte schon wieder.
»Prima. Aber jetzt wird’s schwer: Es ist ein Schatz, der besteht nur aus, sagen wir mal … ganz simplen Goldbarren. Da ist nichts eingeprägt, und du kannst nirgendwo etwas Vergleichbares finden. Was machst du dann?«
Hardys Zunge erschien im linken Mundwinkel und wanderte in Zeitlupe in den rechten. Schließlich zuckte er die Schultern.
»Weiß nicht. Keine Ahnung.«
Der Professor machte eine Kunstpause und hob die Augenbrauen.
»Wisst ihr, was eine Halbwertszeit ist?«
Beide nickten unisono.
»Gut. Denn unsere Maschine hier kann uns bei dem Goldschatz weiterhelfen. Sie macht sich die Halbwertszeit eines bestimmten Isotops zunutze, des Kohlenstoffs 14. Dieses Isotop hat drei Vorteile. Erstens: Es hat keine so fürchterlich lange Halbwertszeit wie Plutonium oder gar Uran, das erst nach vielen, vielen Hundert Millionen Jahren zerfällt. Zweitens: Wir kennen die Halbwertszeit von Kohlenstoff 14 haargenau, nämlich 5730 Jahre. Und drittens: Es kommt in allen organischen Sachen vor, also in Holz, in Knochen und so weiter. Jedes lebende Wesen, ob Mensch, ob Tiere, ob Pflanze, hat diesen Kohlenstoff im Organismus, bis es stirbt. Ab dann beginnt der Zerfall des Isotops.«
Die beiden guckten den Professor verständnislos an.
»Ja und?«, fragte Bernd gedehnt. »Gold ist doch ein Metall und kein lebendes Wesen.«
Da fingen Hardys Augen an zu leuchten.
»Aber die Schatzkiste ist es! Die ist nämlich aus Holz!«
»Genau!«, lachte Schnaitteisen. »Wir sägen also von der Holzkiste eine Ecke ab und schauen, wie viel Kohlenstoff 14 noch drinsteckt. Als Nächstes prüfen wir, wie viel ein normales, neues Stück Holz enthält. Dann errechnen wir die Differenz zwischen dem neuen und dem alten Holz. Und weil wir ja wissen, wie schnell das Isotop zerfällt, können wir ziemlich genau ausrechnen, wie lang das Holz der Kiste schon tot ist. Damit wissen wir, wie alt der Goldschatz ist. Und genau das macht der Riesenapparat da vorn.«
»Wow!«
Die Schüler waren nachhaltig beeindruckt, und Melb musste einmal mehr den Hut vor seinem Chef ziehen. Der Sachverhalt war zwar sehr vereinfacht dargestellt, beschrieb den Vorgang aber einigermaßen treffend. Da war seine Formulierung ›die Maschine neu einstellen‹ tatsächlich ein wenig plump gewesen.
»Und jetzt klappt etwas nicht richtig?«, bohrte Hardy nach. Er war offensichtlich der pfiffigere der beiden Schüler, sein Kamerad Bernd machte einen eher orientierungslosen Eindruck.
Der Professor wiegte den Kopf hin und her.
»Nein, irgendwas ist nicht in Ordnung. Wir kommen partout nicht drauf, was es sein könnte, und das macht uns mächtig nervös. Es ist so, als würden wir verschiedene Ecken von derselben Schatzkiste absägen und jedes Mal ein komplett anderes Alter herausbekommen.«
Melb nickte grimmig. Sein Chef traf den Nagel auf den Kopf. Der Professor hatte den Schülern nämlich nicht erklärt, dass das Institut hier mithilfe der AMS-Technologie eine neue Variante der klassischen C14-Methode betrieb. Dabei wurden die Anionen in einem Tandembeschleuniger mit Hilfe von fünf Millionen Volt umgeladen und doppelt beschleunigt. Anschließend lenkte ein Magnetfeld die Teilchen je nach Masse ab. Da sie aber durch die zweifache Beschleunigung eine wesentlich höhere Energie besaßen, erfolgte die Sortierung genauer als bei der herkömmlichen C14-Methode. Damit lieferte die neue Variante sehr viel exaktere Zeitangaben, die bekannten Ungenauigkeiten der Kohlenstoff-Messung, die zum Teil mehrere Hundert Jahre betrugen, waren endgültig passé.
Theoretisch zumindest. Melb verzog das Gesicht. Denn genau hier lag der Hase im Pfeffer. In den letzten Wochen waren er und sein Team damit beschäftigt gewesen, dieses neue System zu kalibrieren. Schließlich konnte niemand von Anfang an sagen, ob die Ergebnisse des Beschleuniger-Massenspektrometers tatsächlich stimmten oder ob irgendwelche unbekannten Faktoren Fehler einstreuten. Also ging man vor wie bei jeder neuen wissenschaftlichen Methode: Man verglich ihre Ergebnisse mit bekannten und gesicherten Größen. Im Falle einer Altersbestimmungsmethode bedeutete das, zuverlässig datierte Proben durch das Gerät laufen zu lassen und zu hoffen, dass die neuen Ergebnisse mit den alten übereinstimmten.
Taten sie auch. Bis auf ein paar vermaledeite Ausnahmen. Und genau diese Ausnahmen stellten im Moment das gesamte Projekt infrage. Denn die AMS-Methode wurde bis dato nur an einer Handvoll Instituten weltweit durchgeführt, neue Ergebnisse waren also rar und bedeuteten für die betreffende Einrichtung einen erheblichen Gewinn an Reputation. Wenn diese Ergebnisse aber fragwürdig erschienen, blieben zukünftige Forschungs- und Spendengelder allzu leicht auf der Strecke.
Die helle Stimme von Bernd platzte in seine düsteren Gedanken.
»Aber nehmen Sie denn wirklich Holz von alten Schatzkisten für Ihre Versuche hier?«
Melb schnaufte. Er hatte den Intellekt des Burschen offensichtlich genau richtig eingeschätzt. Doch Professor Schnaitteisen blieb ernst und schüttelte den Kopf.
»Nein, Bernd. Bei Schätzen weiß man ja ganz selten, wann genau sie versteckt oder vergraben wurden. Wir brauchen hier aber zum Testen der Maschine Proben, von denen wir ganz genau wissen, wie alt sie sind.« Er schwieg bedeutungsvoll.
Die Schüler machten große Augen.
»Hmmm, verraten Sie uns denn auch, was das für Proben sind?«, fragte Hardy vorsichtig, als würde er an einem großen Geheimnis rütteln.
Der Professor setzte eine verschwörerische Miene auf.
»Ich verrate es euch nicht nur – ich zeige es euch sogar!« Gemeinsam mit den beiden aufgeregten Schülern ging er zu einer Edelstahltür, die zu einem speziellen feuchtigkeits- und temperaturgeregelten Nachbarraum führte.
Melb sah ihnen verstimmt nach. In diesem Raum lag der Ursprung seiner Sorgen und Probleme. Dabei hatte er sich als Projektleiter ganz besonders gefreut, als vor ein paar Monaten während des Aufbaus der AMS-Anlage das Mainzer Landesamt für Denkmalpflege der Senckenberg-Gesellschaft unentgeltlich fantastisches Probenmaterial anbot – mehr als 600 Jahre alt und mit einer jahresgenauen Datierung versehen. Natürlich hatte er sofort zugesagt. Doch was wie ein seltener Glücksfall schien, bereitete ihm bald darauf schon schlaflose Nächte. Denn es gab immer wieder Ausreißer bei den Resultaten, fehlerhafte Befunde, die es eigentlich gar nicht geben durfte und die sich nicht vernünftig erklären ließen. Aber mit Ergebnissen, die nicht hieb- und stichfest und zu 100 Prozent nachprüfbar waren, brauchte sich das Institut gar nicht erst an die wissenschaftliche Öffentlichkeit zu wenden.
Der Professor und die beiden Schüler kamen aus dem Nachbarraum zurück. Schnaitteisen schmunzelte still vor sich hin, während Hardys Augen vor Begeisterung leuchteten. Bernd hingegen sah gar nicht gut aus, er war grünlich im Gesicht und machte den Eindruck, als würde er sich gleich in den nächsten Papierkorb übergeben.
Harald Melb konnte es ihm nicht verdenken. Die Mainzer Proben waren gruselig, wenn man nicht mit einem solchen Anblick rechnete. Mit schmalem Lächeln wandte er sich wieder einem Monitor zu, auf dem die Parameter der nächsten Messreihe erschienen.
Hinter ihm fiel die Edelstahltür ins Schloss und ließ die geheimnisvollen Proben aus Mainz in der Dunkelheit zurück.
Donnerstag, 23. Dezember 2010
An diesem Morgen gab es beim Bäcker Danner in Mainz-Lerchenberg nur ein einziges Gesprächsthema am Verkaufstresen: das nächtliche Erdbeben!
»… unn dann bin isch erschrocke, des hot geknallt wie en Pistoleschuss, unn dann war isch hellwach!«, berichtete eine dickliche Mittfünfzigerin, während ihre Brötchentüte unbeachtet auf dem Tresen lag. Eine sorgfältig frisierte ältere Dame nickte eifrig und trat einen Schritt nach vorn.
»De Helmut is aach gleich wach gewor’n unn hat zuerst gedacht: Einbrecher, gell, dademit muss ma ja immer rechne!«
Die Dicke ließ sich von der Unterbrechung nicht aus dem Konzept bringen und fuhr ungerührt fort.
»Unn dann hat’s gerumpelt unn gedonnert, wie wenn en Zug durchs Haus gerast wär. So hat sich des angehört!«
Bekräftigend machte sie mit den Armen eine Bewegung, als wolle sie eine Wand durchstoßen. Die Verkäuferin und die anderen Kundinnen nickten. Die meisten waren ebenfalls um halb drei in der Nacht wach geworden, als die Erde gebebt hatte.
»Bei uns sind sogar die Tassen vom Kaffeeservice im Schrank umgekippt, so einen Schlag hat das getan!« Eine blasse Frau mit dünnem Haar hatte die Augen aufgerissen.
»Dabei haben immer nur zwei übereinander gestanden, immer nur zwei!«
Allgemeines Gemurmel im Laden kommentierte diesen ungeheuerlichen Vorfall. Die Verkäuferin stützte ihre fleischigen Unterarme auf den Tresen und beugte sich verschwörerisch vor.
»Unn, Elfriede, was hat’n dein Nachbar gemacht, der Jean? Dem is doch bestimmt sein ganzer Krempel vor die Füß’ gefalle heut Nacht. So vollgestellt, wie dem seine Bude is’. Oder?« Kichern und leises Gepruste waren die Reaktion auf ihre Frage. Die meisten Kunden kannten Johann ›Jean‹ Rosenzweig und dessen Sammelleidenschaft, nicht wenige hatten sein sonderbares Haus bereits von innen gesehen.
»Ach Gott, ich hab den Jean nur mal kurz gesehe’.«
Die Frau, die mit Elfriede angesprochen worden war, rollte die Augen theatralisch gen Himmel.
»Er is in die Garage gerennt und mit seinem Werkzeugköfferche widder zurück ins Haus, und dann hat er unterm Dach Licht angemacht. Uff’m Speicher, da hat er ja die größte und schwerste Sache von sei’m Krempel stehe, da wirds am meiste geknallt habbe.«
Sie nickte wissend. »Da ist jetzt bestimmt en schönes Durchenanner.«
Wie schnatternde Hühner echauffierten sich die Damen in der Bäckerei noch eine ganze Weile über das seltsame Haus des Johann Rosenzweig und über das Erdbeben in der Nacht, bevor sie mit Backwaren beladen den Nachhauseweg antraten.
Im Dachboden eines großen Hauses in der Hindemithstraße hockte ein alter Mann auf den kalten Dielen. Eine staubige 100-Watt-Birne warf ihren Lichtschein auf ein Sammelsurium an Gegenständen, die kreuz und quer in dem großen Raum herumstanden: alte Weinbaugeräte, seltsame technische Konstruktionen, ausgestopfte Tiere, antike Waffen, Musikinstrumente, optische und chemische Apparaturen, ramponierte Uniformen und vieles mehr. Dazwischen stapelten sich Bücher, Hefte, Landkarten, Zeitschriften, Loseblattsammlungen, Notizen, Akten und handgeschriebene Vermerke. Die Dachschrägen waren gesäumt von Kommoden, Sekretären, Beistelltischen und Schränken, von denen einige umgefallen waren. Ihr Inhalt hatte sich über die am Boden stehenden Kuriositäten ergossen, sodass der gesamte Raum an ein staubiges Riesenpuzzle erinnerte.
Der Mann kauerte an einem antiken Sekretär, der überaus wackelig auf einer schmalen Anrichte gestanden hatte und deshalb bei dem nächtlichen Erdbeben umgestürzt war. Die Türen hingen in schiefem Winkel in den Angeln, das Holz war an einigen Stellen zerbrochen. Doch die Augen des alten Mannes waren auf eine bestimmte Stelle an der Rückseite des Sekretärs geheftet. Hier hatte die Wucht des Aufpralls die Rückwand aus den Fugen geraten lassen, darunter war eine zweite Wand zum Vorschein gekommen – ein Geheimfach. In dem wenige Zentimeter schmalen Spalt zwischen den beiden Hölzern steckte etwas, das das Herz des Mannes höher schlagen ließ.
Seit Jahrzehnten war er am Suchen, Sammeln, Sortieren und Aufbewahren. Aber heute Nacht, das wusste Johann Rosenzweig ganz genau, hatte ihm das Erdbeben einen ganz besonderen Fund in die Hände gespielt.
»Stadtansicht Mainz«, kolorierter Holzschnitt von Franz Behem, 1565
ERSTER TEIL
Mittwoch, 14. März 2012
Hannah setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Die muffige Luft in dem unterirdischen Stollen war klamm und kalt, der unebene Boden brachte sie immer wieder zum Stolpern. Die Decke des Gangs war so niedrig, dass sie sich ständig bücken musste und ihr Helm in unregelmäßigen Abständen an vorspringende Steine stieß. Um sie herum herrschte Dunkelheit, lediglich der tanzende Lichtkegel ihrer Maglight wies ihr den Weg durch den Stollen. Hannah hatte sich ihren fluoreszierenden Tauchkompass um das Handgelenk geschnallt und warf einen Blick darauf.
»Bin jetzt 25 Schritte in nordwestliche Richtung gegangen. Der Tunnel ist nach wie vor gemauert, allerdings in schlechtem Zustand. Alles ist feucht, der Boden ist mit Geröll und losem Erdreich bedeckt.«
Hannahs Stimme klang dumpf und fremd in dem Gewölbe. Sie blieb stehen, zog eine kleine Digitalkamera aus ihrem Rucksack und schoss ein Foto des Stollens. Der Blitz erhellte für den Bruchteil einer Sekunde einen grob gemauerten Gang, rund 1,50 Meter hoch und ebenso breit. Sickerwasser bildete Rinnsale an den Wänden, die brackigen Pfützen auf dem Boden glänzten wie flüssiges Metall. Hier und dort waren Steine herausgebrochen, bleiche Baumwurzeln ragten wie Knochenarme in den Tunnel hinein.
»Ich gehe jetzt weiter. 35 Schritte. Der Gang wird schwerer passierbar.«
Mit Kraft zwängte sie sich durch eine halb eingestürzte Engstelle. Heißer Schreck durchfuhr sie, als ein wenig Gestein nachbrach und eine Mischung aus Schlamm und Wasser auf ihre Schultern klatschte. Zum wiederholten Male fragte Hannah sich, ob ihre Idee wirklich so gut gewesen war, und wie immer wusste sie die Antwort: Ihre nächtliche Exkursion war die einzige Möglichkeit, den Lauf der Dinge in letzter Sekunde noch zu ändern. Sie machte zwei, drei tiefe Atemzüge, dann ging sie weiter. Seit vielen Hunderten von Jahren hatte kein Mensch diesen Tunnel betreten, das war ihr klar. Ihr Herz klopfte vor Aufregung, aber auch vor Stolz.
»Jetzt macht der Gang eine 90-Grad-Kehre nach rechts, ich befinde mich …«
Irritiert brach sie ab und fuhr herum. Einen Augenblick lang hatte sie geglaubt, hinter sich ein Geräusch gehört zu haben. Doch alles war still. Sie nahm den Faden wieder auf.
»Ich befinde mich in einem größeren Gang, der Boden ist besser erhalten, aber auch hier sind überall Brüche an den Wänden zu sehen.«
Sie musste ihre Angst niederkämpfen, als sie die mächtigen Steinblöcke sah, die herausgefallen waren. Die übrigen Mauersteine schienen stellenweise nur noch minimal verankert zu sein und entgegen jeder Physik an der Wand zu kleben.
»Der Tunnel, eh, macht einen akut einsturzgefährdeten Eindruck.«
Erneut drehte sie sich um. Diesmal war sie sich ganz sicher, ein Geräusch gehört zu haben, eine Art Scharren oder Klopfen. Sie lauschte. Da, schon wieder! Argwöhnisch leuchtete sie in die Richtung, aus der sie gerade gekommen war. Niemand wusste, dass sie hier war, kein Mensch kannte den Eingang zu diesem Tunnel. Wahrscheinlich war Geröll ins Rutschen geraten. Nicht gut. Sie hoffte inständig, dass ihre Aktion keinen größeren Erdrutsch hervorrufen und den Tunnel versperren würde. Aber rasch verdrängte sie diesen Gedanken und konzentrierte sich wieder auf ihr Ziel. Erneut las sie den Kompass ab und begann systematisch, die nassen Wände abzuleuchten. Nach einer halben Minute blieb der Lichtstrahl an einer Steinplatte hängen. Aufgeregt murmelte sie:
»Vor mir ist etwas, das wie der Übergang zur eigentlichen Kammer aussieht.«
Sie trat einen Schritt nach vorn, als plötzlich ein Lichtstrahl seitlich in ihre Augenwinkel fiel. Verblüfft kniff sie die Lider zusammen. Ein schwankendes Licht näherte sich. Also war doch jemand hinter ihr her! Mit einem leisen Fluch knipste Hannah ihre Maglight aus, doch es war zu spät. Schon hatte der tastende Strahl sie gefunden. Mit der Hand schattete sie ihre Augen ab, um sie vor dem grellen Licht zu schützen. Ihre Empfindungen wirbelten durcheinander – Wut, weil ihr offensichtlich jemand zuvorkommen wollte. Und Angst, weil sie wusste, dass sie sich mit rücksichtslosen Menschen angelegt hatte.
Sie ließ ihre Lampe aufflammen und leuchtete dem Ankömmling ihrerseits ins Gesicht. Sofort drehte dieser seinen Lichtstrahl zur Seite, sodass sie wieder sehen konnte. Erstaunt hob sie die Augenbrauen. Das dreckverschmierte Gesicht unter dem Helm kannte sie.
»Na, das ist ja mal eine Überraschung«, meinte sie lakonisch.
*
Im Philosophicum, dem größten geisteswissenschaftlichen Bau der Universität Mainz, herrschte in der vorlesungsfreien Zeit ein gemächliches Tempo. Die langen Flure, in denen normalerweise schwatzende Studierende hin und her eilten, waren nahezu verwaist, nur hier und dort lief jemand mit Büchern im Arm von einem Raum zum anderen.
Vor der verschlossenen Tür von Professor Eckhard Nümbrecht standen drei Gestalten. Nach einer halben Stunde Wartezeit hatte sich zwischen den Studierenden eine nette Plauderei entwickelt, es stellte sich heraus, dass zwei auf derselben Schule gewesen waren und der dritte allerlei Abenteuer während einer Rucksack-Tour durch Nordafrika erlebt hatte. Doch all die Anekdoten konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich im Zimmer des Professors nichts rührte und die Tür nach wie vor verschlossen blieb, obwohl heute seine Feriensprechstunde war.
Die Sekretärin des Instituts für Mittelalterliche Geschichte kam um die Ecke. Sie trug einen Stapel Unterschriftsmappen unter dem Arm und – wie gewöhnlich – eine Leidensbittermiene im Gesicht. Die Studierenden nannten Frau Schillmer hinter vorgehaltener Hand nur ›den Drachen‹. Sie wusste das und tat alles, um diesem Bild zu entsprechen und damit die Anzahl studentischer Anfragen so gering wie möglich zu halten.
Einer der drei Wartenden fasste sich ein Herz und wandte sich an den Drachen.
»Entschuldigung, Frau Schillmer, der Herr Nümbrecht hat eigentlich Feriensprechstunde, aber er ist nicht da. Wissen Sie, wo er ist?«
Der Drache begutachtete den jungen Mann über den Rand seiner Lesebrille hinweg wie ein lästiges Insekt.
»Da weiß ich nichts drüber. Der Herr Professor hat vielleicht wichtigere Termine.«
Eingeschüchtert setzte sich der Student hin. Frau Schillmer drehte den Kopf ostentativ zur Seite und ging ein paar Schritte weiter zur nächsten Tür, hinter der das Büro von Frau Dr. Lohmann lag. Sie hatte während des Vormittags den Flur vor ihrer Bürotür im Auge behalten und wusste sehr genau, dass Frau Dr. Lohmann noch nicht da war. Heimlich warf sie einen Blick auf ihre Armbanduhr. Kurz vor elf. Perfekt! Alles, was sie jetzt brauchte, war ein leeres Büro – mit einem Telefon.
Übertrieben korrekt klopfte Frau Schillmer an die Tür und wartete. Schließlich betonte sie durch einen langen Blick die Wichtigkeit ihrer Unterschriftsmappen, klapperte mit dem Zentralschlüssel und öffnete die Tür.
Vor Überraschung blieb ihr der Mund offen stehen.
Das Büro war gar nicht leer. Am Schreibtisch von Frau Lohmann hockte Professor Nümbrecht, hielt einen Stapel Papiere in der Hand und starrte sie erschrocken an.
»Oh, hallo, Frau Schillmer, eh, ich … ich habe gerade ein paar Folien gesucht für die, eh, Vorlesung über die Ottonen. Die müssen hier irgendwo sein, hm …«
Er blätterte wahllos durch zwei, drei Unterlagen, stand auf und strich sein Sakko glatt.
»Tja, da werde ich wohl auf Frau Lohmann warten müssen.«
Er lächelte verlegen. Im Türrahmen standen inzwischen die drei Studenten und schauten ihn verblüfft an.
»Hallo, Herr Professor, wir warten schon die ganze Zeit vor Ihrem Büro wegen der Sprechstunde.«
»Oh, ja, klar, natürlich, ich … ich komme. Danke, dass Sie gewartet haben.«
Unter dem verwunderten Blick des Drachens verließ der Professor das Zimmer und verschwand in seinem eigenen Büro.
*
Mit einem hellen ›Pling‹ landete die umgekippte Kaffeetasse neben der Tastatur, ein Schwall schwarzer Brühe ergoss sich über Kalender, Unterlagen und Notizen. Tinne zerbiss einen Fluch zwischen den Zähnen, griff nach einigen herumliegenden Papiertaschentüchern und begann hektisch, die Flut einzudämmen. Sie hatte lediglich versucht, ihr Mauspad unter der Tastatur hervorzuzerren, dabei war sie ungeschickt an den Becher gestoßen.
Ihre Kollegin Annegret Dahlmann streckte ihren Wuschelkopf durch die offene Verbindungstür zwischen den beiden Büros. Als sie die Bescherung sah, kam sie herbei und half bei der Tupf- und Wischaktion.
»Ich bin manchmal aber auch ein Trottel!«
Tinne ärgerte sich über ihre eigene Ungeschicklichkeit. Annegret machte eine wegwerfende Handbewegung, doch Tinne sah ganz genau, dass sie ein Grinsen nicht unterdrücken konnte.
Tinne arbeitete noch keine drei Monate am Institut für Neuere Geschichte, doch ihr Ruf als wandelnder Pechvogel eilte ihr bereits voraus. Zuerst hatte sie durch ein paar unbedachte Tastenbefehle den heiligen Kopierer des Fachbereichs auf eine mysteriöse amerikanische Maßeinheit umgestellt, dann war ihr Schlüssel auf wundersame Art und Weise im Schloss abgebrochen, sodass der Schließzylinder der Bürotür ausgewechselt werden musste. Als Krönung hatte sie schließlich versehentlich den computergestützten Raumverteilungsplan des gesamten Instituts lahmgelegt, sodass eine halbe Woche lang aufgebrachte Studierende und saallose Professoren durch die Flure des Philosophicums irrten.
Tinne setzte sich und atmete durch. Wenigstens waren die Hausarbeiten aus dem Proseminar ihres Chefs trocken geblieben, die sie gerade korrigierte – es wäre mehr als peinlich gewesen, wellige Arbeiten mit malerischen Kaffeerändern an Professor Raffael zurückgeben zu müssen.
Annegret warf die nassen Papiertücher in den Abfalleimer und verschwand noch immer grinsend durch die Tür. Tinne schnitt eine Grimasse und lehnte sich zurück. Sie hatte sich noch immer nicht richtig an den Uni-Alltag gewöhnt, an die überfüllten Seminare, die ungelüfteten Flure und an das kleine Büro, das aus allen Nähten platzte. Es war ganz eindeutig viel zu viel Zeit vergangen, seit sie selbst als Studentin auf dem Campus ein- und ausgegangen war. Wie viel? Sie rechnete kurz nach: Im Jahr 2000, also mit 25, war sie im ersten Semester gewesen, mit 30 hatte sie ihren M.A., ihren Magister, in der Tasche. Das war inzwischen sieben Jahre her. Wow, was hatte sich in diesen paar Jahren nicht alles verändert!
Das gesamte Universitätssystem war in der Zwischenzeit auf Bachelor- und Masterabschlüsse umgestellt worden, der Ablauf des Studiums orientierte sich stark am schulischen System: wenig Wahlmöglichkeiten, hoher Prüfungsdruck. Mehr als einmal hatte ein Student ihr schon klipp und klar gesagt, dass ihn nicht die Inhalte des Faches interessieren würden, sondern lediglich der Stoff für die nächste Klausur. Schöne neue Welt des Studierens!
Ein Klopfen riss sie aus ihren Gedanken. Die Tür ging auf, ein Kollege kam herein, ein junger Mann mit beginnender Glatze und kleinem, dreieckigem Teufelsbärtchen am Kinn. Gero Frey war Doktorand von Professor Nümbrecht am Institut für Mittelalterliche Geschichte. Damit trennten ihn und Tinne räumlich gerade einmal 20 Meter, fachlich aber mehrere Hundert Jahre. Denn während er den Zeitraum des Mittelalters zwischen 500 und 1500 bearbeitete, begann ihre Forschung erst im Jahr 1789 mit der Französischen Revolution.
Tinne schaute ihn fragend an und fürchtete heimlich, er würde ihr einen frisch ausgedruckten Papierstapel unter die Nase halten. In einem Anfall von Großmut hatte sie sich nämlich bereit erklärt, seine langsam wachsende Doktorarbeit auf Tipp- und Kommafehler zu überprüfen. Sein Thema – die Juden im mittelalterlichen Mainz – war zwar äußerst interessant, aber leider schrammte Geros Orthografievermögen hart an der Grenze zur Legasthenie entlang, sodass sie jedes Mal einen kompletten Abend für die Korrektur einplanen musste.
Doch Gero hatte keinen Papierstapel dabei, sondern ein dickes Buch mit dem Titel ›Miscellanea Mediaevalia. Das Verhältnis zwischen Juden und Stauferkaiser‹.
»Hi, Tinne, sag mal, wo kann ich davon noch ein Exemplar herkriegen?«
Tinne schnaufte. Das war ja mal wieder typisch! Nur weil sie zuvor in einem Mainzer Fachbuchverlag gearbeitet hatte, ging das gesamte Philosophicum völlig selbstverständlich davon aus, dass sie sogar für die unbekanntesten und merkwürdigsten Bücher eine Bezugsquelle kannte. Weil Gero aber ein netter Kerl war, schluckte sie ihren Ärger herunter und versuchte, ihm zu helfen. In weiser Voraussicht hatte sie von Anfang an sämtliche Buchhändler- und Distributorenlisten ihres ehemaligen Arbeitgebers heruntergeladen und auf ihrem Computer gespeichert. Nach einigen erfolglosen Versuchen nickte sie.
»Beim Schauna-Verlag in Magdeburg gibt’s noch ein paar Exemplare.«
»Danke!« Gero strahlte und verschwand.
Tinnes Gedanken blieben bei ihrem letzten Job, in dem sie für historische Recherchen und Lektorate verantwortlich gewesen war. Nichts Atemberaubendes, auch noch kläglich unterbezahlt, aber immerhin eine Arbeitsstelle. Nach der plötzlichen Entlassung im letzten Dezember hatte sie sich mit dem Mut der Verzweiflung bei Professor Raffael vorgestellt, bei dem sie ihre Magisterarbeit geschrieben hatte. Zu ihrer eigenen Überraschung bot der Professor ihr einen befristeten Teilzeitvertrag als Lehrbeauftragte an. Zwölf Wochenstunden warfen zwar nicht gerade ein üppiges Gehalt ab, reichten aber für ein WG-Zimmer im nahen Stadtteil Bretzenheim und den wöchentlichen Einkauf bei Aldi. Nicht gerade das Leben, das man sich mit 36 erträumte, aber besser als nichts.
Tinne seufzte und machte sich weiter über die Seminararbeiten her. Um halb vier linste ihre Kollegin Annegret erneut durch die Verbindungstür.
»Tinne, du denkst dran, mir noch ein paar Zeilen über die Ersti-Infowoche für die Zeitung zu schreiben? Die AZ hat noch mal nachgefragt.«
Sie unterdrückte ein Stöhnen. Das hatte sie total vergessen!
Die korrekte und ein klitzekleines bisschen langweilige Annegret war nämlich neben ihrem regulären Lehrbetrieb zuständig für die Kommunikation zwischen dem Historischen Seminar und der Stadt Mainz. Unter der hochtrabenden Bezeichnung ›Wissenschafts-Referentin‹ gab sie Informationen über laufende Forschungsprojekte heraus und sorgte dafür, dass die Lokalpresse ab und an über die geschichtswissenschaftlichen Fachbereiche berichtete. Tinne hatte sich in einem schwachen Moment breitschlagen lassen, für die Mainzer Allgemeine Zeitung einen Artikel über die anstehende Erstsemester-Infowoche zu schreiben, diese Zusage allerdings in den letzten Tagen überaus erfolgreich verdrängt.
Nun schob sie gezwungenermaßen die Seminararbeiten zur Seite, suchte sich im Uni-Netzwerk eine Handvoll Informationen zusammen und hackte einen einigermaßen wohlklingenden Artikel herunter. Anschließend speicherte sie ihr Werk im Netzwerk in Annegrets öffentlichem Ordner, packte die restlichen Hausarbeiten in ihre Tasche und zischte ab. Sie war um vier mit einer Freundin im ›Baron‹ verabredet, einer gemütlichen Café-Restaurant-Kneipen-Mischung im Gebäude der Alten Mensa.
Draußen herrschte Urlaubsstimmung. Die Studierenden, die trotz der vorlesungsfreien Zeit auf dem Campus unterwegs waren, genossen die ersten warmen Tage des Jahres. Sie saßen auf den Treppen und Freiflächen, schwatzten, lachten und flirteten. Tinne bekam sofort gute Laune, setzte ihre Sonnenbrille auf und marschierte beschwingt in Richtung Baron. Als sie am ReWi-Bau vorbeikam, dem Gebäude der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, streckte sie die Zunge heraus. Irgendwo in diesem pseudo-modernen Kasten hockte Olaf, ihr ehemaliger Lebensgefährte, ein Doktor rer. oec. und gleichzeitig eine gigantische menschliche Niete. Wahrscheinlich ließ er sich gerade von seiner süßen Doktorandin, Tinnes Nachfolgerin, die Schultern massieren. Na, und wenn schon? Sie hatte jedenfalls keine Lust, sich von diesen unschönen Erinnerungen den Tag versauen zu lassen.
Im Außenbereich des Barons wurde gerade einer der begehrten Tische frei. Fünf Minuten später hatte sie einen Espresso vor sich, blätterte durch die Seminararbeiten und erfreute sich an den frühlingshaften Temperaturen.
Nach einer Weile schaute sie auf die Uhr. Es sah ihrer Freundin nicht ähnlich, unpünktlich zu sein – meist war es Tinne, die zu ihren Verabredungen außer Atem und mit ordentlicher Verspätung angerannt kam.
Sie war gespannt auf dieses Treffen. Ihre Freundin hatte sie vor zwei Tagen per Email kontaktiert und sehr geheimnisvoll getan. Sie müsse sich ›dringend‹ mit Tinne treffen, hatte sie geschrieben, es wäre ›sehr wichtig‹, und sie müsse das Treffen ›absolut vertraulich‹ behandeln. Tinne fragte sich, ob es etwas mit der Habilitation ihrer Freundin zu tun hatte. Denn in letzter Zeit war sie diesbezüglich merkwürdig zugeknöpft gewesen und hatte Tinne nur ausweichend erklärt, es ginge voran und sie wäre einem regelrechten ›Knaller‹ auf der Spur.
Zehn Minuten später kramte Tinne ihr Telefon hervor. Sie versuchte es auf dem Handy und auf dem Festnetz, aber Ersteres war ausgeschaltet, und Letzteres klingelte nur endlos. Nach einer dreiviertel Stunde hatte sie eine weitere Handvoll Seminararbeiten durchkorrigiert und drei Espressi geschlürft. Mit einem unbehaglichen Gefühl zahlte sie und machte sich auf den Heimweg.
Sie fragte sich, was um alles in der Welt Hannah Lohmann wohl dazwischen gekommen sein mochte.
Donnerstag, 15. März 2012
Elli Härtling fand es ungeheuerlich, wenn die Leute ihre Hunde überall hinmachen ließen. Gerade hier im Volkspark, wo so viele Kinder unterwegs waren! Ihr Hund, ein alter Rauhaardackel namens Leopold, hatte natürlich auch seine Bedürfnisse, aber Elli trug stets Papiertaschentücher, Schaufel und Plastiktüten bei sich. Damit waren die Hinterlassenschaften von Poldi innerhalb einer Minute verschwunden, und das war doch wohl nicht zu viel verlangt!
Poldi hoppelte gemächlich neben ihr her, als Elli ihre Runde durch den Park drehte. Wie üblich unterhielt sie sich mit ihrem Hund, denn seit ihr Mann vor acht Jahren gestorben war, hatte sie nicht mehr allzu viele Leute zum Reden.
»Na, Poldi, das schöne Wetter freut dich auch, gell, nach dem kalten Winter? So schön war’s schon lang nicht mehr!«
Der Hund wackelte ungerührt weiter und schnupperte an einem Laternenpfahl. Normalerweise hielt sie ihn vorschriftsmäßig an der Leine, aber heute war wenig los im Park, da durfte er frei herumlaufen. Ob Leine oder nicht, Poldi entfernte sich eh selten weiter als ein paar Meter von Frauchen.
Elli marschierte am Rosengarten vorbei in Richtung Parkhotel Favorite. Unterwegs nickte sie anderen Spaziergängern zu und grüßte kurz. Die Morgensonne schien durch die Zweige der Kastanienbäume und malte komplizierte Schattenmuster auf die Wiesen. Die Luft roch nach frischem Grün, das Summen der Insekten vermischte sich mit dem Lachen spielender Kinder. Ein wirklich schöner Tag!
Poldi verschwand rechts zwischen einigen Bäumen. Das Gelände stieg hier ein wenig an, der Boden war matschig und von wuchernden Büschen gesäumt.
»Poldi, komm her, da gibt’s nichts für dich!«
Elli reckte den Kopf, sah ihren Dackel aber nicht mehr.
»Leopold, komm bei Fuß! Leopold!«
Kein Leopold erschien. Sie rief noch zweimal, dann verließ sie seufzend den Weg und trat auf die Büsche zu. Natürlich hatte Poldi sich das schlammigste Stück ausgesucht, um auszubüxen! Vorsichtig lupfte Elli ihren Mantel und stakste zwischen den Bäumen umher, während sie sich bemühte, das Gleichgewicht zu halten.
»Poldi? Wo steckst du denn? Böser Hund!«
Doch der Dackel war noch immer nicht zu sehen, stattdessen fing er an zu bellen. Das war mehr als ungewöhnlich, denn normalerweise brachte Poldi nichts aus der Ruhe. Schließlich sah sie ihn an einem dichten Busch stehen. Erwartungsvoll drehte der Dackel seinen Kopf zu ihr und kläffte erneut. Die blanken Knopfaugen schienen zu sagen: Da bist du ja endlich, Frauchen!
Elli trat die letzten Schritte auf ihn zu und nestelte die Leine aus ihrer Handtasche.
»So, Poldi, ab jetzt nur noch bei Fuß!«
In dem Gebüsch, bei dem der Hund stand, sah sie etwas Buntes, Großes liegen. Hatten da irgendwelche Vandalen wieder ihren Abfall hingeworfen? Elli hatte schon oft wilden Müll im Volkspark entdecken müssen, leere Flaschen, Kleidersäcke, sogar ganze Möbelstücke. Vorsichtig bog sie die Zweige zur Seite, um besser sehen zu können.
Die wenigen Spaziergänger im Volkspark schauten sich verwirrt um, als ein schriller Schrei zu hören war, ein Schrei, der gar nicht enden wollte.
*
Eine Schnapsidee war das! Gerd Häberle lehnte sich vorsichtig an einen der zahlreichen grauen Sockel, auf denen irgendwelche Statuen herumstanden. Ein scharfer Blick der Ausstellungstante ließ ihn aber schnell wieder ein paar Schritte wegtreten. Hui, wie empfindlich! Gerd schaute zu Wolfgang, Schabbes und Hans hinüber. Sie zogen genauso gelangweilte Gesichter wie er selbst.
»Hier nun verlassen wir das Hohe Mittelalter und erreichen das Spätmittelalter, also ungefähr die Zeit zwischen 1250 und 1500. Jeanne d’Arc ist Ihnen da bestimmt ein Begriff, und natürlich ändert sich auch das Kunstverständnis in dieser spannenden Epoche.«
Die Führerin machte eine einladende Bewegung und komplimentierte die kleine Gruppe in den nächsten Saal.
Eine solche Schnapsidee! Gerd schüttelte den Kopf und schaute desinteressiert die alten Figuren und Ölschinken an. Das hatten sie davon, dass dieses Jahr die Frauen den Ausflug ihres kleinen Stuttgarter Kegelclubs organisieren durften. In den letzten Jahren waren es immer die Männer gewesen, die schöne Ziele ausgesucht hatten: die fränkische Bierstraße, eine Kutschfahrt durch Heidelberg mit eigenem Fässchen an Bord, ein Weinprobiertag an der Mosel, solche Sachen halt. Und dieses Jahr? Ein Besuch in Mainz! Wie spannend! Der Anfang war ja noch ganz okay gewesen, die Frauen hatten eine Führung durch die Kupferberg-Kellerei gebucht mit anschließender Sektverkostung. Fünf Sekte vormittags auf nüchternen Magen, das war schon in Ordnung. Und weil Gerd einen guten Draht zu der hübschen Besucherbetreuerin gehabt hatte, war sein Glas plötzlich zum sechsten Mal voll gewesen.
Aber dann! Statt sich irgendwo hinzuhocken und weiter zu trinken, lotsten die Frauen sie in einen lang gestreckten Bau mit einem goldenen Pferd auf dem Dach – ins Mainzer Landesmuseum!
Die umfangreichen Sammlungen des Museums mit ihren vielfältigen regionalen und überregionalen Bezügen laden zu einer Zeitreise von den frühesten Zeugnissen der Menschheit bis zu den Kunstwerken unserer Tage ein.
So stand es schwarz auf weiß in dem Begleitheft, das jeder von ihnen zur Begrüßung in die Hand gedrückt bekommen hatte. In Gerds Verständnis las sich das eher wie eine Drohung, und genauso öde wurde die ganze Veranstaltung schließlich auch. Eine knochige Frau mit riesigen, runden Ohrringen stellte sich als Marie-Luise Winkelmann vor und fing an, sie durch das Museum zu schleifen. Dazu leierte sie irgendwelche Jahreszahlen herunter. Inzwischen hatten sie alte Steine angeglotzt, Tonkrüge, zerkratzte Waffen, plumpe Tierdarstellungen, kaputten Schmuck, Kirchenkram und immer wieder Bilder, Bilder, Bilder. Gerd wiederholte im Geiste: Schnapsidee!
Dann grinste er. Apropos … für solche Eventualitäten hatte er auf Ausflügen stets einen Flachmann in seiner Hosentasche. Er schaute sich um, verzog sich unauffällig in den Flur und nahm einen beherzten Schluck. War ja auch eine trockene Luft hier im Museum!
Beschwingt trat er in den Saal zurück und schloss sich wieder der Gruppe an. Die Männer guckten Löcher in die Luft, die Frauen hingen an den Lippen der Museumstante. Gerade deutete Frau Winkelmann auf einen großen Ölschinken, der neben der Tür an der Wand hing.
»… trägt die Signatur des Meisters WB, eines Malers und Stechers, der um das Jahr 1500 hier am Mittelrhein tätig war. Wir kennen sogar seinen vollständigen Namen, was eher die Ausnahme ist – wie Sie ja inzwischen wissen, sind viele mittelalterliche Künstler nicht namentlich überliefert, sondern werden nach ihren Werken oder dem Ort ihres Wirkens benannt. Also, was glauben Sie, woher kennen wir seinen Namen?«
Mit hochgezogenen Augenbrauen schaute die Schreckschraube von einem zum anderen. Die Frauen murmelten irgendetwas vor sich hin, Gerd betrachtete seinen Daumennagel. Schließlich gab sie sich selbst die Antwort.
»Albrecht Dürer hat eine Arbeit, die die Signatur WB trägt, mit einem Kommentar versehen: ›Dz hat Wolfgang pewrer gemacht / Im 1484 Ior‹, so schrieb er. ›Wolfgang pewrer‹, das würde in neuzeitlicher Namenslesung ›Wolfgang Beurer‹ heißen.«
Gerd peilte zu Wolfgang hinüber. Soso, da hatte der Herr Märkling also einen historischen Vornamensvetter hier im Museum. Aber Wolfgang hatte total abgeschaltet, er stierte vor sich hin wie ein Halbaffe.
»Ein weiteres Werk von Wolfgang Beurer befindet sich im Mainzer Dom- und Diözesanmuseum, es handelt sich dabei um eine Sammlung von Tafelbildern der Sebastianslegende. Aber natürlich ist dieses Ölgemälde von Beurer, das wir sehr genau auf das Jahr 1480 datieren können, für unsere Ausstellung hier im Landesmuseum viel wichtiger. Ich nehme an, Sie erkennen den Grund sofort?«