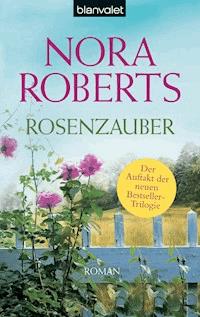9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Liebe, Pferdeleidenschaft und ein Familiendrama vor der beschaulichen Kulisse der grünen Weiden Virginias. - Als Kelsey Byden einen Brief von ihrer totgeglaubten Mutter erhält, fährt sie kurzentschlossen zu ihr auf deren idyllisches Vollblutgestüt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 741
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Mit sechsundzwanzig steht Kelsey ihrer Mutter zum ersten Mal gegenüber. Ihr Vater hatte ihr verschwiegen, dass sie lange wegen Mordes im Gefängnis saß. Nun lädt Naomi ihre Tochter auf ihr Gestüt ein, damit sie sich kennenlernen. Kelsey entdeckt schnell ihre Begeisterung für das Landleben und die Welt der Pferderennen, die ebenso aufregend wie gefährlich ist. Auch Gabe Slater, der charismatische Züchter vom Nachbarhof, übt eine verwirrende Anziehungskraft auf sie aus. Während Kelsey versucht, die Tragödie um ihre Mutter zu verstehen, häufen sich unerklärliche Ereignisse: Ein Mitarbeiter verunglückt, ein Pferd wird verletzt. Will jemand Rache am Gestüt üben? Und ist Naomi wirklich eine Mörderin? Schon bald weiß Kelsey nicht mehr, wem sie noch trauen kann.
Nora Roberts
Schatten über
den Weiden
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Nina Heyer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Vollständige deutsche Taschenbuchneuausgabe 01/2017
Copyright © 1995 by Nora Roberts
Die Originalausgabe erschien 1995 unter dem Titel True Betrayals bei G. P. Putnams’s Sons, New York
Copyright © 1996 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München und © 2017 dieser Ausgabe by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München
Umschlagmotiv: © Shutterstock | Daniiel, Albinoni,
Creative Travel Projects, Porpla Wannobon
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
e-ISBN 978-3-641-09185-9V004
www.diana-verlag.de
Besuchen Sie uns auch auf www.herzenszeilen.de
Für Phyllis Grann und Leslie Gelbman
1
Als Kelsey den Brief aus ihrem Briefkasten nahm, konnte sie nicht ahnen, dass er von einer Toten stammte. Das cremefarbene Briefpapier, die ordentlich von Hand geschriebene Adresse und der Poststempel des Staates Virginia erschienen ihr so alltäglich, dass sie den Brief einfach mitsamt der restlichen Post auf den alten Teetisch unter ihrem Wohnzimmerfenster legte, während sie aus ihren Schuhen schlüpfte.
Dann ging sie in die Küche und schenkte sich ein Glas Wein ein. Das wollte sie in aller Ruhe genießen, ehe sie ihre Post öffnete. Nicht dass sie den Drink gebraucht hätte, um sich für das Lesen der Post in dem schmalen Umschlag, die Reklamesendungen, die Rechnungen oder die bunte Postkarte, die ihr eine Freundin von einer Urlaubsreise in die Karibik geschickt hatte, zu wappnen.
Das kleine Päckchen, das den Absender ihres Rechtsanwaltes trug, hatte sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Es konnte nur ihre Scheidungsunterlagen enthalten; die offizielle Urkunde, die Kelsey Monroe wieder in Kelsey Byden, eine verheiratete Frau, in eine alleinstehende, geschiedene Frau verwandelte.
Sie wusste, dass es töricht war, so zu denken. Schließlich war sie die letzten zwei Jahre mit Wade nur auf dem Papier verheiratet gewesen, fast ebenso lange, wie ihre Ehe gedauert hatte.
Doch das Dokument besiegelte das Scheitern ihrer Verbindung mit einer lähmenden Endgültigkeit; viel mehr, als dies die tränenreichen Auseinandersetzungen, die Trennung, die Anwaltsgebühren und die juristischen Formalitäten vermocht hatten.
Bis dass der Tod uns scheidet, dachte sie erbittert und nippte an ihrem Wein. Was für ein Unsinn! Wenn dem so wäre, hätte sie im Alter von sechsundzwanzig Jahren dahinscheiden müssen. Stattdessen war sie ausgesprochen lebendig und munter, bei guter Gesundheit und für den Markt der Singles wieder verfügbar.
Allein der Gedanke ließ sie schaudern.
Vermutlich war Wade ausgegangen und feierte zusammen mit seiner hübschen, stets nach der neuesten Mode gekleideten Kollegin Lari aus der Werbeagentur das Ende seiner Ehe. Mit derselben Kollegin, mit der er eine Affäre gehabt hatte; eine Affäre, die, wie er seiner überraschten und vor Wut kochenden Frau erklärte, nichts mit ihr oder ihrer Ehe zu tun hatte.
Seltsamerweise hatte Kelsey die Dinge anders gesehen. Zwar dachte sie weder selbst das Zeitliche zu segnen noch Wade ins Jenseits zu befördern, um eine Trennung zu ermöglichen, doch hatte sie ihr Ehegelübde sehr ernst genommen. Und Treue stand dabei an erster Stelle.
Nein, nach Kelseys Meinung hatte die lebhafte, zierliche Lari mit dem aerobicgestylten Körper und dem süßen Lächeln sogar ziemlich viel mit ihr zu tun.
Eine zweite Chance hatte es für Wade nicht gegeben. Sein Ausrutscher, wie er es zu formulieren beliebte, sollte sich nicht wiederholen. Kelsey war auf der Stelle aus dem schönen Stadthaus in Georgetown ausgezogen und hatte alles, was sie im Laufe ihrer Ehe zusammen angeschafft hatten, zurückgelassen.
Zwar empfand sie es als demütigend, in das Haus ihres Vaters und ihrer Stiefmutter zurückkehren zu müssen, doch auch ihrem Stolz waren Grenzen gesetzt. Genau wie ihrer Liebe. Und diese Liebe war in dem Moment erloschen, in dem sie Wade und Lari in einer Hotelsuite in Atlanta überrascht hatte.
Eine nette Überraschung, dachte Kelsey höhnisch. Nun, alle drei Beteiligten waren unangenehm berührt gewesen, als sie mit einer Reisetasche und der lächerlich romantischen Vorstellung, das Wochenende mit Wade zu verbringen und ihm so seine Geschäftsreise zu versüßen, in die Suite hereingeschneit war.
Vielleicht war sie ja wirklich streng, unnachgiebig und hartherzig – alles Eigenschaften, deren Wade sie beschuldigt hatte, als sie sich weigerte, die Scheidungsklage zurückzuziehen. Aber dennoch war sie im Recht gewesen, wie Kelsey sich selbst bestärkte.
Sie leerte ihr Glas und ging in das makellos aufgeräumte Wohnzimmer zurück. Nicht ein einziger Stuhl, nicht eine einzige Kerze in dem sonnendurchfluteten Raum stammte aus dem Haus in Georgetown. Eine klare, saubere Trennung. Das hatte sie gewollt, und das hatte sie auch bekommen. Die kühlen Farben hatte sie gewählt, und die Kunstdrucke, von denen sie nun umgeben war, gehörten ausschließlich ihr allein.
Um Zeit zu gewinnen, schaltete sie die Stereoanlage ein und legte eine CD auf. Beethovens Pathetique erfüllte den Raum. Ihr Vater hatte ihre Liebe zur klassischen Musik geweckt; eine ihrer zahlreichen gemeinsamen Interessen. Gemeinsam war ihnen beiden vor allem ein unstillbarer Wissensdurst, und Kelsey wusste, dass sie auf dem besten Wege gewesen war, zur ewigen Studentin zu werden, bis sie ihre erste feste Stelle bei Monroe Associates angetreten hatte.
Sogar während dieser Zeit konnte sie der Versuchung nicht widerstehen, eine Vielzahl von Kursen, angefangen bei Anthropologie bis hin zur Zoologie, zu belegen. Wade hatte sie ausgelacht, offenbar fasziniert und belustigt zugleich über ihre ruhelose Sprunghaftigkeit, die sie von Kurs zu Kurs, von Job zu Job trieb.
Nach der Hochzeit hatte sie bei Monroe gekündigt. Ihr Treuhandvermögen und Wades Einkommen machten einen festen Job überflüssig. Lieber widmete sie sich voll und ganz dem Umbau und der Renovierung ihres neu erworbenen Hauses. Sie hatte Farbe abgekratzt, Fußböden poliert, in staubigen Antiquitätenläden herumgestöbert, um das passende Möbelstück für eine bestimmte Stelle zu finden – und jede Stunde genossen. Den kleinen Hof in einen typischen englischen Garten zu verwandeln bereitete ihr das reinste Vergnügen. Binnen eines Jahres hatte sie das Haus in ein Schmuckstück verwandelt: Zeugnis ihres Geschmacks, ihrer Anstrengungen und ihrer Geduld.
Nun war es nichts weiter als ein Vermögenswert, der zwischen ihr und Wade aufgeteilt werden musste.
Kelsey ging zurück an die Universität, jenen akademischen Hafen, wo es ihr möglich war, den Alltag für einige Stunden zu vergessen. Nun arbeitete sie dank ihrer kunstgeschichtlichen Kenntnisse halbtags in der National Gallery.
Dabei hatte sie es nicht nötig, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Treuhandfonds ihres Großvaters väterlicherseits ermöglichte ihr ein sorgenfreies Leben, sodass es ihr freistand, ihren ständig wechselnden Interessen nachzugehen.
Jetzt war sie also eine unabhängige Frau. Jung, dachte Kelsey, und, mit einem Blick auf den Stapel Post, alleinstehend, mit vielfältigen Kenntnissen, aber ohne fundierte Ausbildung. Wofür sie ihrer Meinung nach die besten Voraussetzungen mitbrachte, nämlich für eine gute Ehe, hatte sich als völliger Fehlschlag erwiesen.
Kelsey atmete vernehmlich aus, ging langsam zu dem Tischchen und tippte mit den Fingerspitzen auf das amtlich aussehende Päckchen. Sie hatte lange, schlanke Finger; Finger, die Klavier spielen und zeichnen konnten. Finger, die gelernt hatten, eine Schreibmaschine zu bedienen, köstliche Mahlzeiten zuzubereiten und einen Computer zu programmieren, und an einem dieser Finger hatte einst ein Ehering gefunkelt.
Kelsey überging den dicken Umschlag und ignorierte die kleine Stimme in ihrem Kopf, die ihr das Wort Feigling zuzischelte. Stattdessen griff sie nach einem Brief, dessen Umschlag eine ihrer eigenen verblüffend ähnliche Handschrift trug, kühn geschwungen und gut leserlich. Ohne übergroße Neugier riss sie ihn auf.
Liebe Kelsey, du bist bestimmt überrascht, von mir zu hören.
Als sie weiterlas, verwandelte sich ihr flüchtiges Interesse in Schrecken, der Schrecken in Ungläubigkeit und die Ungläubigkeit in eine Empfindung, die Angst am nächsten kam.
Sie hielt die Einladung von einer Toten in der Hand. Und diese Tote war ihre Mutter.
So lange Kelsey zurückdenken konnte, hatte sie sich in Krisenzeiten stets an ihren Vater gewandt. Die Liebe und das Vertrauen, das sie ihm entgegenbrachte, waren das einzig Beständige an ihrer sonst so unbeständigen Natur. Er war immer für sie da, weniger als ein rettender Hafen im Sturm, sondern eher als jemand, bei dem sie Halt fand, bis der Sturm abebbte.
Ihre frühesten Kindheitserinnerungen galten ihm, seinem angenehmen, ernsten Gesicht, seinen sanften Händen, seiner ruhigen, geduldigen Stimme. Er hatte Schleifen in ihr langes, glattes Haar geflochten oder die hellblonden Strähnen ausgekämmt, während Musik von Bach oder Mozart aus der Stereoanlage klang. Er war es gewesen, der Pflaster auf ihre aufgeschürften Knie klebte, der ihr Lesen und Fahrradfahren beibrachte, der ihre Tränen trocknete.
Kelsey betete ihren Vater an und war ungeheuer stolz auf ihn, als er zum Dekan der Englischen Fakultät der Georgetown University ernannt wurde.
Als er wieder heiratete, verspürte sie keinerlei Eifersucht. Damals war sie achtzehn und froh, dass er jemanden gefunden hatte, den er liebte und mit dem er sein Leben teilen wollte. So räumte sie Candace einen Platz in ihrem Heim und ihrem Herzen ein, heimlich stolz auf ihre Reife und ihr Verständnis. Wer hätte schon so ohne Weiteres eine Stiefmutter und einen Stiefbruder im Teenageralter akzeptiert? Wahrscheinlich hatte sie tief in ihrem Inneren immer gewusst, dass nichts und niemand das Band zwischen ihr und ihrem Vater zerreißen konnte.
Nichts und niemand, dachte sie nun, außer ihrer Mutter, die sie für tot gehalten hatte.
Sie kämpfte sich durch den dichten Berufsverkehr zu dem palastähnlichen Landsitz in Potomac, Maryland. In ihr stritt der Schock über den Betrug ihres Vaters mit einer kalten, nagenden Wut. Sie war ohne Mantel aus ihrem Apartment gestürzt und hatte nicht einmal die Heizung in ihrem Spitfire aufgedreht, doch sie spürte die Kälte des Februarabends kaum. Die innere Erregung hatte ihr Farbe ins Gesicht getrieben und ihre porzellanbleichen Wangen rosig überhaucht.
Kelsey trommelte mit den Fingern auf das Lenkrad, während sie an einer Ampel wartete und ihre ganze Willenskraft darauf konzentrierte, das rote Licht zum Umspringen zu bewegen. Ihre von Natur aus vollen Lippen waren schmal und weiß vor Zorn.
Es brachte nichts, sich mit quälenden Gedanken zu zermürben. Besser, sie dachte gar nicht daran, dass ihre totgeglaubte Mutter am Leben war und nur eine knappe Stunde von ihr entfernt in Virginia lebte. Wenn sie jetzt darüber nachgrübelte, müsste sie wahrscheinlich laut schreien.
Aber als sie die von majestätischen Bäumen gesäumte Straße, in der sie ihre Kindheit verbracht hatte, entlangfuhr und in die Einfahrt des dreistöckigen, im Kolonialstil erbauten Hauses, in dem sie aufgewachsen war, einbog, zitterten ihre Hände.
Das Haus strahlte die Ruhe und den Frieden einer Kirche aus, die Fenster blinkten, die Fassade leuchtete in makellosem Weiß. Kleine, gekräuselte Rauchwolken, die von einem abendlichen Kaminfeuer zeugten, stiegen aus dem Schornstein empor, und die ersten Krokusse kamen zaghaft neben der alten Ulme in vorderen Hof aus dem Boden hervor.
Ein perfektes Haus, inmitten einer perfekten Nachbarschaft, hatte sie stets gedacht. Eine Oase des guten Geschmacks, geschützt und unantastbar, nur wenige Autominuten von Washington, D. C., mit seinem reichhaltigen Angebot an Kultur und Zerstreuungsmöglichkeiten, entfernt. Und mit dem sorgfältig gepflegten Image respektablen Wohlstands.
Kelsey sprang aus dem Wagen, lief zur Vordertür und stieß sie auf. In diesem Haus brauchte sie nicht vorher zu läuten. Als sie durch die in Weiß gehaltene Halle stürmte, kam Candace aus einem Zimmer.
Wie üblich war sie untadelig gekleidet. In ihrem konservativen blauen Wollkleid bot sie das perfekte Bild einer Akademikergattin. Das hellbraune Haar trug sie aus der Stirn gekämmt, und in den Ohrläppchen schimmerten schlichte Perlenohrringe.
»Kelsey, war für eine nette Überraschung! Ich hoffe, du bleibst zum Essen. Wir erwarten Gäste, einige Kollegen von der Universität, und ich kann immer Hilfe …«
»Wo ist er?«, unterbrach Kelsey sie schroff.
Verblüfft über den barschen Tonfall zuckte Candace zusammen. Kelsey hatte offenbar wieder eine ihrer Launen. In einer Stunde würde sie das Haus voller Gäste haben, und das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnte, war einer der berüchtigten Wutausbrüche ihrer Stieftochter. Unwillkürlich wich sie ein Stück zurück.
»Stimmt etwas nicht?«
»Wo ist Dad?«
»Du bist ja ganz außer dir. Wieder Probleme mit Wade?« Candace winkte ab. »Eine Scheidung ist zwar unerfreulich, Kelsey, aber noch lange kein Weltuntergang. Komm setz dich erst mal.«
»Ich will mich nicht setzen, Candace. Ich will mit meinem Vater reden.« Ihre Hände verkrampften sich. »Also sagst du mir jetzt, wo er ist, oder muss ich ihn suchen?«
»Hi, Schwesterchen!« Channing schlenderte die Treppe herunter. Sein Äußeres war ebenso wie das seiner Mutter, doch seine Abenteuerlust hatte er nach Meinung seiner Mutter nicht von ihr. Obwohl er bereits vierzehn war, als Candace Philip Byden heiratete, hatten seine Gutmütigkeit und sein Sinn für Humor die Situation sehr erleichtert. »Was ist los?«, fragte er.
Kelsey zwang sich, tief durchzuatmen, um nicht loszubrüllen. »Wo ist Dad, Channing?«
»Der Prof. hat sich mit dem Vortrag, an dem er gerade feilt, in seinem Arbeitszimmer vergraben.«
Channing hob die Augenbrauen. Auch ihm entgingen die Anzeichen aufkeimender Wut nicht – die blitzenden Augen, die glühenden Wangen seiner Stiefschwester. Manchmal versuchte er in solchen Fällen die Wogen zu glätten.
»Hey, Kel, du willst doch wohl nicht den ganzen Abend bei diesen Bücherwürmern rumhängen, oder? Wie wär’s, wenn wir einen Zug durch ein paar Kneipen machen würden?«
Kelsey schüttelte nur den Kopf und marschierte durch die Halle auf das Arbeitszimmer ihres Vaters zu.
»Kelsey!«, rief Candace scharf und verärgert. »Musst du deine schlechte Laune so deutlich zeigen?«
O ja, dachte Kelsey, als sie die Tür zum Heiligtum ihres Vaters aufriss. Und ob!
Ohne einen Ton zu sagen, schlug sie die Tür hinter sich zu. In ihrem Inneren brodelte es, böse, bittere Worte der Anklage würgten ihre Kehle. Philip saß an seinem geliebten Eichenholzschreibtisch, hinter aufgestapelten Büchern und Akten nahezu verborgen, und hielt einen Stift in seiner knochigen Hand. Von jeher vertrat er die Ansicht, dass man nur dann etwas Sinnvolles produzieren konnte, wenn man den Bezug zum Handschriftlichen nicht verlor, und er weigerte sich daher beharrlich, einen Computer zu benutzen.
Seine Augen hinter der silbergerahmten Brille zeigten jenen eulenhaften Ausdruck, den sie immer annahmen, wenn er der Welt vollkommen entrückt war. Das Licht der Schreibtischlampe glänzte auf seinem kurz geschnittenen silbergrauen Haar.
»Da ist ja mein Mädchen. Du kommst rechtzeitig, um den Entwurf meiner Abhandlung über Yeats Korrektur zu lesen. Ich fürchte, er ist ein wenig weitschweifig ausgefallen.«
Wie normal, wie alltäglich er wirkt, dachte Kelsey. Als ob nichts wäre, so saß er da, umgeben von seinen Werken der Dichtkunst, in seinem Tweedjacket und der ordentlich gebundenen Krawatte.
Ihre Welt dagegen, deren Mittelpunkt er bildete, war in tausend Stücke zersprungen.
»Sie ist am Leben«, sprudelte es aus Kelsey hervor. »Sie ist am Leben, und du hast mich die ganze Zeit belogen.«
Er wurde sehr blass und wandte den Blick von ihr ab. Doch für einen Augenblick, Bruchteile von Sekunden nur, hatte Kelsey Furcht und Entsetzen in seinen Augen gesehen.
»Wovon redest du eigentlich, Kelsey?«, sagte er, aber er wusste es bereits, wusste es nur zu gut, und er musste all seine Selbstbeherrschung aufbieten, um den bitteren Tonfall aus seiner Stimme zu verbannen.
»Lüg mich jetzt nicht an!«, schrie sie und stürzte auf seinen Schreibtisch zu. »Lüg mich nicht an! Meine Mutter lebt, und du wusstest es! Du wusstest es die ganze Zeit, während du mir weisgemacht hast, sie sei tot.«
Panik durchfuhr Philip. »Wer hat dich denn auf die Idee gebracht?«
»Sie selbst«. Kelsey griff in die Tasche und zog den Brief heraus. »Meine Mutter. Wirst du mir jetzt die Wahrheit sagen?«
»Darf ich mal sehen?«
Kelsey starrte ihn an mit einem Blick, der bis in sein Innerstes zu dringen schien. »Ist meine Mutter tot?«
»Nein. Darf ich den Brief mal sehen?«
»Mehr hast du dazu nicht zu sagen?« Die Tränen, die sie mühsam zurückgehalten hatte, drohten ihr jetzt in die Augen zu steigen. »Nichts weiter als nein? Nach all den Jahren, all den Lügen?«
Nur eine einzige Lüge, dachte er, und bei Weitem nicht genug Jahre. »Ich werde mein Möglichstes tun, um dir alles zu erklären, Kelsey. Aber lass mich zuerst den Brief lesen.«
Wortlos reichte sie ihrem Vater den Brief, und da sie es nicht ertragen konnte, ihn zu beobachten, drehte sie sich um und sah durch das schmale Fenster, wie die hereinbrechende Nacht die Dämmerung vertrieb.
Philips Hand zitterte so stark, dass er den Brief auf den Schreibtisch legen musste. Die Handschrift war unverkennbar. Furchteinflößend. Sorgfältig, Wort für Wort las er das Schreiben.
Liebe Kelsey,
Du bist bestimmt überrascht, von mir zu hören. Aber es schien mir unklug, oder zumindest unfair, schon früher Kontakt mit Dir aufzunehmen. Obwohl ein Anruf persönlicher gewesen wäre, wollte ich Dir Zeit geben. Ein Brief gibt Dir mehr Zeit, Dir über Deine Absichten klar zu werden.
Als du noch sehr klein warst, hat man Dir erzählt, ich sei gestorben. In gewisser Hinsicht traf das zu, und ich erklärte mich einverstanden, um Dich zu schonen. Doch nun sind zwanzig Jahre vergangen, und Du bist kein Kind mehr. Ich denke, Du hast ein Recht zu erfahren, dass Deine Mutter am Leben ist. Vielleicht wird Dir diese Neuigkeit nicht gefallen. Wie dem auch sein, ich habe mich entschlossen, Kontakt mit Dir aufzunehmen, und ich bereue diese Entscheidung nicht.
Wenn Du mich sehen willst oder einfach nur Fragen hast, die der Klärung bedürfen, dann bist Du herzlich willkommen. Ich lebe auf der Three-Willows-Farm, etwas außerhalb von Bluemont, Virginia. Diese Einladung gilt unbegrenzt, und wenn Du Dich entschließen solltest, ihr zu folgen, würde ich mich freuen, Dich bei mir zu haben, so lange Du willst. Wenn ich nichts von Dir höre, entnehme ich daraus, dass Du keinen Kontakt mit mir wünschst. Ich hoffe aber, dass die Neugier, die Dich schon als Kind angetrieben hat, dazu bringt, mit mir zu sprechen.
Deine
Naomi Chadwick
Naomi. Philip schloss die Augen. Großer Gott, Naomi.
Beinahe dreiundzwanzig Jahre war es her, seit er sie das letzte Mal gesehen hatte, doch er konnte sich mit schmerzhafter Deutlichkeit an sie erinnern. An das Parfüm, das sie benutzt hatte und das ihn immer an dunkles Moos und Gräser denken ließ, an ihr helles, ansteckendes Lachen, das seine Wirkung auf andere Menschen nie verfehlte, an ihr silbrigblondes Haar, das ihr wie ein Wasserfall den Rücken hinunterfloss, an die dunklen Augen und den schlanken Körper.
Die Erinnerung war so lebhaft, dass Philip meinte, sie leibhaftig vor sich zu sehen, als er die Augen wieder öffnete. Sein Magen zog sich zusammen, teils vor Furcht, teils vor lang unterdrücktem Verlangen.
Aber es war Kelsey, die hoch aufgerichtet vor ihm stand und ihm den Rücken zukehrte.
Wie war es nur möglich, dass er Naomi vergessen hatte, fragte er sich, wo er doch nur ihre Tochter ansehen musste, um ihr Ebenbild vor sich zu haben.
Philip erhob sich und schenkte sich aus einer Kristallkaraffe einen Whisky ein, der eigentlich nur für Besucher gedacht war. Er selbst rührte kaum etwas Stärkeres an als ein kleines Glas Brombeerwein. Doch jetzt brauchte er einen Whisky, um seine zitternden Hände zu beruhigen.
»Was hast du nun vor?«, wollte er von seiner Tochter wissen.
»Ich habe mich noch nicht entschieden.« Sie wandte ihm weiterhin den Rücken zu. »Das hängt zum großen Teil davon ab, was du mir erzählst.«
Philip wünschte, er könnte zu ihr gehen und sie in den Arm nehmen. Aber im Moment würde sie diese Geste nicht zulassen. Er wünschte, er könnte in seinen Stuhl sinken und das Gesicht in den Händen vergraben, doch das wäre nutzlos und zudem ein Zeichen von Schwäche.
Am meisten jedoch wünschte er, er könnte die Zeit um dreiundzwanzig Jahre zurückdrehen und etwas, irgendetwas tun, um den unaufhaltsamen Lauf des Schicksals, das jetzt sein Leben zerstörte, abzuwenden.
Doch auch das war unmöglich.
»Es ist nicht einfach, Kelsey.«
»Lügengewebe sind meistens kompliziert.«
Kelsey drehte sich um, und Philips Finger schlossen sich unwillkürlich fester um das Kristallglas. Sie sah Naomi so ähnlich mit ihrem nachlässig gebundenem hellen Haar, den dunklen Augen, der vor Erregung geröteten Haut ihres zarten Gesichts. Manche Frauen sahen dann am besten aus, wenn sie ihr Temperament kaum noch zügeln konnten.
Naomi hatte zu diesen Frauen gehört. Genau wie ihre Tochter.
»In all den Jahren hast du mich angelogen, nicht wahr, Vater?«, fuhr Kelsey fort. »Du hast gelogen, Großmutter hat gelogen, sie hat gelogen.« Sie deutete auf den Brief auf dem Schreibtisch. »Und wenn dieser Brief nicht gekommen wäre, dann hättest du mich auch weiterhin angelogen.«
»Das ist richtig. So lange ich es für das Beste für dich gehalten hätte.«
»Das Beste für mich? Wie könnte es das Beste für mich sein, meine Mutter für tot zu halten? Wie kann überhaupt eine Lüge das Beste für jemanden sein?«
»Du warst dir schon immer so sicher, was richtig und was falsch ist, Kelsey. Eine bemerkenswerte Eigenschaft.« Er hielt inne und trank einen Schluck. »Und eine sehr erschreckende. Schon als Kind hattest du fest umrissene Moralvorstellungen. Für gewöhnliche Sterbliche ist es schwierig, da mitzuhalten.«
In Kelseys Augen loderte es. Das ähnelte stark dem, was ihr auch Wade immer vorgeworfen hatte. »Also ist es meine Schuld?«
»Nein, nein.« Er schloss die Augen und rieb sich geistesabwesend die Stirn. »Nichts davon ist deine Schuld, aber du warst der Anlass für alles.«
»Philip!« Nach kurzem Klopfen öffnete Candace die Tür zum Arbeitszimmer. »Die Dorsets sind da.«
Er zwang sich zu einem gequälten Lächeln: »Kümmere du dich um sie, Liebes. Ich habe noch etwas mit Kelsey zu besprechen.«
Candace warf ihrer Stieftochter einen Blick zu, in dem sowohl Missbilligung als auch Resignation lag. »Na gut, aber bitte nicht so lange. Um sieben Uhr ist das Essen fertig. Kelsey, soll ich noch ein Gedeck auflegen?«
»Nein, danke, Candace. Ich bleibe nicht.«
»Gut, aber halte bitte deinen Vater nicht so lange auf.« Sachte zog sie die Tür hinter sich zu.
Kelsey holte tief Atem und straffte sich. »Weiß sie Bescheid?«
»Ja. Ich musste es ihr sagen, ehe wir heirateten.«
»Du musstest es ihr sagen«, wiederholte Kelsey, »mir aber nicht.«
»Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Keinem von uns ist sie leichtgefallen. Aber sowohl Naomi als auch deine Großmutter und ich wollten das Beste für dich. Du warst erst drei Jahre alt, Kelsey. Fast noch ein Baby.«
»Ich bin schon seit einiger Zeit erwachsen, Dad. Ich war inzwischen verheiratet und bin geschieden.«
»Du ahnst ja gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht.« Philip setzte sich wieder und drehte das Glas in seiner Hand. Er hatte gehofft, dass dieser Augenblick niemals kommen würde. Sein Leben verlief in ruhigen Bahnen, und er wollte sich nicht wieder einem Wechselbad der Gefühle aussetzen. Doch er erinnerte sich gut, dass Naomi nicht viel für ein geregeltes Leben übriggehabt hatte.
Genauso wenig wie Kelsey. Und nun war die Stunde der Wahrheit gekommen.
»Ich habe dir ja schon erzählt, dass deine Mutter zu meinen Studenten gehörte. Sie war jung, bildhübsch und sprühte vor Leben. Ich habe nie so richtig begriffen, was sie eigentlich an mir fand. Alles ging sehr schnell. Sechs Monate nachdem wir uns kennengelernt hatten, heirateten wir. Keiner von uns beiden konnte in dieser kurzen Zeit feststellen, wie grundverschieden wir waren. Wir lebten in Georgetown. Beide kamen wir, wie man so schön sagt, aus gutem Hause, aber in ihr brannte ein Freiheitsdrang, der mir fremd war. Eine Art ungebändigter Lebensgier, ein Hunger nach Menschen, Dingen, Orten. Und dann gab es da natürlich ihre Pferde.«
Um die schmerzliche Erinnerung zu lindern, trank er einen weiteren Schluck. »Ich glaube, es waren in erster Linie die Pferde, die zwischen uns standen, uns entfremdeten. Nach deiner Geburt wollte sie um jeden Preis zurück auf die Farm in Virginia. Sie wollte, dass du dort aufwächst. Meine Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft lagen hier. Ich schrieb damals an meiner Doktorarbeit und hatte bereits den Dekansposten der Englischen Fakultät im Auge. So schlossen wir einen Kompromiss, und ich fuhr eine Zeit lang jedes freie Wochenende nach Virginia, doch das war zu wenig. Man könnte sagen, wir lebten uns auseinander.«
Vorsichtig umschrieben, dachte er, und starrte in sein Glas, mit Sicherheit eine weniger schmerzhafte Formulierung. »Wir beschlossen, uns scheiden zu lassen. Sie wollte dich bei sich in Virginia haben. Ich aber fand, du gehörtest nach Georgetown, zu mir. Ich verstand weder die Leute, mit denen sie verkehrte, die Pferdenarren und die Jockeys, noch interessierten sie mich. Wir fochten einen erbitterten Kampf aus und schalteten schließlich Anwälte ein.«
»Ein Sorgerechtsprozess?« Überrascht schaute Kelsey ihren Vater an. »Ihr habt um das Sorgerecht gestritten?«
»Eine hässliche Geschichte, viel schmutzige Wäsche wurde dabei gewaschen. Dass zwei Menschen, die sich einmal geliebt und ein Kind miteinander haben, zu Todfeinden werden können, spricht nicht gerade für den menschlichen Charakter.« Wieder schaute er hoch und blickte ihr schließlich voll ins Gesicht. »Nicht dass ich auf mein Handeln stolz bin, Kelsey, doch ich fühlte mit Bestimmtheit, dass du bei mir besser aufgehoben warst als bei ihr. Sie traf sich bereits mit anderen Männern, und man erzählte, dass einer von ihnen Verbindungen zum organisierten Verbrechen habe. Eine Frau wie Naomi zog Männer unwiderstehlich an. Es kam mir so vor, als ob sie mit ihren Verehrern angeben wollte, mit den Partys, mit ihrer Lebensweise, um mich und den Rest der Welt herauszufordern. Man sollte ruhig schlecht von ihr denken – sie tat jedenfalls, was sie wollte.«
»Du hast also gewonnen«, entgegnete Kelsey ruhig. »Du hast den Prozess gewonnen, mich dazu, und dann hast du dich entschlossen, mir zu sagen, sie sei tot.« Wieder wandte sie sich ab und blickte in das dunkle Fenster, in dem sie den Geist ihrer selbst erkennen konnte. »In den Siebzigerjahren haben sich noch mehr Menschen scheiden lassen. Kinder sind damit fertig geworden. Es gibt so etwas wie Besuchsrecht. Man hätte mir erlauben müssen, sie zu sehen.«
»Sie wollte das nicht. Ich ebensowenig.«
»Warum? Weil sie mit einem ihrer Kerle durchgegangen ist?«
»Nein.« Philip setzte vorsichtig sein Glas auf einem dünnen Silbertablett ab. »Weil sie einen von ihnen umgebracht hat, und weil sie wegen Mordes zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden ist.«
Ganz langsam drehte Kelsey sich um. »Mord? Du willst mir erzählen, dass meine Mutter eine Mörderin ist?«
»Ich hatte gehofft, dass ich das nie tun müsste.« Er stand auf, überzeugt, dass in der plötzlichen Stille das Knacken seiner Knochen zu hören war. »Du warst bei mir. Gott sei Dank warst du in der Nacht, in der es passierte, bei mir und nicht auf der Farm. Sie erschoss ihren Liebhaber, einen Mann namens Alec Bradley. In ihrem Schlafzimmer kam es zu einer Auseinandersetzung, da nahm sie eine Pistole aus ihrer Nachttischschublade und tötete ihn. Damals war sie sechsundzwanzig, so alt wie du jetzt. Sie wurde des Totschlags für schuldig befunden. Das letzte Mal sah ich sie im Gefängnis. Sie sagte, es sei ihr lieber, du würdest sie für tot halten, und wenn ich mich damit einverstanden erklärte, würde sie nie wieder Kontakt zu dir suchen. Bis heute hat sie ihr Wort gehalten.«
»Ich verstehe das alles nicht.« Kelsey wurde schwindlig, und sie presste die Hände gegen die Augen.
»Ich hätte dir das gern erspart.« Liebevoll fasste Philip ihre Handgelenke und drückte ihre Hände nach unten, damit er ihr ins Gesicht sehen konnte. »Wenn es falsch war, dich beschützen zu wollen, gut, dann war ich vielleicht im Unrecht, aber ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Ich liebte dich, Kelsey. Dafür kannst du mich doch nicht hassen.«
»Nein, ich hasse dich ja nicht.« Aus alter Gewohnheit lehnte sie den Kopf an seine Schulter und blieb so stehen, während sich die Gedanken in ihrem Kopf überschlugen. »Ich muss nachdenken. Es erscheint mir alles so unwirklich. Ich kann mich noch nicht einmal an sie erinnern, Dad.«
»Du warst noch zu klein«, murmelte er erleichtert. »Aber glaub mir, du siehst ihr unwahrscheinlich ähnlich. Es ist beinahe gespenstisch. Deine Mutter war eine lebenssprühende, faszinierende Frau, trotz all ihrer Fehler.«
Wozu unter anderem ein Gewaltverbrechen gehörte, dachte Kelsey. »Ich habe noch so viele Fragen. Ich kann einfach keinen klaren Gedanken fassen.«
»Bleib doch über Nacht hier. Sobald ich mich loseisen kann, reden wir weiter.«
Der Gedanke war verlockend, sich in die Geborgenheit ihres alten Zimmers zurückzuziehen und sich von ihrem Vater den Kummer und die Sorgen vertreiben zu lassen, so, wie er es von jeher getan hatte.
»Nein, ich will nach Hause«, sagte sie und wandte sich ab, um nicht doch noch schwach zu werden. »Ich muss eine Weile allein sein. Candace ist schon nicht gut auf mich zu sprechen, weil ich dich von euren Gästen fernhalte.«
»Sie wird das verstehen.«
»Natürlich. Du kümmerst dich jetzt besser um deine Gäste. Ich gehe lieber hinten raus, ich möchte keinem in die Arme laufen.«
Die hitzige Röte ihrer Wangen war verblasst, und ihr Gesicht wirkte jetzt bleich und abgespannt. »Kelsey, ich wünschte, du würdest hier bleiben«, sagte ihr Vater.
»Es geht mir gut, wirklich. Ich muss das alles nur erst verarbeiten. Wir reden später darüber. Schau du jetzt nach deinen Gästen.« Als Zeichen der Vergebung gab sie ihrem Vater einen Kuss. Als sie allein im Zimmer war, ging sie zum Schreibtisch und schaute nachdenklich auf den Brief, faltete ihn dann zusammen und steckte ihn wieder in ihre Tasche.
Welch ein Tag, dachte sie. Sie hatte einen Ehemann verloren und eine Mutter gewonnen.
2
Manchmal war es am besten, einem Impuls zu folgen. Nun, vielleicht nicht gerade am besten, korrigierte sich Kelsey, als sie die Route 7, die durch die Berge Virginias führte, westwärts fuhr – aber äußerst befriedigend.
Wahrscheinlich wäre es klüger gewesen, noch einmal mit ihrem Vater zu reden, alles noch einmal gründlich zu überdenken. Doch Kelsey hatte sich entschieden, einfach ins Auto zu steigen und zur Three-Willows-Farm zu fahren, um die Frau zur Rede zu stellen, die sich zwei Jahrzehnte lang tot gestellt hatte.
Meine Mutter, dachte Kelsey, die Mörderin.
Um das hässliche Bild zu verscheuchen, drehte sie das Radio auf; Rachmaninoff erklang. Es war ein herrlicher Tag für eine Autofahrt, hatte sie sich immer wieder eingeredet, seit sie am Morgen eilig ihr einsames Apartment verlassen hatte. Und auch als sie die Karte studierte, um den schnellsten Weg nach Bluemont zu finden, hatte sie sich das Ziel ihrer Fahrt nicht eingestanden.
Niemand wusste, dass sie kam. Niemand wusste, wo sie hingefahren war.
Das war Freiheit! Sie trat das Gaspedal durch, genoss die Geschwindigkeit, den kühlen Windzug, der durch die Fenster wehte, und die kraftvolle Musik. Sie konnte tun, was sie wollte, musste niemandem Rede und Antwort stehen. Jetzt war es an ihr, Fragen zu stellen.
Allerdings hatte sich sich entschieden sorgfältiger gekleidet, als es ein Ausflug aufs Land erforderte. Der pfirsich farbene Seidenblazer mit dazu passender Hose schmeichelte ihrem Teint, und der schmale Schnitt unterstrich ihre schlanke Figur.
Schließlich wollte sie, wenn sie ihre Mutter traf, gut aussehen. Sie hatte ihr Haar zu einem komplizierten Zopf geflochten und mehr Zeit als sonst auf ihr Make-up verwandt.
All diese Vorbereitungen hatten ihr geholfen, sich etwas zu beruhigen. Doch je näher sie Bluemont kam, desto nervöser wurde sie.
Noch konnte sie ihre Meinung ändern, sagte sich Kelsey, als sie vor einem kleinen Laden anhielt. Nach dem Weg nach Three Willows zu fragen hieß noch lange nicht, dass sie auch dorthin fahren musste. Wenn sie wollte, brauchte sie nur zu wenden, um nach Maryland zurückzukehren.
Oder sie konnte einfach weiterfahren, Virginia durchqueren und sich in westlicher Richtung halten. Oder vielleicht östlich, zur Küste. Sie mochte es, aus einer Laune heraus ins Auto zu springen und loszufahren, immer der Nase nach. So hatte sie einmal kurz entschlossen ein Wochenende in einer kleinen Pension an der Ostküste verbracht, nachdem sie Wade verlassen hatte.
Dort könnte sie wieder hinfahren, überlegte sie. Ein Anruf bei ihrem Arbeitgeber, ein Stopp an einem Einkaufszentrum, um sich ein paar Kleider zu besorgen, das genügte schon.
Schließlich lief sie ja vor nichts davon – sie brauchte einen Tapetenwechsel.
Aber warum kam es ihr dann so vor, als würde sie davonlaufen?
Der kleine Laden war mit Regalen, Milchkannen und Werkzeugen, die an der Wand hingen, derart vollgestopft, dass drei Kunden kaum Platz gehabt hätten. Hinter der Theke stand ein alter Mann, kahl wie eine Billardkugel, mit einer qualmenen Zigarette im Mundwinkel. Durch eine Rauchwolke schielte er zu Kelsey.
»Können Sie mir sagen, wie ich zur Three-Willows-Farm komme?«
Mit vom Rauch geröteten Augen musterte er sie einen Augenblick lang fragend: »Woll ’n Sie zu Miss Naomi?«
Kelsey schaute ihn mit einem Blick an, den ihre Großmutter immer angewandt hatte, wenn sie den Fragesteller in seine Schranken weisen wollte, und wiederholte: »Ich suche die Three-Willows-Farm. Sie muss hier in der Nähe liegen.«
»Allerdings.« Der Mann grinste sie an, wobei seine Zigarette im Mundwinkel kleben blieb, und sagte: »Sie fahren diese Straße ein Stück weiter, sagen wir mal, zwei Meilen. Da steht ’n weißer Zaun, wo Sie links abbiegen müssen, auf die Chadwick Road. Dann fahr’n Sie noch mal fünf Meilen oder so, an Longshot vorbei. Könn’ Sie gar nicht verfehlen, hat so ’n großes Eisentor, wo der Name draufsteht. An der nächsten Abzweigung steh’n zwei Steinpfosten mit sich aufbäumenden Pferden drauf. Das ist Three Willows.«
»Vielen Dank.«
Er sog den Rauch tief ein und stieß ihn dann wieder aus. »Sie heißen nicht zufällig Chadwick, oder?«
»Zufällig nicht.« Kelsey verließ den Laden und ließ die Tür hinter sich zufallen. Sie spürte förmlich die Blicke des Alten in ihrem Rücken und war erleichtert, als sie wieder im Auto saß.
Verständlich, dachte sie. In einer kleinen Stadt wurden Fremde immer neugierig betrachtet. Trotzdem hatte ihr die Art, wie der Mann sie angestarrt hatte, nicht gefallen.
An dem weißen Zaun bog sie links ab und fuhr aus der Stadt heraus. Die Gegend wurde ländlicher, die Häuser standen weiter voneinander entfernt, und auf den Hügeln hatte sich bereits das erste Grün des Frühlings gegen den Winter behauptet. Pferde mit im Wind wehenden Mähnen grasten auf der Weide, Stuten mit dickem Winterfell knabberten genüsslich an den Halmen, während ihre Fohlen auf spindeldürren Beinen um sie herumtobten. Hier und da waren bereits Felder für die Frühsaat umgepflügt; braune Flecken inmitten der grünen Landschaft.
Bei Longshot verlangsamte sie ihre Fahrt. Longshot war keine Straße, wie sie vermutet hatte, sondern eine Farm. Der Name an dem geschwungenen Eisentor stach einem förmlich ins Auge. Dahinter führte ein lang gezogener Schotterweg zu einem aus Zedernholz und Stein erbauten Haus, das mitten auf einem Hügel stand. Es war ein schönes Haus, das das Gebiet beherrschte, in dem es stand, und von den Terrassen musste man einen atemberaubenden Blick über das Land haben.
Den Weg säumten Ulmen, die sicher älter waren als das Haus, das, geradezu anmaßend modern, seine Umgebung zu beherrschen schien.
Kelsey blieb eine Weile still im Auto sitzen. Nicht weil sie die reizvolle Architektur oder die schöne Landschaft bewundern wollte, sondern weil sie wusste, dass es kein Zurück mehr geben würde, wenn sie dieser Straße weiter folgte.
Longshot war also eine Art Grenzpunkt. Eine angemessene Bezeichnung, fand Kelsey, schloss die Augen und zwang sich zur Ruhe. Sie musste sich vernünftig verhalten. Es würde kein Zusammentreffen geben, bei dem sie sich ihrer totgeglaubten Mutter weinend in die Arme warf.
Sie waren Fremde, die Zeit brauchten, um zu entscheiden, ob sich das ändern sollte. Nein, berichtigte Kelsey sich, sie würde diese Entscheidung treffen. Sie wollte keine Zuneigung, sie wollte noch nicht einmal Entschuldigungen hören. Sie war nur hier, um Antworten auf brennende Fragen zu bekommen.
Und die bekäme sie nicht, ermahnte sich Kelsey selbst, wenn sie nicht weiterfuhr.
Feigheit war noch nie eine ihrer Charaktereigenschaften gewesen, sagte sich Kelsey, als sie den Wagen startete. Dennoch waren ihre Hände eiskalt, als sie das Steuer umklammerte und den Wagen zwischen den steinernen Pfosten hindurch die Auffahrt entlang zum Haus ihrer Mutter lenkte.
Im Sommer schirmten die drei hohen Weiden, nach denen die Farm benannt worden war, das Haus ab. Jetzt zeigte sich ein erstes zaghaftes Grün, Bote des nahenden Frühlings, auf den gebogenen Zweigen. Dahinter sah Kelsey weiße dorische Säulen, Dachträger einer großen Veranda, die sich vor dem dreistöckigen Gebäude im alten Plantagenstil befand. Sehr feminin, dachte Kelsey, fast einer Königin würdig und bezaubernd wie die Epoche, in deren Stil das Anwesen gebaut war.
In einigen Wochen würde der Garten in einem Farbenmeer explodieren. Kelsey sah das Bild vor sich, hörte das Summen der Bienen und das Zwitschern der Vögel und roch sogar fast den Duft von Flieder und Glyzinien.
Unwillkürlich richtete sie den Blick auf die Fenster des oberen Stockwerks. Welcher Raum ist es, fragte sie sich, in dem der Mord begangen worden war?
Ein Schauer lief ihr über den Rücken, als sie den Motor abstellte. Ursprünglich hatte sie direkt zur Vordertür gehen und energisch anklopfen wollen, doch stattdessen ging sie langsam zu einer Seite des Hauses, von dem hohe Glastüren in einen gepflasterten Hof führten.
Von hier aus konnte sie einige Nebengebäude sehen; gepflegte Stallungen und eine Scheune, die beinahe so stattlich wie das Haus wirkte. In der Ferne, wo sich die Berge über das Land erhoben, erkannte sie grasende Pferde und das schwache Glitzern von Wasser in der Sonne.
Auf einmal schob sich eine andere Szene über dieses Bild. Bienen summten, Vögel sangen, die Sonne brannte, und der süße, intensive Duft von Rosen hing in der Luft. Jemand schwang sie lachend hoch und immer höher, bis sie den starken, sicheren Rücken eines Pferdes unter sich spürte.
Kelsey presste eine Hand vor den Mund, um einen leisen Schreckenslaut zu unterdrücken. Sie erinnerte sich nicht an diesen Ort, konnte sich gar nicht daran erinnern. Ihre Fantasie ging mit ihr durch, das war alles. Fantasie, gepaart mit Nervosität.
Dennoch hätte sie schwören können, ein Lachen gehört zu haben, ein wildes, freies Lachen.
Wärme suchend schlang sie die Arme um ihren Körper und trat einen Schritt zurück. Sie sollte ihren Mantel anziehen, sagte sie sich. Sie musste lediglich ihren Mantel aus dem Auto holen. Doch in diesem Moment kamen ein Mann und eine Frau um die Ecke, Arm in Arm.
Die beiden in Sonnenlicht getauchten Gestalten wirkten so überirdisch schön, dass Kelsey einen Augenblick lang meinte, sie seien gleichfalls ein Produkt ihrer Fantasie.
Der Mann war hochgewachsen und bewegte sich mit jener geschmeidigen Anmut, die manchen Männern eigen war. Sein dunkles, windzerzaustes Haar kräuselte sich unbändig über dem Kragen eines ausgeblichenen Flanellhemdes. Seine dunkelblauen Augen in dem kantigen Gesicht weiteten sich kurz in einem Anflug leiser Überraschung.
»Naomi«, seine Stimme klang tief und leicht gedehnt, »du hast Besuch.«
Die Beschreibungen ihres Vaters hatten sie in keiner Weise auf das vorbereitet, was sie nun sah. Ihr war, als blickte sie in einen Spiegel und sähe ihr gealtertes Ebenbild. Einen Augenblick lang glaubte sie, ohnmächtig zu werden.
Naomis Hand schloss sich fest um den Arm ihres Begleiters; eine automatische Reaktion, derer sie sich nicht bewusst war. »Ich dachte nicht, dass ich so schnell von dir hören würde, geschweige denn, dass ich dich leibhaftig vor mir sehen würde.« Die Jahre hatten sie gelehrt, wie nutzlos Tränen sein konnten, und so blieben ihre Augen trocken, als sie ihre Tochter ansah. »Wir wollten gerade Tee trinken. Lass uns hineingehen.«
»Ich komme später noch einmal wieder«, sagte Naomis Begleiter, Gabriel Slater, doch Naomi klammerte sich an ihm fest, als sei er ihr Schutzschild.
»Das ist nicht nötig.« Wie aus weiter Feme hörte Kelsey ihre eigene Stimme. »Ich kann nicht lange bleiben.«
»Dann komm wenigstens rein. Wir wollen deine Zeit nicht verschwenden.«
Naomi führte sie durch die Terrassentüren in ein Wohnzimmer, das genauso hübsch und gepflegt war wie seine Bewohnerin. Ein kleines Feuer flackerte im Kamin, um die winterliche Kälte zu vertreiben.
»Setz dich doch, mach’s dir gemütlich. Ich kümmere mich gleich um den Tee«, sagte Naomi, warf Gabe einen raschen Blick zu und verließ schnell den Raum.
Der Mann hatte offenbar gelernt, schwierige Situationen zu beherrschen. Er setzte sich, zog eine Zigarre hervor und schenkte Kelsey ein charmantes Lächeln. »Naomi ist ein bisschen verwirrt.«
Kelsey hob eine Braue. Die Frau war ihr eher kühl und gefasst vorgekommen. »Ist sie das?«
»Nur zu verständlich, würde ich sagen. Sie haben ihr einen Schock versetzt. Ich selbst dachte, mich trifft der Schlag.« Er zündete sich die Zigarre an und fragte sich, ob sich Kelsey trotz der angespannten Nervosität, die er in ihren Augen las, hinsetzen würde. »Ich bin Gabe Slater, ein Nachbar. Und Sie sind Kelsey.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
Wie eine Königin, die mit einem Untertan spricht, dachte er. Ein Tonfall, der normalerweise jeden Mann reizen musste, besonders einen wie Gabriel Slater. Doch er ließ es ihr durchgehen.
»Ich weiß, dass Naomi eine Tochter namens Kelsey hat, die sie schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen hat. Und für ihre Zwillingsschwester sind Sie ein bisschen zu jung.« Er streckte die Beine in den Reitstiefeln aus und legte die Füße übereinander. Beide wussten, dass er langsam den Blick von ihr abwenden sollte. Und er wusste, dass er es nicht tun würde.
»Sie könnten die Hoheitsvolle noch viel wirkungsvoller spielen, wenn Sie sich setzen und ganz entspannen würden.«
»Ich stehe lieber.« Kelsey ging zum Feuer, in der Hoffnung, es würde sie ein wenig wärmen.
Gabe zuckte nur mit den Achseln und lehnte sich zurück. Schließlich ging ihn das Ganze nichts an. Es sei denn, sie würde Naomi verletzen. Aber im Allgemeinen konnte sich Naomi ganz gut selbst helfen. Noch nie hatte er eine so tatkräftige, unverwüstliche Frau kennengelernt. Dennoch hatte er sie zu gern, um zuzulassen, dass irgendjemand, und sei es ihre eigene Tochter, ihr wehtat.
Auch interessierte es ihn wenig, dass Kelsey offenbar entschlossen war, seine Anwesenheit zu ignorieren. Lässig zog er an seiner Zigarre und genoss ihren Anblick. Die abweisende Haltung verdarb den angenehmen Gesamteindruck keinesfalls, er fand, dass sie sogar einen reizvollen Gegensatz zu den langen, schlanken Beinen und dem herrlichen Haar bildeten. Gabe fragte sich, wie leicht sie wohl aus dem Gleichgewicht zu bringen sei und ob sie lange genug bliebe, damit er sie auf die Probe stellen konnte.
»Der Tee kommt gleich.« Etwas gelassener kam Naomi wieder ins Zimmer. Ihr Blick ruhte auf ihrer Tochter, und ihr Lächeln wirkte aufgesetzt. »Das alles muss furchtbar unangenehm für dich sein, Kelsey.«
»Nicht jeden Tag steht die Mutter von den Toten auf. War es wirklich notwendig, mich in dem Glauben zu lassen, du seiest tot?«
»Damals schien es mir so. Ich befand mich in einer Situation, in der mein eigenes Überleben Vorrang hatte.« Naomi nahm Platz. In ihrem maßgeschneiderten, sandfarbenen Reitkostüm wirkte sie kühl und gefasst. »Ich wollte nicht, dass du mich im Gefängnis besuchst. Außerdem hätte dein Vater das nie zugelassen. Also musste ich mich damit abfinden, zehn oder fünfzehn Jahre von deinem Leben ausgeschlossen zu sein.«
Ihr Lächeln wirkte plötzlich spröde. »Wie hätten denn die Eltern deiner Freunde reagiert, wenn du ihnen erzählt hättest, dass deine Mutter wegen Mordes im Gefängnis sitzt? Ich glaube nicht, dass du sehr beliebt gewesen wärst. Oder sehr glücklich.«
Naomi hörte auf zu sprechen und blickte zur Tür, durch die eine Frau mittleren Alters in einer grauen Uniform mit weißer Schürze einen Teewagen hereinschob. »Da ist ja Gertie. Du erinnerst dich doch noch an Kelsey, Gertie?«
»Sicher, Ma’am.« Die Augen der Frau füllte sich mit Tränen. »Das letzte Mal waren Sie fast noch ein Baby. Sie bettelten immer um Plätzchen.«
Kelsey schwieg. Was sollte sie der Fremden mit den feuchten Augen auch erwidern? Naomi legte eine Hand über die Gerties und drückte sie liebevoll. »Wenn Kelsey das nächste Mal kommt, musst du welche backen. Danke, Gertie, ich schenke selbst ein.«
»Ja, Ma’am.« Schniefend wandte sich Gertie ab, doch dann drehte sie sich noch einmal um. »Sie sieht aus wie Sie, Miss Naomi. Ganz genau so.«
»Ja«, bestätigte Naomi weich und blickte zu ihrer Tochter. »Das tut sie.«
»Ich erinnere mich nicht an sie.« Kelseys Stimme klang feindselig, als sie zwei Schritte auf ihre Mutter zutrat. »Und an dich auch nicht.«
»Damit habe ich auch nicht gerechnet. Möchtest du Zucker? Zitrone?«
»Soll das eine Filmszene werden?«, fauchte Kelsey, »Mutter und Tochter versöhnen sich beim Tee. Erwartest du von mir, dass ich einfach hier sitze und mit dir Assamtee schlürfe?«
»Es ist Earl Grey, glaube ich. Und um die Wahrheit zu sagen, Kelsey, ich weiß nicht, was ich erwarte. Wut vermutlich. Du hast ein Recht, wütend zu sein. Anschuldigungen, Forderungen, Schuldzuweisungen.« Mit überraschend ruhigen Händen reichte Naomi Gabe eine Tasse. »Ehrlich gesagt, glaube ich, dass alles, was du sagst oder tust, gerechtfertigt ist.«
»Warum hast du mir geschrieben?«
Um ihre Gedanken ordnen zu können, füllte Naomi eine weitere Tasse. »Das hatte viele Gründe, einige davon sind egoistisch, andere nicht. Ich hoffte, du wärst neugierig genug, mich sehen zu wollen, du warst schon als Kind neugierig, und außerdem wusste ich, dass du gerade eine schwierige Zeit durchmachst.«
»Wie kannst du irgendetwas über mein Leben wissen?« Naomis Blick war ebenso unergründlich wie der Rauch, der vom Kaminfeuer aufstieg. »Du hast mich für tot gehalten, Kelsey, ich dagegen wusste, dass du quicklebendig warst. Also habe ich dein Leben verfolgt. Das war mir sogar vom Gefängnis aus möglich.«
In Kelsey stieg nackte Wut hoch, und sie musste den Drang niederkämpfen, den Teewagen mit dem zarten Porzellan durch den Raum zu stoßen. Welche Wonne ihr das bereiten würde! Aber gleichzeitig würde sie sich zum Narren machen, und nur dieser Gedanke hielt sie davon ab, einen Tobsuchtsanfall zu bekommen.
Gabe nippte an seinem Tee und schaute zu, wie sie um Selbstbeherrschung rang. Reizbar, entschied er, leidenschaftlich, aber klug genug, sich zurückzuhalten. Vielleicht war sie ihrer Mutter ähnlicher, als beide ahnten.
»Du hast mir nachspioniert.« Kelsey schleuderte ihr die Worte förmlich entgegen. »Wen hast du dazu angeheuert? Einen Privatdetektiv?«
»Es war bei Weitem nicht so melodramatisch. Mein Vater hat dein Leben verfolgt, so lange er konnte.«
»Dein Vater.« Kelsey ließ sich niedersinken. »Mein Großvater.«
»Ja. Vor fünf Jahren ist er gestorben. Deine Großmutter starb ein Jahr nach deiner Geburt, und ich war ein Einzelkind. Somit sind dir Tanten, Onkel und Neffen erspart geblieben. Nun weiter. Was für Fragen du auch hast, ich werde sie dir beantworten, aber bitte lass uns beiden noch ein wenig Zeit, ehe du dir ein Urteil über mich bildest.«
Kelsey konnte nur an eine einzige Frage denken, die ständig in ihrem Kopf hämmerte. »Hast du diesen Mann getötet? Hast du Alec Bradley umgebracht?«
Naomi schwieg einen Moment, dann hob sie die Tasse an die Lippen. Über den Rand hinweg sah sie Kelsey fest an, ehe sie die Tasse lautlos wieder absetzte.
»Ja«, antwortete sie schlicht, »ich habe ihn umgebracht.«
»Entschuldige, Gabe.« Naomi stand am Fenster und sah ihrer davonfahrenden Tochter nach. »Es war wirklich unentschuldbar, dir das zuzumuten.«
»Ich habe deine Tochter kennengelernt, weiter nichts.«
Müde lächelnd kniff Naomi die Augen zusammen. »Du warst schon immer ein Meister der Untertreibung, Gabe.« Sie drehte sich um, sodass sie im vollen Sonnenlicht stand. Dass es die feinen Linien um ihre Augen deutlich hervorhob, erste Anzeichen des Alters, kümmerte sie wenig. Zu lange hatte sie das Tageslicht entbehren müssen. »Ich hatte Angst, und als ich sie sah, wurde ich wieder an vieles erinnert. Einiges habe ich mir vorstellen können, anderes nicht. Alleine wäre ich mit der Situation nicht fertig geworden.«
Gab erhob sich, ging zu ihr und legte beruhigend die Hand auf ihre verkrampften Schultern. »Wenn ein Mann einer schönen Frau nicht mehr gern behilflich ist, dann ist er so gut wie tot.«
»Du bist ein guter Freund.« Sie ergriff seine Hand und drückte sie. »Einer der wenigen, auf die ich mich voll und ganz verlassen kann.« Ihre Lippen verzogen sich leicht. »Vielleicht kommt das daher, dass wir beide eine Zeit lang im Gefängnis gesessen haben.«
Seine Mundwinkel zuckten belustigt. »Nichts verbindet so sehr wie das Knastleben.«
»Knastleben, soso. Obwohl ein Streit in Jugendjahren bei einer Pokerrunde harmlos ist gegenüber Totschlag.«
»Da hast du’s. Du hast mich schon wieder übertroffen.« Naomi lachte. »Wir Chadwicks sind schrecklich ehrgeizig.« Sie wandte sich von ihm ab und rückte eine Vase mit Narzissen auf dem Tisch zurecht. »Was hältst du von ihr, Gabe?«
»Sie ist bildhübsch. Dein Ebenbild.«
»Ich dachte, ich wäre darauf vorbereitet. Mein Vater beschrieb sie mir, ich sah die Fotos. Trotzdem hat es mich aus der Fassung gebracht, sie anzuschauen und mich selbst zu sehen. Ich kann mich an sie als Kind so gut erinnern, und sie nun als Erwachsene zu sehen …« Über sich selbst verärgert schüttelte Naomi den Kopf. Die Jahre vergingen, keiner wusste das besser als sie. »Aber davon mal abgesehen.« Flüchtig blickte sie über die Schulter. »Was hältst du von ihr?«
Er war nicht sicher, ob er ihr seine Gedanken erläutern konnte – oder wollte. Kelsey hatte ihn aus der Fassung gebracht, und er war wirklich kein Mann, den man leicht beeindrucken konnte. In seinem Leben hatte er Scharen schöner Frauen gekannt, er hatte sie bewundert, sie begehrt und mit ihnen gespielt. Doch als er Kelsey Byden das erste Mal sah, hatte ihm der Atem gestockt.
Später würde er sich mit diesem interessanten Phänomen eingehender auseinandersetzen, aber jetzt wartete Naomi auf eine Antwort. Und er wusste, dass seine Antwort von Bedeutung war.
»Sie war nervös, konnte ihr Temperament kaum zügeln. Sie hat nicht so viel Selbstbeherrschung wie du.«
»Ich hoffe, die wird sie auch nie brauchen«, murmelte Naomi.
»Sie war aufgebracht, aber klug – und neugierig – genug, sich zurückzuhalten, bis sie das Terrain sondiert hatte. Wäre sie ein Pferd, würde ich sagen, ich muss ihre Gangarten sehen, um zu beurteilen, ob sie über Mut, Ausdauer und Anmut verfügt. Aber die Blutsverwandtschaft ist unverkennbar, Naomi. Deine Tochter hat Stil.«
»Sie hat mich geliebt.« Naomi bemerkte das Zittern in ihrer Stimme kaum, ebenso wenig wie die ersten Tränen, die ihr aus den Augen quollen und über die Wangen rannen. »Wie soll man jemandem, der selbst keine Kinder hat, diese reine, kompromisslose Liebe, die ein Kind seinen Eltern entgegenbringen kann, begreiflich machen? Kelsey empfand so für mich – und für ihren Vater. Philip und ich haben versagt. Unsere Liebe reichte nicht aus, um diese Einheit zusammenzuhalten. Und so habe ich meine Tochter verloren.«
Naomi tupfte eine Träne mit der Fingerspitze ab und betrachtete sie wie etwas Exotisches. Seit dem Tode ihres Vaters hatte sie nicht mehr geweint. Nichts hatte sie seitdem so stark berührt.
»Niemand wird mich je wieder so lieben.« Sie schnippte die Träne fort und vergaß sie. »Ich glaube, bis zum heutigen Tag habe ich das nie richtig begriffen.«
»Überstürz die Dinge nicht, Naomi. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Du hast sie gerade einmal eine Viertelstunde gesehen.«
»Hast du ihren Gesichtsausdruck gesehen, als ich ihr sagte, ich hätte Alec umgebracht?« Ein Lächeln lag auf ihren Lippen, als sie sich zu Gabe umdrehte; doch es war ein hartes, sprödes Lächeln. »Diesen Ausdruck habe ich bei Dutzenden von anderen Menschen beobachtet. Eine Art beherrschter Abscheu – anständige Menschen töten nicht.«
»Die Menschen, ob nun anständig oder nicht, tun das, was sie tun müssen, um zu überleben.« Diese Erfahrung hatte er am eigenen Leibe gemacht.
»Sie denkt da anders. Vom Äußeren her mag sie ja mir ähneln, aber sie hat dieselben hehren Grundsätze wie ihr Vater. Und der Himmel weiß, es gibt keinen anständigeren Menschen als Dr. Philip Byden.«
»Oder keinen größeren Narren. Schließlich hat er dich gehen lassen.«
Ihr Lachen klang befreit, als sie ihn fest auf den Mund küsste. »Wo warst du bloß vor fünfundzwanzig Jahren?« Dann schüttelte sie seufzend den Kopf. »Da hast du wohl noch mit deinen Buntstiften gespielt.«
»Ich kann mich nicht erinnern, jemals damit gespielt zu haben. Eher habe ich sie verwettet. Da wir gerade vom Wetten sprechen: Ich wette 100 Dollar, dass mein Pferd deins garantiert beim Mai-Derby um Längen schlägt.«
Sie hob die Brauen. »Wie stehen denn die Chancen?«
»Sie haben die gleichen Chancen.«
»Die Wette gilt. Wie wär’s, wenn du jetzt mitkommst und dir meine preisgekrönte Jährlingsstute ansiehst? In einigen Jahren lässt sie jeden Gegner hinter sich.«
»Wie hast du sie genannt?«
Ihre Augen glitzerten, als sie die Terrassentür öffnete. »Naomis Honor.«
Sie war so gefasst gewesen, dachte Kelsey, als sie die Tür zu ihrem Appartement aufschloss, so gelassen. Naomi hatte den Mord so zugegeben, wie eine andere Frau eingestehen würde, dass sie sich das Haar färbt.
Was für eine Frau war ihre Mutter nur?
Wie konnte sie es fertigbringen, Tee zu servieren und Konversation zu betreiben? So höflich, so beherrscht, so furchtbar distanziert. Kelsey lehnte sich gegen die Tür und rieb sich die schmerzenden Schläfen. Alles kam ihr wie ein böser Traum vor, das prächtige, große Haus, die geschmackvolle Einrichtung, die Frau, die ihre, Kelseys, Gesichtszüge trug, der Mann, der so viel Kraft ausstrahlte. Naomis neuester Liebhaber? Schliefen sie in demselben Raum, in dem ein anderer Mann gestorben war? Er sah aus, als wäre er dazu imstande, dachte sie. Er sah aus, als wäre er zu allem imstande.