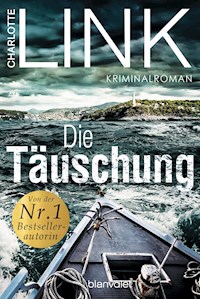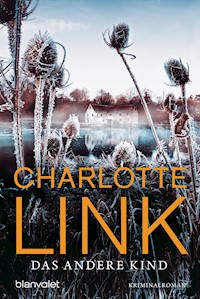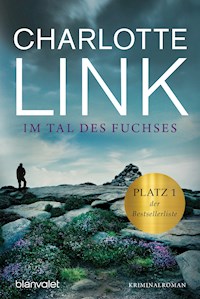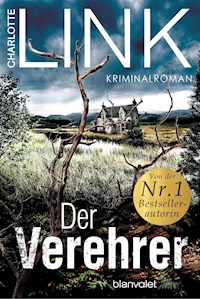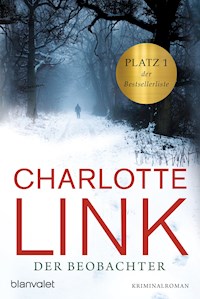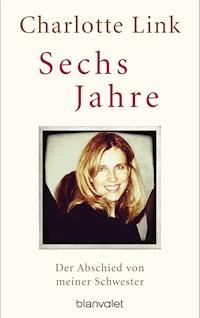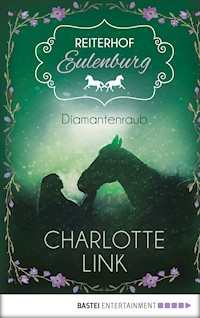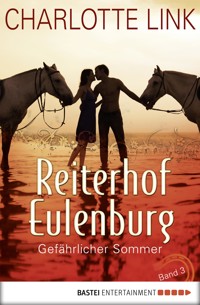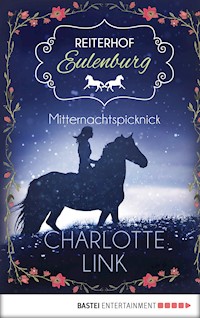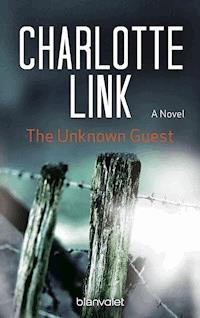10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Eine Einladung zur Neujahrsnacht 1990 führt sie nach Jahren wieder zusammen: David Bellino, Chef eines amerikanischen Industrie-Imperiums, vier seiner Freunde aus Jugendtagen und Laura, seine attraktive Geliebte. Doch nach Ferien ist keinem zumute. Sie sind gekommen, um mit David abzurechnen, dessen Ehrgeiz und skrupelloser Egoismus ihre Pläne nachhaltig zerstört hat. Doch noch bevor es zu der großen Auseinandersetzung kommt, liegt David erschossen in seinem Arbeitszimmer. In stundenlangen Verhören, in dramatischen Aussprachen untereinander, aus quälenden Erinnerungen entstehen wie in einem bizarren Kaleidoskop sechs Lebensbrüder, sechs Schicksale, die die Sehnsucht nach Liebe und Freundschaft verband - und zerstörte. Zwischen dem Berlin des Zweiten Weltkriegs, einem englischen Nobelinternat den Gossen und Prachtvierteln von New York und London und den romantischen Gassen Wiens spinnt Charlotte Link ein Netz fataler, romantischer und angstvoller Beziehungen. Mit Sensibilität und scharfem Instinkt zeigt sie die Emotionen, die hinter unserem Handeln liegen. So gelang ihr ein spannender Zeitroman, der nicht nur ein Verbrechen, sondere auch die verdrängten Ursachen dafür ans Licht bringt.
Millionen Fans sind von den fesselnden Krimis von Charlotte Link begeistert. Dunkle Geheimnisse und spannende Mordfälle erwarten Sie. Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 831
Sammlungen
Ähnliche
Charlotte Link
Schattenspiel
Roman
Buch
Eine Einladung zur Neujahrsnacht 1990 führt sie nach Jahren wieder zusammen: David Bellino, Chef eines amerikanischen Industrie—Imperiums, vier seiner Freunde aus Jugendtagen und Laura, seine attraktive Geliebte. Doch nach Ferien ist keinem zumute. Sie sind gekommen, um mit David abzurechnen, dessen Ehrgeiz und skrupelloser Egoismus ihre Pläne nachhaltig zerstört hat. Doch noch bevor es zu der großen Auseinandersetzung kommt, liegt David erschossen in seinem Arbeitszimmer. In stundenlangen Verhören, in dramatischen Gesprächen untereinander, aus quälenden Erinnerungen entstehen wie in einem bizarren Kaleidoskop sechs Lebensbilder, sechs Schicksale, die die Sehnsucht nach Liebe und Freundschaft verband – und zerstörte. Zwischen dem Berlin des Zweiten Weltkriegs, einem englischen Nobelinternat, den Gossen und Prachtvierteln von New York und London und den romantischen Gassen Wiens spinnt Charlotte Link ein Netz fataler, romantischer und angstvoller Beziehungen. Mit Sensibilität und scharfem Instinkt zeigt sie die Emotionen, die hinter unserem Handeln liegen. So gelang ihr ein spannender Zeitroman, der nicht nur ein Verbrechen, sondern auch die verdrängten Ursachen dafür ans Licht bringt.
Autorin
Charlotte Link ist die erfolgreichste deutsche Autorin der Gegenwart. Ihre psychologischen Spannungsromane in bester englischer Krimitradition (u.a. »Das Haus der Schwestern«, »Die Rosenzüchterin«, »Am Ende des Schweigens«) stehen regelmäßig über viele Monate an den Spitzen der Bestsellerlisten. Die zumeist mehrteiligen TV—Verfilmungen ihrer Bücher werden mit riesigem Erfolg im ZDF ausgestrahlt. Charlotte Link, seit vielen Jahren engagierte Tierschützerin, lebt mit ihrer Familie und ihren Hunden in der Nähe von Frankfurt/Main.
Von Charlotte Link außerdem lieferbar:
Verbotene Wege. Roman (9286) ·Die Sterne von Marmalon. Roman (9776) · Sturmzeit. Roman (41066) · Wilde Lupinen. Roman (42603) · Die Sünde der Engel. Roman (43256/44599) ·Die Stunde der Erben. Roman (43395) · Der Verehrer. Roman (44254) · Das Haus der Schwestern. Roman (44436) Die Täuschung. Roman (45142) · Die Rosenzüchterin. Roman (45583) · Der fremde Gast. Roman (45769) · Am Ende des Schweigens. Roman (46083) · Das Echo der Schuld. Roman (46853) · Die letzte Spur. Roman (46458) · Das andere Kind (Blanvalet,gebundene Ausgabe, 00279)
Inhaltsverzeichnis
New York, Silvesternacht 1988/89
Das neue Jahr war fünf Minuten alt, und über New York rasten die bunten Feuerwerkskörper in den Himmel, als Andreas Bredow einen stechenden Schmerz in der linken Brust spürte und für Sekunden um Atem rang. Am ganzen Körper brach ihm der Schweiß aus. Dann war es vorbei, so plötzlich, wie es gekommen war, aber kaum hatte er tief Luft geholt und sich wieder in seinen Sessel zurückgelehnt, setzte der Schmerz erneut ein, ein krampfartiger, furchtbarer Schmerz, der ihm die Kehle zuschnürte und ihm ein Zittern durch Arme und Beine jagte. Er preßte beide Hände gegen die Brust, krümmte sich zusammen.
Ein Infarkt. Es konnte nur ein Infarkt sein.
Seit Jahren verfolgte ihn die Angst, ihm könnte so etwas passieren. Er war infarktgefährdet, das hatte ihm sein Arzt immer wieder gesagt. Herztabletten und Kreislaufmittel vervollständigten alle seine Mahlzeiten. Eine gewisse Zuversicht hatte Andreas aus der Tatsache gezogen, daß immer genügend Menschen um ihn sein würden, die ihm helfen könnten. Chauffeur, Butler, Putzfrau, Sekretärin, Dienstmädchen. Und David, der auch nachts in der Wohnung schlief.
Tatsächlich war Andreas Bredow in den letzten Jahren kaum eine Minute allein gewesen, denn wohin hätte ein 61jähriger vollkommen blinder Mann allein auch gehen sollen? Irgend jemand hatte ihn stets an der Hand genommen, immer hinter ihm gestanden. Er brauchte nur zu rufen oder zu klingeln, und ein halbes Dutzend dienstbare Geister stürzte herbei. Immer. Bloß in dieser Nacht nicht. In der Silvesternacht der Jahre 1988/89 war Andreas Bredow, einer der reichsten Männer an der amerikanischen Ostküste, in seinem Nobelappartement hoch über der Fifth Avenue vollkommen allein.
Er mußte sich plötzlich übergeben. Das verschaffte ihm eine kurze Erleichterung, in der er einen klaren Gedanken fassen konnte: Er mußte nur den Telefonhörer abheben und die 1 drücken, dann war er mit dem Portier unten in der Eingangshalle verbunden. Der Portier kannte die Nummer des Arztes, besaß außerdem die Sicherheitsschlüssel zum Penthouse. Er würde Dr. Harper also auch nach oben bringen können, zwanzig Etagen hoch. Ja, der Portier. Er brauchte nur den Portier.
Das Zimmer, Andreas’ Arbeitszimmer mit Blick über den ganzen Central Park, war so eingerichtet, daß sich alle Möbel entlang den Wänden aufreihten und sich in der Mitte des Raumes nichts befand. Andreas konnte sich daher rasch und ohne zu stolpern bewegen.
Jetzt schien sich alles um ihn zu drehen. Auf Händen und Füßen kroch er über den Teppich, einen Perser, alt und sehr kostbar. Die Schmerzen waren kaum mehr auszuhalten. Irgendwo mitten im Zimmer brach er zusammen, lag gekrümmt wie ein Embryo, spürte, wie ihm die Tränen in die Augen schossen, griff mit der Hand an den Hals, zerrte die Krawatte herab.
Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe.
Die Todesangst trieb ihn, weiterzukriechen. Bis zum Schreibtisch ... dort stand das Telefon...wenn er das Telefon erreichte... Krachend und tosend zerbarsten draußen die Silvesterraketen. Es war ihm, als hätten sich die Bilder früherer Neujahrsnächte tief in seine Erinnerungen eingebrannt und als könnte er die roten Blitze, die grünen Sterne, die goldenen Feuer am schwarzen Himmel sehen. Röchelnd, halb besinnungslos vor Schmerz, tastete er nach der Schreibtischkante, zog sich an ihr hoch. Seine Hand griff nach dem Telefonhörer und erstarrte.
Das Telefon stand nicht an seinem Platz!
Natürlich glaubte er sofort, er habe sich getäuscht. Er war an der falschen Seite des Schreibtischs angelangt. Schwindel und Atemnot hatten ihn durcheinandergebracht. Er wußte nicht mehr, wo oben und unten, wo rechts und links war.
Jesus, wenn nur der Schmerz nachließe! Er hätte in sein Herz hineinfassen, es mit beiden Händen umklammern, ihm Platz und Raum schaffen mögen, damit es wieder frei schlagen konnte. Vor dem Schreibtisch kniend, versuchte er es noch einmal, ließ seine Hand zitternd über die Schreibplatte tasten. Das Diktiergerät... die gerahmte Fotografie seiner Eltern... die Schale mit Bleistiften ... aber dann mußte hier das Telefon stehen! Er schluchzte auf und versuchte, die Einrichtung zu rekonstruieren: Hinter ihm lag die Sitzecke, dann war vor ihm das Fenster, dann war rechts die Lampe, dann war links, verdammt noch mal, das Telefon!
Nachdem er ein zweites Mal erbrochen hatte, rutschte er zu Boden. Seine Wange kam auf seiner Hand zu liegen, und der schwere goldene Ring, den er von seinem Vater geerbt hatte, schnitt in seine Haut.
Der Ring rief jäh eine Erinnerung in ihm wach. Obwohl die Ereignisse beinahe ein halbes Jahrhundert zurücklagen, waren die Bilder so scharf und klar, als seien sie erst gestern entstanden.
Berlin 1940. Er war dreizehn gewesen in jenem Kriegssommer, ein warmer Sommer, wie er noch wußte, und eine Zeit, in der überall noch frohgemut vom Endsieg gesprochen wurde, und die deutschen Truppen von allen Fronten berauschende Erfolge vermelden konnten. Andreas saß oft vor dem Radio, dem Volksempfänger, und lauschte Joseph Goebbels’ scharfer Stimme, mit der er die Herrschaft der Deutschen über alle Welt propagierte. Andreas mochte Goebbels nicht, und Adolf Hitler auch nicht. Natürlich hatte er das nie laut geäußert, zumal er nicht genau sagen konnte, worauf sich seine Abneigung gründete. Schließlich veranstaltete die Partei tolle Sachen, gerade für die Jugend. Andreas war im Jungvolk, und da gab es an jedem Wochenende Wanderungen und Zelten, Lagerfeuer, spannende Spiele und Kameradschaft und Tapferkeit. Alles in allem wunderbare Dinge für einen dreizehnjährigen Jungen, aber dahinter stand mehr als einfach nur Spiel und Spaß, und das flößte Andreas oft ein leises Grauen ein. Er war ein aufgewecktes und sehr sensibles Kind, und er witterte eine ungreifbare, unnennbare Gefahr. In jenem Sommer also, genauer gesagt, am 25. Mai, ereigneten sich zwei Dinge: Die eine Angelegenheit betraf Christine, Andreas’ Spielgefährtin, sie war Andreas’ beste Freundin, Kameradin, Vertraute, Mitwisserin aller seiner Seelengeheimnisse. Sie hatten Indianer zusammen gespielt und König und Prinzessin, aber jetzt saßen sie oft auch nur einfach stundenlang zusammen und redeten, besonders dann, wenn Andreas schwermütig und traurig war, wenn kein Mensch ihn verstand außer Christine. Sie war die Stärkere von beiden, aber an diesem Tag erschien sie mit verweinten Augen und aufgelösten Zöpfen. »Sie haben meinen Vater verhaftet, Andreas! Sie haben meinen Vater verhaftet!«
»Wer?«
»Die Gestapo. Heute in aller Frühe. Sie haben unser ganzes Haus verwüstet und ihn dann weggezerrt. Andreas, was soll ich tun?«
»Warum haben sie ihn verhaftet, Christine?«
Christine fing wieder an zu schluchzen. »Weil er gegen Adolf Hitler ist. Er sagt, Hitler ist ein Verbrecher, der uns alle ins Unglück stürzt. Und jemand hat ihn angezeigt deswegen... Andreas, ich habe solche Angst.«
Er legte den Arm um sie. »Ich bin bei dir, Christine. Hab keine Angst.« Aber er konnte ihr nicht helfen, das wußte er. Niemand konnte etwas ausrichten gegen die Gestapo. Sie war allmächtig. Man munkelte von Folterkellern, furchtbaren Gefängnissen, Lagern, von Menschen, die nie wiederkehrten. Er sagte: »Sie werden ihn vielleicht nur kurz verhören und dann wieder gehen lassen.« Aber er glaubte es selber nicht. Und Christine auch nicht. Mit einem herzzerreißenden Ausdruck von Trostlosigkeit in den Augen sagte sie, sie sei überzeugt, ihr Vater werde niemals zurückkommen. Dann schlich sie nach Hause, denn sie mußte sich um ihre Mutter kümmern, die wie erstarrt in ihrer Wohnung saß und nicht faßte, was passiert war.
Wie sich später herausstellte, kam Christines Vater tatsächlich nicht zurück; seine Spur ließ sich in eines der berüchtigten Todeslager verfolgen und verlor sich dort. Und es schien wie ein merkwürdiges Spiel des Schicksals, daß Andreas am selben Tag erfuhr, daß sein Vater in Frankreich gefallen war.
Tante Gudrun sagte es ihm, als er abends nach Hause kam. Sie tat es auf die ihr eigene, unsensible, ungeschickte Art. Erst druckste sie ewig lange herum, wich aus und redete etwas von Tapferkeit und deutschem Heldentum (Tante Gudrun war eine gute Patriotin!), und als Andreas schon ganz aufgelöst war und lauter schreckliche Dinge vermutete, sagte sie unvermittelt: »Ja, also, da ist ein Telegramm gekommen heute. Dein Vater ist gefallen, Andreas. Man kann nichts mehr tun.« Dann drehte sie sich wieder zu ihrem Herd um und rührte verbissen in einem großen Kochtopf, unfähig, das blasse, erschreckte Kind, das fassungslos hinter ihr stand, auch nur anzusehen, geschweige denn, es in die Arme zu nehmen oder ihm wenigstens über die Haare zu streichen.
Alles, was Andreas in diesen Minuten denken konnte, war: Nun habe ich niemanden mehr. Niemanden auf der Welt.
Andreas’ Mutter war bei seiner Geburt gestorben, und seinen Vater, den Oberstleutnant Bredow, hatte die Situation, allein für ein Baby sorgen zu müssen, vollkommen überfordert. Er war Offizier von altem preußischem Schlag, ernst, korrekt und pflichtbewußt, immer ein wenig streng und unnahbar. Im Innern empfand er sowohl Stolz als auch Liebe für seinen kleinen Sohn, aber er sah sich völlig außerstande, dem Kind das zu vermitteln. Er besorgte eine Kinderschwester, bezahlte sie fürstlich, zog sich erleichtert zurück und ließ sie vergleichsweise unbeaufsichtigt tun, was sie tun wollte.
Natürlich blieb es nicht bei einer; Aufsichtspersonen dieser Art pflegen häufig aus den verschiedensten Gründen zu wechseln, und bis zu seinem achten Lebensjahr hatte Andreas bereits sieben »Fräuleins« um sich gehabt und seinen Vater nur sehr selten gesehen. Er verehrte und bewunderte diesen Mann, der immer eine so schöne Uniform trug und stets würdevoll und ruhig auftrat, und oft weinte er sich abends in den Schlaf, weil er gedacht hatte, sein Vater käme heute und würde ihm gute Nacht sagen, er aber war wieder einmal nicht erschienen.
Von den Kinderschwestern gab es nur eine, die Andreas wirklich mochte, und die blieb nur ein halbes Jahr, dann heiratete sie und ging fort von Berlin. Alle anderen hatten irgendeinen Fehler. Eine war trocken und humorlos und schüchterte das Kind immer nur ein, eine andere lachte ständig überdreht und redete so viel, daß man Kopfweh davon bekam. Eine ließ ihn völlig verwahrlosen und wurde schließlich gefeuert, eine klaute wie ein Rabe. Die letzte hatte einen Freund, der immer im Hause Bredow herumlungerte, wenn der Oberstleutnant nicht da war, und der Andreas sagte, er werde ihn »abmurksen«, wenn er das seinem Vater petzte. Andreas beobachtete die beiden einmal, während sie sich auf dem Wohnzimmerteppich liebten; er reagierte mit einem Schock, bekam nächtliche Alpträume und behielt kein Essen mehr bei sich. Nicht einmal dem fast ständig abwesenden Oberstleutnant konnte das verborgen bleiben, und schließlich brachte er aus dem Sohn heraus, was passiert war. Damit war das Ende der Kindermädchen gekommen, und Tante Gudrun trat auf den Plan.
Bei Tante Gudrun stand jedenfalls nicht zu erwarten, daß sie sich irgendeinem unmoralischen Tun hingeben würde. Sie war des Oberstleutnants ältere Schwester und eine typische alte Jungfer. Sie haßte alle Männer – hauptsächlich deshalb, weil sich nie einer um sie bemüht hatte –, und sie war verbissen darum bemüht, den Makel ihrer Ehelosigkeit durch besonderen Fleiß und unsagbare Tüchtigkeit auszugleichen. Sie zog in das Haus ihres Bruders mit Sack und Pack ein, versäumte es aber von da an keinen einzigen Tag, alle Welt darauf hinzuweisen, welch ungeheures Werk der Nächstenliebe sie damit tat. Der Satz, den Klein—Andreas von nun an am häufigsten zu hören bekam, lautete: »Du weißt überhaupt nicht, wie dankbar du mir sein kannst!«
Als der Krieg begann und der Oberstleutnant an die Front mußte, wurde Andreas’ Einsamkeit noch größer. Sein Leben war zwar ausgefüllt mit Schule und Jungvolk und Christine, aber es gab keinen erwachsenen Menschen mehr, dem er Vertrauen und Liebe entgegenbringen, an dem er sich orientieren konnte. Alles, woran er festhielt, war der Gedanke: Bald ist der Krieg vorbei und Vater kommt zurück!
Nun war Vater tot. Für sein ganzes Leben würde ihm die Szene dieses Abends gegenwärtig bleiben. Der blaßblaue Abendhimmel jenseits des Fensters, ein paar rot angestrahlte Wolken, drinnen der Geruch nach Eintopf und Schweiß. Tante Gudrun verausgabte sich immer vollkommen bei der Arbeit. Andreas sah nur ihren breiten Rücken, die dicken, roten Arme, die sich beinahe wütend bewegten. Ohne ihn anzusehen sagte sie: »Die Frage ist, was nun aus dir werden soll!«
Nie würde er das Gefühl völliger Hilflosigkeit vergessen, das ihn in diesem Augenblick befiel.
Eine Woche später erschien ein junger Soldat im Hause Bredow. Er hatte die letzten Minuten des Oberstleutnants miterlebt und berichtete, die Gedanken des Sterbenden hätten dem Sohn gegolten.
»Er war besorgt um dich. Er sagte mir, ich solle dich von ihm grüßen und dir sagen, daß er dich sehr liebt. Und er gab mir das hier für dich.« Der Soldat griff in seine Jackentasche und zog etwas hervor. Es war der goldene Ring, den der Vater immer getragen hatte und der in der Familie Bredow schon seit Generationen vom Vater an den jeweils ältesten Sohn weitergegeben wurde. »Der ist jetzt für dich, hat er gesagt. Und du sollst ihn nie vergessen.«
Nie. Nie würde er ihn vergessen.
Kurz darauf begann Tante Gudrun immer öfter zu jammern, sie sei zu alt und zu müde, um ein Kind allein aufzuziehen, außerdem habe sie viel geleistet in ihrem Leben, und es sei ihr Recht, jetzt endlich auch einmal an sich zu denken.
»Wenn ich nur wüßte, was man mit dir macht!« sagte sie immer wieder zu Andreas, der keine Ahnung hatte, was er darauf erwidern sollte.
Glücklicherweise gab es da noch einen Verwandten, einen Cousin von Tante Gudrun und dem Oberstleutnant. Rudolf Bredow war als ganz junger Mann nach Amerika ausgewandert und hatte es dort innerhalb kurzer Zeit zu einem Vermögen gebracht; er war clever und risikofreudig und verwaltete inzwischen ein Imperium, Bredow Industries, wozu eine Hotelkette, Restaurants, Ölfelder in Texas und eine private Fluggesellschaft gehörten. Andreas hatte den legendären Onkel Rudolf nie gesehen, wußte aber, daß er als schwarzes Schaf galt, denn soviel Geschäftemacherei war in der Familie als ordinär verpönt. Das hinderte Tante Gudrun aber natürlich nicht daran, Kontakt mit ihrem Cousin aufzunehmen und ihm brieflich so lange zuzusetzen, bis er sich bereit erklärte, die Vollwaise bei sich aufzunehmen. Er hatte keine eigenen Kinder, seine Frau Judith wünschte sich jedoch lange schon eines, und so schien das eine vernünftige Lösung. Tante Gudrun war ganz aufgeregt. »Du ziehst das große Los, Andreas, das ist dir hoffentlich klar! Am Ende erbst du einmal alles. Vielleicht denkst du dann mal an deine Tante Gudrun! Du hast ja keine Ahnung, wie dankbar du mir sein kannst!«
Benommen erlebte Andreas die sich überschlagenden Ereignisse. Ehe er es sich versah, war eine Schiffspassage für ihn gebucht, standen seine Koffer gepackt im Hausflur. Er war außer sich vor Kummer, weil er Christine verlassen mußte, um die er sich Sorgen machte und die er am liebsten mitgenommen hätte, anstatt sie im Hitler—Deutschland zurückzulassen. Die Gestapo war noch einmal erschienen und hatte sie und ihre Mutter verhört. Es kam Andreas fast wie ein Verrat vor, sich über den Atlantik hinweg abzusetzen.
Rudolf und Judith Bredow nahmen ihn mit offenen Armen auf, und besonders Judith liebte ihn von der ersten Sekunde an mit aller Zärtlichkeit. Tragischerweise kam diese Liebe zu spät, um Andreas aus seiner Einsamkeit und Verstörtheit zu befreien, um gutzumachen, was er als Kind an Verlassenheitsgefühlen und Kälte hatte durchstehen müssen. Immer häufiger befielen ihn schwermütige Stimmungen. Er bemühte sich, sein Traurigsein nicht zu zeigen, weil er wußte, daß Judith darunter litt, aber es war ihm an den Augen abzulesen. Manchmal dachte er, es wäre vielleicht besser, wenn er Christine bei sich hätte, und dann dachte er an die Nachmittage, die sie miteinander verbracht, an die Geheimnisse, die sie geteilt hatten, und Sehnsucht und Kummer überwältigten ihn. Überdies hörte man immer Schlimmeres aus Deutschland, je mehr die Zeit voranschritt, die Städte wurden bombardiert, Tausende starben bei Luftangriffen. Beklommen fragte er sich immer wieder, ob Christine und ihre Mutter immer noch in Berlin säßen oder ob sie sich auf dem Land in Sicherheit gebracht hätten.
New York bedeutete für Andreas den Eintritt in eine neue Welt, ein Leben hoch über dem Central Park, Ferientage auf Martha’s Vineyard oder auf der texanischen Ranch, es bedeutete Private School und später ein wirtschaftswissenschaftliches und juristisches Studium in Harvard, feine Restaurants und Bälle, Chauffeur, eigenes Bad und Tennisstunden. An seinen Geburtstagen durfte er seine Schulfreunde einladen, und für alle gab es Eis und Glückslose, und Judith selbst unterhielt die ganze Gesellschaft mit Spielen. Alles, was sie an Gefühlen zu geben hatte, schenkte sie dem fremden Kind. Andreas dankte es ihr mit Anhänglichkeit und Treue, und das einzige, was er ihr nicht geben konnte, und was sie sich so sehr gewünscht hätte, war die natürliche, unbeschwerte Fröhlichkeit eines heranwachsenden Jungen.
»Du bist zu ernst für dein Alter«, sagte sie oft. »Was macht dich so traurig?«
Er lächelte nur, aber er hätte ihr antworten können: Meine Traurigkeit wird mich begleiten, solange ich lebe.
An seinem achtzehnten Geburtstag – es war im Mai 1945, und Deutschland hatte gerade kapituliert – ließ Rudolf seinen Stiefsohn in sein Arbeitszimmer kommen und reichte ihm einen dicken Briefumschlag. »Für dich, Andreas«, sagte er, »eine Kopie meines Testaments. Ich habe dich zu meinem Alleinerben gemacht. Alles, was mir gehört, sollst du einmal bekommen.«
Alles, was ihm gehörte, waren Millionen. Andreas wollte etwas sagen, aber Rudolf winkte ab. »Ich täte es nicht, wenn ich nicht wüßte, daß du damit umgehen kannst. Du hast immer wieder deinen Verstand und deine Zuverlässigkeit bewiesen. Ich habe großes Vertrauen in dich, Andreas.«
»Glaubst du wirklich, ich bin all dem gewachsen?« fragte Andreas zweifelnd.
»Ich bin felsenfest davon überzeugt«, erwiderte Rudolf.
Andreas war fünfundzwanzig, als Judith an einem Gehirntumor starb. Vier Jahre später kam Rudolf bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben. Er lag noch einen Tag lang schwerverletzt in einem texanischen Krankenhaus, und als er, kurz bevor er starb, noch einmal das Bewußtsein erlangte, sah er Andreas, der sofort aus New York gekommen war und nun an seinem Bett saß. »Andreas, du solltest heiraten«, sagte er, »und Kinder haben. Allein sein ist nicht gut.«
Andreas erinnerte sich dieser Worte in den folgenden Jahren immer wieder, wenn ihm die Einsamkeit weh tat und er mit zusammengebissenen Zähnen durch seine Depressionen ging. Er stürzte sich in seine Arbeit, sorgte dafür, daß er auch an den Wochenenden keinen Moment unbeschäftigt war. Seine Sekretärinnen stöhnten, weil er soviel Streß verursachte. Im Sommer 1967, Andreas war gerade vierzig, erlitt er einen Herzinfarkt. »Wenn’s geht«, sagte sein Arzt betont, »dann möglichst keinen zweiten, Mr. Bredow. Sie sind zu jung, als daß Ihre Pumpe jetzt schon schlappmachen sollte.«
Seit seinem achtzehnten Geburtstag hatte Andreas immer wieder versucht, etwas über das Schicksal seiner Freundin Christine herauszufinden. Noch immer quälte ihn sein Gewissen, weil er Deutschland ohne sie verlassen hatte. Im Herbst 1969 konnten ihm seine Privatdetektive, die er in Europa beschäftigte, eine erfreuliche Mitteilung machen.
»Wir haben Christine gefunden. Ihr Vater starb 1940. Christine und ihre Mutter schlugen sich mehr schlecht als recht durch und blieben sogar weitgehend unbehelligt. Christine heiratete später den italienischen Kaufmann Giuseppe Bellino, mit dem sie nach London ging. Die beiden bekamen einen Sohn, David. Schon kurz nach der Geburt des Kindes starb Giuseppe Bellino an einer schweren Lungenentzündung. Christine und David blieben allein. Der Junge ist heute neun Jahre alt.«
Nie würde Andreas den Moment vergessen, als er Christine und dem kleinen David zum erstenmal gegenüberstand. Was für ein schöner Junge das Kind war! Schlank und blaß, tiefdunkles Haar – ein Erbe seines italienischen Vaters –, helle Augen, die ein wenig versonnen dreinblickten und dann plötzlich ganz wach sein konnten, wenn das Wort an ihn gerichtet wurde. Er neigte sich zu ihm. »Du bist also David. David Bellino.«
Er nickte. Jeder andere hätte festgestellt, daß David zu ernst war für sein Alter, aber Andreas hatte keinerlei Erfahrung mit Kindern. Er sah nur das unverdorbene, junge Gesicht und hatte das Gefühl, endlich einen Menschen gefunden zu haben, dem er alles schenken konnte, was es an Liebe und Zärtlichkeit in ihm gab.
Andreas und Christine genossen ihr Wiedersehen; sie hatten beide nie aufgehört, in der Vergangenheit zu leben, und miteinander konnten sie all die Erinnerungen auferstehen lassen, in denen sie sich während der vergangenen Jahre allein bewegt hatten. Andreas erfuhr, wie sehr Christine unter dem Tod ihres Vaters und später unter dem ihres Mannes gelitten hatte.
»Mein Vater war alles für mich«, sagte sie, »ich habe ihn vergöttert, und ich werde nie darüber hinwegkommen, daß er so früh in diesem furchtbaren Lager sterben mußte. Giuseppe war ihm ein bißchen ähnlich. Ich habe ihn sehr geliebt. Er war zwanzig Jahre älter als ich, und er gab mir Wärme und Geborgenheit. Ich dachte, ich würde es nicht aushalten, als er plötzlich starb. Ich hätte es auch vielleicht nicht ausgehalten, wenn David nicht gewesen wäre. David ist alles, was mir geblieben ist. Ich liebe dieses Kind so sehr, Andreas, ich kann es dir kaum sagen, was ich für den Jungen empfinde. Ich möchte, daß er einmal ein Mann wird wie es mein Vater war.«
David hörte mit großen Augen zu. Er war auch dabei, als Andreas kurz vor seiner Abreise Christine ins Wohnzimmer bat, sie in einen Sessel drückte, sich ihr gegenübersetzte und ihre beiden Hände nahm. »Christine, ich habe mir etwas überlegt. Ich fände es schön, wenn du meinem Plan zustimmen und ihn nicht aus falschem Stolz ablehnen würdest. Du weißt, ich habe keine Erben. Wenn ich einmal sterbe, muß jemand das Bredow—Imperium übernehmen, und ich habe beschlossen, daß David das sein wird. Nein, unterbrich mich nicht. Ich liebe deinen Sohn. Verstehst du, ich habe kein Kind, und er hat keinen Vater mehr, und deshalb sehe ich ihn ein bißchen...als meinen Sohn an. Er ist ein zauberhafter, kluger, schöner Junge. Für mich verkörpert er die Welt, wie sie sein soll, nachdem der Schrecken vorüber ist. Menschen wie er können uns und alle, die nach uns kommen werden, davor bewahren, je wieder das zu erleben, was wir erlebt haben. Er soll alle Möglichkeiten haben, verstehst du? Ich möchte, daß er die beste Ausbildung bekommt, ich werde das bezahlen. Ich möchte, daß er einmal ein reicher, mächtiger Mann wird, auf dessen Worte man etwas gibt, dem man zuhört und den man respektiert. Christine, ich wünsche es mir so sehr. Ich will an ihm teilhaben, und ich will ihm alles geben, vor allem die Fürsorge, die ich erst zu spät bekommen habe.« Leise fügte er hinzu: »Wir werden so stolz auf ihn sein.«
Er sprach Christine aus der Seele. Sie lächelten einander still an, zwei Menschen, die in den gehegten und gepflegten Bildern ihres Gedächtnisses verwurzelt blieben und ein Kind zum Mittelpunkt ihres Daseins auserkoren hatten.
Sie widmeten sich diesem Kind mit aller Hingabe und einem Übermaß an Liebe.
Andreas lag noch immer auf dem Boden, und draußen zerbarsten die Feuerwerkskörper, und der Ring seines Vaters schnitt ihm in die Wange. Für einen Moment fühlte er sich kräftig genug, noch einen Versuch zu unternehmen, das Telefon zu erreichen, aber seine Finger griffen erneut ins Leere. Während er auf dem Teppich zusammenbrach, überlegte er. Hatte er den Apparat mit sich herumgetragen, so wie früher? Nein, das tat er nie, seitdem er sein Augenlicht verloren hatte. Er bewegte das Telefon nicht mehr vom Fleck, weil er darauf angewiesen war zu wissen, wo es stand. Keine Sekretärin, keine Putzfrau hätte gewagt, es auch nur zu verschieben. Er würde diesen mysteriösen Fall nicht mehr lösen, er wußte es. Er würde sterben.
Wenn Journalisten über ihn schrieben, hatten sie immer sein märchenhaftes Leben, die »Verwirklichung des amerikanischen Traums« beschworen. Danach gefragt, hatte er stets geantwortet: »Es war mein Schicksal. Das ist alles.«
Der Gedanke an das Schicksalhafte im Leben eines Menschen ging ihm auch in seinen letzten Minuten durch den Kopf. Erst jetzt, im nachhinein, verketteten sich einzelne Ereignisse und wurden zu einer Geschichte, deren Ende er gerade erlebte. Ein Attentäter hatte vor sieben Jahren auf ihn geschossen, als er das Plaza verließ; er hatte nicht einmal ihn gemeint, sondern seine Sekretärin, die den Schützen wegen eines anderen Mannes verlassen hatte. Er hatte schlecht gezielt, Andreas stürzte zu Boden, blieb in einer Blutlache liegen. Tagelang kämpften die Ärzte um sein Leben. Er hatte dicke Verbände um den Kopf und konnte nichts sehen, und als sie ihm die Verbände abnahmen, konnte er immer noch nichts sehen. So schonend wie möglich brachte man ihm bei, daß er blind geworden war. Wäre er nicht blind, könnte er jetzt das Telefon sehen.
Und daß er alleine war in jener Neujahrsnacht, hing nur mit dem Flittchen zusammen, das David zu seiner großen Liebe erkoren hatte. Eine blutjunge Beautie aus der Bronx, die sich einen zweifelhaften Ruhm dadurch erworben hatte, daß sie nackt durch den »Hustler« getanzt war. Andreas hatte sie natürlich nicht gesehen, aber er hatte ihre Stimme gehört, ihre Aura gespürt.
»Sie liebt dich nicht, David. Glaub mir das doch. Sie will dein Geld, sie will das gute Leben, das sie an deiner Seite haben kann. Sie nutzt dich nur aus!« Er hätte genausogut Felsen predigen können. Sein letzter Versuch hatte diese Nacht sein sollen. Er schickte das Personal fort, ließ ein kaltes Buffet aus einem Restaurant kommen, stellte den Champagner kalt, bat David, eine Schallplatte aufzulegen. Eine Weile, während des Essens, plauderten sie nur über Nebensächlichkeiten, dann brachte Andreas vorsichtig das Gespräch auf Laura Hart. David ließ ihn kaum ausreden. Er explodierte sofort: »Kein Wort gegen sie, Andreas! Kein einziges Wort!«
»David, wenn du nur begreifen wolltest, daß ich dein Bestes will. Diese Frau ist nichts für dich. Du solltest das erkennen, ehe es zu spät ist!«
»Du lehnst sie nur ab, weil sie kein Geld hat und ihre Mutter am Alkohol gestorben ist!«
»Das ist nicht wahr. Ich lehne sie nicht einmal ab, weil sie diese... Nacktfotos gemacht hat, obwohl ich so etwas nicht mag. Ich lehne sie ab, weil ich ihre Unehrlichkeit spüre. Sie liebt dich nicht, David, und wenn sie es hundertmal am Tag beteuert. Vertrau mir. Wir Blinden entwickeln oft die Fähigkeit, Schwingungen wahrzunehmen, die den Sehenden verborgen bleiben. Es ist fast greifbar für mich, daß sie dir ihre Gefühle nur vorspielt.« Andreas schwieg abwartend. Er konnte hören, daß David aufstand, fühlen, daß er wütend war. »Ich hatte geglaubt, wir machen uns ein gemütliches Silvester, Andreas. Aber wenn du streiten willst, dann tu das für dich allein. Ich werde zu Laura gehen.«
»David! Geh nicht fort! Laß uns reden! Laß uns...«
Die Tür fiel ins Schloß. Andreas blieb allein zurück.
I.
Buch
New York, November 1989
Obwohl David wie an jedem Abend eine Schlaftablette genommen hatte, wachte er bereits um drei Uhr morgens auf und wälzte sich ruhelos hin und her. Schließlich wurde auch Laura wach.
»Was ist denn? Kannst du wieder nicht schlafen?«
»Nein. Aber kümmere dich nicht um mich. Ich gehe rüber in mein Arbeitszimmer.«
»Du solltest einen Arzt aufsuchen, David. Es gibt ja kaum noch eine Nacht, in der du durchschläfst!«
»Ich war beim Arzt. Er hat mir diese Tabletten verschrieben, aber sie helfen nicht richtig. Wahrscheinlich brauche ich etwas Stärkeres. Aber mach dir keine Sorgen.« Er schob die Bettdecke zurück und stand auf. Im Dunkeln konnte er Lauras Gesicht nicht sehen, daher bemerkte er auch nicht ihre Feindseligkeit.
Ich mache mir bestimmt keine Sorgen, dachte sie.
Er ging in sein Arbeitszimmer, Andreas’ einstiges Arbeitszimmer, das er nach dessen Tod vor nunmehr beinahe einem Jahr völlig neu hatte einrichten lassen. Nur der Schreibtisch am Fenster war geblieben. Darauf stand eine gerahmte Fotografie von Andreas.
David setzte sich. Er war müde und er fror. Die Tabletten, die er inzwischen in rauhen Mengen schluckte, hatten eine seltsame Wirkung auf ihn; sie machten ihn schläfrig, nahmen ihm aber nichts von seiner Unruhe, er hätte hundert Jahre schlafen mögen, aber zugleich schlug ihm das Herz bis zum Hals.
»Ein Scheißzeug«, murmelte er, »Tabletten...sie machen einen immer kränker!«
Er war ein gutaussehender Mann, sehr groß, dunkelhaarig, mit schmalen, hellen Augen. Den Frauen fielen zuerst immer seine schönen Hände und seine breiten Schultern auf. Er war ein Mann, der um seine Wirkung auf Frauen wußte und sie gelegentlich nutzte. Jetzt aber, als er da übernächtigt am Schreibtisch kauerte, fühlte er sich eher miserabel. Seine Finger zitterten leicht, als er eine Schublade aufzog und die Pistole herausnahm, die zuoberst auf einem Berg gebündelter Briefe lag. Vorsichtig strich er über das schwarzglänzende Metall. Eine Spur Ruhe kehrte zurück.
Seit Andreas’ Tod konnte er nicht mehr schlafen. Seit er an jenem Neujahrsmorgen in die Wohnung zurückgekehrt war und ihn tot vor dem Schreibtisch gefunden hatte, schien ihm sein Leben aus der Bahn geraten zu sein. Beruhigungspillen wurden auf einmal seine ständigen Begleiter, retteten ihn über die Stunden hinweg, in denen ihn Schuldgefühle und Ängste peinigten. In denen er wieder und wieder die letzte Szene der Silvesternacht vor sich sah:
»Ich werde zu Laura gehen!« hatte er gesagt. Sein Blick war gleichzeitig auf den Schreibtisch gefallen, auf den Telefonapparat. Andreas kannte Lauras Telefonnummer; Laura wohnte damals in einem kleinen Appartement über dem Hudson, das David ihr bezahlte.
Und du wirst mich dort nicht stören, dachte David, nicht noch einmal!
Andreas hatte einige Male bei Laura angerufen, wenn er wußte, daß sich David bei ihr aufhielt. Es hatte ein paar unerfreuliche Szenen gegeben. In dieser Nacht wollte David sich nicht stören lassen.
Der Teppich verschluckte seine Schritte, als er zum Schreibtisch ging; außerdem spielte noch immer der Plattenspieler. Ein Handgriff, und er hatte das Telefon fort vom Schreibtisch auf den Aktenwagen in der Ecke gestellt. Nicht ausgeschlossen, daß Andreas es dort fand, aber zumindest würde er eine ganze Weile suchen müssen.
»David, geh nicht fort! Laß uns reden! Laß uns...«
David verließ das Zimmer und warf die Tür hinter sich zu. Draußen atmete er tief durch. Manchmal wünschte er den alten Mann zum Teufel. Warum nur glaubten Menschen jenseits der Fünfzig immer, sie könnten sich ungefragt in alles einmischen, was sie nichts anging?
Er erinnerte sich, als sei es gestern gewesen: Durch einen ruhigen Morgen voller Kälte und Schnee war er nach Hause gefahren. Er hatte den Wagen selber gesteuert, sich in das Polster zurückgelehnt. Er würde sich bei Andreas entschuldigen, weil er so unbeherrscht reagiert hatte, und dann konnten sie vielleicht in aller Ruhe über das Problem »Laura« reden. Womöglich gab Andreas seine Vorurteile auf – Vorurteile, dachte David heute oft bitter. Mehr und mehr gelangte er inzwischen zu der Ansicht, daß Andreas recht gehabt hatte. Aber damals war er überzeugt gewesen, daß Laura ihn liebte. Es gefiel ihm, wie sie lachte, redete, gestikulierte, wie sie mit geradezu leidenschaftlichem Gesichtsausdruck Champagner trank, wie sie durch ein Zimmer ging oder sich zum Fenster hinauslehnte und Schneeflocken auf ihrem Gesicht zerschmelzen ließ. Er mochte es auch, wenn der Ausdruck ihrer Augen plötzlich von Fröhlichkeit in Melancholie wechselte und eine wehmütige Nachdenklichkeit auf ihren Zügen erschien. Nie konnte sie das kleine, blasse, hungrige Mädchen aus der Bronx verleugnen, das sie einmal gewesen war, auch dann nicht, wenn sie ein Kostüm von Ungaro oder einen Pelz von Fendi trug. In ihrem Gedächtnis existierten Kälte und Armut, Angst und hundertfach erlittene Gewalt. Manchmal schmiegte sie sich an ihn, dann kam es ihm vor, als sei sie ein kleines Tier, das sich im Fell seiner Mutter verkriecht. Den Kopf an seiner Brust vergraben, flüsterte sie: »Ich will nie wieder arm sein, David. Nie wieder. Ich habe solche Angst, daß ich eines Morgens aufwache, und ich bin wieder in dem verfallenen Haus in der Bronx, mein besoffener Vater schnarcht nebenan, und Mutter ist nicht heimgekommen, ich laufe wieder durch die Straßen und suche nach ihr ...«
»Keine Angst, Laura. Ich beschütze dich. Du gehörst zu mir.«
»Ich weiß, David. Aber manchmal habe ich so schreckliche Träume, und ich habe Angst, wenn es dunkel wird oder wenn viele Menschen um mich sind ...«
»Du sollst dich nicht fürchten, solange ich bei dir bin, Laura.« Er hielt sie gern in den Armen und tröstete sie, und er hatte es auch in der Silvesternacht getan, als plötzlich gegen Morgen ihre Zukunftsangst wieder wie eine hohe, schwarze Mauer vor ihr aufgestiegen war. Er liebte die Rolle des Beschützers, weil sie ihm Macht verlieh, aber er hatte wenig psychologisches Einfühlungsvermögen und merkte nicht, daß er zwiespältige Gefühle in Laura auslöste: Sie hing an ihm, weil er der erste Mann war, der ihr Geborgenheit gab, und sie haßte ihn zugleich, weil er die einzige dünne Wand darstellte, die sie von ihrem früheren Leben trennte, und weil er sie deshalb vollkommen in der Hand hatte. Daß er sie aufgewühlt und elend zurückgelassen hatte, war ihm nicht im mindesten bewußt, als er durch den verschneiten Neujahrsmorgen zu seiner und Andreas’ Wohnung zurückfuhr. Er glaubte Laura in derselben guten Stimmung, in der er sich selber befand. Später würde sie einmal über ihn sagen: »Er war auf geradezu sensationelle Weise unsensibel.«
Er begriff sofort, daß Andreas tot war, als er ihn vor dem Schreibtisch liegen sah, und er begriff auch schon in der nächsten Sekunde, wie der Gang der Handlung gewesen sein mußte. Das Telefon! Andreas hatte in seinen letzten Minuten versucht, das Telefon zu erreichen.
David wußte nicht, wie lange er in dem Zimmer gestanden und jeden Gegenstand, jedes Möbelstück in sich aufgenommen hatte. Jede Einzelheit brannte sich für immer in sein Gedächtnis: Der Tisch mit dem kalten Buffet vom Abend, Erbrochenes auf dem Teppich, angeklebte Speisereste auf den Tellern, wenig appetitlich anzusehen im fahlen Wintermorgenlicht, halbvolle Weingläser. Auf dem Plattenspieler lag bewegungslos die Platte, die sie gehört hatten, kalter Zigarettenrauch hing zwischen den Wänden. Auf dem Weg zum Schreibtisch mußte Andreas einen Hausschuh verloren haben; er lag mitten auf dem Teppich. Im beleuchteten Aquarium auf dem Regal jagten sich pfeilschnell ein paar Fische.
David zuckte zusammen, als plötzlich das Telefon schrillte. Mit zitternden Händen nahm er den Hörer ab. »Ja bitte?«
»Mr. Bredow?« Das war der Portier. David räusperte sich.
»Nein. Hier ist David Bellino.«
»Ah, Mr. Bellino! Guten Morgen. Die Leute vom Restaurant sind hier und möchten das Geschirr wieder abholen. Kann ich sie hinaufschicken?«
»Es ist... es ist leider etwas Furchtbares passiert...,‹
»Mr. Bellino? Sie klingen ja ganz merkwürdig. Was ist denn los?«
»Als ich eben nach Hause kam, fand ich meinen Onkel vor seinem Schreibtisch liegen. Er...ist tot ...«
Diese Worte hingen bis heute im Raum. Und die Erinnerungen. Die Erinnerung vor allem daran, wie er, noch ehe der Arzt und die Polizei eintrafen, das Telefon an seinen alten Platz gestellt hatte. Nachher dachten alle, Andreas habe nicht mehr die Kraft gefunden, den Hörer abzunehmen. Niemand ging der Sache weiter nach. Über Andreas’ Tod wurde in allen Zeitungen berichtet, aber dann war alles rasch wieder vergessen. David, der Erbe, rückte in den Mittelpunkt der New Yorker Gesellschaft, er lieferte nun den Stoff für die Gazetten, seine Liaison mit Laura Hart gab den farbigen Hintergrund für Klatsch und Tratsch. Kein Mensch machte ihm einen Vorwurf, obwohl man wußte, daß er in der Silvesternacht Streit mit Andreas gehabt und ihn allein gelassen hatte. Wie hätte er ahnen sollen, daß Bredow gerade in dieser Nacht einen Infarkt erleiden würde?
David dachte viel nach über Andreas, jetzt, wo er tot war, sehr viel mehr als früher. Er hatte den alten Mann gemocht, genauer gesagt: Er hatte keinen Grund gefunden, ihn nicht zu mögen, und er hatte sich immer geschämt, wenn da doch etwas war, was an ihm nagte, was ihn innerlich opponieren ließ. Andreas war nur nett zu ihm gewesen, auch der Streit um Laura Hart war der Besorgnis entsprungen, und er hatte zweifellos darunter gelitten, in Unfrieden mit seinem Schützling zu leben. David erinnerte sich an die vielen Ferien, die er in New York verbracht hatte: Andreas hatte alles für ihn getan. Er sollte es schön haben, er sollte etwas erleben, er sollte gern wiederkommen wollen. Er hatte dem Jungen eine Menge Zeit gewidmet, ihm die ganze Stadt gezeigt, hatte ihn einmal auch mit nach Los Angeles genommen und einmal nach Colorado zum Skifahren. Daheim hatte David nie gewußt, wo er mit dem Erzählen anfangen sollte. Und dennoch... da war dieses leise Unbehagen. Die Melancholie in Andreas’ Augen war dieselbe, die in den Augen von Davids Mutter stand. Diese Entrücktheit, dieses Festhalten an Vergangenem. Es hatte ihn bei Christine bedrückt, und es bedrückte ihn bei Andreas. Manchmal bekam er ein schlechtes Gewissen, weil er sich freute und lustig war und ihre Traurigkeit nicht teilen konnte. Niemals würde er das Gespräch vergessen, das Andreas mit ihm führte, als er gerade sechzehn geworden war. Weihnachten 1976. David war am 25. Dezember nach New York geflogen. In Andreas’ Penthouse erwartete ihn ein riesengroßer, über und über mit bunten Kugeln geschmückter Tannenbaum, unter dessen ausladenden Zweigen wahre Berge von Geschenken lagen. Andreas bot ihm ein Glas Champagner an. Der Plattenspieler spielte Weihnachtsmusik, es roch nach Kerzenwachs und Tannennadeln. David saß inmitten seiner Geschenke und fühlte sich wohl. Einfach nur richtig wohl.
Er hielt eine Uhr in der Hand, eine wunderschöne Armbanduhr mit schwarzem Zifferblatt und schmalen, goldenen Zeigern. Ein Geschenk von Andreas. Er schaute auf und lächelte. »Danke, Andreas. Die ist wirklich toll! Woher wußtest du, daß ich mir genau eine solche Uhr gewünscht habe?«
»Deine Mutter hat es mir verraten«, erwiderte Andreas. Er betrachtete den Jungen, und irgendwie wurde es David ungemütlich unter seinem Blick. »Ich freue mich, wenn sie dir gefällt, David. Ich freue mich...wenn es dir überhaupt gefällt, hier bei mir zu sein.«
»Du weißt, daß ich immer gerne nach New York komme«, sagte David vorsichtig.
Andreas nickte. »Wenn du in England mit der Schule fertig bist, wirst du ja für immer in Amerika leben. Ich hatte oft Angst, du könntest es dir anders überlegen und plötzlich feststellen, daß du das Land vielleicht nicht magst. Aber du magst es, nicht wahr? Und du... magst auch mich?«
»Natürlich mag ich dich ...«
Andreas nickte langsam. Er blickte nachdenklich in den Flammenschein der Kerzen auf dem Baum. »Weißt du, David, ich bin immer sehr allein gewesen. Schon als Kind. Deine Mutter war der einzige Mensch, der für mich da war. Sonst hatte ich niemanden. Mit dreizehn war ich Vollwaise, aber davor gab es auch niemanden, der sich wirklich um mich gekümmert hätte. Ich habe mich stets danach gesehnt, einmal einen Menschen ganz für mich zu haben. Jemanden, der mich liebt, der mich braucht, der mir vertraut. Jemanden, dem ich etwas bedeute ...«
O Gott, dachte David mit leiser Panik.
Andreas schaute ihn an. »Du weißt, du bist für mich wie ein Sohn, David. Ich werde dir alles geben, was ich habe. Ich freue mich so auf die Zeit, wenn du für immer hier lebst.«
»In New York, meinst du?«
»Hier bei mir. Sieh mal, dieses Penthouse ist für mich allein viel zu groß. Warum ziehst du nicht hier ein? Wir wären dann beide nicht mehr länger allein. Ich meine, ich werde dich bestimmt nicht stören. Du bist dann erwachsen, und natürlich willst du dann auch manchmal für dich sein. Aber wir könnten abends zusammensitzen und miteinander sprechen, wir könnten zusammen frühstücken oder uns in die Sonne setzen. Es würde Spaß machen, über alles zu reden, was uns bewegt und beschäftigt. Es gäbe immer jemanden, der zuhört.« Andreas hatte leidenschaftlich gesprochen, und David sah, daß Tränen in seinen Augen blinkten. Überrascht erkannte er, wie einsam der reiche Mann aus New York war. Die Traurigkeit und Sehnsucht im Gesicht des anderen lähmten ihn.
Verdammt, dachte er, hier mit ihm wohnen!
Er hatte fest damit gerechnet, eine eigene Wohnung in New York zu bekommen. Es müßte auch keine furchtbar feine oder komfortable sein, einfach ein Ort, an den er sich zurückziehen und wo er für sich sein konnte. Die Vorstellung, mit Andreas zu leben, der so entsetzlich gütig, so entsetzlich fürsorglich, so entsetzlich erdrückend war, erschreckte ihn. Aber wie schon früher bei seiner Mutter vermochte er sich nicht zu wehren. In Mums Gegenwart hätte er manchmal schreien mögen, so unerträglich von ihr vereinnahmt hatte er sich oft gefühlt. Als Kind hatte er bei ihr im Bett schlafen müssen, und sie hatte ständig darüber gejammert, daß sie niemanden habe außer ihn, seit sein Vater gestorben sei. Er erinnerte sich gut an das schlechte Gewissen, mit dem er sich gewünscht hatte, er bräuchte nicht immer für Mum dazusein. Wie oft hätte er sonntags mit den anderen Kindern spielen mögen und war statt dessen daheim geblieben, weil er das traurige Gesicht seiner Mutter nicht ertrug.
»Ich werde dann eben allein meinen Kaffee trinken«, sagte sie in solchen Situationen. »Ich hatte mich so auf den Nachmittag mit dir gefreut, David. Aber natürlich, wenn es dir mehr Spaß macht, mit den anderen Kindern zusammenzusein, als mit deiner langweiligen Mutter ...«
»Ich bin viel lieber bei dir, Mum«, sagte er dann, teils wütend, teils resigniert, und schließlich beschämt, weil er sie offenbar nicht genug liebte, um wirklich gern mit ihr zusammenzusein. »Ich bleibe hier!«
Jetzt sah ihn Andreas mit demselben Ausdruck in den Augen an, den Mum immer gehabt hatte, und wieder überkam David das Gefühl von Wehrlosigkeit und hilflosem Ärger. Wenn er jetzt »nein« sagte, wenn er jetzt erklärte, daß er lieber allein sein würde, das wäre ungefähr so, wie wenn man ein unschuldiges Kind schlägt, das es nur gut gemeint hat. Andreas meinte alles nur gut. Er war die verkörperte Güte selbst, und es war die wohlvertraute Scham, die David empfand, weil er jetzt am liebsten hätte schreien mögen.
»Das ist eine gute Idee, Andreas«, sagte er höflich. »Natürlich wohne ich gern bei dir.«
Bei sich dachte er: Verfluchte Scheiße!
Heute, nachdem Andreas tot war, war er froh, daß er nie die Beherrschung verloren hatte. Es hätte den alten Mann bekümmert und verstört, und er hätte es nicht verstanden.
Gedankenverloren drehte David nun an dem breiten, goldenen Ring der Bredows, den Andreas ihm immer versprochen hatte und den er dem Toten damals am Neujahrsmorgen vom Finger gezogen hatte. Erleichtert ging es ihm durch den Kopf: Wenigstens war ich nicht undankbar. Ich habe ihm nicht weh getan!
Er zog die Schreibtischschublade noch einmal auf und entnahm ihr ein mit einem Gummiband zusammengeschnürtes Bündel Briefe. Sie trugen keinen Absender, waren mit Maschine geschrieben und enthielten wüste Beschimpfungen und Drohungen. Morddrohungen.
»Fühl dich nicht zu sicher, du Schwein. Dein Mörder ist schon ganz nah!« »Du wirst für deine Sünden bezahlen, David Bellino, und der Tag der Rache rückt immer näher.«
David Bellino war zeitlebens ein hochgradiger Hypochonder gewesen. Mußte er niesen, schluckte er sogleich ein schweres Medikament gegen Grippe. Bekam er mehrmals hintereinander Schluckauf, wurde er von der Vorstellung besessen, er habe Speiseröhrenkrebs, und suchte einen Spezialisten auf. Wenn er in der Zeitung auf die Schilderung einer Krankheit stieß, spürte er wenige Minuten später sämtliche Symptome. Der Gedanke an Schmerzen und Siechtum bereitete ihm tiefes Grauen, das Bewußtsein seiner eigenen Sterblichkeit machte ihm schwer zu schaffen. Im wesentlichen beschäftigte er sich damit, einem frühen Tod vorzubeugen.
Mancher hätte die Briefe, die seit einem Vierteljahr in zweiwöchentlichen Abständen eintrafen, als Unsinn abgetan. Ein Mann in Davids Position hatte selbstverständlich immer Feinde, aber keineswegs waren die ständig drauf und dran, tatsächlich zur Waffe zu greifen und das Objekt ihrer Aggression vom Leben zum Tod zu befördern. David hatte die Briefe von einem Psychologen analysieren lassen, und der hatte gemeint, der Schreiber finde eine tiefe Befriedigung im Verfassen solcher Schriften, sei aber keineswegs entschlossen, die Drohungen in die Tat umzusetzen. »Der Schreiber ist intelligent und sensibel. Ich würde ihn nicht als gewalttätig einschätzen.«
David empfand diese Aussage zwar als beruhigend, beschloß aber, sich nicht zu sehr darauf zu verlassen. Er war dabei gewesen, als man auf Andreas geschossen hatte, eine Szene, die sich tief in sein Gedächtnis eingegraben hatte, und jedesmal, wenn er ein Gebäude verließ und auf die Straße trat, erwartete er halb und halb, daß ihm dasselbe widerfuhr. Die Angst wurde zu seinem schlimmsten Feind, sie tyrannisierte ihn, wo er ging und stand. Die Briefe machten ihn fertig, ob sie nun ernst gemeint waren oder nicht. Er mußte herausfinden, wer sie schrieb, er mußte das abstellen, er würde sonst noch verrückt werden.
Natürlich kamen eine Menge Leute in Frage. Geschäftspartner, denen er zuletzt zugesetzt hatte, Angestellte, die entlassen worden waren, politische Gruppierungen, Umweltschützer, die mit irgend etwas, was Bredow Industries tat, nicht einverstanden waren. Er mußte das nach und nach abchecken. Und er würde jetzt damit beginnen. Er nahm einen Bogen Papier und schrieb in ordentlichen Druckbuchstaben vier Namen darauf:
Mary Gordon Steven Marlowe Natalie Quint Gina Artany
Vier Namen, vier Menschen, vier Schicksale. Vier alte Freunde von ihm. Er wußte nicht mehr, wie oft er die Namen notiert, wie oft er an die Personen dahinter gedacht hatte. Aber je öfter er nachdachte, desto wahrscheinlicher schien es ihm, daß es einer von ihnen war, der ihn rachsüchtig zu zerrütten suchte.
Jeder hatte ein Motiv. Jeder konnte es sein.
Er hatte seine Freunde zu sich eingeladen, und zu seiner Überraschung hatten alle zugesagt. Vom 27. 12. 1989 bis zum 1.1.1990 sollten sie seine Gäste sein, und das, nachdem sie einander seit Jahren nicht mehr gesehen hatten. Nachdem sie ihn jahrelang nicht hatten sehen wollen.
David stand auf und trat dicht ans Fenster. Noch kein Licht kündigte den Morgen an. November... dieser düstere, graue, kalte Monat. Nebel überall, und hinter dem Nebel unbekannte Gefahren.
»Nebel. Nebel, Nebel, die ganze verdammte Zeit. Man sieht nicht, wohin man geht, nichts«, hieß es in O’Neills »Anna Christie«. Das genau waren David Bellinos Empfindungen.
David Bellino war keineswegs ein glücklicher Mensch, und daher ging er regelmäßig zum Psychotherapeuten, genauer gesagt: Er ging zu sehr vielen Therapeuten, denn seine Geduld war nicht groß, und wenn ihm nicht sofort geholfen wurde, beschloß er, jemand anderen aufzusuchen.
»Es ist eine langwierige, mühevolle Aufgabe, in die Psyche eines Menschen einzutauchen«, hatte ihm einer seiner Ärzte einmal erklärt. »Dinge, die Sie als Kind erlebt und vollkommen verdrängt haben, müssen erforscht und ganz vorsichtig aufgedeckt werden. Wer hier ungeduldig ist, schadet mehr als daß er nützt!«
»Meine Kindheit war in Ordnung, Doktor!«
Der Arzt hatte nachsichtig gelächelt. »Wenn Sie das so felsenfest glauben, ist es der beste Beweis dafür, daß da etwas ganz und gar nicht in Ordnung war.«
David wechselte den Arzt.
Er wußte nicht einmal genau, was er eigentlich wollte. Schließlich war er gesund. Aber dann – wenn er sich gerade entschlossen hatte, auf die Hilfe eines Seelendoktors zu verzichten – passierte wieder irgend etwas: Er wurde hysterisch, weil er sich einbildete, seine Knochen weichten auf. Oder er hatte Träume, in denen sich grauenvolle Gewaltszenen abspielten. Oder seine Migräneanfälle hielten ihn tagelang von der Arbeit ab. Dann saß er doch plötzlich wieder auf einem Sofa.
»Warum heißen Sie David?« fragte der Arzt. »Ein jüdischer Name!«
»Meine Mutter hat das so bestimmt... sie ist Deutsche, sie war ein Kind während der Nazizeit. Zur Erinnerung an die Millionen ermordeter jüdischer Kinder wollte sie ihrem Sohn einen jüdischen Namen geben.«
»Sie selber ist nicht jüdisch?«
»Nein. Aber ihr Vater starb im KZ.«
Zeitlebens hatte das Bild ihres Vaters einen Ehrenplatz im Wohnzimmer gehabt, daran konnte sich David erinnern – es war vielleicht überhaupt die erste Erinnerung seines Lebens. Eine Art Altar hatte Mum errichtet, Kerzen, Blumen, eine Madonna. Mum war katholisch. In England gab es keine katholischen Kirchen, aber sie hielt an ihrem Glauben fest. David hatte einmal nach der Madonna greifen und mit ihr spielen wollen, er hielt sie für eine schöne Puppe mit einem blauen Kleid und einem roten Schleier auf dem Kopf. Mum hatte sie ihm entrissen und ihm rechts und links auf die Wangen gehauen. »Tu das nie wieder, David!«
Dann, als er brüllend und schreiend auf dem Teppich saß – ihn hatte noch nie jemand geschlagen, und er konnte es nicht fassen – hatte ihn Mum in die Arme genommen. Sie weinte auch.
»David, Liebling, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Du mußt verstehen... mein Vater...David, ich will dir von ihm erzählen, und du wirst verstehen ...«
»Hat Ihre Mutter oft von ihrem Vater gesprochen?« fragte der Arzt, als könnte er Gedanken lesen.
»Ja.«
»Was hat sie erzählt?«
»Ich...weiß nicht mehr genau ...«
»Sie erinnern sich an gar nichts?«
Er erinnerte sich an seine Träume. Sie waren angefüllt mit Geschichten seiner Mutter, aber oftmals hatten sie sich mit Märchen vermischt, die man ihm erzählt hatte, oder mit Bildern, die im Fernsehen zu sehen gewesen waren. Wenn er aufwachte, panisch nach dem Lichtschalter suchte, um sich zu vergewissern, daß er in Sicherheit war, wußte er gar nicht mehr, woraus sich die Schreckensbilder im einzelnen zusammengesetzt hatten.
»Ihre Mutter hat Sie immer sehr geliebt?« fragte der Arzt behutsam.
David nickte. »Ja. Ich war der einzige Mensch, den sie hatte. Sie hatte ihren Vater und ihren Mann verloren, und alles, was sie an Liebe hatte, gab sie mir.«
»Und dann war da noch jener Mann in New York, der Sie zu seinem Erben bestimmt hatte. Verbrachten Sie sehr viel Zeit mit ihm?«
»Ich war in beinahe allen Ferien drüben. Zwischendurch besuchte er uns.«
»Und er hat Sie auch sehr geliebt?«
»Ja, hat er.« David wurde ungeduldig, er sah nicht, worauf das hinauslaufen sollte. »Er hatte ja auch niemanden sonst. Hören Sie, Doktor, ich ...«
»Das ist ein durchaus wichtiger Punkt, Mr. Bellino. Hatten Sie manchmal das Gefühl, erdrückt zu werden? Sich wehren zu wollen, ohne zu wissen, wogegen?«
Er hatte eine empfindliche Stelle angekratzt. David verspürte das würgende Gefühl im Hals, das ihn so oft schon gepeinigt hatte.
»Ach...glaubte zu ersticken, Doktor. Ja, das kam immer wieder. Ich war voller Wut, aber ich konnte sie gegen niemanden richten. Sie waren so gut zu mir. Sie wollten nur das Beste. Ich sollte das Beste bekommen und der Beste sein. Manchmal wollte ich schreien, aber ich schrie nie. Ich hatte Angst vor dem Entsetzen, mit dem sie mich anschauen würden.«
»Ihr Problem, Mr. Bellino, beruht meiner Ansicht nach nicht einmal so sehr auf den Dingen, die man Ihnen erzählt hat, auf den Schrecken, mit denen sich Ihre Mutter herumschlug und die sie zweifellos auch auf Sie übertrug. Das ist eher die Ursache, die Wurzel, für eine ganz andere Entwicklung. Ihre Mutter und auch Mr. Bredow haben Sie in Liebe – und in Ansprüchen, die sie an Sie stellten! – förmlich... ja, wie Sie es nannten, erstickt. Sie waren soviel Liebe gegenüber ohnmächtig. Sie haben nicht die Aggressionen ausleben können, die ein junger Mensch gerade in den Entwicklungsjahren ausleben muß. Und jetzt kauen Sie so verzweifelt darauf herum.« Der Arzt seufzte. »Wenn Sie an sich als Kind denken, und Sie müßten dieses Kind, das Sie waren, mit ein paar Worten beschreiben – welche Attribute fallen Ihnen da ein?«
New York, 28. 12 .1989
1
Gina Artany liebte den Luxus. Da sie in den vergangenen Jahren ständig hatte sparen müssen, verfiel sie nun in einem von Davids Gästezimmern in einen wahren Verschwendungsrausch. Sie knipste alle Lichter an, füllte die Badewanne bis zum Rand mit Wasser und kippte so viel von einem teuren Parfum, das sie in einem Badezimmerschrank gefunden hatte, hinein, daß der Duft das ganze Zimmer ausfüllte. Sie öffnete zwei Flaschen Champagner, nur um einmal wieder festzustellen, daß sie wirklich verschieden schmeckten. Dann riß sie weit das Fenster auf und drehte gleichzeitig die Heizung bis zum Anschlag, denn diese Mischung aus frischer Luft und Wärme schien ihr das Höchste an Luxus. Sie konnte Charles, ihren Mann, hören, wie er mit ängstlicher Stimme sagte: »Wenn du das Fenster aufmachst, Liebling, dreh doch bitte die Heizung runter. Das wird sonst zu teuer, du weißt doch ...«
Lord Charles Artany. Der Mann, der ihr den Titel »Lady« gegeben hatte. Der Mann, mit dem sie auf einem ungemütlichen, zugigen Landsitz im Norden Englands hauste und mit dem sie in den finanziellen Bankrott gesegelt war. Sie trat, gehüllt in einen flauschigen, weißen Bademantel, vor den Spiegel und musterte ihr Gesicht, das Gesicht einer neunundzwanzigjährigen Frau, die praktisch keinen Pence auf dieser Welt mehr besaß und häufiger mit dem Gerichtsvollzieher kommunizierte als mit irgend jemandem sonst.
»Ich bin die Frau, die John Eastley geliebt und verloren hat«, sagte sie laut und betrachtete genau ihr Mienenspiel, während sie Johns Namen aussprach. Immer wenn Charles in der Nähe gewesen war, waren ihr die Tränen gekommen, sobald sie diesen Satz sagte; nun, da der Atlantik sie trennte, überfiel sie die Traurigkeit nicht mehr so heftig. Einem anderen Mann Liebe vorspielen zu müssen, wo doch all ihre Liebe nur John gehörte, war vielleicht das Schlimmste. Sie erduldete Charles’ Zärtlichkeit nur widerwillig, gab sie noch viel widerwilliger zurück und hatte das Gefühl, als würden ihre Wunden nicht einmal anfangen zu heilen. Zum erstenmal verebbte jetzt der Schmerz ein wenig, vielleicht auch deshalb, weil sie es sich nicht leisten konnte, der Traurigkeit allzu großen Raum einzuräumen. Sie mußte ihre fünf Sinne zusammenhalten.
Sie zog den Bademantel aus, stellte fest, daß ihr keine Zeit mehr zum Baden blieb, schlüpfte in Wäsche und Strümpfe und griff nach dem Kleid, das sie zum Dinner tragen wollte. Es stammte noch aus ihren guten Zeiten mit John, war aus schwarzer Seide und hatte einen tiefen, runden Ausschnitt. Mit größter Mühe hatte Gina den Rock kürzer genäht, um ihn der herrschenden Mode anzupassen. Sie legte ein Smaragdcollier um den Hals und bürstete ihre langen, dunklen Haare. Der Spiegel warf ihr das Bild einer ausgesprochen teuer gekleideten Frau zurück. Eine erheiternde Vorstellung, wenn sie bedachte, wie verzweifelt ihre Lage war: hätte David seiner Einladung nicht gleich ein Flugticket beigelegt, wäre es ihr nicht einmal möglich gewesen, die Reise zu bezahlen.
Sie hatte David in ihrem ganzen Leben nie wiedersehen wollen, denn der Haß auf ihn war so frisch und heftig wie eh und je, aber er war ein verdammt reicher Mann, und sie brauchte so furchtbar dringend Geld. Hunderttausend Dollar würden ihr aus dem Gröbsten heraushelfen, und die hunderttausend Dollar sollte David ihr geben. Nicht zuviel für ein verpfuschtes Leben, im Gegenteil, er kam billig weg, viel zu billig.
Hängen und vierteilen sollte man ihn, dachte Gina, er hätte es weiß Gott verdient!
Sie straffte ihre Schultern. Ihr Selbstvertrauen, von dem sie in der letzten Zeit manchmal geglaubt hatte, sie habe es mit all den anderen Sachen ins Pfandhaus getragen, strömte in sie zurück. Der Lampenschein ließ ihr dunkelbraunes Haar wie Seide glänzen und machte aus ihren Augen hellen Bernstein. Sie war eine attraktive und sehr starke Frau, und sie war schon mit schwierigeren Situationen als dieser fertig geworden.
Ein Blick auf die Uhr zeigte ihr, daß sie noch etwas Zeit hatte bis zum Dinner. Sie beschloß, sich vom Hausmädchen noch eine Flasche Champagner bringen zu lassen. Die dritte heute, und von keiner Flasche hatte sie mehr als ein Glas getrunken. Sie wußte, David würde das unverschämt finden, aber sie wußte auch, daß ihm Unverschämtheit stets imponiert hatte.
Den ganzen Tag über hatte Natalie Quint versucht, eine telefonische Verbindung zu ihrer Wohnung in Paris herzustellen. Am späten Nachmittag erst, 23 Uhr Pariser Zeit, hatte sich ihre Freundin Claudine gemeldet. »Combe«, hatte es fröhlich und ein bißchen abgehetzt aus dem Hörer geklungen.
»Claudine! Endlich! Wo um Himmels willen bist du gewesen? Ich versuche dich seit Stunden zu erreichen!«
»Nat? Die Verbindung ist so schlecht, ich verstehe dich ein bißchen schwer. Wie ist es in New York?«
»Ganz o. k. Wo warst du?«
»Erst einkaufen, es war überhaupt nichts Eßbares mehr in der Wohnung. Und dann bei Marguerite Fabre draußen in Versailles. Sie wollte mich unbedingt sprechen, weil sie ein Drehbuch geschrieben hat und meint, nur ich könnte die weibliche Hauptrolle in dem Film spielen. Nach allem, was sie erzählt hat, muß es wirklich eine tolle Geschichte sein.«
»Ich dachte, du wolltest nicht mehr filmen«, sagte Natalie alarmiert. Sie klemmte den Telefonhörer zwischen Kinn und Schulter und zündete sich eine Zigarette an. In den Stunden, in denen sie vergeblich versucht hatte, Claudine zu erreichen, hatte ihre Nervosität einen bedenklichen Grad angenommen. Mit scharfer Stimme wiederholte sie: »Du wolltest doch nicht mehr filmen? Claudine?«
»Natürlich nicht, Liebling.« Das kam rasch und ein wenig ängstlich. »Ich dachte ja nur, es schadet nichts, Marguerite einmal wiederzusehen. Und es freut sie doch so, wenn man sich für ihr Drehbuch interessiert.«
»Und andere Interessenten als dich gibt es nicht?«
»Natürlich...aber ich kenne sie schon so lange. Und was hätte ich denn sagen sollen? Ich kann doch nicht immerzu keine Zeit haben!«
»Du darfst natürlich tun, was du willst«, sagte Natalie steif.
Sofort fing Claudine an, sich zu entschuldigen. »Natalie, ich wollte dich nicht ärgern. Ich habe Marguerite auch gleich gesagt, daß ich eigentlich nicht mehr filmen wollte ...«
»Was heißt ›eigentlich‹?«
»Eigentlich... ach, das habe ich nur so gesagt. Ich werde nicht mehr filmen, Nat, das ist doch klar. Sei mir nicht böse, bitte!« Claudines Stimme klang kindlich und hell.
Nat seufzte. »Tut mir leid, Claudine. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Das Übliche wahrscheinlich.«
»Hast du deine Tabletten dabei?«