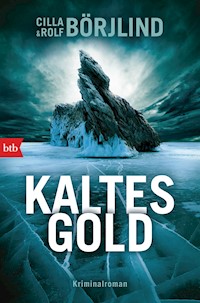10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Rönning/Stilton-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein weiterer Fall für das schwedische Ermittlerteam Olivia Rönning und Tom Stilton
Am Stockholmer Hauptbahnhof herrscht Chaos. Ein Mädchen im Strom der Asylsuchenden schlägt sich ganz alleine durch. Aus Angst vor den Behörden lebt sie mehr schlecht als recht auf den Straßen Stockholms – bis sie auf die Obdachlose Muriel trifft, die sich ihrer annimmt. Gemeinsam suchen sie Zuflucht in einer einsamen Hütte auf dem Land. Aber ist es in den Wäldern Smalands wirklich sicherer als auf den Straßen von Stockholm? Zur selben Zeit versucht der frühere Kriminalkommissar – und frühere Obdachlose – Tom Stilton seinen Polizeikollegen zu beweisen, dass er wieder ganz auf der Höhe ist. Er soll dabei helfen, den grausamen Tod eines Jungen aufzuklären, der vergraben im Wald gefunden wurde. Wenig später bittet ihn Muriel um Hilfe, weil sie ihren Schützling in Gefahr glaubt. Haben die Fälle etwa miteinander zu tun? Tom Stilton und Olivia Rönning kommen der Wahrheit nur langsam auf die Spur ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 687
Ähnliche
Zum Buch
Am Stockholmer Hauptbahnhof herrscht Chaos. Ein Mädchen im Strom der Asylsuchenden schlägt sich ganz alleine durch. Aus Angst vor den Behörden lebt sie mehr schlecht als recht auf den Straßen Stockholms – bis sie auf die Obdachlose Muriel trifft, die sich ihrer annimmt. Gemeinsam suchen sie Zuflucht in einer einsamen Hütte auf dem Land. Aber ist es in den Wäldern Smålands wirklich sicherer als auf den Straßen von Stockholm? Zur selben Zeit versucht der frühere Kriminalkommissar – und frühere Obdachlose – Tom Stilton seinen Polizeikollegen zu beweisen, dass er wieder ganz auf der Höhe ist. Er soll dabei helfen, den grausamen Tod eines Jungen aufzuklären, der vergraben im Wald gefunden wurde. Wenig später bittet ihn Muriel um Hilfe, weil sie ihren Schützling in Gefahr glaubt. Haben die Fälle etwa miteinander zu tun? Tom Stilton und Olivia Rönning kommen der Wahrheit nur langsam auf die Spur …
Zu den Autoren
Cilla und Rolf Börjlind gelten als Schwedens wichtigste und bekannteste Drehbuchschreiber für Kino und Fernsehen. Sie sind unter anderem verantwortlich für zahlreiche Martin-Beck-Folgen sowie für die viel gepriesene Arne-Dahl-Serie. Ihr Markenzeichen sind starke Charaktere und eine stringente Handlung. Die Serie um die junge Polizistin Olivia Rönning und den ehemaligen Kriminalkommissar Tom Stilton, der zum Obdachlosen wurde, wurde ebenfalls verfilmt und wird Anfang 2017 auch im deutschen Fernsehen zu sehen sein.
Cilla & Rolf Börjlind
Schlaflied
Kriminalroman
Aus dem Schwedischen von Christel Hildebrandt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die schwedische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Sov du lilla videung« bei Norstedts, Stockholm.
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Cilla & Rolf Börjlind
by Agreement with Grand Agency
Copyright © 2017 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Semper Smile, München
Covermotiv: nejronphoto/Shutterstock; lane.V.ericson/Shutterstock
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-20133-3 V008
www.btb-verlag.de
… denn es ist noch Winter.
Z. Topelius
Beim letzten Mal stand sie zu nah am Geschehen und bekam ein paar hässliche Blutspritzer auf ihre weiße Leinenhose. Deshalb suchte sie sich in dieser Nacht einen Platz weiter hinten. Die Düfte fremder Pflanzen und Gewürze hingen schwer in der Luft, aber da war noch ein anderer Geruch, oder besser gesagt: Gerüche. Blut, Terpentin, Zigarettenrauch, säuerlicher Schweiß. Inzwischen hatte sie sich daran gewöhnt. Der Raum war klein, und die einzige Luftzufuhr, die es gab, war die Öffnung mit der schmalen Holztür zum Hof, doch sie war geschlossen. Fast fünfzig Personen hatten sich in den engen Raum gedrängt und um die Arena verteilt, und jede einzelne verbreitete ihre persönliche Duftnote. Kein Wunder, dass die Luft so schlecht war.
Sie selbst roch leicht nach Kernseife.
Die Männer in dem Raum, außer ihr waren nur Männer anwesend, trugen alle fast identische Klamotten. Schmutzig gelbe Hosen und ein weißes, dünnes Hemd, um den Hals der Älteren das eine oder andere rotblaue Tuch. Manche hatten weiße, schmalkrempige Hüte auf, andere hielten Flaschen in den Händen, aus denen sie tranken. Braunen, selbst gebrannten Schnaps. Sie hatte bereits höflich mehrere Trinkangebote der Männer abgelehnt, die in ihrer Nähe standen. Jedes Mal hatten sie ihr zugeblinzelt, sie angelacht und ihre kaputten Zähne entblößt.
Und wieder einen Schluck getrunken.
Sie streckte sich ein wenig. Schon so war sie größer als die meisten im Raum, aber wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte, konnte sie leicht über alle anderen hinwegschauen. Und jetzt sah sie den ersten Kampfhahn. Er hieß Black Killer, laut dem handgeschriebenen Schild, das der Besitzer hochhielt. Ein großer, schwarzer Hahn mit stolzem Kamm und kräftigem roten Einschlag im Federkleid. Er wurde in die runde Arena gesetzt, begleitet von einer Kakophonie an Stimmen, in Sprachen, die zu verstehen sie inzwischen gelernt hatte. Natürlich Tagalog, aber auch so melodiöse Sprachen wie Cebuano und Bikolano.
Jetzt wurde der zweite Hahn auf den Boden gesetzt. Red Alert. Genauso groß, genauso selbstsicher wie der andere, genauso bunt und kampfbereit. Die langen, spitz geschliffenen Sporne am Sprunggelenk blitzten in dem gelben Licht auf. Sie sah, wie rund um die Arena Scheine die Hände wechselten, und wusste, einige würden am Ende dieser Nacht nicht mehr ganz so arm sein und andere würden ihren Kummer in braunem Schnaps ertränken.
Sie selbst hatte auf Red Alert gesetzt.
Eine falsche Entscheidung.
Die beiden Hähne wurden freigelassen, sie umkreisten einander ein paar Sekunden lang, schätzten die Situation ein, hielten Abstand, spreizten ihr Federkleid, um zu imponieren oder abzuschrecken, und dann kam plötzlich der Angriff. Von beiden gleichzeitig. Mit einem Mal war nicht mehr zu unterscheiden, welcher Hahn welcher war, ein stürmisch wirbelnder Federball, verursacht durch schwirrende Sporne, rollte über den Boden und füllte die Luft mit abgerissenen Flügelfedern und Blutspritzern, während das Publikum johlte.
Und dann war es vorbei.
Red Alert lag dicht an der niedrigen Holzkante der Arena auf dem Rücken, der zerfetzte Hahnenkörper zitterte, und eines der Beine schlug gegen die Erde. Der Raum war erfüllt von heiseren Schreien. Was davon Freudenschreie waren und was heftige Flüche, war für sie nicht herauszuhören. Aber an den grinsenden Gesichtern einiger der Männer konnte sie ablesen, auf welchen Hahn sie gesetzt hatten.
Nachdem die kleine Wettkampfarena von einem Sieger und einem Toten geräumt und das Blut mit Kies bedeckt worden war, konnte der nächste Kampf beginnen. An dem hatte sie kein Interesse mehr. Sie war gekommen, um auf Red Alert zu setzen, und sie hatte verloren.
Durch die schmale Holztür ging sie hinaus ins Dunkel. Vor ihr lag eine schmale Gasse mit Lehmboden, die in eine größere Straße mündete, die wiederum zum Muelle Pier in Puerto Galera führte, einen der vielen bunten Küstenorte von Mindoro. Sie holte ein Päckchen Zigaretten und ein Feuerzeug aus der Hosentasche.
»Cosmina.«
Sie drehte sich um. Ein zerfurchter, braun gebrannter Mann mit weißem Hut war ihr gefolgt. In der Hand hielt er den toten Hahn. Er gehörte ihm, Ferdinand. Er war einer der wenigen Einheimischen, die sie hier näher kennengelernt hatte. Das war auch der Grund, warum sie auf seinen Hahn gesetzt hatte.
»Kommst du mit und isst mit uns?«, fragte er.
Cosmina wusste, es war eine Ehre, eingeladen zu werden. Der tote Hahn sollte zubereitet und verzehrt werden, und nur Auserwählte durften an diesem Essen teilnehmen. Die Mahlzeit des Verlierers, wie sie hier genannt wurde. Aber sie mochte um diese Tageszeit nichts essen. Und schon gar nicht ein Tier, das vor ihren Augen gerade eben von einem anderen Tier zerfetzt worden war.
»Danke, Ferdinand, aber ich muss los. Grüße an deine Familie.«
Ferdinand verneigte sich leicht und schaute Cosmina offen an. Die große dunkelhaarige Frau ist sehr schön, hatte seine Frau gesagt, und er war ihrer Meinung.
»Es tut mir leid, dass Red Alert verloren hat«, sagte er.
»Mir auch. Es war ein schöner Hahn. Aber dein Verlust ist größer als meiner.«
Ferdinand verneigte sich noch einmal und ging dann langsam in die Dunkelheit hinein. Sie schaute seinem krummen Rücken hinterher und dem toten Hahn, der in seiner Hand baumelte. Vielleicht hätte ich die Einladung doch annehmen sollen?, überlegte sie. Ihm zuliebe. Sie zündete sich eine Zigarette an und ging in die andere Richtung, um ihr dreirädriges Motorrad zu holen. Sie spürte den lauen Wind vom Meer in die Gasse hineinziehen. Er brachte ein wenig Abkühlung mit sich. Die dünne blaue Bluse klebte ihr am Körper, die Feuchtigkeit und die drückende Hitze waren selbst jetzt, mitten in der Nacht, beschwerlich.
Hahnenkämpfe? Offiziell waren sie verboten, aber die Polizei duldete sie aus einem einzigen Grund: Sie ließ sich nicht gern in den schmalen Gassen von Puerto Galera blicken. Nicht so spät am Abend. Zu dieser Zeit blieben die Polizeibeamten lieber daheim, erschöpft in den Armen ihrer eigenen Frau oder der eines anderen. Das wussten alle. Deshalb fanden die Kämpfe an einigen Nächten im Monat statt.
So wie in dieser.
Sie ging zu ihrem dreirädrigen Bike und startete den Motor. Sie liebte dieses Fahrzeug. Es war zu allen Seiten hin offen und hatte ein Plastikdach, das gegen den Regen schützte, der ein paar Mal am Tag fiel. Und beim Fahren war es angenehm kühl. Sie legte einen Gang ein und wollte gerade auf die Gasse rollen, als ein Mann ein Stück vor ihr auf den Weg trat.
»Hei! Nimmst du mich mit?«
Cosmina sah sofort, dass er nicht hier aus der Gegend war. Nicht einmal ein Philippiner. Dieser Mann war mindestens genauso groß wie sie, mit kurzen Haaren, breitschultrig, in einer hübschen grauen Jacke.
»Und wohin?«
»Zu irgendeiner Bar, die nachts offen hat.«
Der Sitz des Fahrzeugs war breit genug für mindestens drei Personen, Platzmangel war also nicht der Grund, warum sie zögerte. Eher lag es wohl am Zeitpunkt und Ort, mitten in der Nacht in einer schlecht beleuchteten Gasse. Wer fährt da als Anhalter mit? Sie nahm einen Zug von ihrer Zigarette und schaute den Mann an, schaute hinter ihn, um zu sehen, ob dort noch andere Männer standen, aber da gab es nur die Dunkelheit. Sie stieß den Rauch aus und trat die Kippe mit dem Fuß auf dem Lehm aus.
»Dann spring auf.«
Der Mann stieg aufs Rad und setzte sich, rutschte aber an den Rand und hielt einen halben Meter Abstand zu ihr. Wofür sie dankbar war. Sie fuhr die Gasse hinunter zu der größeren Straße, dort hielt sie an. Ein paar bunte Taxis fuhren vorbei.
»Zu welcher Bar willst du denn?«, fragte sie. »Es gibt welche links oder rechts.«
»Kannst du eine empfehlen?«
Cosmina war keine große Kneipengängerin. Wenn sie mal ausging, dann in der Regel immer in denselben Laden, eine Kombination aus Bar und Restaurant an der Küstenstraße, nur einen Kilometer von ihrem Haus entfernt. Eine sympathische Location mit freundlichem Personal. Selten tauchten neben den Leuten aus dem Viertel Fremde dort auf. Die Regale hinterm Tresen waren genauso gut gefüllt wie die in den schicken Bars in der Nähe der Hotels, die weiter zu den Stränden hin lagen, aber hier war es deutlich billiger.
»Es gibt eine gute Bar im Norden, an der Straße«, sagte sie. »Dahin fahre ich sowieso.«
»Okay.«
Cosmina bog auf die große Straße ein und gab Gas. Sie spürte, wie der Meereswind ihr langes Haar flattern ließ und das Gesicht kühlte. Nur wenige Autos waren unterwegs, fast keine Radfahrer. Sie hatte die Straße für sich. Als sie das Zentrum ein Stück hinter sich gelassen hatte, endete die Straßenbeleuchtung, und das einsame Licht ihres Motorrads musste den Weg in der Dunkelheit weisen. Ab und zu sprang ein Hund über die Straße und zwang sie zu bremsen, aber das war sie gewohnt. Die Gegend wimmelte nur so von herrenlosen Hunden und Katzen. Links von ihr lag das Ufer, dahinter das Meer mit einzelnen Lichtern nachtfischender Boote. Sie huschten an kleinen Menschengruppen vorbei, die am Strand um Lagerfeuer saßen. Die meisten von ihnen wohnten hier, zwischen den Palmen ein paar Meter vom Meeresufer entfernt, unter provisorischen Wellblechdächern oder Planen. Rechts standen Holzhäuser eng nebeneinander, niedrige Hütten in kräftigen Farben. In ihnen wohnten die etwas Bessergestellten dieser Gegend, die einen eigenen Stand hatten, an dem sie tagsüber den nächtlichen Fang verkauften oder die morgendliche Ernte von Kräutern und Gemüse.
»Ich heiße Cosmina«, sagte sie, nachdem sie schon eine ganze Weile gefahren waren.
»René.«
»Und woher kommst du?«
»Amsterdam.«
Ein Holländer?
»Seit wann bist du schon hier? In Puerto Galera?«
»Ein paar Tage. Es ist verdammt feucht hier.«
»Ja.«
»Aber das ist wohl gut für die Haut.«
Mehr sagte keiner von beiden, bis sie die Bar erreicht hatten.
Cosmina bremste, bog ab und hielt unter einem Holzdach an. Die Bar lag direkt am Straßenrand, es waren nur ein paar Meter hinunter zum Strand. Eigentlich war es ein Straßencafé, begrenzt durch einen Bretterzaun, mit einem Tresen etwas weiter drinnen unter einem Dach. Die wenigen Tische waren leer. Cosmina sah, dass der Mann hinterm Tresen zu ihnen hinausschaute und eine Hand zum Gruß hob. Es war Manny, einer von Cosminas engeren Freunden hier. Er war auch der Besitzer der Bar. Cosmina stieg gleichzeitig mit René vom Motorrad ab und winkte Manny zu.
»Wie ist es gelaufen?«, rief Manny ihr zu.
»Der falsche Hahn ist gestorben.«
Manny lachte und kam auf den Eingang zu. Cosmina schaute zu dem großen Mann neben sich.
»Es ist nicht gerade überfüllt hier, wie du siehst«, sagte sie mit einem leichten Lächeln. »Vielleicht möchtest du mehr Leute um dich haben?«
»Ganz und gar nicht. Das hier ist perfekt. Musst du gleich weiter?«
Es gab kein Muss mehr in Cosminas Leben. Sie wohnte und lebte allein und nutzte ihre Zeit, wie es ihr gefiel. Wenn sie Lust hatte, fuhr sie auf irgendeinen Markt, war sie müde, fuhr sie nach Hause. Also antwortete sie:
»Nein. Lädst du mich auf einen Drink ein?«
René lachte wieder und schaute zu Manny. Der Lichtkegel der Lampe über dem Eingang fiel auf Mannys Gesicht und zeigte, dass größere Teile der linken Gesichtshälfte und ein Bereich der Lippen von Brandwunden entstellt waren. René drehte sich um und schaute zu den leeren Tischen.
»Ich sitze gern nahe an der Straße«, sagte Cosmina.
»Hier?«
René zeigte auf einen Tisch gleich hinter dem Bretterzaun, und schon war Manny zur Stelle und zog für Cosmina einen Stuhl heraus. Sie setzte sich, René nahm den Stuhl ihr gegenüber. Zwischen ihnen war ein unbehandelter Holztisch mit abgenutzter Oberfläche, dekoriert mit Salz- und Pfefferstreuern und einem Serviettenhalter. Manny fuhr schnell mit einer Stoffserviette über den Tisch, um einige Insekten unbekannter Art zu verjagen.
»Das Übliche?«, fragte er Cosmina.
»Ja. Und du?«
Sie schaute René an, der sich gerade die Ärmel seiner grauen Jacke aufkrempelte.
»Was ist das Übliche?«, fragte er.
»Das weiß ich nicht. Manny mixt etwas zusammen, es schmeckt immer gut. Willst du auch probieren?«
»Gern.«
Manny nickte lächelnd, blieb am Tisch stehen. Cosmina schaute zu ihm auf.
»Was ist?«
»Es ist so schön, Gäste zu haben. Leere Tische gebären keine Kinder. Meine Mama hat immer gesagt, dass …«
»Die Drinks, Manny.«
Manny verneigte sich und ging davon. Cosmina lächelte René zu.
»Ihm gehört der Laden hier. Ein sehr, sehr freundlicher Mann, und großzügig, er hat nur einen Fehler, er unterhält sich einfach zu gern mit seinen Gästen.«
»Dagegen habe ich nichts, da bekommt man bestimmt die eine oder andere gute Geschichte zu hören. Was ist mit seinem Gesicht passiert?«
»Bei dieser Geschichte will ich ihm nicht zuvorkommen.«
René lachte und krempelte seine Ärmel zu Ende hoch. Äußerst ordentlich, wie Cosmina feststellte. Und sie merkte, wie schön es doch war, sich mal wieder mit einem Europäer zu unterhalten.
Dazu noch einem ziemlich attraktiven.
»Also, was treibst du hier?«, fragte sie. »In Puerto Galera?«
»Das ist eine lange Geschichte.«
»Das ist immer so, wenn man hier Leute trifft.«
Sie bemerkte, wie René sie musterte, als überlegte er etwas. Das Rauschen der Wellen vom Strand war hier in der Bar zu hören, die Zikaden sangen in der Dunkelheit, Mannys Shaker klapperte im Hintergrund, dann endlich sagte René:
»Ich war früher mal Musiker, habe viel auf der Straße gespielt, dann habe ich mir einen Ruck gegeben und bin Arzt geworden. Chirurg.«
Cosmina starrte ihn an.
»Chirurg?«
»Ja. Das habe ich so einige Jahre gemacht, aber dann … ich bekam keine Luft mehr. Wie ein geschlossener Zirkel, man hatte nur Kontakt mit Ärzten und redete über Operationen oder spielte Golf … es wurde zu eng und zu uninteressant, deshalb bin ich weg.«
»Und bist wieder Musiker geworden?«
Cosmina lächelte, als sie das fragte.
»Nein. Ich fing an zu reisen, habe die weißen Flecken auf meiner Landkarte gejagt. Ich dachte wohl, ich könnte mich irgendwo da draußen finden.«
»Du hast keine Familie.«
»Ich hatte eine.«
Cosminas Blick huschte über Renés Gesicht, sie wunderte sich. Innerhalb kürzester Zeit war diese ganz besondere Intimität entstanden, zwischen Menschen, die ins Nichts geworfen wurden. Inkognito. Wenn man sagen kann, was man will, und sein kann, wer man will.
Mitten in der Hitze.
»Meine Herrschaften!«
Manny rauschte mit zwei Drinks auf einem kleinen Holztablett und einer Speisekarte in der Hand heran. Er stellte die Drinks vor seine Gäste und hielt die Karte hoch.
»Hier ist die Küche Tag und Nacht geöffnet«, sagte er. »Nach dem Drink würde ich das Tagesgericht empfehlen. Es ist Flughund mit süßsaurem Chutney und gegrilltem Gemüse. Eine Delikatesse!«
Cosmina schaute René an. Sie hatte bereits einen toten Hahn dankend abgelehnt und war nicht besonders scharf auf eine tote Fledermaus. Und sie nahm an, dass es René genauso ging.
»Mir reicht der Drink, danke«, sagte er.
»Mir auch.«
Manny wirkte kurz enttäuscht, fing sich aber schnell wieder. Auf einen Drink konnte ja ein weiterer folgen und noch einer, und dann kam vielleicht doch noch die Lust auf etwas zu essen? Die Nacht war lang. Er schaute Cosmina an. Wer war dieser Mann, den sie da aufgegabelt hatte? Sie kam doch sonst nie mit männlicher Begleitung hierher. War das jemand aus ihrer Heimat? Ein Ausländer, das war klar. Aber kannten die beiden sich schon von früher? Von zu Hause? Es gab so viel, was er gern gefragt hätte, aber er spürte, dass Cosmina jetzt nicht gestört werden wollte. Vielleicht später, wenn aus einem Drink mehrere geworden waren. Dann konnte er sich eventuell mit an den Tisch setzen, ein paar Fragen stellen und von seinem verbrannten Gesicht erzählen. Um mit den Gästen in Kontakt zu kommen, war sein Gesicht wirklich die beste Eintrittskarte. Aber wie gesagt, vielleicht später.
Manny nahm die Speisekarte mit zurück zum Tresen, und Cosmina und René prosteten sich zu und probierten ihre Drinks, von denen beide nicht wussten, was sie enthielten, aber auch René war der Meinung, dass sie ausgezeichnet schmeckten.
»Rumbasis, denke ich.«
»Ja.«
Sie nahmen noch einen Schluck. Cosmina merkte, dass René sie wieder genau betrachtete. Sie schob sich das Haar aus dem Gesicht und schaute hinunter zum Strand. Die Hitze hatte etwas abgenommen, ein kühlender Wind kam auf. Schön.
»Und wie bist du ausgerechnet hier gelandet?«, fragte sie.
René schaute blinzelnd auf die Straße, den Strand, übers Meer, die Worte kamen langsam.
»Ein Freund von mir ist ermordet worden, die Beerdigung war vor einer Weile … ich musste einfach erst mal weg.«
»Und bist im hintersten Winkel der Welt gelandet.«
»Ja.«
Cosmina lächelte, während sie überlegte, ob René wohl eher Gangster als Chirurg war.
»Und wie bist du selbst hier gelandet?«, fragte er. »Im hintersten Winkel der Welt?«
»Ich wollte von vorne anfangen.«
»Womit?«
Eigentlich hätte sie jetzt ihren Privatbereich genauso öffnen müssen, wie er es getan hatte, schließlich waren sie ja beide Fremde im Niemandsland. Aber sie war noch nicht so weit.
Also wechselte sie lieber das Thema.
»Hast du mal bei einem Hahnenkampf zugesehen?«
»Nein.«
»Eine ziemlich barbarische Angelegenheit.«
Plötzlich war ein dumpfer Knall von der Straße her zu hören. Beide drehten sich um und sahen, wie ein Auto in der Dunkelheit davonraste. Gleichzeitig fing ein Hund an zu heulen, unglaublich laut. Cosmina stand auf. Auf der anderen Straßenseite sah sie den Hund.
»Er ist angefahren worden.«
Der Hund hatte sich an den Straßenrand geschleppt. Er drehte sich um seine eigene Achse und heulte dabei laut und verzweifelt in die Nacht. Er war schwer verletzt. Cosmina ging über die Straße, hin zu dem sich windenden Hund. Sie beugte sich hinunter und packte einen schweren Stein. Mit einem kurzen, harten Schlag gegen den Kopf des Hundes machte sie seinem Leiden ein Ende. Um sicher zu sein, schlug sie noch einmal zu. Als sie die Straße wieder überqueren wollte, schaute sie vorher in beide Richtungen, während sie sich die Hände im Gras am Straßenrand abwischte.
»Die Leute hier in der Gegend behaupten, ein Tier hätte keine Seele.«
Cosmina setzte sich wieder an den Tisch.
»Wenn wir sie töten, dann halten wir sie an dieser Stelle auf«, fuhr sie fort. »Sie wandern nicht weiter.«
»So wie wir?«
»Einige glauben das.«
»Aber du nicht?«
»Ich bin nicht gläubig. Du?«
»Ich weiß nicht«, antwortete René.
»In Italien, in Calcata behaupten sie, sie hätten ein Stückchen Haut, das wäre die Vorhaut des Jesuskindes.«
»Wurde er beschnitten?«
»Na, er war ja Jude, dann wurde er es wohl. Sie wurde 1970 gestohlen.«
René trank aus seinem Glas.
»Reliquien sind schon interessant«, sagte er.
»Ja.«
»Ganz hinten in der Kirche von Paucartambo gibt es ein …«
»Wo liegt das?«
»In den Bergen von Peru … da gibt es eine in den Fels geschlagene Krypta, in der steht eine Glasvitrine mit einer abgeschnittenen Zunge darin. Die Zunge gehörte einem beim Volk sehr beliebten Priester. Die Leute haben sie als Erinnerung an seine Wohltätigkeit aufbewahrt.«
»Der Glaube kann vieles umfassen.«
»Ja, das stimmt.«
Beide schauten einen Augenblick lang auf den Tisch, während Manny mit einem Pappkarton in der Hand auf dem Weg zu ihrem Tisch war. Als er angekommen war, öffnete er ihn. Drinnen lagen drei kleine, frisch geborene, niedliche Katzenjunge. Er hielt René den Karton hin.
»Willst du sie mal streicheln?«
»Nein.«
Manny wusste nicht so recht, wie er reagieren sollte. Er hatte es noch nie erlebt, dass ein Gast die Katzenjungen nicht streicheln wollte.
»Bist du allergisch?«
»Nein.«
Cosmina gab Manny zu verstehen, dass er besser verschwand, und schaute René an.
»Du magst keine Kätzchen?«
»Nein. Du?«
»Fast schon zu sehr.«
Cosmina spürte, wie René sie beobachtete. Das war vielleicht die falsche Antwort gewesen. Schließlich hatte sie gerade einen Hund erschlagen und sich nicht gerade als perfekte Tierfreundin präsentiert. Oder vielleicht gerade doch?
»Wo wohnst du?«, fragte sie. »Hier?«
»Ich habe die letzte Nacht in einem Hostel im Norden der Stadt verbracht, aber das war ziemlich primitiv.«
»Kakerlaken?«
»Auch. Das Wasser lief die Wände runter.«
»Und wo willst du diese Nacht schlafen?«
»Da wird sich schon was finden.«
»Du kannst bei mir unterkommen.«
Sie sprach es aus, bevor sie es sich genauer überlegt hatte, und jetzt war es gesagt. Sie wohnte ein Stück weiter, in einem eigenen Haus unten am Strand. Ein ziemlich großes Haus, zum Teil aus Holz, zwei Stockwerke und ein kleinerer Aussichtsturm ganz oben. Und keine Nachbarn. Sie hatte das Anwesen billig kaufen können, weil es vollkommen heruntergekommen gewesen war. Um es so hinzukriegen, wie sie es wollte, hatte sie viel Zeit und Geld hineingesteckt. Jetzt war es fast so etwas wie ein Traumhaus, zumindest für sie. Und es gab ein Gästezimmer, das René beziehen konnte. Der Musiker und Chirurg und vielleicht der größte Lügner der Welt. Woher sollte sie das wissen? Aber sie hegte ein gewisses Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, Menschen zu beurteilen, und hatte nichts dagegen, sich auf ein kleines Abenteuer einzulassen. Vielleicht war er ja auch etwas ganz anderes?
»Und wo wohnst du?«, fragte René.
»Ich habe ein Stück weiter ein Haus.«
»Lebst du allein?«
»Ja.«
René nickte und trank sein Glas aus, was Manny im Laufe einer Sekunde registrierte, um mit zwei neuen Drinks am Tisch zu stehen, noch bevor Cosmina ihren beendet hatte.
»Geht aufs Haus«, sagte Manny mit einem schiefen Lächeln.
Der verbrannte Mund verzog sich.
René stand auf.
»Wo ist die Toilette?«
Manny zeigte in eine Ecke neben dem Tresen, und René machte sich auf den Weg. Manny setzte sich an den Tisch und beugte sich vor. Cosmina registrierte seinen sauren Atem.
»Wer ist das?«
»Keine Ahnung. Er heißt René. Holländer. Ich habe ihn nach dem Hahnenkampf auf dem Roller mitgenommen.«
»Also niemand, den du kennst?«
»Nein.«
»Was macht er hier?«
»Weiß ich nicht. Weiße Mädchen jagen.«
Manny schaute Cosmina an.
»Aber du bist vorsichtig, ja?«
Cosmina legte eine Hand auf Mannys Arm, einen dünnen, nackten Arm mit einem merkwürdigen, langgezogenen Tattoo. Sie wusste, er hatte so seine Beziehungen zu Kreisen, aus denen sie sich lieber heraushielt. Sie wollte ihn nur als Manny kennen, der ihr ab und zu Fledermäuse kredenzte. Mit süßsaurem Chutney.
»Ich bin vorsichtig.«
René leerte seine Blase, betrachtete anschließend sein Gesicht mit der feinen Narbe in einem halb zerbrochenen Spiegel und kehrte in die Bar zurück.
»Noch ein Drink?«
Manny rief es ihm vom Tisch her zu, obwohl doch gerade erst der letzte Drink serviert worden war, den sie beide noch nicht angerührt hatten. Aber René streckte den Daumen in die Luft. Ihm war gerade eine Übernachtung bei Cosmina angeboten worden. Bei einer sehr schönen Frau mit eigenem Haus.
Jetzt brauchte er einen Nachschlag.
Und ungefähr das Gleiche dachte Cosmina.
Sie würden also zu ihrem Haus fahren, sie würde ihm sein Zimmer zeigen und außerdem, wo ihr Schlafzimmer lag, und sie würden noch einen Absacker nehmen, in ihrem Turmzimmer sitzen und über das unendliche Meer schauen, vielleicht sogar sehen, wie die ersten zarten Sonnenstrahlen versuchten, über den Horizont zu kommen – und dann? Über eingetrocknete Vorhäute plaudern? Oder abgeschnittene Zungen?
Wohl kaum.
»Prost!«
Cosmina hob ihr Glas, als René sich wieder an den Tisch gesetzt hatte, worauf er seins nahm und den Gruß erwiderte. Beide leerten ihre Gläser, als tränken sie eher Saft als Alkohol.
Schließlich waren die nächsten Drinks schon in Arbeit.
»Jetzt bin ich dran«, sagte Cosmina und stand auf.
Renés Blick folgte ihr auf dem Weg zur Toilette. Wobei sie Manny begegnete, der mit den Drinks schon den Tisch ansteuerte. Er stellte die Gläser ab, zögerte eine Sekunde, ob er sich setzen sollte, doch René gab ihm mit einer Geste zu verstehen, dass er willkommen war.
»Hast du dich über mein Gesicht gewundert?«, fragte Manny.
»Sollte ich das?«
»Normalerweise fragen die Leute immer danach.«
»Und normalerweise antwortest du dann und denkst dir etwas Passendes aus, je nachdem, wer fragt. Stimmt’s?«
»Ja.«
Manny sah ein, dass René nicht an seinem verbrannten Gesicht interessiert war. Vermutlich eher an Cosmina. Manny schaute zur Toilette hin.
»Cosmina ist ein Stern«, sagte er. »Sie strahlt über andere. Weißt du, dass sie hier ein altes Haus gemietet hat, ein Stück weiter im Dschungel, eine alte, leerstehende Schule. Sie will dort ein Heim für Waisenkinder aufmachen.«
»Sie ist schön.«
»Ja. Man sollte auf schöne Frauen gut aufpassen. Du! Warte mal!«
Manny zog sein Handy heraus und klickte sich durch seine Fotos.
»Hier! Guck mal!«
Er hielt René das Handy hin.
»Ein Selfie mit einer anderen schönen Frau! Siehst du, wer das ist?«
»Nein?«
»Kate Moss! Sie war vor einer Weile hier und hat Modeaufnahmen unten am Strand gemacht, und danach hat sie die halbe Nacht Shots getrunken, und anschließend ist sie noch Bungee gesprungen!«
»Bungee?«
»Ja, hinten bei der alten Holzbrücke! Eine echte Touristenattraktion, man springt in eine Schlucht hinunter. Du! Wollen wir ein Selfie machen?«
»Nein.«
Die Antwort kam so schnell und schroff, dass Manny zusammenzuckte.
»Entschuldige, ich wollte nicht …«
»Da kommt Cosmina. Kannst du uns noch einen Drink machen?«
Manny stand auf und ging zur Bar.
Es wurde noch ein Drink und noch einer für Cosmina, so dass ein ziemlich angetrunkenes Paar sich spät in der Nacht auf das dreirädrige Motorrad setzte, um zu einem Haus am Strand zu fahren. Cosmina hatte ein paar Flaschen Bier gekauft. Sie fuhr auf die Straße, und René sah den Hundekadaver auf der anderen Seite, ein Bein ragte in die Luft. Kleinere Tiere waren bereits herbeigelaufen und fraßen von dem toten Körper. René öffnete eine der Bierflaschen und reichte sie Cosmina. Diese nahm ein paar Schlucke und gab sie dann zurück. René leerte die Flasche und bemerkte, dass Cosmina jetzt deutlich langsamer fuhr. Nach einigen Minuten war die Bar hinter ihnen verschwunden, und vor ihnen lag eine dunkle, asphaltierte Strecke ohne jedes Haus.
Cosmina genoss die Situation. Ihre Erwartungen waren nicht groß, es würde bestenfalls so eine Nacht werden, wie sie sie ab und zu mal brauchte, und morgen würde er wieder verschwinden. Was ihr ausgezeichnet gefiel. Es sei denn, er war tatsächlich ein ehemaliger Chirurg. Dann sähe die Sache ganz anders aus.
Sie fuhren eine gute Viertelstunde, bevor sie in einen helleren, mondbeschienenen Bereich gelangten. Die Bäume am Rand verschwanden und wurden ersetzt durch Felsblöcke. Ein Stück vor ihnen öffnete die Natur sich zu einer breiten Schlucht, über die eine lange Holzbrücke führte. Cosmina fuhr auf die Brücke.
»Springen sie hier Bungee?«, fragte René.
»Ja. Woher weißt du das? Von Manny?«
»Ja.«
»Bist du schon mal gesprungen?«
»Nein. Du?«
»Schon oft. Ist wirklich ziemlich heftig.«
Cosmina hielt mitten auf der Brücke an. An einem der Holzpfeiler befand sich ein großer grauer Kasten mit Silberkanten. Ein massives Stahlgerüst war am Brückengeländer befestigt.
»Hast du Lust, es zu versuchen?«, fragte Cosmina.
»Jetzt?«
»Ja?«
René betrachtete Cosmina, er sah, wie sie lachte, als wollte sie seine Männlichkeit testen.
»Warum nicht«, sagte er und stieg ab.
Cosmina stieg auf der anderen Seite ab, ging zu dem Kasten, öffnete ein Kombinationsschloss und zog das lange Sprungseil heraus. Sie befestigte es mit einem kräftigen Sicherheitsbolzen. René beugte sich übers Geländer und schaute hinunter in die Schlucht. Der Mond war hinter den Wolkenbänken hervorgekommen und beleuchtete die Klippen, der Gesang der Zikaden hallte zwischen den steilen Felswänden wider, und er spürte, wie die Hitze erneut stärker geworden war.
»Ganz schön tief«, sagte René.
»Ja.«
Er ließ die leere Bierflasche über das Geländer fallen und versuchte, sie im Auge zu behalten. Doch sie verschwand im Dunkel, und es dauerte eine Weile, bis das Geräusch zerbrechenden Glases zu hören war, weit, weit unten.
»Soll ich zuerst springen?«, fragte Cosmina.
»Wenn du willst.«
Sie ließ wieder dieses schöne, schwer zu deutende Lachen hören und schnallte sich das Seil um ihre Waden fest. René half ihr dabei. Dann kletterte sie auf den grauen Kasten und weiter auf das Brückengeländer. René hielt sie mit einer Hand, damit sie nicht das Gleichgewicht verlor.
»Hau nicht mit meinem Dreirad ab«, sagte Cosmina und lachte wieder.
»Keine Gefahr.«
Cosmina wandte sich der Dunkelheit zu, holte tief Luft und ließ sich nach außen fallen. In der Sekunde, als ihre Füße sich vom Geländer lösten, reckte René sich nach vorne.
Hinterher fragte er sich, ob er rein impulsiv gehandelt hatte oder ob es eine bewusste Entscheidung in genau diesem Moment gewesen war. Oder ob er nicht doch ganz einfach die erstbeste Gelegenheit genutzt hatte. Aber ganz egal, warum er sich vorbeugte, als ihre Füße sich vom Geländer lösten, er tat es. Und zog den Sicherheitsbolzen heraus, der das Sprungseil hielt, und schaute danach hinunter in die Schlucht.
Und wartete.
Das dunkle, dumpfe Geräusch des Körpers, der an den Felsen zerschellte, ließ die Serenaden der Zikaden verstummen, eine Stille, die sich entlang der Felswände fortpflanzte.
Mehrere Minuten lang war es ganz still.
Als die ersten Zikaden erneut zu singen begannen, schob er den Bolzen wieder in seine Position, wischte ihn sorgfältig ab und ging auf den dunklen Strand zu.
René?, dachte er. Wie bin ich nur auf René gekommen?
VIER MONATE ZUVOR
Der Einsatzleiter sah genervt aus, als ihm das Mikrofon vors Gesicht gehalten wurde. Er stand im Zentraleingang des Hauptbahnhofs und wusste nicht so recht, wie er sich ausdrücken sollte. Gern hätte er Gelassenheit und Kompetenz vermittelt, konnte die Fakten jedoch nicht leugnen.
»Es sind allein in der letzten halben Stunde mehr als achthundert Flüchtlinge eingetroffen. Eine schwierige Situation. Viele sind gestresst, nachdem sie seit mehr als einem Monat auf der Flucht waren, darunter haben wir viele Familien mit kleinen Kindern.«
»Dann ist die Situation also chaotisch?«
»Nein. Aber sie ist schwierig.«
Der Unterschied zwischen schwierig und chaotisch war wohl eher semantischer Natur. Schaute man in die Haupthalle, lag die Beschreibung »chaotisch« deutlich näher an der Wahrheit, schaute man hinaus in die Vasagatan und sah die Armada von Polizeibussen, die sich in dem Regen aufreihte, war »schwierig« wohl leicht untertrieben.
In diesen späten Abendstunden Mitte September ergoss sich der Flüchtlingsstrom ohne Unterbrechung in den Hauptbahnhof. Hungrig, müde, ziellos. Alles drängte sich auf dem abgetretenen Steinfußboden zusammen, jede Ecke in der Halle war belegt. Die meisten Flüchtlinge stammten aus Syrien und Afghanistan oder anderen von Krieg betroffenen Ländern. Die meisten Schweden vor Ort gehörten diversen Hilfsorganisationen an oder kamen vom Migrationsamt – dem offiziellen Empfänger dieses lawinenartigen Zustroms. Am Rand der Halle bewegten sich Polizeikräfte, um mögliche Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen.
An die Aufrechterhaltung dessen, was man unter öffentlicher Ordnung verstand, war nicht zu denken.
Hier und da hatten Familien in der großen Halle kleine kugelförmige Zelte in verschiedenen Farben aufgeschlagen, in denen notdürftig geschützt Säuglinge gestillt werden konnten oder einige einfach nur vor Erschöpfung eingeschlafen waren. Überall war das Weinen kleiner Kinder zu hören, das durch das Gemurmel fremder Sprachen und Dialekte brach. Eine große Anzahl Freiwilliger bewegte sich in gelben oder rotgelben Westen zwischen den Menschenmassen hindurch. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, die Flüchtlinge mit Essen und Getränken zu versorgen und herauszufinden, wer besondere Hilfe brauchte. Ärztliche Versorgung beispielsweise, oder spezielle Medikamente. Oder einfach nur Trost. Sie boten Salat an, Sandwiches und Wasserflaschen, solange der Vorrat reichte, Windeln und Hygieneartikel, Isoliermatten und Wolldecken. Andere Schweden reckten ihre Arme weit in die Luft, mit Schildern, auf denen stand REFUGEESWELCOME. Inwieweit die Flüchtlinge in der Lage waren, die Botschaft zu verstehen, wäre bestimmt eine gute Frage. Vermutlich versuchten sie in der tumultartigen Situation eigentlich nur, einen Menschen zu finden, der ihnen zeigte, wo sie die kommende Nacht verbringen konnten.
Einige Menschen im Hauptbahnhof verfolgten allerdings ganz andere Pläne. Sie liefen zwischen den Flüchtlingen hin und her, sie sprachen ihre Sprache, und in dieser Sprache warnten sie vor den schwedischen Behörden. Davor, Kontakt mit Schweden aufzunehmen.
Sie boten Alternativen an.
Der größte Teil der Nicht-Flüchtlinge jedoch war hier, um zu helfen.
Luna war eine davon.
Sie stand mitten in der Halle, umringt von einer Gruppe syrischer Flüchtlinge. Die meisten schauten schweigend zu Boden, ihre fremden Körpergerüche schwängerten die Luft um sie herum. Ein kleiner spindeldürrer Junge mit zotteligem schwarzen Haar zupfte mit einer Hand voller Schürfwunden an ihrer gelben Weste und wiederholte immer wieder das Wort »Fadi«. Sie nahm an, dass es sein Name war. Die Mutter des Jungen stand neben ihm und drückte ein gewickeltes kleines Paket an die Brust. Ihr Gesicht war eingefallen vor Schlafmangel, ihre rot unterlaufenen Augen wurden von dunklen Ringen eingerahmt.
»Wie heißt du?«, fragte Luna.
Ein Teenagermädchen übersetzte die Frage für die Mutter.
»Hawa.«
»Wie geht es dir?«
»Ich bin müde von der Geburt.«
»Wann ist das Kind geboren?«
»Vor einer Woche. In einem Lager in Griechenland.«
Luna betrachtete die Mutter, dann drehte sie sich um.
»Olivia!«, rief sie.
Eine junge Frau mit langem dunklem Haar und einer rotgelben Freiwilligenweste drehte sich zu ihr um. Sie sah, wie Luna sie heranwinkte, und versuchte, sich einen Weg zu ihr zu bahnen. Was nur schwer möglich war. Als sie fast über eine der vielen blauen Ikea-Taschen mit gespendeter Kleidung stolperte, gab sie auf und rief: »Was ist?«
»Kannst du einen Arzt besorgen?«
Olivia nickte, schob sich in die andere Richtung und hoffte, einen weißen Kittel zu entdecken. Einige Mediziner waren hergekommen, um zu helfen. Sie trugen weiße Kittel, damit man sie besser erkannte.
Olivia bekam Kontakt zu einem der Ärzte, und gemeinsam gelang es ihnen, sich zu Luna durchzudrängeln. Diese erklärte, wie es um die beunruhigend bleiche Mutter und das neugeborene Kind stand. Der Arzt öffnete seine Tasche. Sofort reagierte die Mutter und versuchte zurückzuweichen, aber mithilfe der Teenagertochter konnte Luna ihr erklären, dass keinerlei Gefahr bestand. Der Arzt fragte nach dem Namen der Mutter, ihrem Alter und einigen anderen Formalitäten, in erster Linie, um die Frau zu beruhigen. Dann horchte er ihr Herz und ihre Lunge ab, maß ihren Blutdruck und konstatierte, dass keine akute Gefahr bestand.
»Das Beste, was du für sie tun kannst«, sagte er zu Luna, »ist, einen Platz zu finden, wo sie sich ausruhen kann.«
Luna nickte und erklärte der Mutter, was der Arzt gesagt hatte. Sie bat Olivia, bei der syrischen Gruppe zu bleiben, während sie nach einem Vertreter der Migrationsbehörde suchte. Die Behörde hatte einen eigenen Stand in der Halle, aber dorthin zu gelangen, war im Prinzip unmöglich. Eine kompakte Masse von mehr oder minder verzweifelten Menschen blockierte den Weg. Luna schob sich in die andere Richtung. Plötzlich entdeckte sie eine Frau, die ein Namensschild der Behörde trug. Eine Koordinatorin. Es gelang ihr, der Frau auf die Schulter zu tippen, so dass diese sich umdrehte. Schnell erklärte sie ihr die Lage der syrischen Familie.
»Wie sieht es in Sickla aus?«, fragte sie. »Gibt es dort Platz?«
»Nein. Leider nicht.«
»Irgendein Flüchtlingscamp?«
»Null Chance. Alles ist proppenvoll, und auch die anderen Möglichkeiten in der Stadt sind völlig überlaufen.«
»Was sollen wir dann machen?«
»Vielleicht könnten sie in einem provisorisch aufgestellten Zelt schlafen?«
Luna drehte sich um und drängelte sich wieder zurück durch die Menschenmenge. Allein die Vorstellung, der Mutter mit dem Neugeborenen einen Schlafplatz in einem provisorischen Zelt anzubieten, weckte ihren Widerwillen.
Also entschloss sie sich für eine andere Alternative.
»Ich habe einen großen Lastkahn, auf dem könnt ihr wohnen, erst einmal«, erklärte sie der Teenagertochter, als sie sich wieder zu der Gruppe durchgekämpft hatte. »Wie viele gehören zur Familie?«
»Wir sind sechs in meiner und fünf in der von meinem Onkel.«
Elf Personen. Luna überschlug schnell im Kopf die Aufnahmekapazitäten des Schiffes. »Das könnte klappen.« Dann drehte sie sich zu Olivia um. »Kannst du mir helfen, sie auf den Kahn zu bringen?«
Gemeinsam bahnten sie den Weg für die ziemlich große Gruppe auf den Ausgang zur Vasagatan zu. Keiner von ihnen bemerkte das schwarze Mädchen, das von einigen Jugendlichen umringt wurde und an einer orangenen Stofftasche zupfte.
Als sie fast den Ausgang erreicht hatten, lief Olivia einem anderen Freiwilligen in die Arme, mit langen Rastazöpfen bis über die Schultern.
»Ich komme gleich nach!«, rief sie Luna zu, die mit der Gruppe weiterging und nur durch einen flüchtigen Blick über die Schulter mitbekam, wie Olivia den Rastatypen mit einer herzlichen Umarmung begrüßte.
Kurz hinter dem Bahnhofseingang holte Olivia die Gruppe wieder ein. Luna und sie begannen gerade darüber zu diskutieren, wie sie am besten ein Transportmittel beschaffen könnten, als eine laut vernehmliche Stimme sich durch das allgemeine Gemurmel drängte.
»Hallo, Olivia!«
Olivia kannte die Stimme nur zu gut. Sie gehörte einem ihrer Kurskameraden von der Polizeihochschule, Ulf Molin. Damals hing er wie eine Klette an ihr, doch im letzten Jahr hatte er endlich damit aufgehört. Inzwischen hatte sie kein Problem mehr mit Ulf, wenn sie sich zufällig über den Weg liefen.
»Ziemlich was los da drinnen«, sagte er.
»Ja. Hier draußen auch, wie ich annehme.«
»O ja.«
Ulf grinste und machte eine ausladende Armbewegung über den dichten Menschenstrom hinweg, der sich vor dem Halleneingang in alle Richtungen gleichzeitig zu bewegen schien.
»Wir versuchen, ein Verkehrschaos zu vermeiden.«
Plötzlich hatte Olivia eine Idee. Schnell erklärte sie Ulf, was Luna und sie planten. Elf Syrer, die zum Frachtkahn einer Freundin in Söder gebracht werden mussten. Ob er das regeln könne?
»Aber gern. Ich kann euch in einem unserer Busse hinfahren. Kommt!«
Ulf ging voran, und Luna und Olivia gaben der Gruppe zu verstehen, dass sie ihm folgen sollten. Ein Stück weiter, unter dem Klarabergsviadukt, standen einige Polizeibusse geparkt. Ulf ging zu einem der größten und zog die breite Tür auf. Als er sich umdrehte, sah er, dass die syrische Gruppe ein Stück davor stehen geblieben war. Eine lautstarke Diskussion war unter ihnen ausgebrochen. Einige zeigten auf den Bus. Ein paar Männer wollten schon zurück zum Bahnhof gehen.
»Wartet!«, rief Olivia. Sie wollte die Männer unbedingt aufhalten. Luna wandte sich der kleinen Dolmetscherin zu, die auf der Unterlippe kaute.
»Was ist denn los?«, wollte sie wissen.
»Das ist ein Polizeifahrzeug.«
»Ja und?«
»Kommen wir ins Gefängnis?«
»Aber nein, ganz und gar nicht. Wir werden nur mit dem Bus zu meinem Schiff fahren. Kannst du nicht versuchen, das deiner Familie zu erklären?«
»Die haben Angst.«
»Aber es besteht nicht die geringste Gefahr. Ich verspreche es!«
Das Mädchen schaute Luna an, beschloss ihr zu vertrauen. Eilig lief sie zurück zur Gruppe.
Es dauerte eine Weile. Aber nach viel Gestikulieren und Überreden bewegte sich die Gruppe letztendlich doch auf den Bus zu. Die Syrer beäugten Ulf immer noch skeptisch, stiegen aber ein.
Dann fuhren sie los.
Während der Fahrt nach Söder saß das Dolmetschermädchen zwischen Luna und Olivia. Sie heiße Leah, sagte sie, und berichtete mit sehr leiser Stimme, warum sie solche Angst hatten. Auf ihrer langen Flucht hatten sie sehr ruppige, brutale Polizisten erlebt, Beamte, die sie wie Tiere behandelten. Ihre Schutzlosigkeit machte sie zu Freiwild.
»Ich habe von einem Mädchen gehört, das gezwungen wurde, in Rumänien mit drei Grenzbeamten Sex zu haben, damit ihre Familie ins Land durfte.«
Luna sah, wie Olivia in sich zusammensackte.
Sie selbst konzentrierte sich erst mal auf die praktischen Folgen ihrer Entscheidung, die Flüchtlinge mit aufs Schiff zu nehmen. Der Beschluss selbst war ihr leichtgefallen, doch für die Umsetzung war eine gewisse Logistik unabdingbar. Sie musste die Essensvorräte ordentlich auffüllen. Toilettenpapier? Handtücher? Zahnbürsten? Windeln. Auf halbem Weg zum Söder Mälarstrand bat sie Ulf, in die Hornsgatan abzubiegen und bei dem Supermarkt Ecke Ringvägen zu halten.
Der Lastkahn war auf Sara la Kali getauft, nach einer der Schutzheiligen der Roma. Luna hatte ihn in Frankreich gekauft und mithilfe ihres Vaters, eines pensionierten Kapitäns, hierher geschippert. Jetzt lag er schon seit einigen Jahren am Kai und diente als Wohnung. Zuerst für Luna allein und seit einem Jahr auch für Tom Stilton. Der Kahn, zum Teil von Luna umgebaut, war geräumig, mit mehreren größeren und kleineren Kajüten und einem schon etwas abgewohnten, aber hübschen Salon. An Komfort mangelte es nicht an Bord. Sie selbst und Tom wohnten in der Kapitänskajüte achtern.
Und dort wollte sie auch bleiben.
Die elf Syrer durften sich ihre Kabinen selbst aussuchen, und dann zeigten Luna und Olivia ihnen, wie die Küche und die Duschen funktionierten. Nach einem späten Abendessen verschwanden die Gäste in ihren vorübergehenden Behausungen. Luna hatte ihnen erklärt, dass sie die Stadt kontaktieren und versuchen wollte, eine dauerhafte Unterkunft für sie zu finden. Mehr könne sie im Augenblick nicht tun.
Damit schienen alle zufrieden zu sein.
Jetzt saß sie mit Olivia im Salon in dem gedämpften Licht kleiner metallgelber Wandlampen. Sie hatte nicht übel Lust auf einen kleinen Whisky, um etwas runterzukommen, aber ihr war klar, dass sie in Alarmbereitschaft bleiben musste. Wer wusste schon, was in dieser Nacht passieren würde? Sie ging davon aus, dass vermutlich mehr als nur einer ihrer Gäste traumatisiert war von dem, was sie durchgemacht hatten. Leahs Berichte beim Essen ließen daran keinen Zweifel. Also machte sie stattdessen Tee, was Olivia sehr entgegenkam. Schweigend tranken sie ein paar Schlucke, bis Luna einfiel, was sie eigentlich noch hatte fragen wollen.
»Wer war das denn, den du auf dem Weg hinaus umarmt hast?«
»Am Eingang zum Bahnhof?«
»Ja.«
»Ach, ein alter Ex. Ein jamaikanischer Typ, Jamie. Wir waren vor ein paar Jahren zusammen, nicht besonders lange, aber es war cool, ihn wiederzutreffen. Ich habe damals seine Katze übernommen.«
»Ach ja? Die, die später …«
»Ja.«
Olivia schaute in ihre Teetasse, und Luna stellte keine weiteren Fragen. Schweigend saßen sie ein paar Minuten zusammen.
»Hast du mit Tom reden können?«, fragte Olivia.
»Nein, er ist draußen auf Rödlöga und schaut nach dem Haus.«
Die Frauen blickten einander an und mussten beide grinsen. Das Zusammenleben auf engstem Raum, mit elf Flüchtlingen, darunter ein frisch geborener Säugling, gehörte sicher nicht zu Toms Top Five.
»Dann wird er wohl lernen müssen, Windeln zu wechseln«, sagte Olivia und schaute auf die Uhr.
Sie musste am nächsten Morgen nach Värnamo fahren, um dort einen Mordfall abzuschließen, da brauchte sie auf jeden Fall ein paar Stunden Schlaf. Aber vorher noch ein kurzer Abstecher zum Zentralbahnhof, falls Jamie noch dort war?
»Ich werde mal aufbrechen, ist das okay für dich?«
»Auf jeden Fall. Und vielen Dank für deine Hilfe!«
Olivia nickte, stand auf, blieb dann doch stehen, den Blick auf Luna gerichtet.
»Was ist?«
»Ich hoffe nur, dass Tom kapiert, wie super du bist.«
Damit drehte sich Olivia um und ging zur Treppe. Luna schaute ihr nach, bis sie an Deck verschwunden war. Das hoffe ich auch, dachte sie und streckte sich auf dem an der Wand befestigten Sofa aus.
Da fing der Säugling an zu weinen.
Jamie war noch da.
Er schmunzelte, als er sah, wie sich Olivia in ihrer leuchtenden Helferweste einen Weg zu ihm bahnte. Er war gerade dabei, einen Stapel Wolldecken an ein paar frisch eingetroffene Familien zu verteilen, als sie bei ihm ankam.
»Du bist zurückgekommen«, strahlte er.
»Ja, aber nur kurz, dann muss ich nach Hause. Machst du hier schon länger mit?«
»Seit ein paar Abenden. Was da drinnen abgeht, ist ja total irre. Kannst du noch ein paar Decken besorgen?«
Olivia nickte und machte sich auf den Weg. Dabei dachte sie über Jamie nach. Ihn hier zu treffen, in einer rotgelben Weste mitten im Schwarm hilfesuchender Menschen, kam für sie ziemlich überraschend. Während ihrer Beziehung hatte er das Leben genommen, wie es kam, sich mit irgendwelchen Aushilfsjobs in Bars oder Nachtclubs finanziell über Wasser gehalten, bis mittags geschlafen und abends mit ein paar Kumpeln herumgehangen. Nicht gerade der Prototyp eines Flüchtlingshelfers. Zu dem er ja offensichtlich geworden war.
Aus »nur kurz« wurde eine Stunde, aus einer Stunde wurden ein paar Stunden. Gegen drei Uhr nachts ließ sich Jamie auf eine Bank fallen, und Olivia setzte sich neben ihn. Beide waren sichtlich erschöpft.
»Jetzt reicht es aber«, sagte Jamie.
Olivia nickte. Die Füße taten ihr weh, und sie sehnte sich nach einer Kanne Tee. Jamie richtete sich ein wenig auf und versuchte, die Schulterblätter zu lockern.
»Wohnst du noch in der Skånegatan?«, fragte er.
»Nein, ich bin in die Högalidsgatan gezogen.«
»Das ist ja nicht so weit.«
Jamie lachte, und Olivia erkannte es wieder. Dieses Lachen hatte sie mitten ins Herz getroffen, damals, als sie sich kennenlernten.
»Ich bin scheißmüde«, sagte er. »Wollen wir los?«
Olivia nickte und stand auf, und als Jamie auch auf die Beine gekommen war, sagte sie etwas, was sie in keiner Weise vorher überlegt hatte.
»Kommst du noch mit auf eine Tasse Tee?«
Gerne, wie sich herausstellte.
*
Der Eber stand am Rand einer Erdspalte.
Hier und da gab es in dem dichten Nadelwald solche Spalten, verursacht durch umgestürzte Bäume, oft mit dichtem Wurzelwerk, das den Mondschein einfing und ihn meterweit über den Boden verbreitete. Zwischen den Bäumen war es still, kein Wind störte die Äste, dennoch war der Eber vorsichtig. Trat er in die Spalte, wurde er sichtbar. Er lauschte und witterte. Ein Geruch hatte ihn angelockt, er kam aus der Spalte, ein Stück tiefer, bei einem kleineren Felsblock. Er war gezwungen, aus der Deckung zu gehen, um zu dem Geruch zu gelangen. Der große schwarze Körper machte ein paar Schritte hinaus in den Mondschein, der Kopf drehte sich zu beiden Seiten, der Blick aus den kleinen Augen huschte über den Platz. Noch ein paar Schritte, vorsichtig, gleich hatte er den Geruch erreicht.
Der Eber blieb mitten in der blauen Spalte stehen. Der große Kopf schwenkte noch ein letztes Mal hin und her, dann beugte er sich hinunter zur Erde neben dem Felsen. Die spitzen, kräftigen Reißzähne hackten, die Klauen kratzten die dunkle Erde auf. Es dauerte einige Minuten, bis er eine passend große Grube zuwege gebracht hatte, um an das heranzukommen, was ihn hergelockt hatte. Er zwängte seinen Kopf durch das Loch und begann an etwas zu zerren. Das wollte aber nicht loslassen. Der Eber knurrte und schüttelte den kräftigen Kopf hin und her, um das loszubekommen, was seine Kiefer gepackt hatten.
Endlich gelang es ihm.
Der Eber drehte sich um und bewegte sich zum Ausgang der Spalte. Mit schnellen Trippelschritten verschwand er aus dem Mondschein, hinein ins Dunkel. Teile eines nackten Fußes hingen ihm aus dem Maul.
Muriel hieß mit Nachnamen Johansson und stockte ab und zu ihre Sozialhilfe auf, indem sie ihren Körper verkaufte. Sie war gut dreißig Jahre alt und dachte nur selten über sich selbst oder ihre Situation nach. Denn aus dieser Sackgasse, in die sie bereits einige Male geraten war, kam sie nur mit aufgeschnittenen Handgelenken und der Endstation psychiatrische Notaufnahme wieder heraus. Also vermied sie die Gasse. Lieber lebte sie in den Tag hinein – und in die Nacht. Eine Zeitlang blieb sie meistens sauber, was besonders ihren Freunden zu verdanken war, die sie für etwas anderes hielten als sie sich selbst. Ronny und Benseman – und Tom. Aber es gab diese Lichtungen auf ihrer Nachtwanderung, kleine blaue Oasen, in denen sie sich eine Pause gönnen konnte, bevor die Sucht oder die Flucht sie wieder in die Dunkelheit zwangen.
»Flucht wovor?«, hatte Tom gefragt. »Wovor musst du fliehen?«
»Vor mir selbst.«
Sie hätte sagen können »vor der Scham«, diesem ganzen verdammten Dreck, den Schuldgefühlen, was auch immer es war, das sich in ihr zu einem Monster ohne Gesicht zusammengefügt hatte. Das, was ganz hinten in der Sackgasse stand und ihr einen Spiegel aus Eis entgegenhielt.
Und sie auf die Straße hinaus zwang.
Wie am heutigen Abend.
Sie war gerade am Brunkebergstorg abgesetzt worden und trat direkt in eine große Wasserpfütze. Ihre Turnschuhe wurden klitschnass. Verdammte Scheiße! Sie sprang auf den Bürgersteig und fuhr sich mit der Hand durch die zerzauste Frisur. Der Freier hatte während des Blasens die ganze Zeit in ihrem Haar gewühlt. So ein Schwein. Aber er hatte rausgerückt, was sie verlangt hatte. Die zwei Fünfhunderter brannten in ihrer Tasche. Bis zur Platte waren es nur ein paar Minuten zu Fuß.
»Ey, du!«
Muriel schielte zur Seite. Ein silbergrauer BMW rollte mit heruntergelassener Scheibe neben ihr heran.
»Was nimmst du für ein Mal Blasen?«
Ein Mann in den Zwanzigern beugte sich aus dem Fahrzeug heraus. Er hatte das dunkle Haar nach hinten gegelt und die grauen Augen zusammengekniffen. Seine Zähne waren viel zu weiß. Muriel warf einen Blick in den Wagen und konnte ein paar junge Typen erkennen, außerdem registrierte sie teures Rasierwasser, Schnaps und Testosteron.
Die schlimmste Mischung.
»Mann, Scheiße, Micke!«, rief einer der Typen vom Rücksitz. »Das ist doch ’n Junkie! Hör auf! Einfach nur eklig!«
Die Beleidigung traf Muriel bis ins Mark. Sie spuckte auf die Wagentür und trat zurück auf den Bürgersteig.
»Verflucht, was machst du da, du Scheißfotze?!«
Die Wagentür wurde aufgestoßen von dem, der offensichtlich Micke hieß. Seine Kumpel versuchten, ihn zurückzuhalten.
»Cool down, Micke! Die Alte kann Aids haben.«
Micke sprang aus dem Wagen, direkt auf den Bürgersteig. Muriel erkannte ihren Fehler und rannte davon. Die nassen, schweren Schuhe hingen an ihren Füßen, sie würde diesem Idioten niemals davonlaufen können. Verdammt! Warum hatte sie nur gespuckt? Warum war sie nicht einfach weitergegangen? Das war doch sonst ihre Taktik, wenn sich etwas zusammenbraute. Sich klein machen, grau und unsichtbar, um nicht mit all diesen Idioten zusammenzustoßen, die ihr begegneten. Genau das hatte sie doch gelernt, oder?
»Du verfluchte Fotze«, keuchte Micke hinter ihr.
Plötzlich spürte Muriel, wie er ihr Haar packte. Sie schrie, stolperte und versuchte freizukommen. Keine Chance. Sein Griff ließ ihren Kopf nach hinten fliegen, und sie spürte, wie der Schmerz ihr durch den ganzen Körper fuhr. Sie hing fest. Wenn sie jetzt anfing, um sich zu schlagen, würde alles nur noch schlimmer werden. Also krümmte sie sich zusammen, schloss die Augen und wartete auf den ersten Schlag.
Der nie kam.
Alles ging plötzlich ganz schnell.
Sie hörte, wie der BMW an ihre Seite heranfuhr und die Kerle im Auto ziemlich gestresst durcheinanderschrien.
»Micke! Jetzt spring rein, verflucht noch mal!«
»Sofort! Sonst hauen wir ab!«
Plötzlich lockerte Micke den Griff um Muriels Haar und sprang in das silbergraue Auto. Muriel öffnete die Augen und sah, wie sie davonbrausten. Sie kapierte gar nichts, dankte aber ihrem glücklichen Stern. Oder vielleicht Mickes Kumpel. Bis sie den Wagen mit blauen Leuchten auf dem Dach bemerkte.
Muriel streckte sich, strich das kurze Kleid einigermaßen glatt und machte sich auf Richtung Sergels torg, als wäre nichts gewesen. Der Streifenwagen wurde langsamer, als er auf ihrer Höhe angekommen war. Sie konnte spüren, dass die Männer im Auto sie musterten, aber sie hielten nicht an, dieses Mal nicht, sie fuhren weiter zur Malmskillnadsgatan.
Muriel atmete auf.
Da sah sie es, ein Stück weiter vorn.
Ein armseliges kleines Wesen, das zusammengekauert in der Dunkelheit einer Betonwand vor der Riksbanken hockte. Muriel erkannte sofort, dass das Mädchen versuchte, sich unsichtbar zu machen, solange der Streifenwagen in Sichtweite war. Kaum war er verschwunden, richtete sie sich ein wenig auf. Sie schien nicht älter als zehn, vielleicht elf Jahre zu sein und trug lediglich ein dünnes lila T-Shirt und eine gelbe schmutzige Hose, die mit einer Schnur in der Taille zusammengehalten wurde. Um ihren Hals hing eine Kette mit bunten Glasperlen und etwas, das aussah wie eine Art Samenkapseln. In der einen Hand hielt sie einen orangenen Stoffbeutel. Sie war schmutzig und vom Regen durchnässt, aber Muriel war beeindruckt davon, welche Eleganz sie trotz ihrer elenden Lage ausstrahlte. Obwohl sie die Beine an den Bauch herangezogen hatte, war der Rücken kerzengerade. Sie sieht aus wie eine kleine Ballerina, dachte Muriel, aber wie eine Ballerina, die so heftig weinte, dass ihr ganzer Körper bebte.
Muriel trat zu ihr, hockte sich vor sie hin.
»Was ist passiert? Alles in Ordnung mit dir?«
Das Mädchen schaute zu ihr auf, und Muriel zuckte zusammen. Der Blick aus den traurigen braunen Augen wirkte deutlich älter als das Mädchen. Auf der einen Wange liefen die Tränen in eine breite dunkle Narbe, sammelten sich dort für einen Moment. Auf der anderen Wange liefen sie direkt hinunter bis zum Kinn, vorbei an den schön geschwungenen Lippen, bevor sie auf das lila T-Shirt tropften.
Muriel wiederholte ihre Frage, dieses Mal in holprigem Englisch, vielleicht konnte das Mädchen ja gar kein Schwedisch. Sie versuchte zu lächeln, ohne ihre Zähne zu zeigen, für die sie sich sehr schämte. Das Mädchen mit den sonderbaren Augen musterte sie, schien sie zu durchschauen. Muriel wand sich innerlich, der Körper juckte, zum einen, weil sie nicht gern so genau gemustert werden mochte, zum anderen, weil der übliche Entzug sich ankündigte. Langsam stand sie wieder auf. Was soll ich tun?, dachte sie und schaute sich um, als suche sie nach Hilfe.
»Ich habe Hunger.«
Das Mädchen sagte das in klarem Englisch, mit heller Stimme, worauf Muriel sie wieder ansah.
»Und Durst.«
Plötzlich bereute Muriel, dass sie überhaupt gefragt hatte. Was ging sie das Ganze überhaupt an? Glaubte sie etwa, sie könnte dieser Kleinen helfen? Sie war doch keine verdammte Florence Wie-immer-die-noch-hieß-Nightingale, sie hatte genug mit ihrem eigenen beschissenen Leben zu tun. Die Krämpfe im Bauch wurden stärker. Sie machte ein paar Schritte weg von dem Mädchen. Gerade hatte sie einem Freier einen geblasen, sie hatte tausend Piepen in der Tasche, und die Platte war gleich um die Ecke.
»Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll«, sagte das Mädchen.
Muriel dachte erst, da bist du nicht die Einzige, aber dann fasste sie plötzlich einen merkwürdigen Entschluss. Warum, wusste sie selbst nicht. Vielleicht war es die Erinnerung an Vera, die ihr plötzlich durch den Kopf schoss. Vera, die sie getröstet hatte, als das Leben nur noch beschissen war. Die dafür gesorgt hatte, dass Muriel etwas im Magen hatte. Bei der sie im Wohnwagen schlafen durfte, wenn die Ängste zu groß wurden. Die in der täglichen Hölle eine Art Ersatzmutter für sie gewesen war.
Vera, die tot war.
Zu Tode geprügelt.
Muriel drehte sich wieder zu dem Mädchen um, ging auf sie zu und streckte ihr die Hand entgegen.
»Komm, ich helfe dir«, sagte sie in ihrem primitiven Englisch.
Das Mädchen sah die ausgestreckte Hand an, ohne sich zu bewegen. Vielleicht hatte sie erwartet, dass Geld darin lag? Vielleicht schätzte sie das Risiko ab?, überlegte Muriel. Sicher hat sie schon einiges an Streitereien auf der Straße erlebt, sieht genau diese Bilder vor sich. Auch wenn sie die Sprache nicht versteht, so kapiert sie bestimmt, dass ich eine Hure bin. Aber das bin ich ja nicht. Oder doch. Ich verkaufe mich, um mir einen Schuss geben zu können. Aber im Augenblick versuche ich nur, nett zu sein.
»Ich bin nicht gefährlich«, unternahm Muriel einen zweiten Anlauf. »Komm, ich habe Geld, ich kann uns was zu essen kaufen.«
Sie schob die Hand in die Tasche und zog die beiden Fünfhunderter heraus, die sie sich verdient hatte, und die eigentlich für etwas anderes als Essen für ein weinendes kleines Mädchen gedacht waren.
»Es gibt einen Laden da hinten. Komm!«
Endlich zögerte das Mädchen nicht länger, ergriff Muriels Hand und stand auf. Mit der anderen Hand umklammerte sie den orangenen Stoffbeutel. Muriel musste wieder lachen, und dieses Mal vergaß sie ihre kaputten Zähne zu verstecken.
»Du hast schönes …Haar!«
Zöpfe hatte sie sagen wollen, aber ihr fiel das englische Wort dafür nicht ein.
Die Verkäuferin im Seven-Eleven hielt kurz in ihren Bewegungen inne, als sie die Frau hereinkommen sah. Kräftig geschminkt, mager, mit schlappenden Turnschuhen, in einem schwarzen kurzen Kleid. Muriel sah ihren misstrauischen Blick und erkannte ihn sofort, sie kannte solche Blicke nur zu gut. Blicke, die sie auf den Junkie reduzierten, eine Straßenhure. Sie senkte den Kopf, richtete den Blick nach unten. Immer. Wäre Vera dabei gewesen, hätte diese nur gesagt: »Scheiße, was glotzt du, hast du noch nie ’nen Promi gesehen?« Und dann hätte sie laut gelacht und immer weiter gelacht, bis die Verkäuferin nach dem Alarmknopf unter dem Tresen gesucht hätte.
Aber Muriel war nicht Vera.
Sie hielt den Blick gesenkt.
Außerdem hatte sie dieses Mal ein kleines schwarzes Mädchen mit schmutziger, nasser Kleidung im Schlepptau, wodurch sie sich nicht weniger verdächtig machte. Zielstrebig ging sie zu den Softgetränken. Dort hob sie den Blick, schaute das Mädchen an. Diese stand mit kerzengeradem Rücken dicht neben ihr und schaute sich neugierig um. Sie ließ sich nicht erniedrigen. Wie selbstverständlich bediente sie sich aus dem Kühltresen und griff nach einer großen Flasche Coca-Cola. Muriel spürte den Blick der Verkäuferin im Nacken brennen. Das Mädchen hielt die Flasche Muriel hin.
»Okay?«
»Okay«, bestätigte Muriel.
Das Mädchen drehte sich um und suchte Brot, Butter und Aufschnitt zusammen. Muriel stand etwas hilflos dabei.
Heute Abend würde sie mit dem Entzug kämpfen müssen.
Muriel und das Mädchen saßen in einem fast leeren Bus auf dem Weg hinaus in die Wälder von Lissma. Das Mädchen schaute durch das Fenster hinaus. Es gab nur dunkle Straßen dort draußen, und die Bebauung wurde immer spärlicher. Muriel schaute auf ihre Hände und versuchte, das Zittern zu bekämpfen. Sie war immer noch verwundert über ihre Entscheidung, das Mädchen mitzunehmen. Sie waren auf dem Weg zu Ronny Redlös’ Sommerhaus, einer kleinen Hütte im Wald, in der sie der gutherzige Antiquariatsbesitzer ab und zu wohnen ließ. Ein Vertrauensbeweis, das wusste sie, und sie war unsicher, wie er wohl reagieren würde, wenn er wüsste, dass sie ein unbekanntes Flüchtlingsmädchen dort mit hinnahm.
Denn sie nahm an, dass es sich bei dem Mädchen um einen Flüchtling handelte.
Oder besser gesagt, sie spürte es.
»Folami«, sagte das Mädchen plötzlich. »Ich heiße Folami.«
Muriel zuckte zusammen. Ihr war noch gar nicht aufgefallen, dass sie sich nicht vorgestellt hatten.
»Folami?«
»Ja. Und du?«
»Muriel.«
Muriel sprach ihren Namen aus, wie er geschrieben wurde. Andere bevorzugten eine amerikanische Aussprache, eher Mjuriel, doch Muriel wusste, dass ihre Mutter damals die Wahl hatte zwischen Ariel und Muriel. Bei Muriel war sie geblieben, als sie gemerkt hatte, dass Ariel auch ein Waschmittel war. Aber die Aussprache sollte gleich sein, in schwedischer Form, Buchstabe für Buchstabe.
»Muriel.«
Folami wiederholte den Namen genau in der gleichen Form, wie ihr Gegenüber ihn ausgesprochen hatte. Und fügte hinzu, sie fände, es sei ein schöner Name.
»Genau wie Folami.«
Die weitere Busfahrt über schwiegen sie. Muriel fiel es sowieso schwer, sich locker zu unterhalten, und auf Englisch wurde das nicht besser. Folami schien nichts gegen die Stille zu haben. Sie lehnte den Kopf gegen die Fensterscheibe und schaute auf den dunklen Wald, der an ihnen vorbeirauschte. Nach einer Weile schloss sie die Augen und schien zu schlafen. Muriel beobachtete sie. Das Mädchen sah fast friedlich aus. Muriel war zufrieden. Sie hatte diese Mistnacht um 180 Grad gedreht.
Vera wäre stolz auf sie.
Als sie an einer dunklen, verlassenen Haltestelle draußen in Lissma aus dem Bus stiegen, verließ vor ihnen eine magere ältere Frau mit einem vollbepackten Einkaufstrolley in der einen Hand und einer Plastiktüte in der anderen den Bus. Sie keuchte laut, als sie draußen erst einmal wie angewurzelt stehen blieb. Muriel und Folami mussten sich an ihr vorbeidrängeln. Muriel war überzeugt davon, dass die Frau sich absichtlich in den Weg gestellt hatte.
Die Frau schaute die Straße entlang. Eine breite, hoch gewachsene Gestalt näherte sich in der Dunkelheit den Graben entlang, mit einem großen Hund an der Leine.