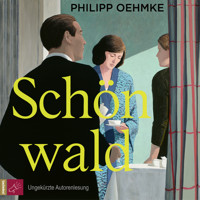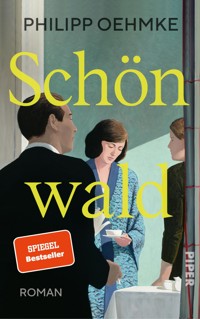
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Eine deutsche Familie, ein großer Roman Anders als Harry findet Ruth Schönwald nicht, dass jedes Gefühl artikuliert, jedes Problem thematisiert werden muss. Sie hätte Karriere machen können, verzichtete aber wegen der Kinder und zugunsten von Harry. Was sie an jenem Abend auf einem Ball ineinander gesehen haben, ist in den kommenden Jahrzehnten nicht immer beiden klar. Inzwischen sind ihre drei Kinder Chris, Karolin und Benni erwachsen. Als Karolin einen queeren Buchladen eröffnet, kommen alle in Berlin zusammen, selbst Chris, der Professor in New York ist und damit das, was Ruth sich immer erträumte. Dort bricht der alte Konflikt endgültig auf. »Schönwald« ist der mitreißende Roman einer Familie und zweier Generationen, die nie gelernt haben, miteinander zu reden - und die ein großes Geheimnis miteinander verbindet. »›Schönwald‹ ist ein entlarvender, preisverdächtiger Roman, vielleicht sogar ein Buch des Jahres.« ― WDR 5 "Bücher"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 755
Ähnliche
Impressum ePUB
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Covergestaltung: XXXX
Coverabbildung: zero-media.net, München
Covercopyright: Covergestaltung zero-media.net, München unter Verwendung des Gemäldes »Kaffee« (2006 von Christan Brandl © VG Bild-Kunst, Bonn 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
1 – Schönwald
2 – Long Island Sound
3 – Von-Melle-Park
4 – Transatlantik
5 – Europa
6 – Beethovenhalle
7 – Hahnwald
8 – Zoo
9 – Leo’s
10 – Gendarmenmarkt
11 – Peshawar
12 – Morningside Heights
13 – Templin
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für Karina, von der und für die alles ist.
1Schönwald
Es war gerade erst halb neun, wie lange würde das hier wohl noch gehen und wie viel würde Hans-Harald noch trinken, fragte sich Ruth von ihrem Beobachtungsposten aus. Sie hatte in einem halben Jahrhundert voller sozialer Verpflichtungen die Technik perfektioniert, in Gruppen eingebunden und an Gesprächen beteiligt zu wirken, wenn sie eigentlich gar nicht da war. Sie musste sich dafür nur möglichst nah an eine lebhafte Gruppe heranstellen und manchmal tonlos in deren Richtung lachen und dazu die Lippen bewegen.
Sie hatte sich also in den Rücken eines Halbkreises aus Freunden ihres Sohnes gestellt, alles Akademiker, die an Universitäten mit klangvollen Namen wie Berkeley oder Yale lehrten. Sie kannte diese jungen Männer, teilweise schon seit Jahrzehnten, doch sie hatten, abgesehen von einem tadellos vorgetragenen Begrüßungsritual, zum Glück keine Notiz von ihr genommen, eine perfekte Tarnung. Ruth hörte sie darüber diskutieren, wo eigentlich Chris sei. Ließ sie alle anreisen zu dieser angeblich so wichtigen Eröffnung seiner Schwester, und wer nun nicht da war, war er.
Ruth zupfte an ihrem Kostüm und brachte die Schulterpartie wieder in Form. Sie war schmaler geworden, obwohl sie ihre Schultern zweimal in der Woche im Frauenfitnessstudio an Geräten trainierte. Dabei war es Hans-Harald, dem sie immer sagte, er müsse aufpassen, nicht zu mager zu werden, während sie hoffte, dass man es bei ihr nicht bemerkte. Sie war immer schlank gewesen und groß für eine Frau und mit einem Meter neunundsiebzig einen Zentimeter größer als ihr Mann.
Beim Kofferpacken zu Hause in ihrem Vorort von Köln hatte sie länger darüber nachgedacht, was man wohl zur Eröffnung eines schwul-lesbischen Buchladens in Berlin trüge, und hatte sich schließlich, aber immer noch zweifelnd, für den Stil »Theater-Premiere am Schauspiel Köln« entschieden. Nicht Theater-Vorstellung, sondern Premiere, eine Kategorie rauf, das hieß Kostüm, schwarze Nylonstrumpfhose, hohe, aber nicht zu hohe und vor allem nicht spitze Schuhe sowie Schmuck, Kette aus Weißgold, Brosche mit grünem Smaragd, Armreif aus Weißgold.
Ihr Blick ging zwanzig Meter durch den Raum zu ihrem Mann. Die meisten hier kannten ihn als Harry, so wurde er seit Kindheitstagen genannt, doch Ruth, die generell Spitznamen ablehnte, fand »Harry« besonders unpassend und hatte ihren Mann als eine der wenigen seit ihrer Hochzeit Hans-Harald gerufen. Hans-Harald stand nicht im toten Winkel einer Gruppe, er stand mittendrin. Seine warmen dunklen Augen blitzten, beim Reden schloss er sie häufig, ein Zeichen, das Ruth aus fünfzig Jahren Ehe kannte. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte sie es gehasst, ihn so zu sehen. So amüsiert, so bei sich, so – sie wusste, dass es ein zu großes Wort war: glücklich. Hoffentlich trank er nicht so viel. Nachher auf dem Weg zum Hotel am Gendarmenmarkt würde sie ihn sonst beim Gehen wieder stützen müssen.
Sie hatte lange darüber nachgedacht, ob ihm der Grund für diese Eröffnung insgeheim auch komisch vorkäme, aber sie hatte sich nicht die Blöße geben wollen, ihn zu fragen. Margot Schuler, die Vorsitzende ihres monatlichen Buchclubs, hatte neulich erzählt, dass auch die großen Buchhandlungen jetzt eigene Ecken für »Kwiere Literatur« einrichteten. Und hätte Margot, mit ihren vierundsiebzig Jahren, diese Genrebezeichnung nicht so aufreizend lässig verwendet, Ruth hätte nachgefragt. So aber musste sie mit dem Hinweis, sie ginge eben mal den frischen Kaffee holen, auf dem Weg in die Küche mit unauffälligem Griff ihr überproportional großes Smartphone von der Kommode mitgehen lassen, um schnell, während der Kaffee seine letzten röchelnden Durchlaufgeräusche machte, bei Google den Begriff »Kwiere Literatur« einzugeben.
Ruth war schon klar, dass es so nicht heißen konnte, aber irgendwo musste sie anfangen. Sie ärgerte sich. Sie würde es nie laut aussprechen, aber wenn man ehrlich war, war sie in dieser Buchclubrunde die Einzige, die Bücher von Literatur unterscheiden konnte. Die nicht nur gerne las, weil man das aus einer bestimmten Generation und Schicht kommend (Nachkriegs-BRD, Bildungsbürgertum) eben so machte.
Das erste Ergebnis, das der Suchbegriff »Kwiere Literatur« hervorbrachte, war einer vom Lesben- und Schwulenverband mit dem Titel »Corona: Auswirkungen auf Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans« veröffentlicht auf einer Webseite namens queer.de. Da war’s: kwier beziehungsweise queer.
Wie einfach die Welt doch geworden war und wie unendlich kompliziert. Jetzt vor der Kaffeemaschine in der Küche ihres Hauses in Köln war sie kurz stolz gewesen. Überhaupt war sie in letzter Zeit, anders als Hans-Harald, mit dem Smartphone immer gewandter geworden. Sie konnte WhatsApp und FaceTime und hatte die Emojis entdeckt.
Rätselhafterweise war im gleichen Maße, in dem sich ihr Geschick beim Umgang mit dem Smartphone gesteigert hatte, Hans-Haralds Ratlosigkeit über sein Gerät, das hoffnungslos veraltet war, ins Verzweifelte gewachsen.
Auf der Schaufensterscheibe der Buchhandlung, die ihre Tochter Karolin, die mittlere ihrer drei Kinder, an diesem Abend in Berlin in einer Gegend eröffnete, die ansonsten Wettbüros, Shisha-Cafés und Goldjuwelieren vorbehalten schien, stand nun also They/Them. Fachbuchhandlung für Queere Literatur.
Queer heiße nicht unbedingt lesbisch, hatte Ruth ihren Freundinnen in Köln vielleicht etwas zu defensiv erklärt, als sie von der bevorstehenden Berlinreise erzählte, die sie und Hans-Harald antreten würden: lieber mit dem Zug statt mit dem Auto, das schöne Hotel am Gendarmenmarkt, nicht zu weit, aber eben doch in einer ganz anderen, angenehmeren Gegend als die Wohnung der Tochter, bei der oft die Junkies im Hauseingang lägen.
»Aber auch nicht hetero«, hatte Gabriele Bongarts eingewandt und damit der Frage den Raum geöffnet: Was denn dann?
»Entweder bist du homo- oder heterosexuell. Dazwischen gibt es ja nichts.« Das war natürlich Christa König mit ihrer tiefen, Furcht einflößenden Stimme und ihrem, wie Ruth schon immer gefunden hatte, ebenso überschaubaren Weltbild. Denn genau dieses Entweder-Oder war eben in einer sich wandelnden Welt nicht mehr richtig. Ruth wusste auswendig herunterzubeten, was noch alles als geschlechtliche Orientierung infrage kam. Sie konnte, ohne sich zu verhaspeln, LGBTQIA sagen und erläutern, welcher Buchstabe wofür stand. Lesbisch-Gay-Bisexuell-Transgender-Queer-Intergeschlechtlich-Asexuell.
»Mama«, hatte Karolin gesagt, »wenn du dein Facebook-Profil erstellst, gibt es allein siebenunddreißig Gender zur Auswahl.« Karolin hatte ihr an langen Abenden das Konzept ihres Geschäfts mehrfach erklärt, und auch warum es immer ihr Lebenstraum gewesen sei, einen solchen Laden zu eröffnen. Das hatte Ruth verwundert, sie hatte fast vierzig Jahre nichts von dem Lebenstraum ihrer Tochter gewusst. Das Leben ihrer Tochter hatte sie sich, nachdem Karolin zum Glück nach zwei Semestern an der Kunstakademie auf Kunstgeschichte umgesattelt hatte, immer als die Karriere einer Kuratorin an einem städtischen Kunstmuseum vorgestellt oder vielleicht an der Universität – und natürlich mit Kindern und einem Mann.
Doch stattdessen sollten sich diese siebenunddreißig Geschlechter, oder wie viele es waren – außer einem, nämlich dem männlichen –, in der heute zu eröffnenden Buchhandlung wiederfinden. Karolin hatte sie mit einer, wie sie betonte: einer Freundin zusammen eröffnet, nicht mit ihrer Freundin. Wie sich solch eine spezialisierte Buchhandlung finanziell über Wasser halten sollte, war Ruth auch nach mehreren Präsentationen eines sogenannten Businessplans, den Karolins Freund, von dem Ruth immer gehofft hatte, er sei ihr Freund, erstellt hatte, schleierhaft geblieben, wenn es in der Buchhandlung nicht einmal Jonathan Franzen oder ihretwegen wenigstens Joachim Meyerhoff zu kaufen gebe.
»Aber jetzt komm doch mal weg von dem männlichen Blick, Mama«, hatte Karolin erklärt. »Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass die von der patriarchalischen Gesellschaft überhörten und mundtot gemachten Erzählstimmen bei uns ihren eigenen Raum bekommen. Einen Safe Space, weißt du?«
Das Problem, das Ruth mit alldem hatte, bestand darin, dass sie sich zeitlebens, gerade was intellektuelle und gesellschaftliche Strömungen betraf, als moderne Frau gesehen hatte und stolz darauf war. Doch die Attribute, die aufgeklärtes Leben und Denken heute verlangten – Bioessen, Pilates, gendergerechte Sprache, Identitätspolitik –, klangen für sie, wenn sie ganz ehrlich war, alle nach Nonsens. Sollte man denn, nur um mit der Zeit zu gehen, komplett den gesunden Menschenverstand ausschalten? Früher, in der alten Bundesrepublik, war es einfacher gewesen, modern zu sein. Mit Beginn ihres Studiums 1966 in Tübingen hatte sie ein Abonnement der ZEIT abgeschlossen und war für die nächsten fünf Jahre, die Zeitung unter den Arm gerollt, durch das Germanistische Seminar geschritten. Wie alle Germanistikstudenten der späten Sechzigerjahre las sie Hermann Hesse, doch anders als die Hippies und Rebellen, die den kitschigen Steppenwolf liebten, erkannte sie in der Kontemplation des Glasperlenspiels Hesses stärkste Arbeit, denn es war, wie sie ihren Kommilitoninnen sagte, sein Gruß an Thomas Mann. Als junge Ehefrau las (und verstand) sie Erich Fromms Kunst zu Lieben; als junge Mutter Alice Millers progressive Pädagogikbücher.
Ruth hatte, auch wenn es lang her war, genügend Zeit an literaturwissenschaftlichen Seminaren westdeutscher Universitäten verbracht, als dass ihr die Klagen über die patriarchalische Perspektive neu wären, und es war nicht so, als ob sie das intellektuell nicht begriffe oder sogar unterstützte – und doch war ihr das »Brimborium« darum richtiggehend zuwider. Frauenbuchhandlungen gab es seit den Sechzigern, da hießen sie »lila Buchläden«, und Ruth hatte sie damals schon als bedrückend empfunden. Nun versahen Leute wie Karolin und ihre Partnerin (Businesspartnerin, nicht Lebenspartnerin, hoffentlich) die lila Buchläden mit neuen Labeln und Akronymen und verkauften sie als Durchbruch in der Geschichte der Geschlechter. Essen direkt vom Bauern hatte sie mit ihrem Vater schon Anfang der Fünfzigerjahre erworben. Es war das, was arme Leute kauften (sie waren nicht arm, aber Ruth gefiel sich in der Vorstellung, dass sie es damals waren). Heute nannten ihre Kinder das »Farm to Table«, und es kostete ein Vermögen. Ruth wusste, dass sie sich gegenüber Karolin solche Kommentare dazu verkneifen musste.
Seit einigen Jahren nährte sie die Hoffnung, dass sie ihre eigene Unzufriedenheit vielleicht besser ertragen könnte, wenn wenigstens die Kinder glücklich wären (und mit gewissen Abstrichen auch Hans-Harald). Soweit sie wusste, hatte ihre Tochter keinen Mann, erst recht keine Kinder, und lebte in einem Gebäude, dessen Treppenhaus Junkies als Schlafplatz nutzten. Wenn es dann eben dieser queere Buchladen war, in dem sich Karolins Zufriedenheit manifestierte, dann würde Ruth sie darin unterstützen. Deswegen hatten Hans-Harald und sie auch nicht lange gezögert, als Karolin gefragt hatte, ob sie sich vorstellen könnten, ihr zu ihrer Unternehmensgründung ein Startkapital zuzuschießen. In dem vorausschauenden Wissen, dass die Generation ihrer Kinder sich möglicherweise nicht mehr darauf verlassen konnte, dass es ihnen automatisch besser ginge als den Eltern, hatte Ruth vor dreißig Jahren einen Fond angelegt, dessen Zugewinne und Verluste sie inzwischen fast täglich auf ihrem iPad kontrollierte. Das Geld hierfür hatte wiederum aus dem Erbe ihrer Eltern gestammt. Außer der Renovierung des Gästebads und ein paar Schiffsreisen, mit dem Postboot durch die Fjorde, mit der Queen Mary II nach New York, war ihr wenig eingefallen, wofür sie das hauptsächlich in Bundesschatzbriefen angelegte Geld sinnvoll verwenden könnte. Sinnvoll, darauf kam es ihr an. Ihr Vater hatte so hart für dieses Geld gearbeitet. Er kam zwar aus einer guten Theologenfamilie, aber nach dem Krieg hatten auch sie nicht mehr viel gehabt. Tagsüber hatte er als Tischler zerstörte Schrankwände und zerbrochene Stühle repariert, nachts Mathematik studiert, dazu noch drei Töchter und zwei Söhne zu Hause.
Siebzig Jahre später ging das Geld nun eben in einen schwul-lesbischen Buchladen oder so was Ähnliches. Das war wohl der Lauf der Dinge. Trotzdem wäre es doch sicherlich im Sinne ihres Vaters gewesen, seine Enkelin bei ihrer Existenzgründung zu unterstützen. Außerdem war Karolin die letzte der drei Kinder, die die großelterliche Anschubfinanzierung in Anspruch nahm. Christopher, der Älteste, hatte sie schon Ende der Neunzigerjahre für sein Studium in New York genutzt, damit er endlich in sein Sehnsuchtsland Amerika hatte ziehen können, und Benni, der Jüngste, hatte von seinen Hunderttausend (plus Inflationsausgleich, den hatte Ruth immer minutiös ausgerechnet) ein Fertighaus auf einer, wie Christopher immer sagte, »von AfD-Wählern umzingelten Wiese« an einem Waldrand bei Templin errichten lassen.
Benni war schon seit dem frühen Morgen hier und hatte Karolin geholfen, die letzten Regale an die Wand zu dübeln, die beladen mit queeren Büchern sichtlich zu schwanken begonnen hatten. Karolin wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass die Bücherborde kippen könnten, es war Bennis Frau Emilia gewesen, die plötzlich geschrien hatte, als ihre beiden Jungs, August und Otis, versuchten, an ihnen hochzuklettern. Hinter dem Rücken von Bennis Frau hatte Karolin die Augen verdreht. Das Überbeschützermandat, das Emilia an ihren Kindern auslebte, hatte in den vergangenen Jahren schon häufiger die halbe Familie genervt, doch eine Ausweitung des Mandats auf ihren Buchladen überschritt nun wirklich eine Grenze, hatte Karolin gesagt.
Ruth hatte mit aller mentalen Kraft, die ihr zur Verfügung stand, versucht, die kleine Irritation zu ignorieren. Ihr Gehirn berechnete in Sekundenschnelle, welche Auswirkung die Irritation auf die Zukunft haben würde, in diesem Fall also auf den weiteren Verlauf jenes Tages, für den sie extra aus Köln angereist war: Benni würde sich, auch wenn er es selbst lächerlich fand, auf die Seite seiner Frau stellen müssen und damit gegen seine Schwester. Dass die Kinder sich gut verstanden – nein, mehr als das: dass sie am besten überhaupt nie einen Konflikt austragen müssten –, das war ihr, so hatte es Ruth vor Jahren für sich festgelegt, das Allerwichtigste. Und so hatte sie mit großer Erleichterung registriert, dass Benni schon so früh gekommen war, um seiner Schwester bei den Vorbereitungen zu helfen, und kommentarlos Dübel in die frisch getünchte Wand rammte, damit Karolins Bücherregale nicht auf die Kinder fallen konnten.
Bloß auf welche Kinder überhaupt, dachte Ruth dann und bemühte sich schnell, die Bitterkeit, die sie überkam, wegzuwischen. Welche Kinder würden sich ausgerechnet in eine queere Buchhandlung verirren? Karolins jedenfalls nicht, sie hatte keine. Und nach allem, was Ruth hier auf der Eröffnungsparty erkennen konnte, würde sich das so bald auch nicht ändern.
Christopher war immer noch nicht da, es ging auf neun Uhr zu. Ruth konnte seine Freunde hören (sie hatte sich seit zehn Minuten keinen Zentimeter von ihrem Beobachtungsposten wegbewegt), wie sie beratschlagten, in welche Bar sie jetzt angesichts von Chris’ Abwesenheit weiterzögen.
Und gerade als sich in Ruths Kopf ernsthaft das Katastrophenszenario ausbreiten wollte, dass Christopher zum großen Tag seiner Schwester nicht auftauchte, nachdem er doch letzte Nacht extra aus New York gekommen war – sich mit Meilen auf Business Class hochgestuft, sodass er schlafen konnte und fit sein würde für die Eröffnung (sie hatte in steter Sorge, dass er sich in seinem Beruf und zwischen den Zeitzonen auf seinen vielen Reisen überanstrengte, sogar darüber hinweggesehen, dass sie dieses Business Class-Tamtam von ihm eigentlich verabscheute, ja gar eine Charakterschwäche darin vermutete) – gerade also, als die Katastrophe, die aus Christophers Abwesenheit für die innergeschwisterliche Beziehung folgen würde, in ihrem Kopf Form anzunehmen begann, hörte Ruth irgendwo vorne im Laden etwas platschen.
Sie konnte nicht sehen, wo das Geräusch herkam, aber dann hörte sie Schreie und schließlich ein dumpfes Raunen. Ihr Blick ging durch den Raum zu Hans-Harald, der das Platschen in seiner Runde zunächst mit einem lustig gemeinten »Huch!« quittiert, doch als niemand lachte, ein ernstes Gesicht aufgesetzt hatte.
Dann folgte ein zweites Platschen, lauter als das erste, vielleicht auch nur, weil es jetzt still im Raum war. Die Gäste im hinteren Teil des Geschäfts drängten nach vorne, wo man offenbar schon zu wissen schien, was los war. Ruth musste aus einer Art Nebenzimmer um die Ecke kommen, und in dem Nadelöhr zwischen den Räumen staute es sich.
Sie fragte eine Art Fabelwesen neben sich im Gedränge, ein junger Mann offenbar, schlaksig, mit einem von Pomade festgekleisterten Scheitel und in einem grauen Nadelstreifenanzug mit Hosenträgern darunter. Hosenträger unter Nadelstreifenanzug, das hatte Ruth zuletzt bei ihrem Vater gesehen.
»Wissen Sie, was passiert ist?«
In einer glockenhellen Frauenstimme antwortete das Fabelwesen im Nadelstreifenanzug: »Etwas ist an die Scheibe geknallt. Wir hatten gestern schon Ärger mit denen. Und vorgestern. Wegen dem Nazigeld.«
Ruth verstand kein Wort. »Ärger mit wem? Mit Nazis?« Nicht, dass sie in Berlin nicht alles für möglich hielte.
»Nein, nicht mit Nazis«, sagte das Fabelwesen über seine oder ihre Nadelstreifenschulter. »Mit den Instagram-Kids.«
Als Ruth mit den anderen Gästen endlich in den vorderen Geschäftsraum waberte, glaubte sie, in eine Unfallszene geraten zu sein. Blut rann von der kleinen Schaufensterscheibe, die Karolin und Benni am Nachmittag noch mühsam mit den Worten »They/Them« beklebt hatten. Außerdem lief etwas dickflüssiges Schwarzes an der Scheibe herunter. Sie hatte jetzt ein Muster aus schönen konzentrischen Kreisen, dort wo das Glas zwar gesplittert, aber nicht zerbrochen war. Jemand oder etwas musste dagegengeknallt sein.
Automatisch suchten Ruths Augen ihre Kinder. Da war Karolin. Ihr fassungsloser Blick erfüllte Ruth augenblicklich mit Traurigkeit, aber Karolin war nicht verletzt. Auch Benni war unversehrt, er jagte seinen beiden Jungs hinterher, angetrieben von Emilia, die ihn anschrie: »Bring die Kinder in Sicherheit. Das ist ein Terroranschlag!«
Und dann setzte verlässlich Ruths über Jahrzehnte antrainierter Reflex ein, der schon ein Zwang war, nämlich jedes Unglück als »nicht so schlimm« zu deklarieren. Während die meisten Besucher von dem Schaufenster weg strömten, schritt Ruth näher und betrachtete die Scheibe.
»Ist nur Farbe, ist nur Farbe«, rief sie in den Raum hinein. »Nicht so schlimm, kann man bestimmt abwaschen!« Tatsächlich müssen es Farbbeutel gewesen sein, die gegen die Scheibe geflogen waren, und draußen standen keine Terroristen, sondern vielleicht zwölf bis fünfzehn aufgebrachte junge Ausländer, wie man früher gesagt hätte. Manche trugen Schilder, alle waren komischerweise angezogen wie die Eröffnungsgäste – hoch über der Hüfte sitzende Hosen, lila, rote oder blaue Strähnen in den Haaren, manche mit zusammengefilzten Zöpfen, die Dreadlocks hießen, wie Karolin ihr erklärt hatte, und die ursprünglich aus Jamaika stammten oder aus Tansania.
Und dann sah sie Christopher. Er war da! Er hatte die Eröffnung seiner Schwester gar nicht vergessen, er hatte auch nicht plötzlich etwas Besseres vorgehabt, und ihm war auch nichts Chaotisches dazwischengekommen, wie so häufig. Nein, er stand draußen und schrie sich mit den Demonstranten an. Für seine Schwester! Auf Englisch! Er war doch inzwischen ein echter New Yorker und würde sich von ein paar Kindern mit Dreadlocks nicht einschüchtern lassen. Wahrscheinlich war er schon die ganze Zeit hier draußen gewesen und hatte versucht, den Anschlag zu verhindern.
»Are you calling me a Nazi, too?«, brüllte Christopher jetzt.
Das war Ruth bei aller Freude über den Einsatz für seine Schwester doch ein bisschen unangenehm, zu laut, zu viel. Was immer die Farbbeutelschmeißer für ein Problem mit ihrem Sohn und wohl auch ihrer Tochter hatten, Ruth hätte es bevorzugt, das diskret zu klären. Aber dafür schien es zu spät. Christopher hatte, seitdem er fünfzehn gewesen war, alle möglichen Mitmenschen, nicht nur Lehrer und Polizisten, als Nazis bezeichnet, bei ihm gab es sogar den »SPD-Nazi«, einen Begriff, mit dem er vor allem seinen Vater belegt hatte. Ruth empfand diese Leichtfertigkeit ihres Sohns als Hohn auf die Menschen, die wirklich unter den Nazis gelitten hatten (nicht, dass sie welche kannte). Dass Christopher jetzt wieder irgendwas über Nazis auf Englisch quer über den Gehweg schrie, war Ruth nicht nur peinlich, sie fand es unerträglich, ja unappetitlich.
Und was sollte das überhaupt mit den Nazis? Was hatten Nazis mit der Eröffnung eines Buchladens zu tun?
Sie hatte sich auf interessante Diskussionen über Diskriminierung von Homosexuellen eingestellt und sich auch mit der erneuten Lektüre der entscheidenden Stellen bei Thomas Mann in Tonio Kröger, Unordnung und frühes Leid und natürlich dem Tod in Venedig ein bisschen vorbereitet. Sie hatte sich sogar ausgemalt, wie sie in einem angeregten Gespräch einem modischen Schwulen erklärte, dass Homosexualität keineswegs, wie er vielleicht zu denken schien, ein modernes Phänomen sei, sondern schon bei Thomas Mann behandelt wurde, nur eben gezwungenermaßen auf subtilere Weise, als die Schwulen von heute darüber sprechen könnten. Sie hatte darin eine nahezu ideale Gelegenheit gesehen, ihren Lieblingspunkt zu machen, nämlich dass die Menschen es früher schwerer hatten, auch die schwulen.
Karolin trat heraus auf den Bürgersteig zu ihrer Mutter. Wenn sie verärgert oder verängstigt war, sah man es ihr nicht an. Sofort wurden die Nazirufe lauter, die Menge war inzwischen angewachsen. Ungefähr ein Dutzend Passanten, die meisten junge arabische Männer, hatten sich dazugestellt, filmten mit ihren Handys, redeten laut auf Arabisch und fielen gelegentlich lachend in die Nazichöre ein. Für sie musste das aussehen wie einer der inzwischen schon üblichen Konflikte in diesem Bezirk, die stets aufflammten, wenn wieder ein Sportwettenbüro für eine Naturwein-Bar weichen musste.
»Gebaut, gebaut – auf Nazigold! Gebaut, gebaut – auf Nazigold!«
Ruth suchte jetzt Hans-Harald, interessanterweise war es immer noch er, der in Konfliktsituationen ruhig blieb, anders als Christopher, der sich produzierte, und Karolin, die den Konflikt mit Sturheit verschärfte, oder Benni, der ihm am liebsten aus dem Weg ging. Sie entdeckte Hans-Harald drinnen im Buchladen. Er hatte schon die Polizei gerufen. Ganz der alte Staatsanwalt sah sie ihn mit unaufgeregten, präzisen Worten berichten, was vorgefallen war, und wie immer würde er darauf achten, Interpretationen, Spekulationen oder Verdächtigungen zu vermeiden.
Ruth hielt es für eine Kunst, mit Behörden richtig zu sprechen. Die wenigsten Menschen konnten das, aber Hans-Harald hatte eben eine lange Karriere als Staatsanwalt hinter sich, natürlich konnte er dann sprechen wie eine Behörde, er war ja quasi die Behörde! –, aber er hatte das auch schon gekonnt, als sie sich 1968 kennengelernt hatten.
»You stupid idiots, it’s a queer bookstore! It’s not a Nazi store. What’s wrong with you guys?«
Als würde Christophers selbstverliebtes Gebrüll – auf Englisch! – jetzt noch irgendetwas ändern. Es war mehr als nur unpassend inzwischen, fand Ruth. Sie wischte Karolin mit ihrer Hand über den Rücken, als säubere sie eine Tafel mit einem Schmiertuch, beugte sich zu ihr und hörte sich sagen: »Toll, dass Christopher sich so für dich einsetzt, oder?«
Karolin blickte ihre Mutter in einer Mischung aus Irritation und Abwesenheit an, schüttelte den Kopf.
»Der weiß gar nicht, worum es geht.«
»It’s not a Nazi store!« Wieder Christopher. Jetzt reichte es. Ruth wandte sich ihm zu und bewegte ihre Hand auf Hüfthöhe auf und ab, als würde sie auf Wasser schlagen, presste die Lippen zusammen und schüttelte leicht den Kopf.
»Natürlich nicht. Das ist ja das Schlimme.«
Ruth drehte sich um. Ein junger Mann mit dunkler Hautfarbe war hervorgetreten. Inmitten des Gedränges und Geschreis war er ganz ruhig. Seine Worte strahlten die Ruhe desjenigen aus, der wusste, dass er schon gewonnen hatte; für den Typen wie Christopher, die aus dem 20. Jahrhundert kamen und auf Englisch rumschrien, keine Gegner waren. Der Kampf würde ja schließlich nicht hier auf der Straße entschieden, sondern ganz woanders. Womöglich an Orten, an denen sich Christopher gar nicht auskannte.
Der junge Mann sagte: »Wir können auch sehen, dass dort Judith Butler im Schaufenster liegt. Wir sind keine Idioten, auch wenn du uns vielleicht dafür hältst, weil wir braun sind.«
»Braun?« Zu ihrer großen Enttäuschung bemerkte Ruth, dass ihr Sohn seit einigen Minuten nichts mehr mit dem Ivy-League-Professor aus New York gemein hatte.
»Braune Hautfarbe, Mann. Wenn es wenigstens ein Nazibuchladen wäre. Aber so habt ihr es euch besonders perfide ausgedacht. Euer Laden tut so, als wäre er woke und aufseiten der Minderheiten. Aber wieso ist er von einem Nazi bezahlt worden?!«
Ruth hatte keine Ahnung, wovon der Mann sprach, doch Christopher schien verstanden zu haben. Jedenfalls verstummte er und bahnte sich den Weg durch die Menge. Er stolperte an den Demonstranten vorbei. Alle Spannung schien von ihm abgefallen, ein Mann Mitte vierzig in Blundstone Boots, zu enger schwarzer Jeans, und seinem über alles geliebten alten Margiela-Sakko, der durch eine Menge Zwanzigjähriger taumelte, die respektvoll, fast mitleidig Platz machte.
»Das Geld für den Laden kommt doch von Großvater!« Christopher stand nun vor seiner Mutter und seiner Schwester. Was er sagte, stimmte. Ruth hatte ja häufig genug davon in langen Familien-Zoomcalls gesprochen. Heimlich hatte sie gehofft, dass die Geschwister Karolin vielleicht noch von der Buchladenidee abbringen würden.
»Meinen die das? Der war doch kein Nazi, oder?«
»Papperlapapp. Natürlich nicht«, sagte Ruth. Und nach kurzem Nachdenken, lauter und unbestimmt zu den Demonstranten: »Ich verbitte mir das!«
»Fragt sich nur, wie die darauf kommen, wenn da gar nichts dran ist, Mama.«
Ruth kannte das von Karolin. Sie war das einzige der drei Kinder, bei dem es ihr gelungen war, eine emotionale Bindung aufzubauen, die es dem Kind erlaubte, seinen Frust bei der Mutter abzuladen. Jetzt würde Ruth erst mal schuld sein, bis Karolin sich beruhigte. Wahrscheinlich würde sie sich sogar auf die Seite der Demonstranten schlagen, gegen ihre Mutter, gegen ihren Großvater, letztlich gegen sich selbst.
»Hier, lies den Scheiß«, sagte Karolin und reichte der Mutter ihr Handy. »Ich hatte gehofft, ich könnte es von dir fernhalten. Das geht seit Wochen so.«
»Da geht es um Vati?« In ihrer Angst nutzte Ruth den Namen, den sie für ihren Vater als Kind gebraucht hatte, obwohl sich in den letzten Jahrzehnten, mit Geburt ihrer eigenen Kinder, in der Familie der Begriff »Großvater« durchgesetzt hatte. Ihr Vater hatte 1975, als Christopher zur Welt kam, als Generalleutnant, der er damals war, die Bezeichnung »Opa« abgelehnt und sich den autoritätsgebietenderen Titel »Großvater« auserbeten und hätte damit seine Frau, Ruths Mutter, theoretisch zur Großmutter gemacht, was diese allerdings kategorisch ablehnte: Großmutter klinge ihr zu streng. Sie wolle lieber eine fröhliche Oma sein, sagte sie, eine Generalsgattin im Nerzmantel, perfekt auf Empfängen und Bällen, die über die aktuelle Inszenierung des Käthchen von Heilbronn an den Kammerspielen genauso flüssig sprechen konnte wie über Brendels neuste Aufnahme von Beethovens Klavierkonzerten.
»Oma oder nichts. Tut mir leid.« Und so fanden sich Christopher, Karolin und Benni, sobald sie sprechen konnten, der für Kinder rätselhaften Kombination aus »Oma und Großvater« ausgesetzt.
Auf Karolins Handy war Instagram geöffnet. Ruth hoffte, dass sie schnell würde erfassen können, was sie da sah. Sie durfte sich inzwischen durchaus als WhatsApp-Meisterin fühlen, aber sich mit Instagram zu befassen, dazu hatte sie bisher keine Veranlassung gesehen. Ein Video, zwei junge Menschen mit dunkler Hautfarbe redeten miteinander, sie auffallend gutaussehend, er mit einem Schnurrbart, für den er zu jung schien. Sie erkannte in ihm den jungen Mann, der zuvor aus der Menge hervorgetreten war und Christopher verhöhnt hatte.
Sie sah auf dem Instagram-Video, wie er mit der gut aussehenden Frau sprach, doch Ruth verstand nichts, ihre knochigen Hände griffen Karolins Handy und suchten den Lautstärkeregler. Sie kannte sich inzwischen gut auf ihrem Samsung aus, doch iPhone konnte sie nicht, und es ärgerte sie insgeheim, dass all ihre Kinder auf die minderwertigen Apple-Geräte hereinfielen. Stiftung Warentest hatte doch in unzähligen Tests (die Ruth alle ausgeschnitten hatte und in Klarsichthüllen verwahrte, um sie zu jeder sich bietenden Gelegenheit den Kindern vorzulegen) gezeigt, dass Samsung die gleichen, wenn nicht besseren Funktionen für einen deutlich geringeren Preis bot. Karolin griff ungeduldig ihren Arm und drückte die Lautstärke des iPhones hoch.
»Jetzt hör doch mal zu!«
Die beiden jungen Menschen sprachen sehr selbstbewusst von »einer Kontinuität der Kapitalströme zwischen dem Dritten Reich und der Berliner Republik«. Außerdem verstand Ruth das Wort Nazierbe.
Dann hörte sie den Namen ihres Vaters. Rupert Wartenburg. Was wussten diese beiden Anfangzwanzigjährigen, die so aussahen … aber diesen Gedanken verbat sie sich, egal, die so aussahen, als seien sie nicht in diesem Land geboren, und wenn doch, dann zu einer Zeit, zu der ihr Vater schon tot war – was wussten die von ihrer Familie? Was erlaubten die sich? Ihr Vater war ein Repräsentant der bundesrepublikanischen Elite gewesen, nicht der Naziproleten. Er hatte eine Zeit lang wöchentlich Schach gespielt mit Helmut Schmidt, dem Sozialdemokraten. Wussten die das überhaupt?
Ruth hackte mit dem Zeigefinger auf dem Bildschirm rum. Stopp.
Unter dem Video stand ein Text. Der Buchladen They/Them in bester Kreuzberger Lage, stand da, werde geführt von Menschen mit Nazihintergrund.
– Wir haben keinen Nazihintergrund.
In Deutschland lebten Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, und diejenigen, die den nicht haben, die Herkunftsdeutschen, die hätten logischerweise einen Nazihintergrund, denn wer seine Wurzeln in diesem Land hatte und nicht zu den erschütternd wenigen im Widerstand gehörte, sei eben leider auf die eine oder andere Weise in die Naziherrschaft verstrickt.
– Wer waren diese Menschen?
Ruth blickte auf die Fotos der beiden dunkelhäutigen Gesichter. Malala Noorzai und Azhar Caudhari stand neben ihren Gesichtern, obwohl nicht klar wurde, wer hier die Frau war und wer der Mann.
Karolin Schönwald, schrieben sie – was wollten die von ihrer Tochter!? –, habe in einem Interview selbst zugegeben, sie habe ihre Buchhandlung durch eine Erbschaft finanziert.
– Was heißt Erbschaft? Das klingt abwertend. Es waren vielmehr mühsam angesparte Reserven ihres Vaters für seine drei Töchter und zwei Söhne sowie gegebenenfalls deren Kindeskinder.
Und wer in diesem Land etwas erbe, so hieß es in dem Instagram-Text weiter, in diesem – immer noch – Land der Täter und Verräter, müsse sich im Klaren sein, dass irgendwo in der Kette der Kapitalvermächtnisse relativ bald, zwei, drei Generationen zurück, ein Nazi zu finden sein werde. Jemand, der im Deutschland zwischen 1933 und 1945 sein Geld gemacht oder vermehrt habe. Kapital, das durch Nazihände gegangen sei und in ihnen vermehrt wurde. Eine simple Google-Recherche hätte gereicht, schrieben Noorzai und Caudhari, um zu erfahren, dass Karolin Schönwalds Großvater in Hitlers Wehrmacht Karriere als Soldat gemacht habe und …
– Es war nicht Hitlers Wehrmacht.
… 1944 als junger Offizier in den Generalstab des Heeres berufen wurde. Diese Erfahrungen in der Naziarmee befähigten ihn offenbar dazu, später in der Bundeswehr bis zum General aufzusteigen und somit Macht, Privileg und Kapital anzuhäufen. Geld, das nun dazu genutzt wurde, in einer ursprünglich migrantisch geprägten Gegend Berlins gewachsene Strukturen zu zerstören und eine rein herkunftsdeutsche Enklave zu schaffen durch einen Buchladen, der Bücher verkaufe, die sich mit Problemen befassten, mit denen sich zu beschäftigen die autochthone Bevölkerung in ihrem täglichen Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sowie getrieben vom postkapitalistischen Erwerbsdruck weder über die Zeit noch die Mittel verfüge.
Diese Diktion, dachte Ruth. Lächerlich, verschleierte nur Gedankenschwäche, klang fast nach RAF. Und bitte, was hatte der Unfug nun mit ihrem Vater zu tun? Diese Menschen waren schlecht informiert und brachten alles Mögliche durcheinander, und das in schlechtem Deutsch. Schon in ihrer Zeit als Dozentin an der Universität war ihr das in den Jahren vor ihrer Pensionierung aufgefallen. Was war mit den Gehirnen der jungen Menschen geschehen?
Lebenslüge, sagten Malala und Azhar, eine Lebenslüge sei es, dass Karolin nicht offenlege, von wem sie das Nazigeld geerbt habe, und somit zu ihrer Schuld stehe. Ihre »Schuld ownen«, sagten sie, vom englischen Verb to own, etwas besitzen. Ihre Tochter solle ihre Schuld anerkennen. Ihre Tochter? Sie war 1978 geboren. Sogar sie selbst, Ruth, war erst zwei Jahre nach Kriegsende auf die Welt gekommen, wo läge denn streng genommen ihre Schuld? Mit einem gruseligen Interesse hatte sie in den späteren Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Debatten um den Begriff »Kollektivschuld« verfolgt. Geschichtstheoretisch stimmte das Konzept, in der Praxis hatte Ruth immer Schwierigkeiten gehabt, es anzuwenden. Sie alle seien jetzt schuld? Qua Geburt?
Manchmal hatte sie sich vorgestellt, dass die Schuld mit jedem Jahr, das sie auf der Welt verbrachte, ein bisschen kleiner wurde. Obwohl um über Schuld zu sprechen oder nur nachzudenken, meistens gar keine Zeit gewesen war, jedenfalls die ersten zehn Jahre ihrer Kindheit nicht. Ein neues Leben, ein neues Land mussten aufgebaut werden.
Als Ruth zehn war, 1957, wusste sie nichts vom Holocaust. Als sie zwanzig wurde und stolz in Tübingen studierte, stürmten ihre Kommilitonen in die Vorlesung »Germanistik I« und wollten schreiend wissen, wessen Eltern dabei gewesen waren, als Deutschland die Welt angezündet und die Juden vergast hatte. Ruth glaubte nicht, dass ihre Eltern dabei gewesen waren, allerdings hatte sie auch nie gefragt. Als sie dreißig war, hatte sie schon ihr erstes Kind, geboren in den freien Siebzigerjahren eines schüchternen Westdeutschlands, ein Kind von unschuldigen Eltern.
Als Ruth vierzig war, erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die ersten Aufsätze von Historikern, die dafür eintraten, dass jetzt auch langsam Schluss sein könnte mit der ewigen Schuld. Dass die Verbrechen der Nazis eben doch nicht so einzigartig gewesen seien, wie Ruth das immer eingeprügelt wurde, sondern durchaus in den Zusammenhang mit den anderen Gräueln (Gulag, Bolschewisten, stalinistische Säuberungen) des an Gräueln nicht armen 20. Jahrhunderts gestellt werden müssten. Als dann von London aus Jürgen Habermas dieser Deutung nachdrücklich widersprach, entzündete sich, vierzig Jahre nach Ende des Krieges, zum ersten Mal eine wissenschaftliche Debatte darüber, was Schuld für Deutschland eigentlich bedeuten könnte, der sogenannte Historikerstreit, der mehr als ein Jahr lang andauerte. Die Positionen der FAZ-Historiker passten zum politischen Klima und zur geistig-moralischen Wende, die der neue Bundeskanzler in seiner ersten Regierungserklärung 1982 ausgerufen und die auch Ruth als durchaus notwendig empfunden hatte. Und als Ronald Reagan vier Jahre später zu Besuch zum kleinen Bruder Deutschland kam, war es schon wieder in Ordnung für den Bundeskanzler und den US-Präsidenten, in dem Städtchen Bitburg auf einem Soldatenfriedhof Blumen niederzulegen, auf dem SS-Männer begraben lagen. Irgendwann muss doch mal eine Normalisierung eintreten, glaubte auch Ruth.
Als sie sechzig wurde, war Deutschland längst wiedervereinigt und richtete die Fußballweltmeisterschaft aus. Man durfte wieder deutsche Fahnen schwenken und sie sich sogar an die Antenne des Audi heften. Wenn die Deutschen gewannen, konnten sie in den Stadien und Innenstädten »Sieg, Sieg, Sieg« skandieren, mussten das »Heil« aber noch weglassen.
Zu ihrem siebzigsten Geburtstag schließlich war kurz zuvor Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden, und Ruth wurde klar, dass das amerikanische Versprechen verwirkt war. Dass die alte Ordnung wohl nicht würde aufrechterhalten werden können. Die Ruhe und der Frieden, in dem die Deutschen leben konnten, hatten ja nur existiert im Schatten der großen USA, die das Land mit Popkultur und Moral versorgt hatten, solange sie dazu in der Lage gewesen waren. Das fürs Erste möglicherweise Letzte, was aus den USA über Instagram und Twitter noch nach Deutschland geschwappt kam, war die Identitätspolitik. Der Aufstand der Minderheiten gegen die weiße, westliche, heterosexuelle Herrschaft mit ihren Privilegien, ja, auch so ein Modewort, wie Ruth fand.
Im Windschatten dieses Aufstands hatte ihre Tochter ihren Buchladen eröffnen können. Wie hatte sie gesagt? »Die von der patriarchalischen Gesellschaft überhörten und mundtot gemachten Erzählstimmen.« Aber so wie es aussah, sollten diese Stimmen, kaum waren sie für ein paar Stunden in Karolins Buchladen laut geworden, gleich wieder erstickt werden. Weil ihre Artikulation von Nazigeld bezahlt wurde, wenn Ruth das richtig verstanden hatte. Das Geld ihres Vaters, der, das wusste sie, kein Nazi gewesen war.
Christopher nahm ihr Karolins Handy aus der Hand.
»I’ll take care of it, Mama.« Er sprach schon wieder Englisch, als fände er in der fremden Sprache irgendeinen Halt. In Deutschland, das wusste sie, gab es auch gute Literaturwissenschafts-Institute. Er würde vielleicht auch hier lehren können. Aber das schien ihm noch nie in den Sinn gekommen zu sein. Deutsche Universitäten und ihre Wissenschaftler interessierten ihn nicht. Aber Hans-Harald und sie wurden nicht jünger. Wenn er Familie hätte, dort in den USA, dann verstünde sie seine Zurückhaltung vielleicht, aber so? Sie hatte sich vorgenommen, ihn nicht zu fragen.
»Vielleicht müssen wir jetzt mal am Wochenende in Ruhe über alles reden, was hier heute zur Sprache kam.« Das war Hans-Harald, der inzwischen aus dem Geschäft gekommen war, typisch, immer über alles reden. Hans-Harald ging weiter, nein, der ehemalige Staatsanwalt schritt auf die inzwischen eingetroffenen Polizisten zu. »So. Da sind Sie ja, meine Herren.« So hatte man in den Achtzigerjahren mit deutschen Polizisten gesprochen. Doch das wussten der türkischstämmige Beamte und seine Kollegin vermutlich nicht.
Die meisten Eröffnungsgäste waren gegangen. Nachdem in den ersten Minuten nach dem Angriff fast alle geblieben waren und eine intensive Spannung in der Luft gelegen hatte, strahlte der Buchladen mit seinen verschmierten Scheiben nun eine gewisse Erschöpfung aus. Es war dunkel geworden.
Ruth sah von draußen, wie Karolin mit ihrer Geschäftspartnerin, die Ruth noch nicht vorgestellt worden war, drinnen hinter dem Infotresen saß. Sie hatten eine Flasche Weißwein geöffnet.
»Nein«, sagte Ruth.
»Nein? Was, nein?«, fragte Christopher.
»Dein Vater glaubt immer, alles müsse besprochen werden. Doch das ist ein Irrglaube.«
Es sei das ewige Besprechen und Auseinandernehmen der Probleme, erklärte sie ihrem Sohn, das die wahren, auf alle Zeiten unheilbaren Wunden verursache. Die Konflikte auf sich beruhen zu lassen, sie mit aller Kraft zu ignorieren, sie sogar, wenn man so wolle, unter den Teppich zu kehren, hingegen sei eine menschlich erprobte und bewährte Überlebensstrategie.
2Long Island Sound
Die Menschen vergäßen ja, dass New York am Meer liege, das war einer jener Sätze, mit denen Chris Schönwald die Beschreibung seines neuen Lebens begann. Sein Beach House, wie er es nannte, hatte eine große weiß gestrichene Veranda und lag an einer Küstenstraße. Der Blick ging hinaus auf die Bucht von Long Island, die eine gute halbe Stunde nördlich von New York City wohlhabenden, der Hektik der Stadt überdrüssigen und somit glücklichen Menschen eine Heimat bot.
Er hatte sogar das Surfen angefangen, ursprünglich als er noch in Brooklyn gelebt hatte, damals vor allem, weil es ihm gefiel, mit dem Surfboard im überfüllten A-Train zu stehen auf dem Weg raus zu einem hässlichen Strand in Queens, in Vans und mit Anglerhut, den Neoprenanzug locker über die Schulter gehängt. Der surfende Literaturwissenschaftsprofessor aus der Ivy-League, so hatte er sich gesehen, so hatte er sich gefallen.
Jetzt, wo er tatsächlich am Meer lebte, hatte er das mit dem Wellenreiten wieder sein gelassen. Hier, im maritimen Zusammenhang, fehle ihm »der postmodern-ironische Bruch«, hatte er Kimberley neulich erklärt, als sie, wie Chris gehofft hatte, seine Surfbretter neben der Außendusche im Garten entdeckte. So begeistert Kimberley von der Opulenz des Beach House gewesen war und dem morgendlichen Blick auf das hier zugegeben oft graue Meer, so enttäuscht war sie, als Chris ihr erklärte, dass er das Surfen aus Coolness-Gründen wieder aufgegeben habe. Der wahre Grund lag darin, dass Chris schlicht zu schlecht war, und dass das in einem ernst gemeinten, von durchtrainierten Tech-Millionären bevölkerten Küstenvorort stärker auffiel als an einem Hipsterstrand in Queens.
Sie hatten ihn gefeuert, das ja. Sie hatten ihn gedemütigt, aber, und das ist ein großes Aber, sie hatten ihm, ohne es zu wissen, damit einen Gefallen getan. Diese »Social Justice«-Aktivisten, die sich das Human Resources Department der Universität nannten, gingen wohl davon aus, sie hätten ihn vernichtet, doch tatsächlich ging es ihm besser. Er hatte Geld jetzt, richtiges Geld, nicht mehr das lächerliche Professorengehalt, das für ein gutes Leben, wie es ihm vorschwebte – groß wohnen, auswärts essen, komfortabel reisen –, in New York nicht reichte.
Mit einem letzten Blick auf den Long Island Sound stieg er in den bestellten Wagen von Uber-Select. Endlich eine Klasse höher fahren, ein schwarzer E 350, okay cool, immerhin. Wie sehr er die stinkenden Toyota-Priusse der normalen Uber-Kategorie am Ende verabscheut hatte. Ein Wagen der Select-Klasse kostete raus zum Newark-Airport mit vierundneunzig Dollar mehr als das Doppelte. Aber Chris hatte sich mit sich selbst darauf geeinigt, dass er sich das nun leisten konnte. Er warf die für eine Woche Deutschland gepackte italienische Stofftasche in den Kofferraum, den der Fahrer per Knopfdruck von innen geöffnet hatte, ohne auszusteigen. Der Mercedes rollte an, Chris nahm sein Telefon ans Ohr, Lufthansa Frequent Traveller Service, er musste sich noch ein Upgrade besorgen, sonst würde er den Flug nach Frankfurt nicht überstehen. Die weißen und hellblauen Villen mit ihren Holzverandas zogen vorbei, vor den meisten hingen die Teslas an ihren Ladebuchsen wie an einem Tropf. Die Menschen, die hier leben, waren gesellschaftspolitisch progressiv, wie Chris es als Literaturwissenschaftsprofessor auch gewesen war, doch jetzt waren Graydon und er die Einzigen, die bei der letzten Wahl die Make America Great Again Flaggen rausgehängt hatten und anschließend verhöhnt wurden von den Nachbarn, als Trump die Wahl gestohlen worden war – obwohl Chris sich da nicht sicher war, beziehungsweise war er sich sicher, dass sie nicht gestohlen worden war, doch das versuchte er zu verdrängen, sonst würde ja alles zusammenbrechen.
Kimberley war gestern Nacht aus dem Beach House ausgezogen, nach nur drei Monaten. Auf dem schwarzen Marmorboden in der Eingangshalle lagen noch die Scherben des Chardonnay-Glases, das sie beim Verlassen des Beach House, ihre braune mit den Louis-Vuitton-Initialen bedruckte Reisetasche geschultert, im Gehen hatte fallen lassen.
Chris hatte sich nicht bemüht, die Scherben wegzukehren. Wenn er in einer Woche zurückkäme und hoffentlich das Zusammentreffen mit seiner Familie halbwegs unbeschadet überstanden hätte, würden die Scherben ihn an diesen Augenblick großer Verzweiflung erinnern. Sie würden ihm dann sicherlich lächerlich und unbedeutend vorkommen, Ausdruck einer nervösen Überreaktion und unbegründeter Sorgen. Vielleicht wäre bis dahin auch die Putzfrau gekommen und hätte sie weggefegt.
Kimberley hatte ihm geraten zu fliegen. Er selbst hatte seine Zweifel gehabt. Warum wollte sie eigentlich so dringend, dass er nach Deutschland reiste, hatte er sie gefragt. Weder seinen Eltern noch seinen Geschwistern hatte er bisher erzählt, dass er kein Professor mehr war, sondern nun als – konnte man das so sagen? – »political operative« agierte und zusammen mit Kimberley gegen alles operierte, was ihm früher heilig gewesen war. Kommende Woche hatte Graydon ihn zum fünfjährigen Bestehen seiner Talkshow »Get off my Lawn« eingeladen, und das war, so formulierte Graydon es, für Chris die Chance, sein Profil auch jenseits der legitimen politischen Kreise in den Straßenkämpfer- und J6-Zirkeln (gemeint war der Tag des Kapitolsturms, der sechste Januar) zu schärfen. Abgesehen davon, dass Chris gerade alles tat, was Graydon ihm sagte, war er seit Monaten so siegesbesoffen über seinen Ruhm in dieser neuen politischen Welt, dass er mehr wollte. Er könnte in Graydons Show gehen und sich feiern lassen – oder er konnte nach Deutschland fahren, wie Kimberley es wollte, und sich misstrauische Fragen zu seiner Professorenkarriere anhören. Doch stand Kimberley auf seiner Seite? Oder wollte sie ihn nach Deutschland verfrachten, weil sie befürchtete, er würde sie bald überstrahlen? Sie war nicht eingeladen bei Graydon, der in Nebensätzen immer mal wieder fallen ließ, dass er sie als Anwältin zwar effektiv, als Performerin aber dröge fände. Chris hatte ihr das dann an den Kopf geworfen.
»Ist es das? Weil du nicht in Graydons Show eingeladen bist? Willst du deswegen, dass ich auch nicht gehe?«
»Um diesen Kindergeburtstag bei Graydon geht es nicht. Familie ist wichtiger als der Zirkus, den wir hier machen. Und ich komme mit. Ich will deine Leute kennenlernen.«
»Was?«
»Ich liebe Europe«, sagte sie. Sie sei dort quasi aufgewachsen, ihre Familie habe früher ein Haus am Comer See gehabt. Außerdem, wenn sie schon miteinander schliefen, wolle sie auch gern seine Familie kennenlernen.
Natürlich war sie konservativ, aber politisch, doch nicht habituell.
Familie sei alles, sagte sie. Sie hatte keine Geschwister, und ihre Eltern waren früh gestorben. Die Mutter, als Kimberley ein Kind war, der Vater kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, oje, diese Geschichte, sie war Kimberleys glühender Kern, ihr Antrieb.
Sie hatten fast die ganze Nacht gestritten und sich einiges an den Kopf geworfen. Sie wollte über seine Unaufrichtigkeit reden, seine Unfähigkeit, sich zu bekennen, ob zu ihr oder zu seiner Familie. Und als irgendwann alles vorbei schien, hatte er entschieden, dass er ihr die Wahrheit sagen konnte, und sich dadurch eine Schockwelle erhofft, die den Streit sofort beenden würde. Was wollte man noch sagen zu jemandem, der ein Jahr lang seine Familie belogen hatte, die angeblich eine so große Rolle in seinem Leben spielte? Wollte man mit so jemandem sein Leben teilen? Chris schloss die Augen und zählte leise bis drei.
»Meine Familie weiß nicht, dass ich nicht mehr Professor bin. Sie wissen nicht, dass ich für euch arbeite. Und sie wären schockiert. Deshalb kannst du nicht mitkommen.«
»Du kannst nicht stolz sein auf das, was du für uns machst? Dass du Amerika vor einer Diktatur der Eiferer, der Korrekten und der Minderheiten rettest – und damit auch die Welt?«
»Du hast doch selbst gesagt, dass das alles nicht ernst gemeint ist!«
»Nicht jeder Einzelfakt, den wir verbreiten, ist die Wahrheit. Natürlich hat niemand Donald die Wahl gestohlen. Er hat sie verloren, weil er zu faul war, das weiß jeder. Aber unser Ziel ist deswegen trotzdem wahr und richtig: zu verhindern, dass uns unser Land weggenommen wird.«
»Und du willst mir was von Aufrichtigkeit erzählen? Davon, dass du zu mir stehst? Ich bin doch für dich nicht mehr als eine Trophäe. Der übergelaufene linke Professor! Und du bist abgestellt worden, mich zu betreuen. Um mich zu kontrollieren.«
Eine ganze Weile war es dann still gewesen im Haus. Das Meer war wieder zu hören, und der entfernte Boxermotor des Vintage-Porsche vom Nachbarn, der wie jede Nacht um vier Uhr dreißig zum Before-Sunrise-Yoga fuhr. Es war, wie Chris es sich erhofft hatte, er hatte den Streit in Ungeheuerlichkeit erstickt.
»Dir ist wirklich nicht mehr zu helfen, Chris«, hatte Kimberley am Ende nur gesagt.
Vielleicht war noch nicht alles verloren, dachte er im Mercedes zum Flughafen, die leiernde und scheppernde Warteschleifenmusik der Lufthansa am Ohr. Vielleicht musste er sich an diese MAGA-Frauen erst gewöhnen. MAGA war Chris’ neues Mantra. Die Dinge waren nicht mehr mega. Sie waren MAGA. Das Akronym stammte vom ehemaligen und vielleicht – hoffentlich? – zukünftigen Präsidenten. Ursprünglich nur ein politischer Slogan, umschrieb »Make America Great Again« inzwischen einen Lebensstil. Es gab MAGA-Kleidung, MAGA-Bärte, MAGA-Sprache, MAGA-Autos und eben auch MAGA-Frauen. Chris schien das alles so frisch. Nicht so erschöpft und verbraucht wie die Insignien seines abgelegten linksliberalen Lebens.
Er hatte in den letzten zwanzig Jahren bloß die irgendwie linken, feministischen, woken, bisexuellen, intersektionalen, transgender-bewegten, immer noch Roland Barthes lesenden Dozentinnen, Doktorandinnen und sonstigen Kolleginnen kennengelernt, die bei den teuren Abendessen, die Chris in ausgesuchten Restaurants für sie inszenierte, Dinge sagten wie: »Mir ist schon klar, dass das jetzt eine sehr linke Position ist, aber ich möchte sie trotzdem mal formulieren.« Chris wusste nach zwanzig Jahren genau, was er sagen und fragen musste, damit diese Abende, und manchmal wurden Monate daraus, in seinem Sinne gelangen.
MAGA-Frauen dagegen schienen wie ein anderes Geschlecht. Nichts von dem, was bei den Ivy-League-Progressive-Girls (okay, es waren keine Girls, die meisten waren älter als fünfunddreißig, er verbot sich Affären mit Studentinnen, gerade er, der so viel über Machtstrukturen, Abhängigkeiten und Dominanz in literarischen Texten forschte, hätte sich lächerlich gemacht mit einer solchen Liaison) – nichts also, was bei den Progressive Girls so präzise funktioniert hatte, schien die MAGA-Frauen zu beeindrucken. Chris musste komplett neu lernen, wenn auch unter blendenden Startvoraussetzungen.
The man himself, The Donald, wie ihn alle nannten, hatte einige höhnische Twitternachrichten von Chris retweetet und sich zweimal telefonisch in seinen Podcast eingewählt, und im März würde Chris in Washington, D. C. auf der Conservative Political Action Conference sprechen, kurz CPAC, der wichtigsten Konferenz für ultrakonservatives Denken. Don Jr. hatte sich persönlich für Chris als Redner starkgemacht. Mehr Status geht eigentlich nicht. Außerdem hatte Chris schnell erkannt, dass es in der MAGA-Welt nur zwei Kategorien junger Männer gab: die leicht affigen, polierten douche bags, Typ Trumpsöhne, oder die bärtigen Pick-up-Fahrer, Typ Hinterwäldler, ihre Gefährte dekoriert mit gewaltigen Auspuffrohren und den Fahnen der Sezessionsarmee. Bei einer der letzten Veranstaltungen, auf der er gesprochen hatte, einer Versammlung unter dem Titel »Let’s Go, Brandon« in West Virginia, waren nach Chris’ Vortrag ein Dutzend Bärtige mit Fantasiekostümen in ihre Pick-ups gestiegen und hatten mit »rolling coal« begonnen. Dabei handelte es sich, wie Chris später erfuhr, um das absichtliche Produzieren gigantischer Dieselwolken. Ursprünglich als Technik entwickelt, um Elektroautofahrer zu provozieren oder Black-Lives-Matter-Demonstranten in Abgase zu hüllen, konnte es offenbar auch Ausdruck von Freude bedeuten. So hatte Chris es jedenfalls nach seinem Vortrag für sich interpretiert.
Es gab ohnehin so viel zu lernen, auszuwickeln und zu dekodieren in der MAGA-Welt. Er fühlte sich immer wieder an sein Erwachsenwerden erinnert, an die verschiedenen Jugendbewegungen, denen er sich anzuschließen versucht hatte, von den Mods zu den Teddy-Boys, über die Punks bis hin zu den Poppern: Immer wieder gab es Dickichte aus popkulturellen Zeichen zu durchdringen. Chris hatte das geliebt, und auch später im Studium wies der Poststrukturalismus Züge einer Geheimwissenschaft auf. Chris glaubte deswegen, über das intellektuelle Rüstzeug zu verfügen, diese Welt zu begreifen und zu erobern. Außerdem – und das war ein sehr angenehmer Unterschied zu seiner früheren Tätigkeit als Professor – gab es kaum Konkurrenz. In der MAGA-Welt hatte Chris eine Alleinstellung. Denn Intellektuelle, wie es sie noch zehn Jahre zuvor unter den Neocons gab, waren in MAGA-Land ausgerottet worden. Nur für Chris, den kultivierten Literaturprofessor, hatten sie Platz geschaffen. Natürlich war er für die Rechten die perfekte Trophäe, da hatte Kimberley recht gehabt, aber das störte ihn nur manchmal.
Kimberley war eine klassische MAGA-Frau: fake blond, streng, Louboutin-Absätze, im guten Sinne eine Achtzigerjahre-Konzeptfrau, wie Chris sie aus den US-Fernsehserien seiner Kindheit kannte, als diese unbändige Amerikaliebe sich in seinem Kopf festzusetzen begann. Kimberley war früher Anwältin in Washington, D. C. gewesen, hatte den Job aber aufgegeben zugunsten eines gut ausgestatteten Vertrags als Gastkommentatorin für Fox News. Außerdem hatte sie ihren eigenen Internetkanal Censored TV gegründet, wo sie in Sendungen wie »The Feminist Illusion« Häme gegen alles Progressive versprühte, von der Chris sich einredete, dass er sie erfrischend fand.
Er hatte Kimberley vor einem halben Jahr auf einem Meeting einer Gruppe namens »Prevent The Steal 2024« kennengelernt. Die Organisation, die sich schon jetzt, zwei Jahre vor der nächsten Wahl, damit befasste, ein zweites 2020 zu vermeiden – das heißt, zu verhindern, dass Trump erneut eine Präsidentschaftswahl gestohlen würde, wie es hier hieß – hatte ihn als Redner eingeladen. Das Honorar von 1000 Dollar sei nicht gerade ein Betrag »to write home about«, fand Chris’ Agent Trip (zu Hause wollte Chris von der ganzen MAGA-Sache sowieso lieber nichts erzählen), aber »Prevent The Steal 2024«, so Trip, könnte noch wichtig werden. Die Gruppe sei momentan der vielleicht kürzeste Weg direkt zu the man himself.
Als Chris bei der Konferenz ankam, schien Trips Behauptung allerdings doch ein wenig gewagt. »Prevent The Steal 2024« bestand aus einer deprimierenden Mischung aus lokalen Republikanischen Politikern, ein paar »I love Trump«-Hausfrauen sowie einigen Vertretern der örtlichen Proud-Boys-Fraktion. Egal, Chris würde seine Hit-Rede halten, die fertig in der Schublade lag, die er schon oft gehalten hatte und die in den vergangenen Monaten in MAGA-Land zu einer Art unverhofftem Hype geworden war.
In seiner Hit-Rede hatte Chris den Beweis angetreten, dass die von den Kritikern des Ex-Präsidenten beklagte Postfaktizität – im Klartext: sein ständiges Lügen, wie selbst Chris es heimlich nannte – in Wirklichkeit Ausdruck einer scharfsinnigen und zeitgemäßen poststrukturalistischen Perspektive auf die Welt sei. Es sei naiv, erklärte Chris seinem Publikum, Trumps Versionen der Ereignisse Lügen zu nennen. Denn es sei doch klar, dass es für Lügen zunächst einmal Wahrheiten brauche. Die poststrukturalistische Theorie in Literaturwissenschaft, Linguistik oder Philosophie, von der er, Chris, nun zufälligerweise einiges wüsste, habe jedoch gezeigt, dass Wahrheit eine Illusion sei. Chris war bewusst, dass er mit dieser These in den Literaturwissenschaftsseminaren von Columbia bis Harvard nur ein müdes Lächeln hervorrufen würde: Ja, Chris, danke, aber da waren wir 1975 schon. Er selbst hatte in seinem Jahr für Jahr innerhalb von Minuten ausgebuchten Erstsemester-Kurs »Deconstructionism 101« seine Studenten (und Studentinnen, wie er sich angewöhnt hatte zu sagen) immer wieder daran erinnert, dass Fakten im Lichte individueller Perspektiven und Erfahrungen stets verhandelbar waren.
Doch darum ging es in der Rede nicht. Da davon auszugehen war, dass es keine Überschneidungen zwischen den Ivy-League-Departments der Ostküste und der MAGA-Welt in West Palm Springs gab, wusste Chris, dass er seinem MAGA-Publikum etwas geradezu Lebensveränderndes erzählte, nämlich: Lügen war okay, solange es keine Wahrheit gab.
So hatte er mit den Mitteln der analytischen Philosophie Trump legitimiert, eine Art Gottesbeweis, dachte Chris, pervers, und freute sich. Am meisten befriedigte ihn vielleicht sogar, dass der Poststrukturalismus immer eine dezidiert linke Strömung gewesen war. Tatsächlich hatten sich seine konservativen Kollegen jahrzehntelang so verzweifelt wie vergebens gegen die poststrukturalistischen Theorien gewehrt, weil sie die Welt, wie sie nicht müde wurden zu beklagen, der Objektivität beraubten, die als kognitiver Fels im Zentrum jeder konservativ-moralischen Weltbetrachtung stand.
Immer schon hatte der Poststrukturalismus zugunsten linker Ideologien gearbeitet. Einer von Chris’ Kollegen war sogar so weit gegangen, die Theorie dafür verantwortlich zu machen, wie Präsident Obama mit den Problemen der Krankenversicherungs-Gesetzgebung umging. »Im Kanon postmodernen Relativismus’, was macht es da noch für einen Unterschied, dass der Präsident der Vereinigten Staaten versprochen hat, bestehende Versicherungsangebote nicht anzutasten, obwohl er genau das immer vorhatte?« Chris hatte es damals sehr amüsiert, dass der Kollege sich nicht entblödete, hochabstrakte Konzepte auf die Niederungen der Gesundheitspolitik anzuwenden. Der Wahrheitsbegriff in postmoderner Poetik hatte natürlich nichts mit dem in profaner Realpolitik zu tun. Trotzdem propagierte Chris in seiner Hit-Rede genau das.
»Damals«, rief Chris in sein Publikum, »damals, als der Poststrukturalismus noch auf ihrer Seite war, habe ich keinen meiner linksgerichteten Kollegen gehört, der sich beschwert hätte.« Er dehnte das Wort »linksgerichteten« so lange, bis erste Buhrufe zu hören waren. Und dann kam der große demagogische Moment seiner Rede, den Chris bei jedem Vortrag besonders genoss.
»Aber jetzt auf einmal beschweren sie sich, die Snowflakes! Beschweren sich, dass da auf einmal jemand ist, der sie mit ihren eigenen Waffen schlägt! Dass ein Präsident ihrer dürftigen Interpretation von Fakten – und nichts mehr ist es! – nicht folgen will. Dass sich jemand auflehnt gegen das Interpretationsdiktat in einer Interpretationsdiktatur!«
Verlässlich jubelte das Publikum, sobald Chris das Wort »Diktatur« aussprach.
Es war stets der Moment, in dem Chris glaubte, nein fühlte, dass er in die Euphorie hinein eine Ballade spielen musste, wie es die DJs früher konnten, die er so bewunderte, damals in den Neunzigern, in den Clubs. Chris hatte damals immer geträumt, selbst da oben zu stehen und eine Masse zu steuern. Er war dann nur Professor geworden, ein »Rockstar-Professor« immerhin, wie ihn die New York Times in einem Porträt von 2015 auf der Höhe seines akademischen Ruhms genannt hatte. Er hatte sich die Zeitungsseite damals rahmen lassen und selbst mit rotem Filzstift »For the Rockstar Prof« draufgekritzelt, als sei es ein Geschenk gewesen, was nun in seinem Columbia-Büro hinter dem Schreibtisch hing und von vielen Besuchern kommentiert wurde. Aber ein Vorlesungssaal war eben doch etwas anderes als eine Trump-Rally.
Jetzt hingegen beim Interpretationsdiktatur-Moment seiner Rede fühlte er sich zum ersten Mal in seinem Leben wie ein Rockstar, mit sechsundvierzig Jahren. Es verwunderte ihn, wie gut sich das anfühlte. Und wenn es dazu die Trumpisten, die MAGA-Spinner und Hater der Alt-Right-Bewegung brauchte, um seinem Ego zu geben, wonach es gierte – dann war Chris das recht, hatte er beschlossen.
»Diktatur! Diktatur! Diktatur!«, skandierten die Zuhörer. Chris hätte es noch besser gefallen, wenn sie »Interpretationsdiktat« gerufen hätten, und hatte es bei einer Rede in West Palm Beach einmal auch so angestimmt, aber das war zu kompliziert. Er ließ den Chören Zeit auszuklingen – und setzte dann zur Ballade an: Er erzählte seinen MAGA-Freunden von einem Franzosen namens Jacques Derrida, für den Sprache vor allem ein System sei, das Bedeutung verstecken oder verschieben konnte. Unsere Zeichen, von denen Sprache nur eines war, seien nicht zuverlässig oder objektiv. Vieles ließ sich aus ihnen herauslesen, und was man las, hatte mit den Erfahrungen, Gefühlen und Eigentümlichkeiten des Adressaten mindestens genauso viel zu tun wie mit denen des Senders. Und sei es nicht genau das, was Trump tat? Mit Sprache Bedeutung verschieben? Neue Perspektiven zu eröffnen?
Chris wusste, dass er hier zu weit ging – Derrida für Trumpblödmänner! –, aber wenn die Rede bis hierhin gut gelaufen war, kam er damit durch, was ihm große Freude machte, und manchmal stand einer seiner Zuhörer nach dem Vortrag vor ihm und sagte, dass dieser Jack, dieser Franzose, gar nicht so falschgelegen habe und dass man doch vielleicht mal etwas in Mar-a-Lago organisieren könnte, er habe da einen Draht.
Doch in Washington beim Kongress von »Prevent The Steal 2024« hatte es nicht funktioniert. Chris hatte sein Publikum vielleicht falsch eingeschätzt, was ihm selten passierte. Die Teilnehmer von »Prevent The Steal 2024« waren offenbar gebildeter, als Chris sich das vorgestellt hatte. Wie hatte ihm das passieren können? Das hier war Washington, D. C. und zwar die K Street, wo all die Thinktanks saßen, er hatte doch gewusst, dass einige wichtige CPAC-Redner kommen würden. Chris war überheblich geworden, das musste es sein, nach so kurzer Zeit schon, und bereits während seines Vortrags hatten einige im Publikum ihn mit Zwischenrufen als »ex-linken Blender« beschimpft.
Auf dem Weg zum Ausgang war er an Kimberley Conway vorbeigelaufen. Sie war der funkelnde Star der Konferenz, jeder kannte sie hier, eine Traube von MAGA-Fans in J6-Fantasiekostümen hatte sich um sie gebildet. Sie war gerade dabei, eins ihrer berüchtigten, oft hitzig geführten Sparring-Interviews mit dem sehr linksliberalen CNN-Starmoderator Chris Cuomo zu beenden (inzwischen wie Chris selbst gestürzt über die Affären eines anderen), der sie diesmal live auf der Konferenz befragt hatte. Kimberley hatte ihn dabei mehrfach aus der Fassung gebracht, indem sie Ereignisse, die Cuomo als Fakten präsentierte, mit steinernem Gesicht abstritt.
Kopfschüttelnd und amüsiert zog sie sich schließlich das angeklippte Mikrofon vom Revers und verhedderte sich dabei mit ihren äußerst langen nylonbestrumpften Beinen in den Mikrofonkabeln. Kurz hatte sie ausgesehen wie ein Mädchen beim Gummitwist, dann hatte sie gelacht über die eigenen Verrenkungen mit den Kabeln und das Bild, das sie dabei abgab und inzwischen einige Zuschauer belustigte, darunter Chris. Er war stehen geblieben, und zum ersten Mal an diesem Tag spürte er so etwas wie Wärme, Natürlichkeit, menschliche Nähe, oder war das zu pathetisch? Dann war der Augenblick vorbei, Kimberley Conway hatte sich wieder gefangen und rief beim Weggehen: »Mann, wann wirst du endlich erwachsen, Cuomo?«
Cuomo lächelte wölfisch, formte mit den Lippen den Satz Next time I’ll get you undwinkte Kimberley noch einmal fröhlich zu. War das denn hier alles ein Spiel, und keiner meinte, was er sagte? Als Chris das Gefühl hatte, dass Cuomos Blick auf ihn fiel, setzte er ebenfalls ein Lächeln auf, das angriffslustig wirken sollte, und hob testweise die Hand zum Gruß. Doch Cuomo reagierte nicht, vielleicht hatte er doch woanders hingeschaut. Dafür war nun Kimberley Conway zu Chris herübergeschlendert, als hätte sie die ganze Zeit nichts anderes vorgehabt. »Das«, sagte sie, »war also der hotteste Vortrag, den man im Moment in MAGA-Land hören kann?« Er konnte ihr Lächeln nicht deuten. Spott? Mitleid? Oder doch Faszination?
»Na ja, die poststrukturalistische Perspektive verändert ja tatsächlich alles. Sie entzieht der Trump-Kritik jegliche Basis. Das perfekte Schachmatt, weil die Linke diese Perspektive jahrzehntelang für gültig befunden hat.«
»Jaja.« An Kimberleys enttäuschtem Blick merkte Chris, dass seine bemühte Antwort bei ihr nicht ankam. Wahrscheinlich hätte er sofort in den Gegenangriff gehen müssen. So gingen die Spielregeln in MAGA-Land.
Kimberley hatte vor ihm am Rednerpult gesprochen. Warum, verdammt, hatte er ihr nicht gesagt, dass die Faktenverdrehung, aus der ihr Vortrag bestanden hatte, ohne Chris’ Rede gar nicht möglich gewesen wäre? Kimberley hatte in ihrem Vortrag die rund tausend Zuschauer mithilfe fragwürdiger Arithmetik überzeugt, dass offenbar vierzehn Millionen Stimmen für den Präsidenten, der Trump abgelöst hatte, bei der Wahl gefälscht worden sein sollen. Chris musste sich eingestehen, dass er sogar nach einem knappen Jahr in der MAGA-Welt immer noch Schwierigkeiten hatte, Behauptungen wie diese ohne sofortigen inneren Widerspruch in sein System aufzunehmen. Keinem anderen schien es auf dieser Versammlung so zu gehen.
Chris hatte ja glauben wollen, was die smarte Anwältin da sagte. Er musste es glauben – wollte er seiner neuen Existenz nicht gleich wieder die Grundlage entziehen. Es ging so weit, dass er sich die Erinnerung an den alten Chris verbot, der früher mit seinen Studentinnen vom Universitätscampus in Manhattan bis nach Queens zum JFK-Airport marschiert war, um dort erschöpft und zermürbt von den Minusgraden – es war Januar! – mit selbst gebastelten Schildern gegen das Einreiseverbot für Menschen aus muslimischen Ländern zu demonstrieren, das die neue Trump-Regierung verhängt hatte.
Seine MAGA-Freunde hatten nicht genug kriegen können von Chris’ Schilderungen aus der Welt der Snowflakes. Chris hatte den Ausdruck zunächst nicht verstanden. Als er im New Vocabulary for the Alt Right-Guide nachschlug, den ihm Kimberley zu ihrem einmonatigen Jubiläum geschenkt hatte, erfuhr er, dass die Trump-Anhänger ihre linken Widersacher als »Schneeflocken« verspotteten.