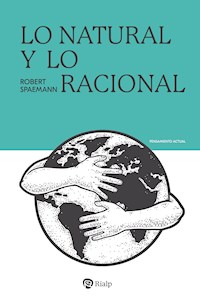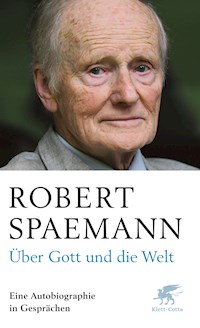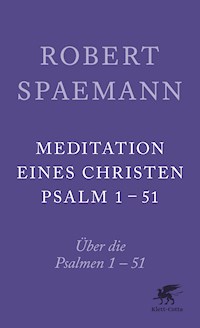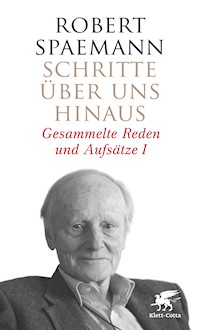
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Schritte
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Die moderne Weltanschauung ihrer inneren Widersprüchlichkeit zu überführen, ist ein Leitmotiv des Philosophierens von Robert Spaemann: Dem philosophischen Denken geht es um etwas jenseits seiner selbst. Und dass es ihm überhaupt um etwas geht, denn es verbindet den Menschen mit allem Lebendigem. Diese philosophische Haltung zeigt sich in seinem Gespräch mit den Großen der Philosophie und wird zum roten Faden seines Opus, dessen essayistischer Teil in Form von Reden und Aufsätzen der letzten 60 Jahre in diesem Band vorliegt. Ihre Lektüre bereitet zudem Vergnügen. "Die Zeit" nennt Spaemann den das beste Deutsch schreibenden lebenden Philosophen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Ähnliche
Robert Spaemann
Schritte über uns hinaus
Gesammelte Reden und Aufsätze I
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
© 2010 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: buero-jorge-schmidt.de
Unter Verwendung eines Fotos von © Markus C. Hurek/dpa
Datenkonvertierung: Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital – die digitale Verlagsauslieferung Stuttgart
Print: ISBN 978-3-608-94248-4
E-Book: ISBN 978-3-608-10300-7
|7|Versuche, das Ganze zu denken. Anstelle eines Vorworts
Vorbemerkungen
Dass wir niemals einen Schritt über uns hinaus tun, diesen Satz David Humes finde ich bei Durchsicht meiner Texte aus den letzten Jahren immer wieder zitiert. Er erscheint mir als ein Schlüssel zur modernen Weltanschauung. Allerdings ist er widersprüchlich, denn wenn er wahr wäre, könnten wir ihn nicht aussprechen und von seiner Wahrheit nicht wissen. Aber er ist suggestiv. Die Reflexion, die ihm zugrunde liegt, scheint ja unwiderstehlich. Auch das Jenseits unseres Denkens ist ja selbst wieder ein Gedanke. Und das Wohlwollen gegenüber anderen kann jederzeit uminterpretiert werden zu meinem Interesse an jener Befriedigung, die ich in diesem Wohlwollen finde, Gedanken aber und Interessen zu Zuständen von Gehirnen. Husserls »Logische Untersuchungen« von 1900 mit ihrer Kritik des Psychologismus haben – trotz der phänomenologischen Bewegung, die sie auslösten – die Richtung des Mainstream nicht umkehren können. Die dank dem Interesse des Verlages Klett-Cotta in dieser Sammlung erneut vorgelegten Texte aus mehr als sechs Jahrzehnten haben miteinander gemein, dass sie diesem Mainstream entgegenstehen – aus theoretischen, aber auch aus »existentiellen« Gründen. Der Gedanke der Menschenwürde scheint mir nämlich zu stehen und zu fallen mit der wenn auch noch so eingeschränkten Wahrheitsfähigkeit und der wenn auch noch so eingeschränkten Liebesfähigkeit des Menschen. Wichtig ist nur, sich klarzumachen, dass das selfish system ausschließlich auf einer Entscheidung beruht, einer grundlosen Entscheidung. Während die entgegengesetzte Denkweise eigentlich keiner Entscheidung bedarf, weil sie dem spontanen Selbstverständnis |8|unser aller als Denkender und Handelnder entspricht, einem Selbstverständnis, das sich nur durch eine die Phänomene aushebelnde Reflexion selbst zum Verschwinden bringen kann.
Wie schon in dem Sammelband »Grenzen« ist das literarische Genus der Texte sehr unterschiedlich. Die meisten wurden zunächst mündlich vorgetragen, und ihre Unterschiedlichkeit ist begründet in der Verschiedenartigkeit des jeweiligen Publikums und des jeweiligen Anlasses. Was mein philosophisches »Selbstverständnis« betrifft, so habe ich in der Einleitung in die »Philosophischen Essays« 1983 geschrieben, was ich auch heute schreiben würde. Ich bin deshalb dem Reclam-Verlag dankbar für seine Zustimmung zu dem folgenden Wiederabdruck.
Die Auswahl der Aufsätze, die in diesem Band erneut vorgelegt werden, soll nach Wunsch des Verlages unter dem Gesichtspunkt philosophischer Selbstdarstellung stehen. Aber ist »philosophische Selbstdarstellung« nicht eine contradictio in adiecto? Uns selbst gehören nur unsere Irrtümer. Philosophie will »Erkenntnis dessen, was in Wahrheit ist« (Hegel). Als Philosoph möchte man sich über das Selbstverständliche klar werden. Wo Leser die Ergebnisse solcher Bemühungen als Informationen über die privaten Meinungen ihres Autors auffassen, da haben philosophische Mitteilungen im Grunde ihre Intention verfehlt. Man wünscht ja, dem Anderen leuchtete das Erinnerte ebenfalls als selbstverständlich ein, er vergäße, von wem die Mitteilung stammte, und hielte es für bloßen Zufall, dass er nicht selbst es immer schon so gesehen hat.
1. Das Selbstverständliche
Wann ist etwas selbstverständlich und scheint nicht nur so, weil seine Voraussetzungen tief verborgen oder geschickt versteckt sind? Was ist das Kriterium für Selbstverständlichkeit? Der Traum aller Philosophie ist entweder so etwas wie »Letztbegründung« oder aber ein Ganzes von einander wechselseitig vollständig tragenden Selbstverständlichkeiten: das System. Denn dass man |9|überhaupt etwas verstanden hat, kann man mit Bestimmtheit erst wissen, wenn man es von Grund auf oder wenn man es ganz, d. h. im Prinzip verstanden hat. Das sokratische »Ich weiß, dass ich nichts weiß« ist kein ironisches Understatement, sondern drückt die Einsicht in diesen Sachverhalt aus. Nun scheint aber kein Zusammenhang dem des Systems so entgegengesetzt zu sein wie der biografische und keiner dem Wahrheitsanspruch philosophischen Denkens so äußerlich. Philosophie ist untrennbar vom Bemühen, die zufällige Standpunktgebundenheit des Denkens zu überwinden. Der Philosoph kann auf seinen psychologischen, methodologischen, sozialen oder ideologischen Standpunkt reflektieren, um ihn als begriffenen hinter sich zu lassen. Das tut er auch dann, wenn er den Standpunkt auf nicht zirkuläre Weise begründet. Jedenfalls möchte er weniger auf sich aufmerksam machen als darauf, »wie die Sache sich verhält«.
Aber leider redet die Sache selbst nicht – nicht einmal in Hegels »Wissenschaft der Logik«. Wer redet, ist allemal ein einzelner Mensch. Und je mehr dieser sich freizumachen sucht von den Vorurteilen der Zeit, von methodologischen Vorentscheidungen der Wissenschaft und von dezisionistischen Sprachregelungen, um zu »reden wie die Wirklichkeit selber«, um so mehr tritt »seine besondere Artung und Schwierigkeit« (Brecht) hervor, seine persönliche Weise, die Sache zu sehen, sein Stil, sie zur Sprache zu bringen. Platon verstand Universalität als Entindividualisierung. Aber heißt Entindividualisierung nicht zugleich: Verzicht auf die wirklichkeitserschließende Kraft der vollen persönlichen, sinnlich-geistigen, geschichtlichen, gesellschaftlichen, politischen, künstlerischen und religiösen Erfahrung zugunsten jener formalen Abstraktionen, die jedermann jederzeit voraussetzungslos zur Verfügung stehen, weil sie leer sind? Im Unterschied zur heutigen Formalphilosophie zog Platon diese Konsequenz nicht. Was er im Auge hatte, war die universalisierte Erfahrung einer asketischen, mathematisch-mystischen Bildungselite, die ihre Individualität nicht beiseite lassen muss, weil sie sie entprivatisiert, zur Allgemeinheit herausgearbeitet hat.
|10|An die Stelle dieses platonischen Gedankens ist heute eher die Vorstellung getreten, vernünftige Allgemeinheit stelle sich als Resultat eines Diskurses her, in den jedermann seine individuellen Meinungen einbringt, indem er sie zugleich zur Disposition stellt. Nun kann es aber einen Diskurs unmittelbar über Meinungen so wenig geben wie über Interessen. Der praktische Diskurs geht nicht über Interessen, sondern über Vorschläge zur tunlichen oder gerechten Lösung von Interessenkonflikten. Der theoretische Diskurs geht nicht über Meinungen, sondern über die Begründung von Meinungen, aufgrund deren die Wahrheit dieser Meinungen behauptet wird. In beiden Fällen also geht der Diskurs über individuelle Antizipationen von Diskursergebnissen. Das heißt aber: Die Individuen, die in den Diskurs mit Anderen eintreten, müssen ihn zuvor schon mit sich selbst geführt haben. Und am Ende müssen sie ihn wieder mit sich selbst führen, falls sie nicht als Subjekte abdanken und sich in gruppendynamische Prozesse hinein auflösen wollen. Sie müssen selbst entscheiden, wann sie vom Reden zum Handeln übergehen wollen, sie müssen selbst beurteilen, ob sie einen erzielten Konsens als einen vernünftigen betrachten können oder nicht, und sie müssen selbst wissen, was sich für sie als Resultat des Diskurses ergibt. Der Diskurs ist ein Zwischenglied in der Selbstverständigung sterblicher, vernünftiger und verantwortlicher Personen und ein Element ihrer Kooperation, nicht mehr und nicht weniger. Diese Perspektive unterscheidet die Philosophie von der Wissenschaftstheorie, für welche wirkliche Menschen nur unreine »Instantiierungen« eines Subjektes wissenschaftlicher Sätze sind, und von der Soziologie, für welche Individuen zur »Umwelt« sozialer Systeme gehören. Ars longa vita brevis. Diese Disziplinen haben es mit der ars longa, die Philosophie hat es mit der vita brevis zu tun. Von daher wird vielleicht verständlich, warum in der Philosophie paradoxerweise mehr als in allen anderen Disziplinen die individuelle Perspektive zählt. Der Philosophie geht es um echte Universalität, um ein Ganzes von Einsicht, um »Totalität«, um absolute Wahrheit. (Das klingt nach Anmaßung; |11|in Wirklichkeit ist der Begriff »absolute Wahrheit« eine Tautologie.) Das Ganze zu denken kann jedoch immer nur Sache eines individuellen Versuchs sein – auch Spinozas »Ethik« und Hegels »Logik« sind Essays –, und der Versuch, das Absolute zu denken, hat mehr als jede andere Denkbemühung den Charakter eines kontingenten Denkweges auf eigene Gefahr, ja eines Denkschicksals. Er gleicht nach Platons Bild dem Brett, auf dem man durchs Meer des Lebens schwimmt, »wenn jemand nicht auf einem göttlichen Logos sicherer fahren kann«.
2. Theorie der Moderne
Warum der sisyphusartige Versuch, dasjenige thematisch denken zu wollen, was doch gerade nicht Thema, sondern Horizont, nicht Gegenstand, sondern Hintergrund ist, »das Ganze«? Warum das immer erneute Anrennen an die Grenzen der Sprache – schon bei Aristoteles mit seinen substantivierten Präpositionen? Es ist nicht die Philosophie, die damit anfängt. Sie ist immer erst eine zweite Reflexion, und die erste ist so alt wie das Denken selbst. Eine deutliche und definitive Grenze zwischen Gegenstand und Horizont gibt es nur für die Tiere, die darum keine Geschichte haben. Der Nomos des Menschen – sein Weg, sein Ethos, sein »Tao« – und seine Sprache als Medium seiner Existenz sind zwar nicht vom Menschen gemacht, aber sie sind deshalb doch weder seinem Nachdenken noch seinem Zugriff entzogen. Den Nomos des gegenwärtigen Daseins, des Bewusstseins der Zeit aus einem Horizont zu begreifen, der nicht durch dieses Bewusstsein definiert ist, das schien mir immer Aufgabe der Philosophie zu sein. So muss Philosophie heute explizit oder implizit Theorie der Moderne sein. Die Moderne ist ein europäisches emanzipatorisches Projekt von einzigartigem Ausmaß, das inzwischen die Menschheit als Ganze in seine Dynamik hineingerissen hat und das Gesicht unseres Planeten auf irreversible Weise zu transformieren beginnt. – Die Philosophie kann sich zum Bewusstsein der Moderne, das dieses Projekt definiert, nicht wie |12|eine Metatheorie zu einer Objekttheorie verhalten. Denn das moderne Bewusstsein versteht sich selbst als »prima philosophia« oder als deren Ersatz. Der Name »Philosophie« ist mit dem Projekt der Moderne auch insofern verbunden, als dessen ideologische Wortführer im 18. Jahrhundert sich als Partei der »philosophes« etablierten. Sie haben damit erstmals die verhängnisvolle Gleichsetzung von Philosophie und Ideologie möglich gemacht. Die Gegenideologie wird dann unvermeidlich. Die Philosophie der Restauration war der der Revolution um eine Reflexionsstufe überlegen. Aber gerade deshalb repräsentierte sie noch eindeutiger als jene das Prinzip der Moderne. Das hat am Ende des 19. Jahrhunderts schon Charles Péguy bemerkt, wenn er im Gegensatz zu Zola seinen Kampf für Dreyfus nicht als Kampf gegen die »alten Mächte«, sondern gegen den »Modernismus« verstand. Modernismus aber hieß für ihn: »nicht zu glauben, was man glaubt«, die Frage nach Wahrheit zu ersetzen durch die Frage nach der politischen, sozialen, psychischen oder biologischen Funktionalität von Überzeugungen. So hat MacIntyre unlängst ganz richtig den Emotivismus in der Ethik als ein Merkmal der modernen Kultur diagnostiziert.
Eine solche Definition der Modernität ist natürlich polemisch. Die Philosophie muss zum Projekt der Moderne so oder so Stellung nehmen, das hängt mit dessen Totalitätsanspruch zusammen. Denn dieses Projekt will die Kategorien, mittels derer es adäquat begriffen werden kann, ebenso wie die Maßstäbe seiner Legitimation selbst bereitstellen. Es anders verstehen heißt, es kritisieren. Alle großen Philosophen der Neuzeit haben eine Ortsbestimmung der Gegenwart versucht, ohne das Koordinatensystem hierzu der Moderne selbst zu entnehmen. Dabei ist eines wohl unstrittig: Das zentrale Signum der Moderne ist die neuzeitliche Wissenschaft, »science«. Wer verstanden hätte, was diese Wissenschaft im Ganzen menschlichen Wissens und Verstehens, im Ganzen des In-der-Welt-Seins, im Ganzen der Wirklichkeit eigentlich ist und bedeutet, der hätte verstanden, was die Moderne ist. Die »Wissenschaftstheorie« versucht gerade dies nicht.
|13|Warum ist diese Frage so wichtig? Ist die Thematisierung des eigenen Zeitalters, die Suche nach einem Prinzip desselben nicht selbst ein modernes Phänomen? Für die Alten hatten nur die bleibenden Dinge Prinzipien, Zeitalter nicht. Auch das moderne Denken verfügt über kein sich selbst und die Wirklichkeit begründendes »Prinzip«, sondern es ist eine Reflexionsform, die sich jeden Inhalt gerade so anverwandelt, dass dieser als er selbst verschwindet – so wie das moderne Tauschsystem tendenziell alle Güter in Waren verwandelt und jeden Aufstand der Spontaneität mühelos entweder vermarktet oder politisch funktionalisiert. Man entzieht sich der modernen Weltanschauung nicht durch einen »antimodernistischen Entschluss«, nicht durch Zappeln im Netz, sondern wenn überhaupt, dann durch Aufklärung, d. h. durch die ganz einfache Entdeckung, dass ein Netz, welches das Denken verstrickt, immer nur ein gedachtes Netz ist. Dann ist die Befreiung Sache eines Augenblicks, dann ist sie schon geschehen. Modernität als »wissenschaftliche Weltanschauung«, als Paradigma des In-der-Welt-Seins hat keine Argumente, sie beruht auf petitiones principii. Wer das Paradigma ignoriert und ungerührt fortfährt, in Sachen der Philosophie, der Religion und der Moral nach Wahrheit zu fragen und die Worte »gut« und »böse« oder gar »Gott« ohne Anführungszeichen zu benutzen, der stößt daher nicht eigentlich auf Gegenargumente, sondern auf die banale Einschüchterungsphrase, so könne man »heute nicht mehr« sprechen, denken oder fragen. Wirklich nicht? Warum nicht? Eine gewisse Unempfindlichkeit gegen diese Redensart verdanke ich dem Umstand, dass sie in meiner Jugend vorherrschte und ich mit dem Widerwillen gegen sie aufgewachsen bin: der Nationalsozialismus, von Dahrendorf als Führer der Deutschen in die Modernität begriffen, wollte die »morschen Knochen« das Zittern und alle an die »neue Zeit« glauben lehren, während ich in meiner näheren Umgebung lernte, dass »gut« und »böse« nicht gleichbedeutend ist mit »neu« und »alt« und dass eine neue Zeit recht, aber auch unrecht haben kann. Man muss dies übrigens nicht eigentlich lernen. |14|Kinder wissen es sowieso. Man darf es sich nur nicht ausreden lassen.
Sokrates wurde oft entgegengehalten, dies oder jenes – z. B. dass Unrecht leiden besser sei als Unrecht tun – könne man nicht sagen, ohne ins Abseits zu geraten. Er pflegte darauf zu antworten: »Was man sagen kann, kann ich nicht beurteilen. Wer ist ›man‹? Was alle sagen, ist nicht wichtig, denn alle haben ja nicht nachgedacht. Lass uns lieber zusehen, ob wir beide, du und ich, es einsehen.« Die Philosophie steht und fällt mit diesem Du und Ich. Die wissenschaftliche Weltanschauung nimmt dem Du und Ich, dem kurzen Leben des Einzelnen, seinen Ernst und seine Bedeutung, einmalige Darstellung des Unbedingten zu sein, zugunsten eines kollektiven Prozesses, der als eigentlicher Sinnträger gilt. Was die Worte »schön« und »hässlich«, »wahr« und »falsch«, »gut« und »böse« bedeuten, wird selbst zum Gegenstand wissenschaftlicher Hypothesen. Der Prozess der Verifikation oder Falsifikation dieser Hypothesen ist offen. Ihn als Fortschritt verstehen heißt, sich grundlos seine Selbstdeutung zu eigen machen. Denn es müsste ja feststehen, was »gut« heißt, wenn feststehen soll, was »Fortschritt« im Singular heißen soll. Das Koordinatenkreuz, aufgrund dessen man Fortschritt von Rückschritt oder bloßer Veränderung unterscheiden könnte, schwimmt aber für das moderne Bewusstsein mit im Fluss. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass das Bewusstsein des Fortschritts, das sozusagen noch von klassischen Parametern lebte, heute weltweit in ein Gefühl der Modernität als eines unaufhaltsamen Schicksals oder Verhängnisses umschlägt.
Ich sprach vom Versuch einer Ortsbestimmung der Gegenwart aus einem anderen Gesichtspunkt als dem des Zeitgeistes. Aus der Perspektive der Modernität handelt es sich dabei um den Versuch, die »lebensweltliche« Sicht gegenüber dem wissenschaftlichen Rationalitätsdruck zu behaupten. Aber diese Unterscheidung ist selbst schon eine wissenschaftliche, die das, was wir alle wissen, als »Lebenswelt« verfremdet und relativiert. Wer gefoltert wird und schreit, der wird es als Hohn betrachten, wenn |15|jemand die Tatsache, dass er leidet, als »lebensweltliche Perspektive des Vorgangs« bezeichnet. Er weiß nämlich, dass sein Schmerz wirklich ist und in alle Ewigkeit wirklich gewesen sein wird, und er weiß, dass seine Perspektive des Schmerzes wahrer ist als alles, was in wissenschaftlicher Objektivität über Schmerz gesagt werden kann, d. h., er ist weder Transzendentalphilosoph noch Scientist, er ist Ontologe. Die Kategorien, die den Schmerz als unreduzierbare Realität zu denken erlauben, sperren sich gegen jede Mediatisierung durch modernes, d. h. wissenschaftliches Denken. Die Gemeinschaft der Leidenden ist wie die communio sanctorum indifferent gegen Epocheneinteilungen.
3. Metaphysik oder Funktionalismus
Ich habe zum Verständnis jenes Geschehens der Moderne, in das wir alle verwickelt sind, stets zwei Weisen des Zugangs gesucht. Die eine ist die Geistesgeschichte. In meiner Dissertation von 1951 über de Bonald, die unter dem Titel »Der Ursprung der Soziologie aus dem Geist der Restauration« 1959 erschien und 50 Jahre später in Italien, Spanien und Frankreich übersetzt wurde und eine Diskusssion auslöste, versuchte ich zu zeigen, dass erst in der Kritik an der Französischen Revolution und an der sie vorbereitenden Ideologie die Moderne ihre spezifische theoretische Gestalt gewinnt. »Die Restauration«, so schrieb ich damals, »vermag den Zirkel der modernen Gesellschaft nicht zu durchstoßen, sie gerät nur tiefer in ihn hinein.« Metaphysik wird abgelöst durch eine soziologisch-funktionale Begründung der Notwendigkeit ihrer Erhaltung. »Ecarter Dieu comme irreligieux« hat dann bald darauf Comte gefordert: Funktionalismus, Rationalisierung als Unterordnung des Daseins unter die Bedingungen seiner Erhaltung, das waren die ersten Hilfsbegriffe der Selbstverständigung über das, was Moderne heißt. Ein 1949 zufällig erworbenes obskures, in Amsterdam erschienenes Buch über »Die Dialektik der Aufklärung« hat, neben der »Summa theologica« und Joachim Ritters um das Thema von Herkunft |16|und Zukunft kreisenden Vorlesungen – Marx, Lenin und Lukács hatte ich zwei Jahre vorher absolviert –, meine Weise zu sehen geprägt, obgleich ich weder die Prämissen noch die Konklusionen dieses Buches zu teilen vermochte. Jene schienen mir selbst noch in den Vorurteilen der Moderne befangen, diese eben deshalb zum haltlosen Schwanken zwischen Utopie und Fatalismus verurteilt. Erst kürzlich lernte ich »The Abolition of Man« von Clive S. Lewis kennen, der 1943 auf eine kürzere, nüchternere und weniger dialektische Weise all das gesagt hat, was »Die Dialektik der Aufklärung« zu sagen versucht.
Ich erprobte später das interpretatorische Instrumentarium an einem Gegenstand des 17. Jahrhunderts, der Kontroverse der Bischöfe Fénelon und Bossuet über die »reine Gottesliebe«, dem letzten theologischen Disput, der noch den Charakter einer Haupt- und Staatsaktion hatte und an dem das gesamte gebildete Europa Anteil nahm.1 Was war es, das das jahrtausendealte platonisch-christliche Lehrstück von der Liebe Gottes um Gottes willen plötzlich zweideutig und die Alternative »Selbstverwirklichung oder Selbsttranszendenz« zu einem Antagonismus werden ließ? Voraussetzung hierfür war die Umfunktionierung der ideologischen Ontologie am Beginn der Neuzeit, die »Inversion der Teleologie« auf Bestandserhaltung und die Funktionalisierung aller Lebensvollzüge im Dienste dieser Erhaltung. Ich sprach damals von »bürgerlicher Ontologie«. Es ist bezeichnenderweise Don Quijote, der, unter Berufung auf die theologische Lehre vom »amour pur«, daran festhält, Dulcinea »um ihrer selbst willen« zu lieben. Das Thema Modernität und Selbsterhaltung ist dann von Blumenberg, Henrich und anderen weiterdiskutiert worden, durchweg in einem stärker modernitätsapologetischen Sinne. Wer möchte sich schon gern mit Don Quijote sehen lassen?2
Niemand hat in seiner denkerischen Existenz die Antinomien der Moderne so exemplarisch verkörpert, und zwar wissentlich, wie der arme Jean-Jacques, zu dem es mich deshalb immer wieder aufs Neue mit einer Mischung von Neugier, Rührung und |17|Abscheu gezogen hat.3 Er konfrontierte erstmals die Maßstäbe der Moderne mit jenem Maßstab, der für die klassische Tradition der letzte und unhintergehbare war, dem der physis. Aber sein Naturbegriff ist der nichtteleologische der Moderne. Deshalb sieht er schließlich keine andere Möglichkeit als die Moderne schon mit der Menschwerdung des Prähominiden durch Sprache und Arbeitsteilung beginnen zu lassen, Sündenfall und Menschwerdung zu identifizieren.4 Einmal herausgetreten aus der Natur, gibt es für den Menschen kein Maß und Ziel des Fortschritts mehr. Das geschichtlich-gesellschaftlich-politisch-religiöse Dasein ist nicht »Erfüllung« der Natur des Menschen, sondern mit dieser ganz inkommensurabel. Natur ist nicht der Anfang, der das Umwillen in sich enthält, sondern nur noch Terminus a quo eines unendlichen Weges ins Niemandsland, für welchen Goethes Wort gilt: »Man geht nie weiter, als wenn man nicht mehr weiß, wohin man geht.«
4. Dialektik von Naturalismus und Spiritualismus
Mein zweiter Zugang zum Phänomen der Moderne ist ein spontaner Widerwille gegen die Uminterpretation unseres natürlichen Selbstverständnisses, die Vergessen verlangt. Philosophie ist Widerstand gegen dieses Vergessen, Erinnerung. Nicht als irrationaler Impuls zur Mimesis einer Natur, von der man gar nicht sagen kann, worin ihre Verletzung bestünde,5 sondern als denkender Vollzug einer teleologischen Struktur, als Bewegung, die den Anfang in der Gegenwart anwesend hält. Eine nichtteleologische Natur kann ja gar nicht verletzt werden. Sie ist eben nur der Anfang, der dadurch definiert ist, dass man sich von ihm entfernen muss: exeundum e statu naturali. Indem Philosophie den Anfang als archē, als Prinzip, als Maßstab des Weges erinnert, ist sie Vergegenwärtigung der verborgenen Voraussetzungen der Moderne und holt diese zurück in einen Horizont, der sie mit allen anderen Epochen verbindet, ihre selbstbescheinigte Inkommensurabilität nicht gelten lässt.
|18|Philosophie ist antidialektisch, indem sie die Dialektik der modernen Abstraktionen sichtbar macht, ihr haltloses Umkippen ins jeweilige Gegenteil. Der Hegel’sche Gedanke, dass das Konkrete, das Wahre als Resultat dieser Dialektik der Abstraktionen zu denken sei, ist selbst nur wahr unter der teleologischen Voraussetzung, dass »das Absolute an und für sich schon bei uns ist und sein will« (»Phänomenologie des Geistes«, Einleitung). Aus »non-A« folgte nämlich in alle Ewigkeit gar nichts und schon gar nicht B, wenn das Ganze, von dem A abstrahiert wurde, nicht bereits als offenbares Geheimnis da wäre und vor Augen läge. Dialektik bringt nicht das Wahre hervor, sie überführt nur den Irrtum des Selbstwiderspruchs, und auch dies nur, weil wir das Wahre im Grunde schon wissen und deshalb nie konsequent und vollständig irren, d. h. nie aus der Wahrheit des Seins gänzlich herausfallen können. Ich kann daher Hegels Logik nur verstehen, wenn ich sie als moderne Propädeutik zu Aristoteles, Aristoteles aber als Scholion zu Platon lese.
In historischen Analysen können wir versuchen, die Moderne als Phänomen auf einen Begriff zu bringen. Wo es um die Gegenwart geht, gewinnt der Begriff der Ortsbestimmung immer zugleich eine aktiv-kritische Bedeutung. Denn was die Moderne ist, das hängt ja davon ab, als was wir sie verstehen wollen. Entweder wir verstehen sie streng aus sich selbst, radikal-emanzipatorisch, dann verstehen wir sie zu Tode, dann ist Selbstaufhebung der Aufklärung unvermeidliches Resultat ihrer Dialektik. Das hat Nietzsche mit vollendeter Klarheit gesehen, wenn er schrieb, dass Aufklärung selbst noch lebt von dem platonischchristlichen Glauben, »dass Gott die Wahrheit, dass die Wahrheit göttlich ist«, und dass sie mit der Zerstörung dieses Glaubens auch sich selbst aufheben und einem neuen Mythos Platz machen müsse.
Wenn wir solche Selbstaufhebung nicht wollen, dann dürfen wir die Moderne nicht aus sich selbst verstehen, dann müssen wir sie, dann müssen wir Aufklärung, Emanzipation, Menschenrechte, Wissenschaft und Naturbeherrschung gegen sich selbst |19|in Schutz nehmen. Wir müssen sie ideologisch begreifen, als Entfaltung einer nicht durch sie selbst gesetzten anfänglichen Wahrheit über den Menschen. Ins 21. Jahrhundert werden wir sie nur retten, wenn sie in dieser Wahrheit ihr Maß findet. Diese Alternative scheint mir unausweichlich. Sie bildet den Hintergrund und den roten Faden meiner sonst ziemlich disparaten theoretischen und auch praktisch-politischen Äußerungen, die fast immer kritischer Natur sind: Verteidigung der Aufklärung gegen ihre Selbstdeutung. Fast alle diese Äußerungen sind daher »Ergänzungen« des Zeitbewusstseins.
Das moderne Bewusstsein schwankt zwischen einem akosmistischen Transzendentalismus und einem reduktionistischen Naturalismus. Transzendentalismus – auch in seiner sprachanalytischen Variante – fragt nach den »Bedingungen der Möglichkeit«, er versteht Philosophie als Theorie des Möglichen, als Gesamtheit der Sätze, die für alle möglichen Welten wahr sind. Wirklichkeit wird hier zum Grenzfall des Möglichen, die wirkliche Welt ist die beste oder schlechteste aller möglichen Welten, Dinge sind »Gegenstände möglicher Erfahrung« und möglichen Tausches gegen Äquivalente: die Struktur aller funktionalen Theorien. Der Bewusstseinsraum wird verstanden als Möglichkeitsraum, der Wirklichkeit aus sich entlässt. Geltung, Sollen, Wert sind nicht nur aus Sein nicht ableitbar, sie sind sogar kategorial den im engeren Sinne ontologischen Kategorien übergeordnet.
Für Aristoteles galt es als Axiom, dass das Wirkliche vor dem Möglichen ist. Möglichkeit war verstanden als Spielraum, der mit jedem wirklich Seienden eröffnet ist. Möglichkeit hieß: »Können«. Nur Wirkliches »kann«. Der Primat der Möglichkeit in der Philosophie der Neuzeit hatte die christliche Theologie zur Voraussetzung, nach welcher Gott alles kann, was widerspruchsfrei denkbar ist. Wenn aber hinter der Gleichsetzung von Möglichkeit und Denkbarkeit nicht mehr diese Prämisse steht, was heißt dann »möglich«? Der transzendental-philosophische, weder theologisch noch anthropologisch fundierte Raum des |20|Apriorismus spiegelt philosophisch die Bodenlosigkeit der Moderne. Es konnte nicht ausbleiben, dass sie vom Kopf auf die Füße gestellt wurde.
Der Naturalismus ist die unvermeidliche dialektische Kehrseite des Transzendentalismus: »Das Sein bestimmt das Bewusstsein.« Das seinslose Apriori wird als »Rückseite des Spiegels« zum Produkt evolutionärer Anpassungsprozesse des neurophysiologischen Apparates, theoretische Erkenntnis und sittliche Einsicht zu erhaltungsdienlichen Modifikationen desselben, Freiheit zu einem Zufallsgenerator in komplexen Systemen, Negativität – das eigentliche Signum des Geistes – zu einem physikalischen Datum im Gehirn. Die »Bedeutung« der Zeichen für »nicht«, »minus« und »null« ist in Wirklichkeit ebenso pure Positivität wie diese Zeichen selbst. Das Subjekt der Wissenschaft lässt sich vollständig als Objekt derselben rekonstruieren. Transzendenz, »Referenz« auf anderes, wird – da sie naturalistisch nicht einmal gedacht werden kann – uminterpretiert zu internen Zuständen von Organismen.6 Auch die Ablösung des Paradigmas der Bewusstseinsphilosophie durch Sprachphilosophie und Intersubjektivitätstheorie ändert nichts daran. Die Sprachgemeinschaft als Ganze versteht sich entweder akosmistisch als »transzendentale« Gemeinschaft von Subjekten, die sich miteinander »über« Gegenstände verständigen, welche nur im Rahmen dieser Verständigung überhaupt Realität gewinnen, oder aber sie wird sich selbst gegenständlich und setzt sich in ein Verhältnis zu ihrer eigenen Naturgeschichte. Im letzteren Fall hängt aber alles davon ab, wie Natur verstanden wird. Wenn sie nicht ideologisch, sondern »naturalistisch« verstanden wird, dann muss eine solche Reflexion der eigenen Naturgeschichte für eine Transzendentalpragmatik ebenso katastrophale, nämlich reduktionistische Konsequenzen haben wie für die Bewusstseinsphilosophie. Einen naturalistischen Begriff von Wahrheit kann es nicht geben. Man könnte zugespitzt sagen: Jeder Transzendentalismus – bewusstseinstheoretischer, sprachphilosophischer oder sozialpragmatischer Art –, der glaubt, ideologische Ontologie aufgehoben |21|zu haben, ist gegen das naturalistische Reduktionsprogramm wehrlos. Dieses Programm scheitert zwar in concreto immer, aber das zwingt nicht dazu, es als Programm aufzugeben. Es gibt Fanatiker des Reduktionismus, auch geniale wie Quine. Glücklicherweise gibt es auch Naturalisten wie Gottfried Benn, deren Sensibilität und Aufrichtigkeit sie bestimmte Erfahrungen machen lässt, die gegen die naturalistische Reduktion resistent sind:
Ich habe mich oft gefragt
Und keine Antwort gefunden
Woher das Sanfte und das Gute kommt.
Weiß es auch heute nicht.
Und muss nun gehn.
Philosophie »weiß« es auch nicht. Aber sie ist Skepsis gegenüber einem Begriff von Wirklichkeit, von Natur, nach dem es das Sanfte und das Gute eigentlich gar nicht geben dürfte. Philosophie im platonischen Sinne dieses Wortes fragt nicht, woher das Gute, sie fragt allenfalls, woher das Schlechte kommt. Im Gegensatz zu Transzendentalismus und Naturalismus versucht sie, die intensivsten Erfahrungen von Sinn zum Ausgang für das zu nehmen, was unter dem Wort »Sein« gedacht wird. Der Naturalismus hat ja nicht darin unrecht, dass er den Primat der »unbesiegbaren Natur« geltend macht, sondern darin, dass er mit einem reduktionistischen, d. h. einem antiteleologischen Begriff von Natur arbeitet. Auch die Entgegensetzung von Sollen und Sein beruht schon auf einer antiteleologischen Reduktion des Seinsbegriffs. Dabei geht doch alles Sollen ins Leere, wo es nicht die Qualifikation eines Wollens ist, dem es um »Freundschaft mit sich selbst« geht. Nicht als hätten die antiken Heiden das Phänomen des Sittlichen in seiner Reinheit ausdifferenziert. Aber alle Ausdifferenzierung ändert nichts daran, dass jemand schon wollen muss, ehe er sollen kann, und dass kein Sollen motivierende Kraft besitzt, wenn es nicht als die Bedingung einer vita beata, genauer gesagt: als diese selbst begriffen wird.
|22|5. Naturbeherrschung
»Übereinstimmung mit sich selbst« bedeutet immer auch: »Übereinstimmung mit der Natur«. Diese stoische Einsicht hat seit einigen Jahrzehnten als »ökologisches Bewusstsein« zu einer Krise der Modernität geführt, deren Ausmaß noch nicht abzuschätzen ist. Das einseitig emanzipatorische Verständnis von Freiheit als »Befreiung« durch eine nicht ideologisch begrenzte Naturbeherrschung droht die ökologische Nische zu zerstören, in welcher menschliche Freiheit angesiedelt ist. Hinfällig ist zumindest die marxistische Variante der Moderne, der Gedanke, Gerechtigkeit überflüssig zu machen durch Beseitigung von Knappheit. Aber mimetisches Sich-Anschmiegen an das »Natürliche« als das »Ursprüngliche« ist auch noch eine Variante des abstrakten Naturbegriffs der Moderne; und die dies proklamieren, fühlen ja auch eine seltsame Geistesverwandtschaft zu ihren dialektischen Zwillingsbrüdern. »Ende der Moderne« ist überhaupt ein zweideutiger Gedanke. Er kann zum Einen die Selbstaufhebung der Moderne durch konsequentes Zu-Ende-Führen ihres Marsches bedeuten: Iter impiorum peribit. Es kann auch heißen: Rettung des humanen Gehaltes der Moderne durch ein anderes Selbstverständnis, Erinnerung der nicht durch die Moderne selbst gesetzten natürlichen und geschichtlichen Inhalte, von denen sie lebt. Das setzt vor allem die Entwicklung eines Verständnisses von Herrschaft voraus, die das Beherrschte nicht in seinem Selbstsein zum Verschwinden bringt.
Wenn es so ist, dass Naturbeherrschung immer auch Herrschaft über Menschen impliziert, dann folgt – da wir auf Naturbeherrschung nicht verzichten können – die Notwendigkeit, den Begriff von Herrschaft neu zu denken und auch anderen Wesen als nur erwachsenen Diskurspartnern der Spezies Homo sapiens in abgestuftem Maße so etwas wie Selbstsein zuzuerkennen. Es kommt darauf an, diese Anerkennung nicht als Beeinträchtigung, sondern als Chance der Verwirklichung des eigenen Selbstseins zu erfahren. Eine solche Entwicklung der Moderne |23|lässt sich nicht als Ergebnis eines neuen Trends erhoffen. Sie ist schwierig und unwahrscheinlich, wie alles Gelingen: Omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt. (Spinoza)
Geringfügig ergänzte Einleitung in: Robert Spaemann, Philosophische Essays, Stuttgart: Reclam 1994, S. 3– 18.
Anmerkungen
»Reflexion und Spontaneität. Studien über Fénelon«, Stuttgart 1963.
Vgl. das diese Diskussion sammelnde Bändchen von H. Ebeling, Hrsg., »Subjektivität und Selbsterhaltung«, Frankfurt a. M. 1976.
Vgl. zuletzt »Rousseau – Mensch oder Bürger? Das Dilemma der Moderne«, Stuttgart 2008.
Eine Arbeit über den Rousseauismus des Verfassers der »Dialektik der Aufklärung« steht noch aus!
Vgl. hierzu J. Habermas’ Adornokritik, in: »Theorie des kommunikativen Handelns«, Bd. l, Frankfurt a. M. 1981, S. 522 ff.
Vgl. W. V. Quine, »The Roots of Reference«, Cambridge, Mass., 1973.
|25|PHILOSOPHIE
|27|Philosophie als institutionalisierte Naivität
(1973)
Der Titel enthält, was man im 18. Jahrhundert ein Paradox nannte, das heißt eine der geläufigen entgegengesetzte Ansicht. Wir sind gewohnt, Philosophie als das genaue Gegenteil von Naivität anzusehen – naiv ist der Common Sense. Und in einem gewissen Grade sind auch die Wissenschaften naiv, weil sie gewisse theoretische und praktische Voraussetzungen ihrer selbst ungedacht lassen. »Die Wissenschaft denkt nicht«, sagt Martin Heidegger. Philosophie hingegen thematisiert dieses Ungedachte. Sie ist absolute Reflexion. Sie hinterfragt alles noch einmal.
In den Wissenschaften wird auch hinterfragt. Das heißt, es wird versucht, weniger allgemeine auf allgemeinere Gesetze zurückzuführen, Oberflächenstrukturen auf Tiefenstrukturen, Bewusstes auf Unbewusstes, Meinungen auf Vorurteile und Interessen, Interessen auf gesellschaftliche Stellungen.
Wozu ist dieses Hinterfragen gut? Es vermehrt unsere Kenntnis von der Wirklichkeit und damit unsere Möglichkeit, die Wirklichkeit unseren Zwecken entsprechend zu benutzen und für solche Benutzung zu verändern. Die Philosophie vermehrt diese Kenntnisse nicht. Was man hingegen von ihr erwartet, was diejenigen erwarten, die öffentliche Mittel für philosophische Institute bereitstellen, ist, dass die Philosophie Hilfestellung leistet bei der Verständigung über unsere Handlungszwecke und über die einschränkenden Regeln, die wir bei der Verfolgung dieser Zwecke respektieren. Und dies ist ja in der Tat seit Platon der Anspruch der Philosophie: Wissen über richtige und falsche Ziele, richtige und falsche Prioritäten zu sein. Aus diesem Anspruch folgte konsequent die These Platons, das Problem der Lebensqualität ließe sich nur lösen, wenn die Philosophen, die davon etwas verstehen, etwas zu sagen haben. Immanuel Kants Meinung in dieser Frage war von der Platons gar nicht weit entfernt. Nur glaubte Kant, bei der Personalunion von Philosoph und Machthaber sei das Risiko zu groß, dass die Philosophie korrumpiert werde durch die notwendigerweise taktischen Gesichtspunkte des Machthabers. Es sei deshalb besser, den Philosophen einen maßgeblichen Beraterstatus einzuräumen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!