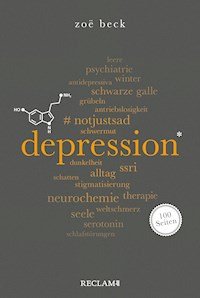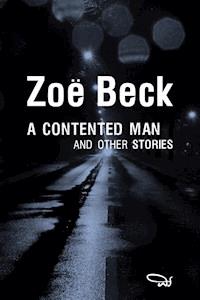12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Mitten in London wird der Dokumentarfilmer Niall Zeuge eines bestialischen Attentats auf einen jungen Mann, begangen von Dschihadisten. Als er für eine Reportage die Hintergründe dieser Tat erforscht, gerät er in einen Strudel aus Angst und Gewalt, befeuert von politischen Machenschaften und den Medien. Er ahnt nicht, wie sehr sein Leben mit dem Terrorakt verwoben ist, bis es endgültig aus den Fugen gerät.
Wie hypnotisiert nimmt Niall mit der Handykamera auf, wie zwei Männer mit Macheten einen Soldaten in Zivil niedermetzeln. Die beiden Täter bemerken die Kamera, bekennen sich im Namen Allahs zu dem Mord und schwenken stolz die Flagge des Islamischen Staats. Ab diesem Moment ist Nialls Leben nicht mehr, wie es war. Er nimmt den Auftrag an, eine Dokumentation über den Terrorakt zu drehen, und weiß nicht, dass er mit grausamer Absicht für diese besondere Aufgabe ausgewählt wurde …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Ähnliche
Cover
Titel
Zoë Beck
Schwarzblende
Thriller
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Der vorliegende Text ist eine Neuauflage des 2014 unter demselben Titel beim Wilhelm Heyne Verlag, München, erschienenen Romans.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5383.
Neuausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagfoto: Howard Kingsnorth/Stone/Getty Images
eISBN 978-3-518-77776-3
www.suhrkamp.de
Motto
This is a simple story of good and evil,
light and dark,
white and black.
»Sun«, Hofesh Shechter Company
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
Mittwoch
1
2
3
4
Donnerstag
5
6
7
Freitag
8
9
10
11
12
Samstag
13
14
15
Sonntag
16
17
18
19
20
21
22
23
Montag
24
25
26
27
Dienstag
28
29
30
Mittwoch
31
32
Donnerstag
33
34
35
36
37
38
39
Freitag
40
Drei Wochen später
Informationen zum Buch
Schwarzblende
Mittwoch
1
Niemand lief mit einer Machete durch London.
Abgesehen von den beiden Männern, die gerade an ihm vorbeigingen. Niall lehnte an der Brückenbrüstung, er hatte Fotos von der Stelle gemacht, an der einst der Fluss Effra in die Themse geflossen war, als sich einer der beiden nach ihm umdrehte. Der Blick des Mannes blieb eine Sekunde zu lang an ihm hängen. Er sah ihn an, auffordernd, so kam es ihm zumindest vor. Vielleicht wollte er ihn provozieren, herausfordern, hey, sieh mal, was wir uns trauen, und niemand hält uns auf. In dieser Stadt, die nicht einmal Mülleimer in der Nähe von Regierungsgebäuden zuließ, aus Angst, jemand könne darin eine Bombe platzieren, ganz so, als sei dies nur in Mülleimern möglich.
Niall hätte eigentlich noch zu tun gehabt. Den Dreh nächste Woche vorbereiten. Sich weiter umsehen, was er filmen würde, welche Kamerafahrten er plante, welche Motive sich eigneten. Dann einkaufen, nach Hause fahren … Eigentlich. Aber jetzt folgte er den beiden. Er war unruhig wegen der Macheten. Und irgendwie auch neugierig. So ein unterirdischer Fluss lief ihm außerdem nicht weg.
Die Männer gingen auf das südliche Themseufer zu, unter der Bahnbrücke durch, bogen links ab, ein Stück am Park entlang. Sie schienen es nicht besonders eilig zu haben. Manchmal kamen ihnen Leute entgegen, aber niemand achtete auf die beiden. Alle richteten ihre Blicke nur auf den eigenen Weg. Auf das eigene Leben.
Schauspieler, dachte Niall. Auf dem Weg zur Probe oder zum Dreh. Aber brachten Schauspieler ihre Requisiten selbst mit? Eine kleine Truppe, vielleicht. Oder Angeber, die etwas beweisen wollten. Eine Mutprobe, wie bei einem Junggesellenabschied, nur eben nichts Albernes, sondern etwas mit Waffen. Irgendeinen Grund würde es geben. Ob er die Polizei rufen sollte? Besser noch abwarten, wenigstens ein paar Minuten. Schließlich taten sie keinem was und wirkten auch nicht bedrohlich, trotz der Macheten. Sie trugen die Waffen allerdings mit einer Selbstverständlichkeit, als handele es sich um Spielzeug. Es könnte Spielzeug sein. Niall machte unauffällig ein paar Fotos von den beiden. Sonst würde es ihm später niemand glauben.
Von hinten hätten die beiden Brüder sein können. Ähnliche Größe, ähnliche Statur, beide trugen sie Jeans und Sneaker, beide hatten ähnlich geschnittene kurze schwarze Haare, tief gebräunte Haut, gepflegte Bärte, soweit Niall das beurteilen konnte. Der eine trug ein grünes T-Shirt, der andere ein blaues, anders waren sie nicht voneinander zu unterscheiden, nicht von hinten auf die Entfernung.
Sie bogen in den Park ein, wurden noch langsamer, blieben stehen. Sie sprachen miteinander, aber das hatten sie die ganze Zeit schon getan, immer mal wieder. Sie hatten sogar gelacht. Einmal hatten sie sich auch nach ihm umgedreht, ihn zur Kenntnis genommen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Niall hatte die ganze Zeit das Smartphone in der Hand, bereit, den Notruf zu wählen. Aber es geschah nichts. Die Machetenmänner standen herum und wirkten gut gelaunt, so als würden sie auf jemanden warten. Niall schätzte, dass sie etwas jünger waren als er. Nicht viel jünger. Mitte oder Ende zwanzig. Durchtrainiert, alle beide. Der mit dem blauen Shirt sah ziemlich gut aus: gleichmäßige offene Gesichtszüge, große wache Augen. Der mit dem grünen Shirt wirkte durch seine schmaleren Lippen und die enger zusammenstehenden Augen etwas verschlossener. Wieder sprachen sie miteinander, lachten, sahen sich manchmal um.
Zwei Jogger quälten sich durch den Park. Eine junge Frau schob einen Kinderwagen, neben ihr eine weitere Frau, etwa im selben Alter. Ein Typ schritt an Niall vorbei quer über den Rasen.
Es störte sich immer noch keiner an den Macheten. Spielzeugschwerter, davon war Niall mittlerweile überzeugt. Sie trafen sich hier im Park zu irgendwelchen Rollenspielen. Gleich würden ihre Freunde kommen, ebenfalls mit Spielzeugwaffen, vielleicht sogar in Verkleidung. Alles harmlos. Gut, dass er nicht die Polizei gerufen hatte, er hätte sich nur blamiert. Niall machte noch ein paar Aufnahmen von den beiden. Dann drehte er sich weg und ging.
Er hatte den Park schon fast verlassen, als er jemanden schreien hörte. Es waren Angstschreie, dann riefen mehrere Stimmen durcheinander. Er sah sich um. Die Machetenmänner bedrohten jemanden. Es war der Junge, der so entschlossen an ihm vorbeigegangen war. Er hatte die Hände erhoben, wie um sich zu ergeben, und rief immer wieder: »Lasst mich.« Dabei war er viel größer als die beiden, durchtrainiert, und trotzdem unsicher und verletzlich. Er war allein, sie zu zweit und bewaffnet. Sie hielten ihn mit ihren Macheten in Schach. Einer stand vor ihm, der andere hinter ihm, beide hatten die Knie leicht gebeugt, als wären sie bereit zum Sprung, hatten die Arme ausgebreitet, die Waffen als Verlängerung, zur Umarmung bereit.
Die Jogger waren nicht weit von Niall entfernt stehen geblieben und sahen in Richtung der drei.
Niall hatte sein Smartphone immer noch in der Hand, um die Polizei zu rufen, aber dann tippte er auf das Symbol für die Kamera.
»Ruft die Polizei«, sagte er zu den Joggern.
Beide tasteten zeitgleich nach ihren Telefonen.
»Warum rufen Sie nicht an?«, fragte der eine, während der andere schon den Notruf wählte. »Sie haben das Ding doch in der Hand.«
»Ich filme«, sagte Niall.
»Spinner«, sagte der andere.
Der im blauen Shirt holte mit der Machete aus und zielte auf den Hals des Jungen, traf aber seinen zum Schutz erhobenen linken Arm. Der Junge schrie vor Schmerz, wich zurück und krümmte sich. Mit der rechten Hand drückte er auf die blutende Stelle am linken Oberarm. Der mit dem grünen Shirt stand daneben, filmte ebenfalls mit dem Smartphone. Niall hörte, wie er zu seinem Freund sagte: »Noch mal, du musst weitermachen.« Er sagte es, als würde er Anweisungen zur Reparatur eines Motorrads geben.
»Ich mach doch«, sagte der im blauen Shirt und trat dem Verletzten gegen die Knie, der daraufhin ins Gras fiel und seine Angreifer zwischen Schmerzensschreien verfluchte. Dann beugte sich das blaue Shirt über den Jungen und hackte auf ihn ein.
Der im grünen Shirt sagte: »Ja. Richtig. Du machst das gut.«
»Ich weiß.« Der andere klang gereizt. Er hackte weiter, bis die Schmerzensschreie seines Opfers abrupt abrissen. Er hackte auch danach immer noch weiter, aber nicht mehr so motiviert, als fehlten ihm die Schreie.
»Das dauert«, sagte der mit dem Smartphone.
»Ich weiß«, sagte der andere wieder. Seine Bewegungen bekamen etwas Träges. Zum Schluss stocherte er mit der Spitze der Klinge an dem Toten herum. Sein Freund lief um ihn herum und filmte weiter, bis er aufhörte und die Machete gelangweilt durch die Luft schwang. Blut tropfte von der Klinge und von seinen Händen. Sein Shirt war ebenfalls voller Blutspritzer, und auf seinem Gesicht mischten sich Schweißperlen mit dem Blut des Jungen.
Der mit dem grünen Shirt ließ das Handy sinken, nickte ihm anerkennend zu und legte ihm eine Hand auf die Schulter. Dann sah er zu Niall und den Joggern, zu den anderen Menschen, die ein Stück hinter Niall stehen geblieben waren. Schaulustige. Die Faszination des Todes. Sie war immer stärker als die Angst.
»Wir haben Besuch«, sagte der im grünen Shirt.
Der Mörder folgte seinem Blick und richtete sich zu voller Größe auf. »Das ist gut.«
2
»Hey«, sagte das grüne Shirt zu einem der Jogger. »Hey! Was machst du mit dem Handy?«
Der Mann, der die Polizei gerufen hatte, ließ das Telefon fallen und hob die Arme. »Nichts, nichts.«
Der in Grün hob seine Machete und ging auf ihn zu. »Nichts? Willst du mich verarschen? Hast du telefoniert?«
Der Jogger machte sich in die Hose. Sein Begleiter stöhnte auf, vor Entsetzen oder weil es ihm peinlich war. Statt ihm zu helfen, war er zurückgewichen.
»Telefonieren ist scheiße. Ihr sollt Respekt haben. Nicht telefonieren.« Er stellte sich direkt vor den Jogger. »Du sollst dir genau ansehen, was wir machen. Hast du gehört? Nicht telefonieren. Das ist scheiße.«
Der Jogger wimmerte.
Niall rief: »Er hat nichts gemacht. Ich hab’s gesehen.«
Er hielt die Kamera weiter auf den Machetenmann gerichtet, merkte aber, dass ihm schwindlig wurde.
»Du!«, rief der im grünen Shirt. »Du hast aufgepasst, ja?« Er ließ die Machete sinken. »Hast du das alles aufgenommen?«
Niall nickte.
»Alles?«
»Ja.«
»Gut. Warte. Geh nicht weg.« Er zog etwas aus der Hosentasche, ein Stück Stoff, das er auseinanderfaltete. Ein schwarzes Rechteck, oben in Weiß arabische Schriftzeichen, darunter ein weißer Kreis, ebenfalls mit Schriftzeichen. Die Flagge des Islamischen Staats. Er ging zurück zu seinem Freund und dem Toten, stellte sich vor die beiden und schwenkte das Tuch.
»Ist das drauf? Hast du’s?«
Niall nickte. Er hatte Angst. Einerseits zog ein Fluchtreflex an ihm. Andererseits wollte er bleiben und sehen, wie es weiterging.
»Komm näher«, sagte der mit der Flagge.
Niall gehorchte. Er war kein Deut besser als alle anderen, die stehen geblieben waren, aber bei ihm kam noch etwas hinzu: eine Art Pflichtgefühl. Er hatte alles, was geschehen war, dokumentiert, und jetzt war es seine Aufgabe, die beiden abzulenken, von den Joggern, von den anderen Menschen, die hinzugekommen waren, von den Frauen mit dem Kinderwagen, die immer noch im Park waren, anstatt sich und das Kind in Sicherheit zu bringen. Niall konzentrierte sich auf seine Angst, wusste, dass er sie nutzen musste wie ein Schauspieler sein Lampenfieber.
»Ihr kämpft für den Islamischen Staat?«, fragte er.
»Ja!«, rief der andere stolz und schwenkte noch einmal mit Hingabe die Flagge.
Der Mann in Blau schob ihn beiseite, dabei hinterließ er einen Blutabdruck auf dessen Shirt. Er ging direkt auf Niall zu und sah in die kleine Smartphone-Kamera. Niall hatte Mühe, ruhig stehen zu bleiben. Seine Instinkte riefen ihm zu: abhauen. Er hatte schon andere Raubtiere vor der Kamera gehabt und sie beim Töten gefilmt, aber keines war ihm so nah gekommen. Er stellte sich breitbeinig hin, um seinem Körper die Illusion von Stabilität zu geben, und hielt das Smartphone mit beiden Händen. Die Aufnahme verwackelte trotzdem.
»Wir haben einen Soldaten getötet.« Der Mann zeigte mit der blutigen Machete auf den Toten im Gras. Nialls Blick und die Kamera folgten der Geste. Der Junge am Boden hatte sehr akkurat und kurz geschnittenes, hellbraunes Haar. Er war höchstens Anfang zwanzig. In jedem Fall jünger als Niall, auch jünger als die beiden Männer. Er trug normale Kleidung. Nichts wies darauf hin, dass er Soldat war. Vom Haarschnitt einmal abgesehen, aber dieser Kurzhaarschnitt konnte alles bedeuten. So wie die Bärte der beiden anderen auch alles Mögliche hätten bedeuten können.
»Wir haben einen britischen Soldaten getötet, weil wir im Krieg sind.«
»Welcher Krieg? Meinst du den Dschihad?«
»Wir befinden uns im Krieg gegen alle, die den Islamischen Staat nicht anerkennen.«
»Ihr seid Dschihadisten?« Nialls Hände waren jetzt ruhiger, dafür klang seine Stimme etwas kratzig.
Der Grüne hob den rechten Zeigefinger und grinste in die Kamera. Der Blaue sagte: »Wir töten eure Soldaten, weil ihr unsere Soldaten getötet habt. Wir nehmen euch die Frauen, wie ihr uns die Frauen genommen habt. Wir machen eure Kinder zu Waisen, wie ihr unsere Kinder zu Waisen gemacht habt.« Er veränderte leicht seine Position und warf seinem Freund einen kurzen Blick zu. Der nickte ihm zu. Der Blaue fuhr fort: »Wir unterstützen die Errichtung des Islamischen Kalifats und tun, was Abu Bakr al-Baghdadi verlangt. Es ist unser Wunsch, seine Soldaten zu sein. Wir fordern die Befreiung aller Palästinenser. Ihr habt Palästina besetzt und die Juden dorthin geholt. Ihr kommt in unsere Länder und tötet Frauen und Kinder und Zivilisten. Wir töten eure Soldaten. Dieser Mann«, wieder zeigte er mit der Spitze der Machete auf den Toten, »hat unsere Frauen und Kinder und Zivilisten getötet. Wir dürfen ihn töten. Es ist unsere Aufgabe.«
»Habt ihr ihn gekannt?«
»Er war Soldat.«
»Woher wusstet ihr das?«
»Er war Soldat«, wiederholte der Blaue und trat einen Schritt auf Niall zu.
Niall ließ die Kamera sinken.
Der Mann mit der blutigen Machete sagte: »Das soll jeder sehen. Stell das ins Internet.«
»Was?«
»YouTube«, rief der in Grün.
»Okay«, sagte Niall. Er schluckte ein paarmal, weil er glaubte, Druck auf den Ohren zu haben, wie beim Fliegen, aber es wurde nicht besser.
»Lass laufen. Dreh weiter«, sagte der in Blau.
Niall zielte mit dem Smartphone wieder auf die beiden.
Der mit dem grünen Shirt ging vor der Leiche auf und ab, fuchtelte ein paar Mal mit seiner Machete in Richtung der Jogger, um die sich weitere Passanten gruppiert hatten.
Ich muss weiter mit ihnen reden, dachte Niall. Wenn sie reden, sind sie abgelenkt. Dann kippen sie ihren Wahnsinn in die Kamera und lassen die Leute in Ruhe. Er dachte noch darüber nach, was er fragen sollte, da rief der in Grün etwas.
»Takbīr!«
»Allāhu akbar!«, antwortete der Blaue.
Niall sagte schnell: »Wo kommt ihr eigentlich her? Ihr seid doch aus London?«
Der Mann zögerte. Niall betrachtete sein Gesicht auf dem kleinen Display, weil er es nicht wagte, ihn direkt anzusehen. Der Mann wirkte vollkommen normal auf ihn. Ruhig, gelassen. Er hatte dunklere Haut und schwarzes Haar, könnte Araber sein. Vielleicht auch nicht. Er sprach mit unverfälschtem Südlondoner Akzent.
»Palästina«, sagte der im blauen Shirt endlich. »Wir wurden von euch Briten besetzt und unterdrückt, ihr habt uns unser Land genommen.«
»Ihr seid beide aus Palästina?« Niall hörte, wie sich Polizeisirenen näherten. »Dein Freund auch?«
»Wir fordern die Errichtung des Islamischen Kalifats in unserer Heimat.«
»Er kommt auch aus Palästina?«
»Türkei«, rief der im grünen Shirt.
»Türkei?«
»Wenn die türkische Regierung weiter das Wasser des Euphrat kontrolliert, um unsere Brüder im Islamischen Staat zu erpressen, müssen wir Istanbul befreien!« Er schwenkte die schwarze Flagge und stellte sich zu seinem Freund, dem Palästinenser.
»Wir befinden uns im Krieg mit den Streitkräften der Ungläubigen, mit allen Ungläubigen«, sagte der Palästinenser. Der im grünen Shirt reichte ihm die Flagge. Dann ging er zurück, beugte sich über den Toten, stieß ihn mit der Fußspitze an.
»Komm her«, sagte der Türke zu Niall. »Komm, ich zeig dir was. Na los. Und immer schön weiterfilmen.«
Niall näherte sich ihm langsam, achtete darauf, dem Palästinenser nicht zu nahe zu kommen und weiterhin beide im Auge und im Bild zu behalten. Er hätte sich darüber keine Sorgen machen müssen: Der Palästinenser stellte sich zu seinem Freund und hielt mit beiden Händen die Flagge hoch wie vorher der Türke. Die blutverschmierten Hände, die die schwarze Flagge mit den weißen Zeichen hielten, die Machete mit den blutroten Schlieren, die er weiter in einer Hand umklammert hier, sodass es aussah, als sei die Flagge daran befestigt. Archaisch der Triumph des Mannes, der gerade getötet hatte, für seinen Glauben, sein Land, sich. Er stolzierte neben der Leiche auf und ab. Demonstrierte Sieg, Macht, Überlegenheit. Ein großartiges Bild. Eine schreckliche Erinnerung an jeden Krieg in der Geschichte.
Der Mann im grünen Shirt brachte sich in Position: Breitbeinig stand er neben dem Kopf des Toten. Er umklammerte die Machete fest mit beiden Händen, holte aus und ließ sie auf den Hals des Toten niedersausen. Blut spritzte, und er hackte immer weiter, brüllte nun bei jedem Schlag nach seinem Gott.
Niall zwang sich, das Smartphone weiter so zu halten, dass er alles im Bild hatte, aber er schaffte es nicht, direkt hinzusehen. Am liebsten wäre er weggerannt. Hinter sich hörte er entsetzte Schreie. Er warf einen Blick über die Schulter. Immer mehr Menschen waren gekommen. Sie standen eng aneinandergedrängt in kleinen Gruppen, starrten ängstlich und fassungslos, hatten die Hände vors Gesicht geschlagen. Einige übergaben sich, ein Mann war ohnmächtig geworden.
Niall schloss für einen Moment die Augen und wünschte sich ganz weit weg. Als er die Augen wieder öffnete, war der im grünen Shirt fertig. Er hatte den Kopf des Jungen abgehackt. Er stieß ihn ein Stück vom Körper weg wie einen Fußball, beugte sich hinab und hob ihn auf.
»Hast du das?«, rief er Niall zu. »Das machen wir mit denen, die gegen den Islamischen Staat kämpfen.« Dann rief er seinem Freund zu: »Polizei.«
Niall dachte, die beiden würden spätestens jetzt fliehen. Aber sie taten es nicht. Sie blieben, wo sie waren. Immerhin legten sie den Kopf des Jungen wieder auf den Boden.
Niall speicherte die Filmsequenz ab. Seine Hände waren nass vom Angstschweiß. Der Touchscreen seines Smartphones konnte die Befehle, die er mit den Fingerspitzen eingab, kaum verstehen. Immer wieder musste er den Daumen an seiner Hose abwischen, die Befehle wiederholen, etwas rückgängig machen, weil er zu sehr gezittert und etwas Falsches angeklickt hatte.
Sie kamen mit drei Mannschaftswagen, zwei Streifenwagen und zwei Rettungsfahrzeugen. Die beiden Männer mit den Macheten sahen sich nach ihnen um. Zwei Streifenpolizisten versuchten, die Schaulustigen zurückzudrängen. Niall blieb bei dem Palästinenser stehen und filmte jetzt die Polizisten. Sie waren bewaffnet. Special Police Force. Einer rief: »Alle Waffen auf den Boden, Hände dahin, wo wir sie sehen können.«
Die beiden anderen warfen ihre Macheten von sich und streckten die Arme zur Seite.
»Wir befinden uns im Krieg. Wir haben einen Soldaten getötet«, rief der Palästinenser.
Die Polizisten kamen immer näher, kreisten sie ein.
»Alle Hände hoch!«, tönte es.
Niall verstand erst jetzt, dass einige der Waffen auch auf ihn zielten. Dass er gemeint war. Er hob die Hände, das Smartphone hob sich mit.
»Hey, ich gehör nicht dazu«, rief er und sah sich um. »Sagt es ihnen! Ich gehör nicht zu euch!«
Der Palästinenser sah ihn nicht mal an. Der Türke zuckte grinsend die Schultern, dann sah er an sich hinab, senkte die rechte Hand und griff nach seiner hinteren Hosentasche. Wie jemand, der nach seinem Handy greift, weil er gerade eine Nachricht bekommen hat. Er zog das Handy heraus.
Jemand rief: »Waffe!«
Es folgten Schüsse.
Niall sah den Türken zu Boden gehen. Zwei große dunkle Flecken breiteten sich auf dem grünen Shirt aus. Der im blauen Shirt schrie und rannte zu seinem Freund. Die Polizisten waren schneller. Sie stürzten sich auf ihn und warfen ihn zu Boden. Jemand riss auch Niall um, setzte sich auf ihn, fesselte ihm Arme und Beine.
»Ich hab nichts damit zu tun.« Er keuchte und bekam keine Antwort.
Sanitäter rannten zu dem Angeschossenen. Niall konnte nicht erkennen, ob er tot war oder sie noch versuchten, ihn zu retten. Nach dem Jungen, seinem Kopf und seinem Körper, sah niemand.
Der, der auf Niall saß, erhob sich. Als er stand, versetzte er Niall einen Tritt in die Rippen. Zwei andere packten ihn an den Oberarmen und zogen ihn vom Boden hoch. Er sah, dass er mit dem Gesicht nur knapp neben einem Hundehaufen gelegen hatte. Dafür war sein Telefon im Kot gelandet.
»Mein Handy«, sagte er.
»Gehört uns«, sagte jemand in Uniform. »Und du auch.«
3
Sie stießen ihn durch die Hecktür in den Mannschaftswagen. Er fiel auf den Boden. Dort ließen sie ihn liegen. Er sah nur die Stiefel der Polizisten, die neben ihm saßen und ihn bewachten. Ein paar Mal fragte er, wo sie ihn hinbrachten. Er bekam keine Antworten, nur Fußtritte, bis er nichts mehr sagte.
Vielleicht dauerte die Fahrt eine Stunde, vielleicht etwas weniger. Durch die vergitterten hinteren Fenster konnte er vom Boden aus nicht viel sehen. Er glaubte aber, dass sie die Themse nicht überquerten und größtenteils in Richtung Osten fuhren. Greenwich, und noch weiter.
Die Polizisten sprachen nicht miteinander. Nur Fahrer und Beifahrer unterhielten sich, er hörte sie murmeln, konnte aber nicht einmal einzelne Wörter ausmachen. Niall spürte Schmerzen beim Atmen. Er versuchte, seine Position zu verändern, um besser Luft holen zu können. Ein Stiefel traf ihn im Rücken.
»Ups«, sagte jemand. Vielleicht der, der zugetreten hatte. Ein anderer schnaufte höhnisch. Mehr bekam Niall auf der Fahrt nicht mehr zu hören.
Als sie angekommen waren, packten ihn zwei Polizisten an den Schultern und schleiften ihn ins Freie. Sie ließen ihn auf den gepflasterten Boden fallen, er knallte hart mit dem Kopf auf. Wieder wurde er getreten. Jeder, der an ihm vorbeikam, schien kurz auszuteilen. Einer blieb stehen und trat zwei, drei Mal zu, bis ein anderer sagte: »Lass gut sein.« Niall konnte nur Füße in Stiefeln, Beine in Uniformhosen sehen. Er versuchte, den Kopf zu heben. Jemand drückte ihm den Kopf runter. Man ließ ihn noch eine Weile liegen, dann wurde er hochgehoben und in das Gefängnisgebäude gestoßen. Die Polizisten übergaben ihn an die Gefängnisbeamten wie einen Sack Müll.
Im Trakt für die Untersuchungsgefangenen sprach man nur das Nötigste mit ihm, Wärter wie Arzt: Ausziehen. Mund auf. Bücken. Husten.
»Woher haben Sie die Verletzungen?«, fragte der Arzt.
Niall sagte es ihm. Der Arzt reagierte nicht darauf, machte aber Fotos.
Niall sagte immer wieder: »Ich habe nichts damit zu tun. Ich war nur zufällig dort.«
Niemand interessierte sich für das, was er sagte. Man interessierte sich für Nialls Blut, Urin, Haare.
Er sagte: »Ich will telefonieren. Ich will einen Anwalt. Habe ich keine Rechte mehr?«
Niemand sah ihn auch nur an, als er das sagte.
Er bekam Gefängniskleidung und wurde in eine Einzelzelle geführt. Bevor die Tür hinter ihm zuging, sagte er: »Carl Davis. Das ist mein Onkel. Sie müssen mit ihm reden. Sie können mich nicht einfach hier festhalten, ohne dass ich jemandem Bescheid geben darf. Carl Davis, er arbeitet für das Gesundheitsamt. Bitte!«
Die Tür war längst zugeknallt. Niall klopfte und trat dagegen und rief, zunächst nach jemandem, mit dem er sprechen könne, dann um Hilfe, schließlich Verwünschungen. Dann gab er auf, weil er keine Kraft mehr hatte. Sein Kopf dröhnte, die Rippen schmerzten von den Tritten, sein Hintern fühlte sich wund an, weil der Arzt darin gewühlt hatte, seine Stimme machte nicht mehr mit. Er schleppte sich zu der Pritsche, legte sich auf die Decke und starrte an die Wand. Stand wieder auf, ging zum Waschbecken, ließ sich Wasser über die Hände laufen und wusch sich das Gesicht. Dort, wo er Schrammen vom Hinfallen hatte, schmerzte es, blutete aber nicht. Er spülte sich den Mund aus, ging zurück zu seiner Pritsche und starrte weiter an die Wand. Er hatte Angst davor, die Augen zu schließen. Er wollte nicht wieder sehen, wie sie dem Jungen den Kopf abschlugen. Aber die Bilder des abgetrennten Kopfs kamen immer wieder in ihm hoch.
Niall versuchte, an etwas anderes zu denken. Daran, dass sein Onkel ihn sicherlich hier rausholen würde. Sein Onkel Carl wusste meistens eine Lösung. Er war ein konservativer älterer Mann, spießig und ein wenig arrogant, aber doch irgendwie nett und vor allem hilfsbereit. Kannte sich aus mit Behörden, weil er selbst in einer arbeitete, und wusste mit hierarchischen Strukturen umzugehen, weil er früher beim Militär gewesen war. Eigentlich war Carl gar nicht sein richtiger Onkel. Er war ein Cousin von Nialls Mutter, aber Niall hatte schon früher immer Onkel Carl zu ihm gesagt.
Niall musste irgendwie an ein Telefon kommen. Er war in Großbritannien, nicht in Südamerika. Alles würde gut werden, versuchte er sich einzureden.
Es hielt nicht lange vor. In Nialls Vorstellung rollte der Kopf wie ein Fußball über die Wiese.
Niall stand von der Pritsche auf und schlug gegen die Tür, bis jemand kam. Die Tür wurde aufgerissen, Niall zurückgestoßen. Man warf ihn zu Boden. Niall hob die Arme schützend über den Kopf und zog die Beine an. Jemand bohrte ihm die Spitze eines Schlagstocks in die Schulter.
»Wenn du keine Ruhe gibst, haben wir noch eine ganz andere Zelle für dich, Arschloch«, sagte jemand. Als Niall hörte, dass sie wieder gingen, wagte er es, den Kopf zu heben und ihnen nachzusehen. Zwei Männer in Uniformen, mehr konnte er nicht erkennen. Er ließ den Kopf wieder sinken, blieb auf dem Zellenboden liegen, krümmte sich noch enger zusammen.
Zum ersten Mal dachte er: Was, wenn ich hier nicht mehr rauskomme?
Erst Stunden später kam jemand, um ihm etwas zu essen zu bringen. Falls man es Essen nennen wollte. Wieder fragte Niall, ob er telefonieren könnte. Wieder bekam er keine Antwort.
Er war müde, erschöpft und unterkühlt vom Liegen auf dem Boden, aber als er sich nach dem Essen auf die Pritsche legte, konnte er nicht einschlafen. Er hatte keine Orientierung, wo er war. Noch in London? Wie spät war es? Wann wurde es dunkel? Es rauschte und pfiff in seinen Ohren. Kam das von außen oder innen? Dabei war er noch nicht mal besonders lange eingesperrt.
Vor allem aber konnte er nicht schlafen, weil er immer wieder die Bilder vor sich sah: den Palästinenser, wie ihm das Blut von den Händen lief, an der Klinge der Machete entlang. Den Türken, wie er den Kopf des Jungen abschlug, abhackte, und ihn als Trophäe stolz in die Kamera hielt.
Warum hatten sie eigentlich nicht auch ihn umgebracht? Oder einen von den Joggern? Warum den Jungen?
Ein Soldat, hatte der Palästinenser im blauen Shirt gesagt. Vielleicht hatten sie ihn vorher schon gekannt. Oder ausgesucht. Vielleicht waren sie mit ihm verabredet gewesen. Der Junge war so zielstrebig an Niall vorbeigegangen. Er hatte sicher nicht gewusst, dass er in den Tod ging.
Ob er wirklich ein Soldat gewesen war? Ein junger Mensch, der nichts ahnend durch einen Park ging und dann getötet wurde, weil zwei Fanatiker der Welt etwas beweisen wollten.
Warum hatten sie nicht Niall umgebracht? Möglich, dass alles ganz knapp gewesen war. Dass sie ihn getötet hätten, wenn der Junge nicht vorbeigekommen wäre.
Und jetzt? Saß Niall hier, weil er für die Polizisten ein Terrorist war, weil er am Tatort gewesen war. Musste er Angst haben, von Gefängniswärtern misshandelt zu werden, obwohl er nichts getan hatte. In ihren Augen war er Teil einer islamistischen Terrorgruppe und Mittäter bei einem islamistischen Anschlag. Was sonst sollten die auch von ihm denken, er hatte danebengestanden und die Kamera draufgehalten, während der blutüberströmte Mörder ihm in aller Ruhe ein Interview gegeben hatte. Natürlich traten sie auf ihn ein. Langsam begriff Niall seine Lage: Seit man ihn im Park mitgenommen hatte, galten für ihn nicht mehr die üblichen Rechte, die jeder britische Staatsbürger üblicherweise genoss. Er hatte kein Recht auf einen Anwalt. Er durfte länger als üblich ohne Anklage festgehalten werden, sehr viel länger als jeder, der unter Mordverdacht stand.
Vorhin im Arztzimmer hatte er auf einer Akte lesen können, wo er sich befand: Belmarsh Prison.
Nach dem 11. September 2001 hatte man hier Gefangene untergebracht, die unter Terrorverdacht standen: ohne Anklage und ohne Prozess, auf unbestimmte Zeit. Bis der Lordrichter entschied, dass es sich dabei um einen Verstoß gegen die Menschenrechte handelte. Das britische Guantanamo wurde Belmarsh damals genannt. Sie hatten die Gesetze geändert. Mehrfach. Jetzt konnten sie einen achtundzwanzig Tage ohne Anklage festhalten. Achtundzwanzig Tage lang mit ihm machen, was sie wollten. Fast schon Glück, dachte Niall und fand den Gedanken nicht einmal zynisch. Im Parlament waren auch schon neunzig Tage diskutiert worden.
Während er hier festsaß, würde man seine Kleidung untersuchen, seine Körperflüssigkeiten, seine Wohnung, seinen Computer. Die Ermittler würden sein Bewegungsprofil oder eigentlich das Profil seines Handys erstellen, was leicht war, weil das GPS immer eingeschaltet und er bei allen möglichen sozialen Netzwerken registriert war, die auch ohne eine Aktion seinerseits seinen Standort veröffentlichten. Sie würden seine telefonischen Verbindungsdaten überprüfen, seine Mails, seine Suchanfragen im Netz, die aufgerufenen Seiten. Sie würden in seinen Kalender schauen, das Bewegungsprofil von jedem Tag stundengenau protokolliert vorfinden, seine Fotos sehen, sie würden seine Facebook-Postings und seinen Twitter-Account auf verdächtige Meldungen hin scannen. Sie würden alles nachprüfen, was es über ihn irgendwo bei irgendeiner Behörde gab, von der Geburtsurkunde bis hin zur letzten Steuererklärung, und die Ermittler hätten mehr Befugnisse, in seinem Privatleben herumzusuchen, als üblich. Er war ein Fall für den Inlandsgeheimdienst, den MI5.
Niall wurde schwindlig. Das Rauschen in den Ohren wurde lauter, er spürte den Herzschlag bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehen.
Sie würden etwas finden. Diverse Reisen ins Ausland. Darunter arabische, islamische Länder. Sie würden es gegen ihn verwenden. Sie würden sehen, dass er von der Brücke an bis zum Park denselben Weg genommen hatte wie die Attentäter. Sie würden sich fragen, was er so lange auf der Brücke gemacht hatte. Sie würden herausfinden, dass er immer wieder das Gebiet, auf dem sich das Gebäude des Auslandsgeheimdienstes MI6 befand, erforscht hatte. Vor allem den Lauf des unterirdischen Flusses. Wie das wohl für paranoide Terrorermittler aussah.
Er würde hier so schnell nicht mehr rauskommen. Würden sie ihm eine Chance geben, sich zu verteidigen? Oder ihn einfach hier eingesperrt lassen, ohne ihn jemals angehört zu haben? Niall dachte an das, was er über Guantanamo wusste, und daran, was angeblich auch in britischen Gefängnissen wie diesem geschehen war. Er dachte an die Bilder von den US-Soldaten, die Kriegsgefangene misshandelten, die Leichen des Feinds schändeten und sich dabei fotografierten. Daran, dass Menschen zu Sadisten wurden, wenn die Gesetze nicht mehr für sie galten. Wie sie sich veränderten durch die Macht, die sie mit einem Mal über andere Menschen hatten, ohne dass sie selbst mit einer Strafe zu rechnen hatten, ganz egal, was sie tun würden.
Achtundzwanzig Tage ohne Rechte und ohne Schutz. Und für die außerhalb seiner Zelle war er nur der, der die Kamera gehalten hatte.
Was würden sie mit den beiden Attentätern machen? Ob der Türke nach den Schüssen, die man auf ihn abgegeben hatte, überhaupt noch lebte? Ob sie den Palästinenser auf der Fahrt ins Gefängnis auch zusammengetreten hatten?
Er hatte dabei zugesehen, wie sie grundlos den Jungen geschlachtet hatten. Es war ihm egal, was mit den beiden geschah. Aber Niall hatte nichts getan. Die beiden hatten eine Strafe verdient, er nicht. Eigentlich war alles ganz einfach.
Langsam wurde er ruhiger. Je länger er nachdachte, desto logischer erschien es ihm, dass sich alles irgendwann klären würde. Niall hatte sich nie politisch geäußert. Es gab keine Verbindung zu den beiden Attentätern. Er konnte alles erklären – sobald man es ihn erklären ließe. Sein Onkel Carl kannte gute Anwälte, und sobald er erfuhr, was mit Niall geschehen war, würde er sich für ihn einsetzen. Außerdem passte er nicht ins Profil islamistischer Terroristen, auch nicht in das westlicher Konvertiten. Er stammte aus der weißen englischen Mittelschicht. Das würden diejenigen, die das Attentat untersuchten, berücksichtigen.
Wie schnell man zum Rassisten wurde, wenn es um die eigene Haut ging.
Niall atmete ruhiger und versuchte wieder zu schlafen. Es war zu hell. Das Licht ging nicht aus. Draußen war es mittlerweile dunkel, aber in seiner Zelle brannte gleißend helles Licht. Auf der Pritsche gab es nur einen übel riechenden Stoffballen als Kissen und eine nicht minder stinkende grobe, dünne Decke. Nichts, was er sich über das Gesicht ziehen wollte. Er legte eine Hand auf die geschlossenen Augen. Es half nicht. Er blieb wach liegen, und die Erschöpfung wuchs.
Nach einer Weile kam die Angst wieder zurück. Was, wenn sich da draußen doch niemand für ihn interessierte? Wenn sein Onkel keine Gelegenheit bekäme, ihm einen Anwalt zu stellen, bevor die achtundzwanzig Tage um waren? Was würde in dieser langen Zeit geschehen? Würden sie ihn irgendwann noch viel übler zusammenschlagen, einfach nur, weil sie es konnten? Ihm kein Essen bringen? Er erinnerte sich daran, was einer der Wärter zu ihm gesagt hatte. Dass es noch eine ganz andere Zelle gab. Niall wusste nicht, was er damit gemeint hatte, stellte sich aber ein dunkles Loch ohne Klo, ohne Waschbecken, ohne Pritsche vor. Einen Quadratmeter groß. Vier Wochen lang im eigenen Dreck sitzen.
Gab es so etwas heutzutage?
Er dachte an Guantanamo.
Es gab alles, und alles war möglich.
Niall hatte Angst, natürlich. Er hing an seinem Leben. An seiner Freiheit und den Möglichkeiten, die er noch hatte. Er war einunddreißig und hatte noch lange nicht das erreicht, was er erreichen wollte. Er drehte immer noch langweilige Dokumentarfilme, sogar noch langweiligere als vor ein paar Jahren, weil es in der Branche gerade nicht gut aussah. Und vermutlich auch deshalb, weil er vor zwei Jahren durch besondere Sturheit bei einer Produktion aufgefallen und rausgeflogen war. Das sprach sich rum. Aber er hatte damals keine gute Phase gehabt.
Niall wollte in Wirklichkeit die großen, spannenden Sachen machen: Missstände aufdecken. Menschen in Not zeigen. Politisch relevante Themen behandeln. Gebucht wurde er für Tiere und Landschaften. Wenn man einmal einen Ruf hatte, dann blieb der für immer an einem kleben. Tiere und Landschaften. Exotische Tiere und Landschaften. Trotzdem. Und der nächste Film würde über die vergessenen unterirdischen Flüsse Londons gehen. Er sah sich schon eines Tages die Kamera bei Kochshows schwenken.
Vielleicht war es doch nicht verkehrt, hier drin zu sein, dachte er für einen Moment. Dann sprangen die Lebensgeister wieder an. Raus hier, ab ins Leben, es gibt noch zu viel da draußen. Nein, er wollte nicht sterben.
Nicht so.
Niall stand auf und ging in der Zelle auf und ab. Sein Herz klopfte zu schnell, er musste sich bewegen, um ruhiger zu werden. Er fühlte sich, als bekäme er einen Herzinfarkt.
Wenn du hier rauskommst, sagte er sich, dann entschuldigst du dich bei ein paar Leuten. Bei deinem Vater, weil du so stur warst und nicht mit ihm reden wolltest, bei deiner Ex-Freundin, weil du sie hast sitzen lassen, ohne es ihr zu erklären, bei deinen Kumpels, weil du dich kaum noch im Pub blicken lässt und die Arbeit vorschiebst. Wenn du hier rauskommst, machst du alles anders. Dann nimmst du nicht mehr die Jobs an, die dich sowieso nerven, sondern machst nur noch das, was dich auch weiterbringt. Wenn du hier rauskommst.
Immer wieder maß er die Schritte von der Zellentür zur gegenüberliegenden Wand ab, hin und her. Und noch mal. Alles wird gut, versuchte er als Mantra, und weil es nicht funktionierte: Wir sterben doch alle irgendwann.
Mitten in seiner Zelle blieb er stehen. Er hatte gerade etwas verstanden: wie Religion funktionierte. Natürlich gab es keinen Sinn für die menschliche Existenz. Würden das mehr Menschen begreifen und akzeptieren, dass es nach dem Tod vorbei war, würden sie vielleicht aufhören, sich gegenseitig umzubringen. Leben und leben lassen. Am Ende sind alle gleich, dachte Niall, wir hören einfach auf zu existieren. Aber wenn jemand sagt, einige sind auserwählt, dann wollen die Menschen dazugehören und ein Leben nach dem Tod haben. Ein gutes Leben nach dem Tod. Ein besseres. Klare Feindbilder, klare Regeln, Angst vor Strafe, das Konzept des Nachlebens als Belohnung für den Gehorsam. Religion war eine sehr kluge Erfindung gegen die Angst vor dem Tod. So machte man Menschen ein Leben lang gefügig.
Nur, dass Niall an keinen Gott glauben konnte.
4
Er wurde wach, weil er Schritte vor seiner Zellentür hörte. Schritte kamen näher, metallisches Kratzen, Schritte entfernten sich. Und wieder von vorn. Es hatte ihn bereits eine Weile im Schlaf begleitet. Jetzt war er wach geworden und musste feststellen, dass es kein Traum gewesen war. Niall wusste nicht, wie spät es war. In seiner Zelle brannte immer noch gleißend helles Licht. Er konnte sich nicht erinnern, sich auf die Pritsche gelegt zu haben und eingeschlafen zu sein.
Er versuchte weiterzuschlafen. Nach kurzer Zeit kamen die Schritte wieder. Er setzte sich auf und lauschte. Vor seiner Tür blieb jemand kurz stehen. Ein metallisches Kratzen war zu hören, zwei Mal kurz hintereinander. Dann wieder Schritte, die sich entfernten.
Sie überwachten ihn. Suicide watch. Deshalb hatten sie Licht in der Zelle angemacht, um ihn im Auge zu behalten. Er sollte sich nicht umbringen.
Er wertete es als halbwegs gutes Zeichen. Sie brauchten ihn noch.
Oder hatten sie nur Angst vor schlechten Schlagzeilen? »Verdächtiger in U-Haft erhängt« kam nicht gut. Kurz fragte er sich, wie er auf Erhängen kam. Er sah sich in der Zelle um. Tisch, Stuhl, Klo, Waschbecken, Schrank, Bett. Die Tür hatte innen keinen Griff. Das Fenster war von außen vergittert und ließ sich nicht öffnen. Man konnte sich hier nicht erhängen.
Er stand auf und sah aus dem Fenster. Draußen setzte die Dämmerung ein. Es war noch sehr früh am Morgen. Er legte sich zurück auf die Pritsche und wälzte sich auf die Seite. Dann hörte er wieder Schritte.
»Ich bin noch da!«, rief er, bekam keine Antwort. Die Schritte entfernten sich.
Er fühlte sich müde, aber es stellte sich kein Schlaf ein. Die Bilder waren wieder da. Der abgetrennte Kopf. Das Blut an den Händen des Palästinensers. Niall setzte sich auf und wartete darauf, dass die Schritte zurückkamen. Er zählte die Sekunden, um seine Gedanken zu kontrollieren. Er wollte das Blut nicht mehr sehen.
Endlich hörte er die Schritte wieder.
»Hallo?«
Er bekam keine Antwort. Also stand er auf und stellte sich an die Zellentür. Er klopfte laut. Als sich nichts tat, trommelte er fester und trat mit dem Fuß dagegen. Er bereute es sofort. Er trug keine Schuhe. Niall schrie vor Schmerz auf, humpelte laut fluchend zurück zu der Pritsche und setzte sich hin. Er untersuchte seinen rechten Fuß, tastete ihn ab, in der Hoffnung, sich nichts gebrochen zu haben.
Es schien ihn jemand gehört zu haben. Die Zellentür öffnete sich. Ein Mann in Uniform kam herein und sah sich um, aber er sagte nichts.
»Ich will mit jemandem sprechen«, sagte Niall.
Der Mann drehte sich um und wollte gehen.
»Ich benötige lebenswichtige Medikamente«, rief ihm Niall hinterher.
Der Mann zögerte kurz, aber nur ganz kurz. Dann zog er die schwere Stahltür donnernd hinter sich zu.
Niall ließ sich zurücksinken. Sie reagierten mit Absicht nicht auf ihn. Egal, was er sagte. Sie sahen nur nach, ob er noch lebte. Das war alles.
Vielleicht tat sich etwas, nun, da er die Medikamente angesprochen hatte. Er musste abwarten. Niall tastete wieder seinen Fuß ab und bewegte vorsichtig die Zehen. Alles schien in Ordnung. Es tat nur noch etwas weh. Das nächste Mal würde er vorsichtiger sein. Er wusste ja jetzt, was er tun musste, um Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Er blieb liegen. Draußen war es heller geworden. Irgendwann würden sie ihm etwas zu essen bringen. Er hatte keinen Hunger, aber er würde etwas essen müssen, allein schon, um durchzuhalten. Ihm fiel der tote Junge ein, doch diesmal sah er nicht seine Leiche, sondern wie er voller Energie über die Wiese geschritten war. Was war sein Ziel gewesen? Wollte er zu einer Verabredung? Was war mit seiner Familie, seinen Eltern? Ob er Geschwister hatte? Eine Freundin? Für diese Menschen musste die Welt zusammenbrechen. Während er, bestürzt über sich selbst, feststellen musste, dass er gerade zum ersten Mal an die Hinterbliebenen des Getöteten dachte, hörte er wieder Schritte vor der Tür, und auch diesmal öffnete sie sich. Der Wärter von vorhin kam herein. Er hatte jemanden in Zivilkleidung dabei. Es war der Arzt, der ihn direkt nach seiner Ankunft untersucht hatte.
»Welche Medikamente brauchen Sie?«, fragte er ohne jede Begrüßung.
»Ibuprofen. Ich habe überall Schmerzen von gestern.«
»Die gehen vorbei.«
»Und außerdem kann ich nicht schlafen.«
»Völlig normal. Erste Nacht im Knast, wer schläft da schon gut.«
»Ich habe Angstzustände. Panik!«
»Ja. Wie gesagt.« Der Arzt wandte sich zum Gehen.
»Wenigstens eine Schmerztablette! Ich meine, wer hat mich denn zusammengetreten? Doch die Polizei, oder?«
»Sie bekommen von mir nur, was Sie zum Überleben brauchen. Wären Sie Diabetiker und bräuchten Insulin, wäre das so ein Fall.« Er ging zu Niall, fasste an sein Handgelenk und sah auf die Uhr, um den Pulsschlag zu messen. »Gleichmäßig und fest.« Dann beugte er sich über ihn und zog ihm das untere Augenlid runter. »Sieht gut aus.« Er drehte sich von ihm weg.
»Sie würden mir nicht mal eine Aspirin geben, was?«
»Entspannen Sie sich, machen Sie ein paar Yogaübungen oder etwas in der Art. Sie werden jedenfalls nicht dran sterben.«
»Ich habe überall blaue Flecken, und beim Einatmen tun mir die Rippen weh. Und …«
»Das gibt sich«, unterbrach ihn der Arzt. Er ging zur Zellentür.
Niall stand von der Pritsche auf und folgte dem Arzt. Er streckte die Hand nach ihm aus, weil er ihn aufhalten wollte. Der Wärter riss ihm den Arm auf den Rücken und stieß ihn zu Boden. Niall knallte mit dem Kopf gegen die Kante des Schranks. Er schrie auf.
»Mann, was machen Sie da?« Der Arzt klang verärgert. Er kniete sich neben Niall. »Lassen Sie ihn in Gottes Namen los!«
»Er wollte Sie angreifen.«
»Wirklich?«
»Ja. Ich hab’s doch gesehen.«
»Gehen Sie von ihm runter. Er blutet am Kopf. Ich muss mir das ansehen.«
»Erst sichern.« Er legte Niall Handschellen an. Niall schrie wieder auf, der Schmerz in seiner Schulter war kaum zu ertragen.
»Haben Sie ihm die Schulter ausgerenkt? Verdammt noch mal, wo haben Sie Ihre Ausbildung gemacht? Beim Wrestling?«
»Hey, Doctor«, sagte er, während er aufstand, Niall aber liegen ließ. »Sie sollten es doch besser wissen, mit wem wir es hier den ganzen Tag zu tun haben. Und der hier«, er versetzte Niall einen Tritt, »hat’s verdient.«
»Helfen Sie mir, ihn hinzusetzen. Na los.« Sie hoben Niall vom Boden hoch und zerrten ihn auf die Pritsche. Der Arzt untersuchte Nialls Stirn. »Das können wir klammern. Das muss nicht genäht werden.«
»Sie wollen, dass ich ihn auf die Krankenstation bringe?«
»Nein. Zu mir ins Zimmer.«
»Doctor …«
»Dann holen Sie meine Sachen.«
Der Wärter rührte sich nicht vom Fleck.
»Heute noch.«
»Ich kann Sie nicht allein lassen.« Er nahm sein Funkgerät und trug einem Kollegen auf, die Arzttasche zu bringen.
»Warum kann ich nicht auf die Krankenstation?« Niall keuchte beim Sprechen. Der erneute Tritt in die Rippen hatte die Schmerzen von gestern, die entgegen seiner Behauptung schon besser geworden waren, zurückgebracht.
»Sicherheitsverwahrung«, sagte der Arzt. »Für die Krankenstation sind Sie noch zu gut beieinander.« Der Arzt drückte ihm ein Papiertaschentuch auf die Stirn. »Ich desinfiziere das gleich und klammere es Ihnen zusammen. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Sie waren nicht ohnmächtig, ich glaube nicht, dass Sie eine Gehirnerschütterung haben, aber achten Sie im Laufe des Tages auf Symptome. Falls Ihnen schlecht wird, zum Beispiel. Oder falls Sie Kopfschmerzen bekommen.«
»Was ist dann? Komm ich dann auf die Krankenstation?«
»Da wollen Sie nicht hin. Seien Sie froh, dass Sie hier ein bisschen für sich sind.«
»Sie wissen nicht, was Sie da sagen«, murmelte Niall.
»Sie kennen Ihre Mithäftlinge noch nicht«, sagte der Arzt.
»Machen Sie sich etwa doch Sorgen um mich?«
»Erwarten Sie nicht zu viel von mir. Ich gebe Ihnen nichts gegen Ihre Schlafstörung oder Ihre Angst. Da müssen Sie selbst mit klarkommen. Sie können von mir wirklich nur bekommen, was auf der Liste steht.«
»Welche Liste?«
»Medikamente, die Insassen zustehen.«
»Da gibt es eine Liste?«
Der Arzt betastete Nialls Schulter. Niall stöhnte auf.
»Arm heben.«
»Das tut weh.«
»Ja, aber heben Sie ihn. Ganz langsam.«
Er tat es. Sehr langsam.
»Wunderbar. Darf ich mal?« Der Arzt bog Nialls Arm vorsichtig in verschiedene Richtungen. »Nicht ausgerenkt. Wahrscheinlich was gezerrt. Sehen wir uns in Ruhe an.«
Der Wärter fragte über Funk noch einmal nach seinem Kollegen. Einen Moment später öffnete sich die Zellentür, und ein Arztkoffer wurde hereingereicht. Niall konnte nicht sehen, wer ihn brachte. Der Wärter nahm ihn entgegen und gab ihn an den Arzt weiter. Er blieb breitbeinig vor der geschlossenen Tür stehen, als hätte er Angst, Niall könnte während der Wundversorgung türmen.
Als der Arzt fertig war, fragte Niall: »Bekomme ich jetzt wenigstens Ibuprofen für die Schulter? Der Typ da reißt mir fast den Arm raus und schlägt mich blutig …«
»Ich war dabei. Ganz so war es nicht.«
»Ich habe Schmerzen.«
»Die sind sicher auszuhalten.«
»Ist das normal, wenn …«
»Hören Sie«, unterbrach ihn der Arzt. »Überlegen Sie mal, wo Sie hier sind. Und warum. Haben Sie geglaubt, es wird so eine Art Wellnessurlaub?«
»Ich hab überhaupt nichts …«
Wieder unterbrach der Mann ihn, aber diesmal sprach er sehr schnell und leise. »Ich bin Arzt, kein Staatsanwalt und schon gar kein Richter. Es muss mir egal sein, was Sie getan haben. Seien Sie froh, dass man mich überhaupt zu Ihnen gelassen hat, und halten Sie am besten den Mund.«
Der Arzt drehte sich um, den Koffer in der Hand, und klopfte an die Stahltür. Jemand öffnete sie von außen. Der Wärter warf Niall noch einen misstrauischen Blick zu, bevor er ging. Dann schloss sich die Zellentür.
Niall starrte auf den Stahl. Er konnte also froh sein, dass der Arzt bei ihm gewesen war? Was machten sie mit dem Türken? Ihn an seinen Schussverletzungen sterben lassen?
Niall hatte zugesehen, wie er einem Toten den Kopf abgehackt hatte. Noch vor wenigen Stunden hatte er gedacht, dass er kein Mitleid mit ihm und dem Palästinenser haben würde. Gerade aber spürte er, wie sich seine Sicht relativierte, während aus der Angst vor den Wärtern Wut wurde. Sie schlugen und traten, weil sie es konnten und niemand genau hinsah. Aber nicht nur das. Es geschah mit System. Nicht mit den Gefangenen reden. Sie nicht schlafen lassen. Die ständige Kontrolle. Die Verweigerung medizinischer Hilfe. Institutionalisierte Folter. Wenn Niall an Guantanamo dachte, waren es noch sanfte Methoden. Der Arzt hatte recht gehabt: Er sollte froh darüber sein, wie es bisher für ihn gelaufen war, und von nun an den Mund halten.
Donnerstag
5
Ein anderer Wärter weckte ihn.
»Gibt’s was zu essen?«, fragte Niall. Er musste weggedämmert sein und hatte kein Gefühl dafür, wie spät es war.
»Mitkommen.«
»Ich hab Hunger.«
Der Wärter antwortete nicht. Er sah ihn nur an und zeigte auf die offene Tür.
»Wie spät ist es?«
Der Mann schwieg.
»Bekomm ich meine Klamotten wieder?«, fragte Niall.
Nichts.
»Kann ich einen Anwalt anrufen?«
Er erwartete schon gar keine Antwort mehr. Er fragte nur, um noch einmal gefragt zu haben. Schweigend führte man ihn durch Gänge und Sicherheitsschleusen in den Gefängnishof, wo ein Transporter auf ihn wartete. Zwei Männer saßen in der Fahrerkabine, zwei bewachten ihn hinten. Das Unwirklichkeitsgefühl, das eine Panikattacke ankündigte, stellte sich langsam ein.
»Wo bringt ihr mich hin?«
Keine Antwort.
Niall versuchte, während der Fahrt durch die vergitterten Fenster des Transporters etwas zu erkennen. Lange Zeit sagte ihm die Gegend nichts, und er schaffte es nicht, die Schilder zu lesen, an denen sie vorbeikamen. Er glaubte aber, dass es in Richtung City ging, jedenfalls nicht aus London heraus. Als sie am Greenwich Park vorbeikamen, hatte Niall die Orientierung wieder. Er erkannte das Old Royal Navy College und auf der anderen Seite das National Maritime Museum. Ihm fiel ein, wie er dort vor längerer Zeit einmal gewesen war. Spazieren, mit seiner Freundin. Jetzt Ex-Freundin, weil er nicht mit ihr über das hatte reden wollen, was ihn am meisten beschäftigte.
»Welcher Tag ist heute?«, fragte Niall.
»Donnerstag.«
Er war fast erschrocken darüber, dass sie ihm antworteten. Eigentlich hatte er nur gefragt, um etwas zu fragen. Vielleicht auch, um sich zu versichern, dass er wirklich nur eine Nacht im Knast gewesen war. Er wagte noch eine weitere Frage. »Und wie spät ist es?« Er tippte auf späten Nachmittag, dem Licht nach zu urteilen. Im August wurden die Tage langsam wieder kürzer.
»Fünf.«
Ihm würde übel von dem Schaukeln des Transporters. Wann hatte er zuletzt gegessen? Heute hatten sie ihm kein Mittagessen gebracht, vielleicht hatte er da gerade geschlafen. Er fühlte sich unterzuckert, außerdem hatte er Durst. Er sagte es ihnen. Diesmal reagierten sie nicht.
Nach einer guten Stunde waren sie an der Westminster Bridge angelangt. Er sah Big Ben und die Parlamentsgebäude. Ein Anblick wie auf einer Postkarte, wären die Gitter nicht gewesen. Eine Brücke weiter flussabwärts war der MI5. Noch eine Brücke weiter flussabwärts der MI6, und gleich dahinter Vauxhall Pleasure Gardens, der Park, in dem man dem Jungen den Kopf abgehackt hatte. Er fragte sich, ob sich die Terroristen mit Absicht diesen Ort ausgesucht hatten, so nah an den Geheimdiensten.
»The Met?«, fragte Niall.
Der eine sah ihn an, schien ihm mit den Augenlidern zuzunicken.
Der Transporter bog von der Victoria Street rechts ab und hielt vor der bewachten Einfahrt zu dem Gelände, auf dem sich das Gebäude von New Scotland Yard befand: ein rechteckiger, hoher Klotz, bestehend aus glatten, spiegelnden Glasscheiben. Der Fahrer sprach mit den Beamten an der Absperrung, dann öffneten sich die Schranken. Sie fuhren an das Gebäude heran und hielten davor.
Seine Begleiter blieben sitzen und warteten. Niall hörte auch nicht, dass die beiden in der Fahrerkabine ausstiegen. Er machte sich nicht die Mühe zu fragen, worauf sie warteten. Seine Bewacher wurden nicht unruhig, es schien alles nach Absprache zu laufen oder im Rahmen zu sein, die beiden kannten die Abläufe. Niall sah, dass einer von ihnen eine Schachtel Zigaretten in der Hosentasche hatte und abwesend mit den Fingern daran herumspielte.
»Du kannst ruhig rauchen«, sagte er. »Stört mich nicht.«
»Nein.«
»Dann eben nicht.« Niall hatte es nett gemeint. Jetzt fühlte er sich beleidigt.