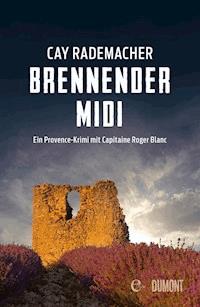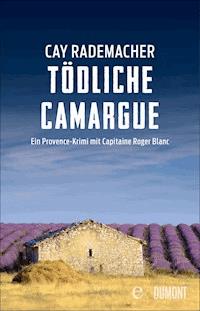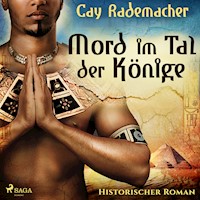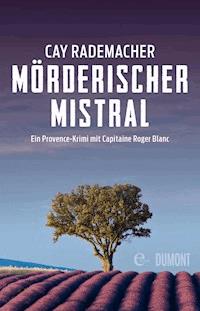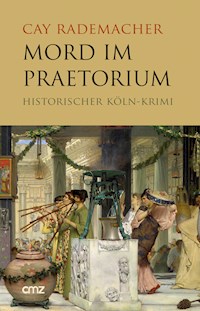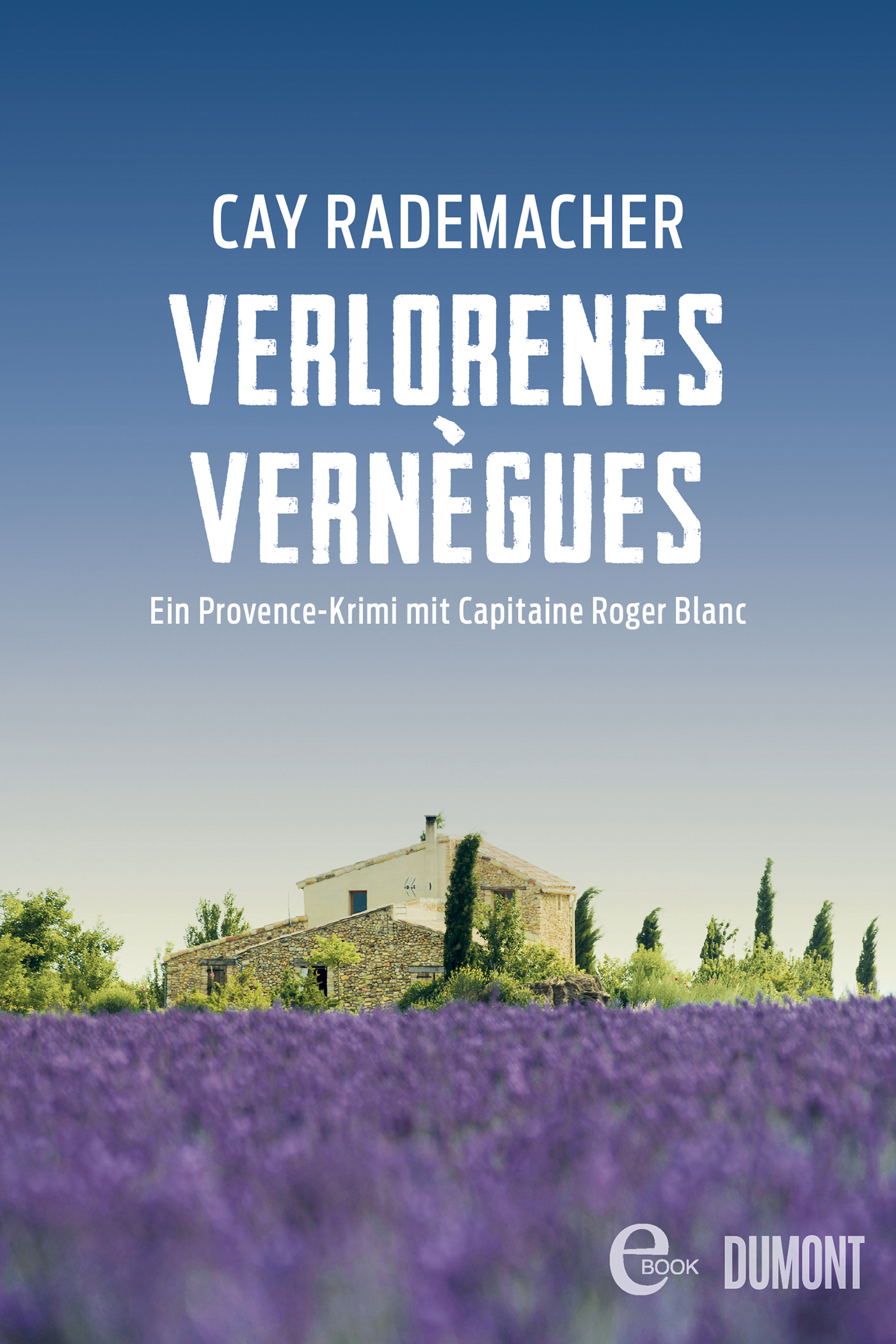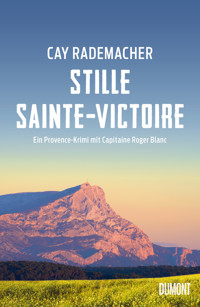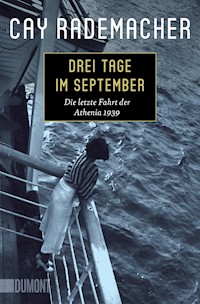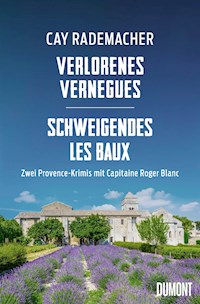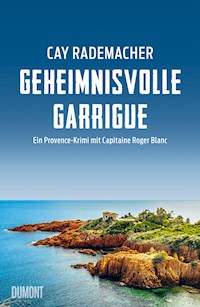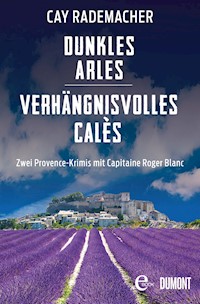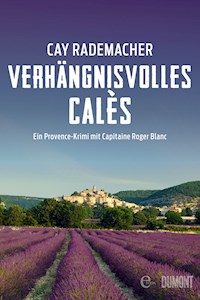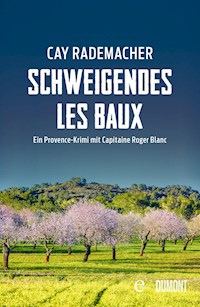
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Capitaine Roger Blanc ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Blühende Mandelbäume und düstere Verbrechen - der achte Fall für Capitaine Roger Blanc Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der berühmten Burgruine liegen die Carrières de Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem nun Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil ein Bild aus seiner umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert heimlich noch ganz andere Nachforschungen angestellt hat, und stößt auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten Dramen der französischen Kriminalgeschichte. Der Mörder ist damals in der Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss … Mord in der Provence - Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Band 9: Geheimnisvolle Garrigue Band 10: Stille Sainte-Victoire Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Ähnliche
Februar in der Provence: Es wird langsam Frühling, die Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. In einem düsteren Tal unterhalb der berühmten Burgruine liegen die Carrières de Lumières, ein aufgegebener Steinbruch, in dem nun Kunstausstellungen gezeigt werden. Während eines Besuchs wurde ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer, Patrick Ripert, Privatdetektiv. Der wohlhabende Besitzer eines Mandelhofs in der Nähe hatte ihn erst wenige Tage zuvor engagiert, weil ein Bild aus seiner umfangreichen Sammlung gestohlen worden war. Wie hängen die beiden Fälle miteinander zusammen? Blanc findet heraus, dass Ripert heimlich noch ganz andere Nachforschungen angestellt hat, und stößt auf ein grausames Verbrechen: Vor sieben Jahren wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten Dramen der französischen Kriminalgeschichte. Der Mörder ist damals in der Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss …
© in medias res
Cay Rademacher, geboren 1965, ist freier Journalist und Autor. Bei DuMont erschienen seine Kriminalromane aus dem Hamburg der Nachkriegszeit: ›Der Trümmermörder‹ (2011), ›Der Schieber‹ (2012) und ›Der Fälscher‹ (2013). Seine Provence-Serie mit Capitaine Roger Blanc umfasst acht Fälle, zuletzt kam ›Verlorenes Vernègues‹ (2020) heraus. Außerdem schrieb er die Kriminalromane ›Ein letzter Sommer in Méjean‹ (2019) und ›Stille Nacht in der Provence‹ (2020). Cay Rademacher lebt mit seiner Familie in der Nähe von Salon-de-Provence in Frankreich.
CAY RADEMACHER
SCHWEIGENDESLES BAUX
Ein Provence-Krimimit Capitaine Roger Blanc
Von Cay Rademacher sind bei DuMont außerdem erschienen:
Der Trümmermörder
Der Schieber
Der Fälscher
Mörderischer Mistral
Tödliche Camargue
Brennender Midi
Gefährliche Côte Bleue
Dunkles Arles
Verhängnisvolles Calès
Verlorenes Vernègues
Ein letzter Sommer in Méjean
Stille Nacht in der Provence
eBook 2021
© 2021 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
unter Verwendung eines Fotos von LademannMedia/Alamy Stock Foto
Karte: Kartografie Angelika Solibieda, Cartomedia-Karlsruhe
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-8321-7083-7
www.dumont-buchverlag.de
Savourons ces courtes délices;
Disputons-les même au zéphyr,
Epuisons les riants calices
De ces parfums qui vont mourir.
Der Tote im Steinbruch
Die Hügel der Alpilles ragten vor Capitaine Roger Blanc auf wie eine Festung, hinter der sich das Böse verbarg. Er schüttelte den Kopf, um diese düsteren Gedanken gleich wieder zu vertreiben; es fehlte noch, dass er nach mehr als zwanzig Dienstjahren bei der Gendarmerie plötzlich abergläubisch wurde. Es war zwar Freitag, der Dreizehnte – doch es war ein 13.Februar, und das bedeutete in der Provence: Der Frühling war da. Alles hier ist schön, sagte er sich, und ich bilde mir diesen finsteren Unsinn bloß ein, weil ich weiß, dass irgendwo in diesen Hügeln ein Toter auf mich wartet.
Blanc fuhr mit Lieutenant Marius Tonon und Sous-Lieutenant Fabienne Souillard in einem alten Mégane über die Route Départementale 27A. Die Federung des Streifenwagens ächzte in jeder Kurve, und obwohl sie die Fenster heruntergelassen hatten, hielt sich in den Sitzpolstern noch immer der säuerliche Geruch des betrunkenen Schlägers, den die Kollegen vom Nachtdienst ein paar Stunden zuvor verhaftet hatten. Blanc hatte die Sirene ausgeschaltet, das Blaulicht jedoch angemacht, was eigentlich auch überflüssig war, denn an diesem frühen Vormittag hatten sie die Landstraße fast für sich allein. Sie fuhren durch eine sanft ansteigende Ebene, Olivenhaine zu beiden Seiten, so weit das Auge reichte. Das Laub der Bäume war dunkelgrün, außer dort, wo die Strahlen der tief stehenden Sonne die kleinen Blätter trafen und sie wie Silberpapier leuchten ließen. Der Boden zwischen den schwarzen Stämmen war geharkt, krümelige, rötlich schimmernde Erde, es hatte seit Tagen nicht mehr geregnet. Zwischen den Baumwipfeln machte Blanc im Vorbeifahren flüchtig Dächer und Mauern aus, ockerrot, braungelb: versteckte uralte Häuser mitten in den weiten Hainen. Zwischen den Oliven wuchsen hier und da Mandelbäume; sollte es dabei ein Muster geben, konnte Blanc es jedenfalls nicht erkennen. Sie standen in voller Blüte, Wolken in Weiß und Rosa mitten in einem Meer aus Grün, die erste Blütenpracht des Jahres, die fröhliche Botschaft: Der Winter ist vorüber.
Marius hatte, gegen die Vorschriften, das Autoradio angestellt. Radio Camargue spielte den Song einer Sängerin, deren Stimme sich wahnsinnig jung anhörte, ein Lied, das man jetzt überall vernahm, und Blanc schien der einzige Kerl in der ganzen Provence zu sein, der weder den Titel kannte noch wusste, wie die Interpretin hieß. Dann kamen Nachrichten: Die Seuche in Wuhan. Sie brachten nun täglich Zahlen von Infizierten und Toten, und in den Alpen und im Département Oise mussten ein paar Pechvögel, die sich bei Chinareisenden angesteckt hatten, ebenfalls in Quarantäne.
»Arme Schweine«, kommentierte Marius. »Ausgerechnet jetzt, wenn es endlich warm wird, müssen die zu Hause bleiben.«
»Mir ist das irgendwie unheimlich«, sagte Fabienne. »Gestern war dieses Virus in Asien, heute in den Alpen – wer weiß, wo es morgen ist.«
Blanc schwieg. Fabienne hatte eine Fehlgeburt erlitten, und er wusste, dass sie es demnächst wieder mit einer künstlichen Befruchtung probieren würde. Seine Kollegin wirkte tough und unbesiegbar, doch sie machte sich seither Sorgen bei jedem Husten.
Die Route Départementale stieg nach ein paar weiteren Minuten Fahrt steiler an, die Reifen quietschten in den scharfen Kurven, weil Blanc nicht vom Gas gehen wollte. Aus der Ferne hatten die Alpilles dunstig-blau geschimmert, die Hügel hatten weich gewirkt und waren unmerklich in den Himmel übergegangen. Aus der Nähe jedoch erkannte Blanc weiße und gräuliche Felsen, die Dutzende Meter schroff aufragten, bis sie in Kappen aus Kiefernwäldern und Garrigues-Gestrüpp verschwanden. Auf einem der höchsten Gipfel thronte die Ruine der Burg von Les Baux: zernarbte Mauern, Fensterhöhlen, Gewölbe, ein eckiger Turm, aufgerissen, als hätte ihn einst ein Blitz gespalten. Die Burg war aus demselben Stein gefügt wie der Fels. Es sah so aus, als hätte ein wahnsinniger Künstler eine fantastisch große Festung vor Urzeiten aus dem Berg herausgemeißelt, denn man konnte fast nicht erkennen, wo der natürliche Stein endete und wo der von Menschenhand gemauerte begann.
»Ich war zuletzt mit meinen Kindern hier, als sie noch in der Grundschule waren«, sagte Marius. »Irgendwann im vergangenen Jahrhundert.«
»Das hört sich an, als hättest du persönlich noch ein paar Ritter und Troubadoure angetroffen«, spottete Fabienne. »Ich habe die Ruine mit Roxane im vorigen Sommer besucht. War allerdings keine gute Idee, die Autos der Touristen parkten bis runter zu den Olivenhainen. Wir mussten den ganzen Berg neben dem Straßengraben hochmarschieren und waren schon genervt, als wir endlich oben angekommen waren. Dann haben wir eine halbe Stunde an der Kasse angestanden. Später wollten wir etwas essen, und die kleine Stadt unterhalb der Burg besteht ja praktisch nur aus Restaurants. Aber überall haben uns die Kellner bloß ausgelacht, als wir fragten, ob wir ohne Reservierung einen Tisch haben könnten.«
Blanc warf einen Blick auf die Seitenstreifen. Tatsächlich waren auf den Asphalt der Landstraße schon Hunderte Meter vor Les Baux Parkbuchten gemalt, vor Felsen und Olivenbäumen standen Parkscheinautomaten. Er hatte schon gehört, dass sich in Les Baux die Reisenden aus aller Welt drängten, weshalb er nie Lust dazu verspürt hatte, diesen Ort zu besuchen. Doch an einem Freitag im Februar noch vor zehn Uhr morgens war die Straße frei. Erst kurz vor der Burg rollten sie an ein paar geparkten Wagen, zwei Wohnmobilen und einem großen weißen Reisebus mit niederländischem Kennzeichen vorbei. Blanc bog nach rechts in eine schmale Straße ein, die von Felswänden zu beiden Seiten fast erdrückt zu werden schien. Val d’enfer las er auf einem Schild.
Das Höllental.
Sie hatten ihr Ziel erreicht.
Blanc fuhr jetzt im Schritttempo. Kein anderes Auto war zu sehen. Die Felsen ragten zwanzig, dreißig Meter neben der Straße auf und kappten das Sonnenlicht. Im Halbdunkel wirkten die Brocken, als würden sie sich bewegen: Drachen, Feen, Grimassen, schiefe Hexenhäuser, eine Fabelwelt aus Stein glaubten die Menschen des Mittelalters dort zu erkennen.
»Unheimlicher Ort«, murmelte Blanc.
»Die Leute haben sich über dieses Tal schon immer die seltsamsten Geschichten erzählt«, erwiderte Marius. »Hier hat nie jemand leben wollen. In Les Baux, das ja. Aber hier: nein. Obwohl der Mistral in Les Baux mörderisch wüten kann, schlimmer als sonst irgendwo in der Provence, während du in diesem Tal geschützt bist.«
»Roxane und ich haben im Internet recherchiert, nachdem wir hier waren«, ergänzte Fabienne. »Meine Lieblingsgeschichte ist die Legende von Abd al-Rahman, dem Emir von al-Andalus.«
»Die Schatzgeschichte kenne ich auch!«, rief Marius. »Als ich klein war, habe ich hier mal einen Tag lang jeden verdammten Stein umgedreht.«
»Der Emir soll aus Spanien gekommen sein, um die Provence zu plündern«, fuhr Fabienne fort. »Doch irgendwann wurde er von christlichen Rittern geschlagen. Auf seiner Flucht hat er die gigantische Beute irgendwo im Val d’enfer versteckt – und da ruht sie noch heute. Wie aufregend.«
»Ist da was dran?«, fragte Blanc.
Seine Kollegen lachten.
Blanc trat auf die Bremse. Hinter einer Kurve hatten einige mit Maschinenpistolen bewaffnete Gendarmen die Straße gesperrt. Auf einem Parkplatz standen ein paar Streifenwagen und der helle Kleintransporter der Kriminaltechniker. Drei Uniformierte und zwei Frauen in weißen Ganzkörperschutzanzügen gingen auf eine Felswand zu und schienen dann plötzlich darin zu verschwinden.
»Dann wollen wir uns die Scheiße mal ansehen«, sagte Marius.
Der Alarm war vor etwas mehr als einer Viertelstunde in der Station von Gadet eingegangen. Sie wurden in die Carrières de Lumières gerufen, die »Steinbrüche des Lichts«. Auch die kannte Blanc bislang nur vom Hörensagen: alte Steinbrüche im Val d’enfer, die in eine Art Kunstmuseum verwandelt worden waren und wo man Riesenfotos berühmter Bilder auf die Felswände projizierte. Blanc stellte sich eine Grube vor, in der man eine Diashow installiert hatte – so ähnlich wie das, was stolze Hobbyknipser vor vielen Jahren nach dem Sommerurlaub in ihren Wohnzimmern vorgeführt hatten, nur größer. Er hatte bislang keinen Grund gesehen, sich so ein altmodisches Spektakel freiwillig anzutun. Die Carrières de Lumières hatten an diesem Tag um neun Uhr geöffnet, und wenn man der ersten Meldung glauben durfte, waren auch schon einige Dutzend Besucher dort gewesen. Einer dieser Besucher war mitten im Steinbruch tot aufgefunden worden.
Eine junge Beamtin – mon Dieu, dachte Blanc, inzwischen waren die jüngsten Kolleginnen jünger als seine Tochter Astrid – winkte sie auf einen kleinen Parkplatz auf der linken Straßenseite, wo sich eine Lücke in der Felswand auftat. Ein Mann wartete dort auf sie. Er schüttelte Blanc die Hand, kaum dass er den Mégane verlassen hatte, fast so, als wollte er ihn mit einem Händeschütteln aus dem Wagen zerren.
»Gut, dass Sie so schnell gekommen sind! Ich bin Maurice Pavy, der Direktor von Carrières de Lumières. Wir sind wirklich schockiert. So schrecklich. Wer hätte gedacht, dass hier jemals …«
»Ihnen gehört der Steinbruch?«, unterbrach Blanc den Redestrom. Dann stellte er sich und seine beiden Begleiter vor. Pavy war klein gewachsen und dick, aber die Bewegungen seiner Hände waren erstaunlich schnell. Einer dieser fülligen Männer, die flink geblieben waren, vermutete Blanc, ein Mann in seinen Fünfzigern, der lange Sport getrieben, aber irgendwann vor seiner anderen Leidenschaft kapituliert hatte: dem guten Essen. Perfekte Glatze, die Kopfhaut glänzte wie poliert, dichter schwarzer Vollbart, ohne ein einziges graues Haar. Blauer Kaschmirpullover, dunkelblaue Hose, doch darunter hohe hellbraune Timberland-Trekkingschuhe. Ein Mann, der sich gern elegant kleidete, aber viel draußen unterwegs sein musste.
Pavy lächelte wehmütig. »Ich wünschte, der Steinbruch würde mir gehören«, antwortete er. Seine Stimme war angenehm voll, ohne laut zu sein. »Der Steinbruch ist heute lukrativer als zu der Zeit, als man hier wirklich noch Steine gebrochen hat. Aber ich bin nur ein Angestellter von Culture Espace. Es ist ein privates Unternehmen, das im Auftrag von Gemeinden Denkmäler verwaltet. Ich bin der Regionaldirektor für Les Baux und kümmere mich um die Carrières de Lumières und«, er deutete mit einer unbestimmten Geste die Straße, die sie gekommen waren, hoch, »auch um die Burg von Les Baux. Die betreut Culture Espace nämlich ebenfalls.«
»Ich wünschte, ich würde Ihre Kultureinrichtungen unter angenehmeren Umständen kennenlernen«, sagte Blanc.
»Das wünschte ich auch. Folgen Sie mir bitte.« Pavy drehte sich um und überquerte die Straße. Unten in der Ebene zwischen den Olivenhainen war es schon mild gewesen, vielleicht fünfzehn, sechzehn Grad. Doch in der engen Schlucht hier oben war es noch so kühl, dass Blanc sich seine Lederjacke zuzog. Der Asphalt war an manchen Stellen dunkel vom Tau, die Felsen sandten Kältewellen aus, in der Luft lag Pinienhauch: Oberhalb des Tals, auf den Kämmen der Alpilles, badeten die Wälder bereits in der Sonne, ein leichter Wind wehte ihren Duft bis zu ihnen hinunter. Sie näherten sich einer lotrechten Felswand, in die eine Spalte hineingehauen worden war. Hineingesägt, korrigierte sich Blanc in Gedanken. Die Öffnung war relativ schmal, doch ungewöhnlich hoch und mit so auffallend geraden Kanten, dass sie nur Menschenwerk sein konnte. Als hätte jemand den Stein sorgfältig weggeschnitten, um ein überdimensioniertes Tor in den Berg einzufügen. Pavy führte sie an einigen Kassenhäuschen vorbei, in denen kein Angestellter mehr saß, das eingeschaltete Display der Apparate aber verriet, dass sie noch bis vor Kurzem besetzt gewesen sein mussten. Und erst dann erkannte Blanc, dass die Carrières de Lumières gar keine Grube irgendwo im Val d’enfer waren, wie er gedacht hatte – sondern eine monströse Höhle.
Pavy hatte ein schweres, schwarzes Stofftuch angehoben, hinter dem sich eine Stahltür verbarg. Nachdem sie hindurchgegangen waren, stand Blanc in einer Welt wie aus einer anderen Zeit: eine Höhle, so weit wie eine Kathedrale. Im Licht versteckter Halogenspots schimmerte der Stein grau, weiß oder hellgelb. Die Wände waren gerade, Ecken waren scharf herausgeschnitten; im Näherkommen sah er jedoch Hunderte kleine Narben im Stein, Sägespuren, Meißelhiebe, Risse. Hoch über ihm war ein Gesicht in den Felsen geritzt worden, ein grinsender Mann, dessen Proportionen falsch waren, fast wie bei einer Kinderzeichnung. Blanc bildete sich einen Moment lang ein, dass ihn diese steinerne Fratze verhöhnen würde. Zu seiner Rechten führte eine in den Felsen geschlagene, breite Rampe zu einer Art Balkon über dem Höhlenboden hinauf. Zur Linken zweigte ein Gang ab, breit wie eine Autobahn, der sich nach Dutzenden Metern in der Dunkelheit verlor. An manchen Stellen war der Fels zu Pfeilern herausgeschnitten worden, die die Last des über ihnen liegenden Berges trugen, es mussten Tausende Tonnen sein. Diese Pfeiler, schätzte Blanc, waren vielleicht zehn Meter hoch und genauso breit. Er fühlte sich beklommen. Ihm war, als wäre er in eine archaische Grabkammer eingedrungen, eine Pharaonengruft, ins Pyramidenhafte vergrößert. Die Luft war kalt, abgestanden und schmeckte nach Steinstaub.
»Beeindruckend, nicht wahr?«, meinte Pavy. Er hatte seine Stimme gesenkt, so als zieme es sich nicht, hier laut zu sprechen. »Selbst mich überwältigt der Anblick, jedes Mal wenn ich eintrete, und dabei bin ich fast täglich hier.«
»Das muss uralt sein«, murmelte Fabienne.
Pavy schüttelte den Kopf. »Nur ungefähr zweihundert Jahre. Das war einmal der Carrière des Grands Fonds, einer von mehreren Steinbrüchen in diesem Tal der Alpilles. Arbeiter haben hier Blöcke von zwei Kubikmetern aus dem Kalkstein gesägt.«
»Und sich manchmal einen Spaß erlaubt?« Blanc deutete auf die Fratze hoch über ihren Köpfen.
Pavy nickte. »Jeder Mensch ist ein Künstler. Na, jedenfalls hat man die Blöcke anschließend im Freien zu handlichen Formaten zersägt und fortgeschafft. Praktisch alle alten Häuser der Region sind aus dem Kalkstein von Les Baux gemauert worden.« Er deutete auf Sägespuren an einer Wand. »1935 wurde der Steinbruch aufgegeben, weil sich der Abbau nicht länger lohnte. Man brauchte einfach zu viele Arbeiter. Stahl und Beton waren billiger. Danach kümmerte sich jahrelang niemand mehr um diese Höhle.«
»Hier könnte man Fantasyfilme drehen«, sagte Blanc.
Pavy verzog sein Gesicht. »Nicht Fantasy, mon Capitaine, sondern Kunst! Jean Cocteau hat 1959 im Steinbruch Le Testament d’Orphée gedreht.« Der Direktor deutete auf den breiten Gang, der sich im Dunkeln verlor. »Am anderen Ende zeigen wir die hier spielenden Szenen in einer Art Felsenkammer.«
Er führte sie jedoch nicht dorthin, sondern auf die Rampe zu ihrer Rechten. »Seit 1977 ist der Steinbruch eine Galerie, wenn Sie so wollen. Seither läuft hier Jahr für Jahr ein neues Kunstprogramm. Wir projizieren Meisterwerke berühmter Maler in Riesengröße auf die Wände. In der letzten Saison haben wir van Gogh gezeigt. Normalerweise schließen wir Anfang Januar, wenn die Winterferien vorbei sind, und bereiten mehrere Wochen lang eine neue Show vor, die Anfang März startet. Doch die letzte Show mit van Gogh war unglaublich populär, mehr als siebenhunderttausend Besucher, und wir mussten noch Interessenten abweisen, weil einfach nicht mehr Menschen in den Steinbruch hineingepasst hätten. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Vorstellung ausnahmsweise auch im Februar für eine Woche zu zeigen. Die Leute lieben das. Zumindest bis heute. Ich kann nur hoffen, dass dieses … dieses Unglück niemanden abschreckt.«
»Wir werden unsere Ermittlungsergebnisse nicht mit den Touristen teilen«, versprach Blanc, der diese Sorgen schon viel zu oft gehört hatte: Ein Verbrechen war dann schrecklich, wenn es das Geschäft verdarb.
»Wir werden bereits weniger chinesische Besucher haben als in der letzten Saison, fürchte ich«, fuhr Pavy fort. »Seit dort diese seltsame Grippe ausgebrochen ist, stornieren ganze Reisegruppen ihre Besuche in Les Baux.«
»Den Tag, an dem keine Touristen mehr durch Les Baux streifen, werden Sie und ich nicht erleben«, beruhigte ihn Marius.
Sie hatten den Balkon erreicht. Zwischen zwei Pfeilern sah Blanc auf die Höhle hinunter, dann atmete er tief durch und richtete den Blick zum Balkonboden. Auf dem staubigen Felsen lag der Tote.
Kriminaltechniker hatten schon mehrere mobile Scheinwerfer um die Leiche herum aufgestellt; die Kabel liefen über den Boden bis zu den Wänden, in denen geschickt versteckte Steckdosen eingelassen waren.
»Sie können nahe herangehen, mon Capitaine«, sagte eine der maskierten Kolleginnen von der Kriminaltechnik, »wir haben den Boden um die Leiche schon abgesucht. Da ist nichts: kein Fußabdruck, keine Zigarettenkippe. Passen Sie nur auf, dass Sie nicht ins Blut treten.«
Blanc nickte. Der Tote war ein kräftiger Mann, mittelgroß, schwarze, kurze Haare, plumpe, dicht behaarte Hände, seine Augen waren weit aufgerissen, als hätte er in seiner letzten Sekunde am fernen Höhlendach irgendetwas Schreckliches erblickt. Er war in einen weiten dunkelblauen Lodenmantel gehüllt, elegant und etwas altmodisch und eigentlich schon zu warm für diese Jahreszeit, zumindest in der Provence. Darunter trug er eine ebenfalls dunkelblaue Stoffhose und schwarze Lederschuhe, Kleidung, die eher zu einem normalen Museumsbesuch gepasst hätte und nicht in diesen alten Steinbruch. Vermutlich hatte der Unbekannte einen schwarzen Rollkragenpullover an, doch sicher konnte Blanc sich da nicht sein, denn das, was am Hals aus dem Mantel ragte, war nicht mehr eindeutig als Rollkragen zu identifizieren – es waren bloß noch Stofffetzen, die in Blut klebten.
Dem Mann war die Kehle durchtrennt worden.
Blanc betrachtete den Schnitt, eine bogenförmige Linie fast vom einen Ohr bis zum anderen. In seiner Ausbildung hatte er Fotos von Mordopfern gesehen, denen die Kehle durchgeschnitten worden war, aber in all den Jahren hatte er sich noch nie um einen derart schlimm zugerichteten Toten kümmern müssen. Er spürte, wie eine Welle der Übelkeit in ihm aufstieg, und hörte, wie Fabienne hinter ihm scharf einatmete. Vielleicht der Schock. Oder eine unbewusste Reaktion, so als wollte sie sich versichern, dass sie selbst noch problemlos einatmen konnte. Der Schnitt musste sehr tief sein, aus der Wunde war unfassbar viel Blut ausgetreten; circa sechs Liter zirkulierten in jedem Menschen, aber das hier sah aus, als wären sechzig Liter aus dem Körper geströmt. Neben Hals und Brustkorb hatte sich eine weite rote Lache über den Felsboden gebreitet. Sie war noch nicht ganz trocken. Trotzdem war der Unbekannte, vermutete Blanc, nicht verblutet – er musste erstickt sein. Der Schnitt hatte Schlagadern und Kehlkopf durchtrennt, und der Sauerstoffverlust hatte wahrscheinlich schneller zum Tod geführt als der Blutverlust.
Blanc betrachtete die Hände des Toten genauer. Blut überall. Die Rechte lag auf der Brust, dicht unter dem Hals, die Linke ruhte ebenfalls angewinkelt zwischen Kopf und Schulter auf dem Steinboden. Die eleganten Schuhe waren verdreckt, der Staub auf dem Boden daneben von den Sohlen zerkratzt.
»Putain«, murmelte Marius. Er war neben Blanc getreten und starrte auf den Toten. Die drei Gendarmen gingen nun in die Hocke und beugten sich über die Leiche. Der Eisengeruch des Blutes vermischte sich mit dem Hauch eines teuren Rasierwassers, in das sich der Mann eingehüllt hatte. Fabienne sog die Luft schon wieder scharf ein.
»Du solltest durch den Mund atmen, nicht durch die Nase« riet ihr Blanc. »Vielleicht ist der Täter von hinten gekommen«, erklärte er dann und deutete auf die Wunde. »Ein rascher Schnitt quer durch den Hals. Grausamer Schmerz, aber kein Geräusch. Das Opfer bricht zusammen, greift sich mit beiden Händen an die Kehle, die Beine zucken.«
»Wie lange?«, fragte Fabienne. Sie war blass geworden.
Marius zuckte mit den Achseln. »Kommt darauf an, ob er vor dem Angriff gerade ein- oder ausgeatmet hatte, schätze ich. Eine Minute? Zwei? Dann verlor er das Bewusstsein, seine Hände sanken vom Hals – und er war tot.«
»Zwei Minuten …«, murmelte Fabienne.
»Und niemand hat ihn gehört«, ergänzte Blanc. »Mit durchgeschnittener Kehle konnte er nicht mehr schreien.«
Blanc richtete sich wieder auf und blickte in die Höhle. Wie groß dieser verdammte Steinbruch war. Zwei Minuten. Bevor das Opfer auch nur tot war, hatte der Mörder schon wieder irgendwo hinter einem Pfeiler oder im anderen Gang verschwunden sein können. Oder vielleicht hatte er es sogar schon bis nach draußen geschafft.
»Wir müssen alle verhören, die sich heute Morgen im Steinbruch aufgehalten haben«, befahl er. »Besucher, Mitarbeiter, einfach alle.«
Pavy räusperte sich verlegen. »Alle, die noch da sind, mon Capitaine. Wir haben diesen, diesen …«, er war nur bis auf vier, fünf Schritte an den Toten herangetreten, »diesen Unglücklichen erst nach der Vorstellung gefunden. Ein Wärter hat den Schrei einer Besucherin gehört und ist hinzugeeilt. Doch während der Vorstellung kommen andauernd neue Besucher hinein und«, er hüstelte verlegen, so als glaubte er, dass das irgendwie seine Schuld sei, »nun ja, viele gehen auch während einer Vorstellung hinaus. Die Vorstellung läuft, dann flammen kurz die Lichter zur Pause auf, und die Vorstellung beginnt wieder. Es ist eine endlose Schleife. Die Besucher kommen und gehen, wann sie möchten. Das fällt niemandem auf. Ich weiß nicht, wie viele Besucher die Carrières de Lumières verlassen haben, bevor wir den Toten entdeckten.«
»Der Mann ist also während einer Vorstellung getötet worden«, vergewisserte Blanc sich. »Während alles dunkel war? Wie ist das möglich? Und wie lange dauert so eine Vorstellung?«
»Wenn Sie es wünschen, dann zeige ich es Ihnen.« Pavy hob die Hand und winkte einen Mitarbeiter heran. Blanc gab einigen Uniformierten ein paar Hinweise.
Kurz darauf wurde alles schwarz.
Plötzlich flutete von überall Musik durch die Höhle, irgendetwas Klassisches. Farbschlieren wurden von Projektoren auf Wände und Fußböden geworfen, es war, als würde man in die tausendfach vergrößerten wilden Pinselstriche eintauchen. Auf einmal schimmerten in diesem bunten Chaos van Goghs Selbstporträts auf, auf jedem Pfeiler ein anderes. Blanc fühlte sich, als würden ihn die Augen des wahnsinnigen Malers von überall anstarren. Die Musik wechselte, Jazz nun, Häuser und Brücken leuchteten im Steinbruch, so groß, als könnte man durch van Goghs Bilder spazieren gehen. Später erklangen Opernarien, und Schriftzüge aus van Goghs Briefen liefen über Wände und Boden. Zu Smetanas Die Moldau blühten gelbe und orangefarbene Sonnenblumen auf dem Stein, blaue Irissträuße, ein Zweig mit Pfirsichblüten, so monumental, dass man sich wie ein Insekt fühlte, das um diese Blumen schwebte. Der Nachthimmel über der Rhône, deren gemaltes im Sternenlicht funkelndes Wasser durch irgendeinen Projektionstrick wie echtes Flusswasser dahinzuströmen schien. Am Ende leuchteten gelbe Weizenfelder im Steinbruch, darüber ein dräuender Gewitterhimmel, in den sich nach und nach ein Schwarm Krähen ergoss. Die dunklen Vögel schienen durch die Höhle zu fliegen, eine Krähe wurde größer und größer – und dann war alles schwarz.
Als die Scheinwerfer aufflammten, atmete Blanc tief durch. Krähen, Todesboten. Er fragte sich, ob der Ermordete in seinen letzten Augenblicken möglicherweise genau das gesehen hatte.
Erst nach und nach legte sich seine Verwirrung. Er analysierte die Lage: Die Vorstellung hatte mehr als eine Viertelstunde gedauert. Die Bilder wurden von Dutzenden versteckter Projektoren an die Wände geworfen, ohne Unterlass flimmerten Farben auf den Steinen. Die Höhle selbst war in Regenbogenlicht getaucht, bunte Schleier schienen mitten im Raum zu stehen, der Wechsel der Motive erzeugte manchmal die Illusion, als würden sich die Felsen bewegen oder in flirrender Luft auflösen. Die Polizisten, die in den Carrières de Lumières standen, hatten während der Vorstellung wie kleine Schattenrisse gewirkt, schwarze, beinahe zweidimensionale Geister, winzig neben den Bildern; die Höhle schien noch einmal doppelt so hoch gewesen zu sein wie zuvor.
Perfekt, dachte Blanc erschaudernd, das hier war perfekt für einen Mord.
Der Täter musste sein Opfer ausgespäht haben, während der Steinbruch in der Pause zwischen zwei Vorführungen durch Scheinwerfer erhellt wurde. Wenn man wusste, wo die Person stand, die man töten wollte, dann reichte das diffuse Licht während einer Vorstellung aus, um sich unbemerkt an das jetzt nur noch schemenhaft erkennbare Opfer zu schleichen. Wenn man dann rasch von hinten herankam und zustieß, fiel das niemandem auf: ein Schatten, der mitten im Geflimmer verschwand, nichts sonst. Und die Musik übertönte jeden anderen Laut, ganz sicher auch das Röcheln eines Sterbenden.
»Wir haben einhundert computergesteuerte Projektoren verbaut und ebenso viele Lautsprecher. Alles ist mit Glasfaserkabeln verbunden und perfekt synchronisiert. Die Leute lieben das«, erklärte Pavy nun schon zum zweiten Mal. »Wir haben jedes Jahr Hunderttausende Besucher. Noch nie ist etwas passiert.«
»Irgendwann ist immer das erste Mal«, brummte Blanc.
Einer der Schatten, den er während der Vorstellung im unteren Bereich des Steinbruchs bemerkt hatte, kam nun über die Rampe auf sie zu: Fontaine Thezan. Die Gerichtsmedizinerin trug eine ihrer extravaganten Brillen und hatte sich in einen roten Mantel gehüllt. Als sie ihm ihre Wange zum Begrüßungskuss bot, atmete Blanc den vertrauten Duft von Marihuana ein – und einen Hauch Schweiß. Fontaine Thezan hatte Ringe unter den Augen, die auch ihre große Brille nicht ganz verbergen konnte. Ob sie die letzte Nacht gar nicht geschlafen hatte? Zum ersten Mal, seit Blanc sie kannte, wirkte die Gerichtsmedizinerin erschöpft.
»Ich freue mich, dass Sie so schnell gekommen sind«, begrüßte er sie. Dann setzte er leise hinzu: »Fühlen Sie sich gut?«
»Besser als mein Patient«, erwiderte Fontaine Thezan kühl und betrachtete das Opfer. »Danke der Nachfrage. Sie lassen mich ein paar Augenblicke allein, ja?«
Ohne seine Antwort abzuwarten, beugte sie sich zum Toten hinunter, streifte sich Gummihandschuhe über und begann, die Leiche behutsam zu betasten.
Blanc wusste, dass Marius bei Leichenuntersuchungen nicht gern zusah, deshalb winkte er ihn zu sich. »Geh bitte nach draußen und überzeug dich, dass alle Personen, die in der Höhle waren, auch wirklich noch auf uns warten. Ich will auf keinen Fall, dass sich jemand davonstehlen kann.«
Marius nickte erleichtert. »Ich fange mit der Befragung an.«
Blanc und Fabienne warteten danach geduldig, bis Fontaine Thezan ihre erste vorläufige Untersuchung abgeschlossen und sich die Gummihandschuhe abgestreift hatte. Die Gerichtsmedizinerin steckte sich eine Mentholzigarette an und ignorierte Pavys missbilligenden Blick. »Der Schnitt war so tief, dass die Klinge bis auf den vorderen Halswirbel gedrungen ist«, begann sie.
»Mon Dieu«, flüsterte Fabienne. Sie sah aber nicht länger blass aus. Irgendwann gewöhnte man sich an den Anblick der Toten.
»Vermutlich hat sich der Täter dem Opfer von hinten genähert und einen raschen, tiefen Schnitt von links nach rechts durch den Hals gezogen. Sie suchen also einen Rechtshänder, mon Capitaine.«
»Einen Rechtshänder mit einem Kampfmesser oder einer Machete«, murmelte Blanc. »Wenn die Wunde bis auf die Halswirbel geht …«
Fontaine Thezan schüttelte den Kopf. »Das schaffen Sie auch mit einem guten Küchenmesser. Deshalb werden ja fast die Hälfte aller Tötungsdelikte mit dem Messer verübt: Jeder hat ein solches Mordwerkzeug im Haus.«
»Weitere Verletzungen?«, fragte Blanc.
Die Gerichtsmedizinerin schüttelte abermals den Kopf. »Nicht, soweit ich das bei der ersten Beschau feststellen konnte: kein Hämatom am Kopf, keine weiteren Stichwunden. Genau weiß ich das selbstverständlich erst, nachdem er bei mir auf dem Tisch gelegen hat.«
»Hat er sich gewehrt?«, wollte Fabienne wissen.
»Vermutlich nicht. Seine Hände sind zwar voller Blut, aber das kommt alles aus dem Hals, als er sich im Todeskampf an die Kehle fasste. Die Hände selbst zeigen keine typischen Abwehrverletzungen. Als ich den Körper auf die Seite gedreht habe, habe ich das in seiner Manteltasche ertastet.« Sie reichte Blanc eine dünne Plastikschutzhülle, in der ein französischer Führerschein steckte.
Blanc verglich das Bild mit dem Gesicht des Toten. »Das ist unser Mann«, verkündete er und las die Daten vor: »Patrick Ripert. Achtunddreißig Jahre alt. Der Führerschein ist vor zwanzig Jahren in der Gemeinde Montmorillon ausgestellt worden.«
»Nie gehört«, sagte Fabienne.
»Postleitzahl 86500«, fuhr Blanc fort. »Das ist das Département Vienne. Irgendwo in Aquitanien. Muss Hunderte Kilometer von hier entfernt sein.«
»Ein Tourist«, vermutete seine Kollegin.
»Monsieur Ripert muss längst nicht mehr da gewohnt haben, wo er einst den Führerschein gemacht hat. Vielleicht lebt er inzwischen irgendwo in der Provence. Lebte er«, korrigierte er sich.
»Ich überprüfe das«, erwiderte Fabienne und hatte bereits ihr iPhone in der Hand. »Aber ich muss raus. In der Höhle habe ich keinen Empfang.«
Blanc blieb mit Fontaine Thezan noch ein paar Augenblicke schweigend neben der Leiche stehen. »Darf ich?«, fragte er dann.
»Nur zu.«
Er streifte sich Gummihandschuhe über und tastete den Toten sorgfältig ab.
»Seltsam, nicht wahr?«, bemerkte die Gerichtsmedizinerin, nachdem er sich wieder aufgerichtet und die Handschuhe ausgezogen hatte. Sie blickte scheinbar gelassen auf das Mordopfer, aber Blanc kannte sie inzwischen gut genug, um zu sehen, dass etwas sie störte.
»Ja«, bestätigte er. »Ripert hat seinen Führerschein in der Manteltasche – aber nichts sonst. Keine Brieftasche, kein Geld, kein Handy, keine Schlüssel. Ohne Kreditkarte und Telefon ist man doch heute nackt. Und ohne Auto kommt man kaum bis zu diesem Steinbruch.«
Fontaine Thezan deutete auf die feinen Lederschuhe des Opfers. »Er wirkt jedenfalls nicht so, als sei er einen langen Weg zu Fuß gewandert.«
»Jemand muss Ripert ausgeraubt haben«, vermutete Blanc.
Vor den Carrières de Lumières verabschiedete er sich von Fontaine Thezan. Die Sonne war inzwischen so hoch gestiegen, dass ihr Licht endlich bis ins Val d’Enfer fiel. Es war warm und windstill, die Tauflecken waren längst verdampft, irgendwo in dem Wald über ihnen zwitscherten Spatzen. Bei Tageslicht sah er, wie blass die Ärztin war. Er zögerte kurz. »Wollen Sie nicht …?«
»Mir geht es wirklich ausgezeichnet«, unterbrach sie ihn nüchtern. »Schicken Sie einen Beamten nach Salon, der bei der Leichenöffnung dabei ist. Heute Abend haben Sie meinen Bericht auf dem Schreibtisch. Viel Erfolg bei der Jagd, mon Capitaine.«
Blanc sah ihr nach und ließ dann den Blick über den Parkplatz schweifen. Die Gendarmen hatten die Menschen, die in den Carrières de Lumières gewesen waren, in kleine Gruppen aufgeteilt, um sie zu befragen. Manche Kollegen machten sich Notizen, andere hatten ihre Handys als Aufnahmegeräte eingeschaltet. Vielleicht dreißig Besucher, schätzte er, darunter einige Kinder. Dazu noch etwa zehn Frauen in Blusen mit dem Aufdruck von Culture Espace, vermutlich die Damen an der Kasse und im Souvenirshop. Und vier junge Männer im schwarzen Outfit eines Sicherheitsdienstes. Blanc musterte die Menge und fragte sich, ob irgendjemand dort auffallend nervös wirkte. Oder ob ein Kerl darunter war, dem er es zutraute, einem Mann die Kehle durchzuschneiden. Absurd. Die Leute waren aufgeregt und unruhig, aber das war angesichts der Umstände ja auch verständlich. Im Übrigen wirkten sie jedoch harmlos.
Fabienne trat zu Blanc. »Patrick Ripert hat eine eigene Website«, sagte sie und hielt ihm ihr Handy hin. »Er ist Kunstdetektiv.«
»Klingt wie aus einem Roman von Agatha Christie.«
»Klingt nach ziemlich gutem Einkommen«, erwiderte Fabienne, »zumindest wirkt es auf seiner Website so, als hätte Monsieur Ripert nicht auf jeden Cent achten müssen. Ripert ist tatsächlich in Montmorillon aufgewachsen, aber schon als junger Mann nach Paris gegangen, um Kunstgeschichte zu studieren, und da wohnt er bis heute, behauptet er zumindest in der Vita auf seiner Seite. Irgendwie – seine Website bleibt da ziemlich vage – hat er schon als Student angefangen, für reiche Klienten nach vermissten Kunstwerken zu fahnden. Er sucht nach Bildern und Skulpturen, die bei Einbrüchen gestohlen worden sind oder bei Erbschaftsstreitigkeiten verschwinden oder die irgendwann von den Nazis geraubt wurden und seither verschollen sind. Wenn man seiner eigenen Darstellung glauben darf, dann gelingt es ihm ziemlich häufig, vermisste Werke aufzuspüren.«
»Was hat so ein Spezialist in einer Höhle verloren, in der Van-Gogh-Dias über die Wände laufen?«
»Keine Ahnung. Vielleicht ist er ja wirklich als Tourist in die Provence gekommen. Vielleicht arbeitet er hier aber auch für einen seiner Klienten. Noch habe ich nicht mal herausgefunden, wo er in der Region abgestiegen ist. Wir werden Stunden, vielleicht Tage brauchen, bis wir alle Hotels und Ferienhäuser überprüft haben.«
Blanc seufzte. »Wen muss ich informieren? Hatte Ripert Familie?«
Fabienne schüttelte den Kopf. »Du musst vermutlich niemandem dein Beileid aussprechen. Soweit ich das überblicke, gibt es weder Ehefrau noch Kinder. Auch keine Ex-Frau. Ob es eine Freundin oder einen Freund gibt, weiß ich nicht, in seiner Pariser Wohnung ist er jedenfalls alleine gemeldet. Und seine Eltern scheinen schon lange tot zu sein. Vielleicht hat er irgendwo Geschwister oder andere Verwandte, aber auch das wird uns einige Zeit kosten, bis wir das wissen.«
»Vorstrafen?«
»Nein. Ripert ist bei mehreren Prozessen als Zeuge oder Sachverständiger aufgetreten. Bei allen Gerichtsverfahren ging es um verschwundene Kunstwerke, die er wiedergefunden hatte. Sonst gibt es da nichts. Er war nie in Gewaltverbrechen verwickelt, nie in Familienstreitigkeiten, Beleidigungen, politische Sachen, Finanzaffären, nicht mal in Verkehrsdelikte. Das schließe ich zumindest aus den Einträgen in der Datenbank der Gendarmerie. Denn außer seiner Website findest du wenig über ihn im Internet, er war weder bei Facebook noch sonst einem sozialen Netzwerk, er taucht auf keiner Nachrichtenseite auf, und Google weiß auch nicht viel mehr über ihn, als dass er eben ab und zu vor Gericht ausgesagt hat.«
»Ein diskreter Mann.«
»Ein Privatdetektiv halt.«
Blanc dachte nach. »Hat Ripert denn auf seiner Website wenigstens eine Kundenliste veröffentlicht? Referenzen? Irgendjemanden, den wir nun befragen können?«
»Leider nein. Über die Prozesse, bei denen er ausgesagt hat, werden wir sicherlich an ein paar Namen kommen, aber auch das wird …«
»… dauern«, vollendete Blanc. »Leider sollten wir uns besser beeilen.« Er winkte Marius hinzu und erklärte den beiden, dass das Opfer vermutlich ausgeraubt worden war. »Möchte wissen, warum«, sagte er.
Aus den Augenwinkeln sah er, dass unter den Menschen, die auf dem Parkplatz warteten, plötzlich Unruhe ausbrach. Ein Mann schrie etwas, stieß einen Gendarmen vor die Brust, dann wurde er von zwei anderen Beamten zu Boden geworfen und mit Handschellen gefesselt. Die junge Beamtin, die Blanc vorhin an seine Tochter erinnert hatte, eilte auf ihn zu, ihre Wangen waren vor Aufregung gerötet. »Mon Capitaine!«, rief sie. »Wir haben den Täter!«
»Das können Sie mir auch leise sagen, Brigadier«, er sah auf das Namensschild an ihrer Uniform, »Brigadier Solange.« Sie eilten hinüber.
Die Gendarmen hatten den Mann inzwischen vom Boden aufgerichtet und zerrten ihn mit. Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Er bedachte Blanc mit einem finsteren Blick. Dunkle Augen, dunkle, zu einem Zopf gebundene Haare, olivenfarbene Haut, kleiner, aber sehniger Körper. Ein Gitane, dachte Blanc. Hunderte Gitanes zogen durch die Provence, campierten auf Plätzen, die ihnen die Gemeinden zur Verfügung stellten, oder wild am Rand irgendwelcher Schnellstraßen und Müllkippen. Gitanes, »Zigeuner«, tausend Vorurteile hallten sofort durch seinen Kopf. Lass dich nicht irremachen, ermahnte er sich. »Was ist passiert?«
Brigadier Solange reichte ihm eine Brieftasche aus schwarzem Leder. »Die haben wir bei diesem … diesem Monsieur entdeckt.«
Blanc öffnete die Brieftasche. Einige Geldscheine. Münzen. Zwei Kreditkarten und eine Carte d’Identité – alle Dokumente waren ausgestellt auf Patrick Ripert.
»Wie heißen Sie?«, fragte Blanc und starrte dem Mann in die Augen. Er hatte nicht vor, sich von diesem stechenden Blick einschüchtern zu lassen.
»Finden Sie es selbst heraus. Warum soll ich euch Flics die Arbeit abnehmen?«
»Je länger wir arbeiten, desto länger bleiben Sie unser Gast.« Blanc lächelte dünn.
Die Lippen des Mannes zuckten, so, als ob er etwas sagen wollte, es aber im letzten Moment bleiben ließ. Er war noch jung, nicht einmal Mitte zwanzig, doch Blanc glaubte, dass er nicht zum ersten Mal von einem Gendarmen verhört wurde. »Ich heiße Manuel Bonati«, murmelte er schließlich.
»Wo wohnen Sie?«
»Mal hier, mal dort.«
»Warum waren Sie in den Carrières de Lumières?«
Bevor der junge Mann antworten konnte, trat einer der Gendarmen vor. »Wir haben nicht nur eine Brieftasche bei diesem Typen gefunden.« Er reichte ihm einen durchsichtigen Plastiksack, in dem mehrere Geldbörsen, Autoschlüssel und Handys lagen. »Ein Taschendieb«, fuhr der Beamte fort, »der sich in der Dunkelheit während der Vorstellungen an die Touristen heranmacht.«
Blanc nickte. »D’accord. Zeigen Sie den Beutel allen Leuten auf dem Parkplatz. Die Besucher sollen ihre Wertsachen identifizieren. Vielleicht wissen die meisten noch nicht einmal, dass sie bestohlen worden sind. Nehmen Sie die Angaben der Geschädigten auf. Und wenn es Wertsachen gibt, die niemand für sich reklamiert, dann bringen Sie die zu mir zurück.«
Der Gendarm salutierte, winkte die junge Kollegin zu sich und machte sich daran, die Besucher zusammenzurufen.
Blanc wandte sich wieder dem Verhafteten zu. Er hatte die Anweisungen absichtlich so gegeben, dass Bonati alles hatte mit ansehen und anhören können. »Alors«, begann er, »so, wie ich das sehe, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für Sie, Monsieur Bonati. Entweder geben Sie zu, dass Sie ein Taschendieb sind, oder …«
»Ich habe die Sachen auf dem Parkplatz gefunden!«, rief der Mann. »Beweisen Sie erst einmal, dass das nicht so war!«
»… oder ich verhafte Sie jetzt wegen Mordes an Monsieur Patrick Ripert. Ripert liegt mit durchgeschnittener Kehle im Steinbruch. Seine Brieftasche haben wir bei Ihnen gefunden. Das reicht für lebenslänglich.«
»Ich war das nicht!« Bonatis Augen waren nicht länger stechend, sein Blick flackerte unruhig hin und her, fokussierte schließlich Fabienne, so als erhoffte er sich von der jungen Beamtin mehr Verständnis. »Das können Sie mir doch nicht anhängen.«
»Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen das anzuhängen«, erwiderte Fabienne kühl, und man musste sie schon so gut kennen wie Blanc, um herauszuhören, dass sie in Wahrheit nicht einen Augenblick an Bonatis Schuld glaubte.
Der Mann schluckte, starrte wieder zu Blanc, dann auf seine Füße, als stünde die Lösung für sein Dilemma auf seinen alten Turnschuhen. »D’accord«, gab er schließlich zu. »Ich habe ein paar Typen ausgenommen. Das ist so einfach hier, die Leute sind selbst schuld.«
»Als Sie Monsieur Ripert …«, Blanc suchte nach dem richtigen Wort, »erleichtert haben, wo stand er da?«
»Auf dieser Galerie, von wo aus man in die ganze Höhle sehen kann. Wenn die Leute da oben stehen, dann haben sie alle Bilder im Blick und achten nicht auf jemanden, der von hinten an sie herankommt.«
»War Monsieur Ripert allein?«
»Ja. Da war niemand in zehn Schritte Umkreis. Das überprüfe ich vorher, damit mich keiner bei der Arbeit ertappt. Aber ich schwöre: Der Typ war quicklebendig, als ich mit dem fertig war. Ich brauche nur ein paar Sekunden, dann bin ich schon wieder weg. Ich habe dem nicht mal ein Haar gekrümmt!«
»Als der Alarm losging nach der Vorstellung, wo waren Sie da?«
»Hinten in der Felsenkammer, wo sie diesen bescheuerten alten Film zeigen. Ich habe da einer Frau die Handtasche geöffnet. Plötzlich schrien alle herum, die Lichter gingen an, die Security-Leute sind gekommen und dann die Flics. Ich habe es nicht mehr bis zum Ausgang geschafft. Und weil es hell war und alle herumrannten, konnte ich meine Beute auch nicht mehr wegwerfen. Merde, wer kann den so etwas ahnen?!«
Blanc bedeutete einem der Beamten, die den jungen Gitane verhaftet hatten, näher zu kommen. »Haben Sie bei diesem Mann ein Messer sichergestellt oder irgendeinen anderen scharfen Gegenstand?«, fragte er leise.
Der Gendarm hüstelte verlegen. »Leider nein, mon Capitaine.«
»Leider?«
Jetzt hustete der Mann richtig. »Nun ja, das hätte die Ermittlung doch erleichtert, oder nicht?«
Blanc erwiderte nichts und ging zu einer der Kriminaltechnikerinnen. »Haben Sie ein Messer gefunden, das hier irgendwo weggeworfen worden wäre?«
»Dann hätten wir Sie doch sofort informiert!« Die Frau schien ehrlich empört zu sein, dass ihr Vorgesetzter ihr eine so unprofessionelle Arbeit zutraute.
»Selbstverständlich«, murmelte Blanc, »Entschuldigung.« Er wartete, bis der Beamte, der den Besuchern die gestohlenen Gegenstände zeigte, seine Runde beendet hatte. In dem Plastiksack lagen noch ein Handy und ein Autoschlüssel, die niemand für sich beansprucht hatte. »Haben Sie das auch Monsieur Ripert gestohlen?«, fragte er den Gitane und hielt den Beutel hoch.
Bonati zuckte mit den Achseln. »Ich habe ihm sein Handy aus der Tasche gefischt und einen Schlüssel auch, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber keine Ahnung, ob es das war, was Sie mir vor die Nase halten. Die Dinger sehen im Dunkeln alle gleich aus.«
Fabienne streifte sich Plastikhandschuhe über und holte das Smartphone aus dem Beutel. Sie strich einmal über den Bildschirm. »Passwortgeschützt«, verkündete sie. »Ich werde einige Zeit brauchen, bis ich das gehackt habe.«
Blanc nickte. »Wir nehmen es trotzdem zu den Beweisstücken. Vermutlich ist es ja Riperts Handy.« Dann baute er sich vor Bonati auf. »Sie sind verhaftet!«, erklärte er laut.
»Weswegen?«
»Diebstahl.«
Bonati grinste erleichtert und ließ sich widerstandslos zu einem Streifenwagen führen.
»Ist das nicht ein bisschen voreilig?«, brummte Marius, als der Mann außer Hörweite war.
»Du bist nicht hundertprozentig überzeugt?«, fragte Blanc zurück.
»Es geht hier nicht um mich. Wir haben einen Mann mit durchtrennter Kehle. Und einen Zigeuner, der diesen Mann bestohlen hat. Die Frage, warum man Bonati nur als Dieb verhaftet hat und nicht als Mörder, wird man morgen in der Zeitung stellen.«
»Und im Netz«, ergänzte Fabienne. »Die Kommentare dazu kann ich mir jetzt schon ausmalen.«
Blanc zuckte mit den Achseln. »Vorurteile ersetzen keine Ermittlungen. Bonati war hier, um seine Opfer auszunehmen. Warum sollte ein kleiner Taschendieb einem Mann den Hals durchschneiden? Und mit welcher Waffe hätte er das tun sollen? Außerdem hat er nach dem Diebstahl von Riperts Sachen weitergemacht. Als der Alarm losging, war er im hintersten Teil des Steinbruchs, am weitesten weg vom Ausgang. Wenn er Ripert wirklich getötet hätte, dann hätte er sich doch sofort aus dem Staub gemacht, bevor der Mord aufgefallen wäre.« Blanc schüttelte den Kopf. »Nein. Riperts Mörder ist noch frei.« Er deutete zum Parkplatz. »Und vermutlich ist es auch keiner von den anderen, die wir befragt haben. Der Täter ist uns durch die Maschen geschlüpft. Der war schon fort, bevor irgendjemand die Leiche entdeckt hatte.«
»Na«, sagte Marius spöttisch, »dann musst du nur noch die Untersuchungsrichterin von deiner Theorie überzeugen.«
»Allô, Madame le Juge?« Blanc hatte sich ein paar Schritte von seinen Kollegen entfernt und drehte ihnen den Rücken zu. Es musste ja niemand seine Gesichtszüge studieren, während er mit seiner ehemaligen Geliebten telefonierte.
»Mon Capitaine, was kann ich für Sie tun?«
Blanc hielt einen Moment den Atem an, als er ihre vertraute Stimme hörte. Aveline Vialaron-Allègre, Untersuchungsrichterin in Aix-en-Provence, Ehefrau des mächtigen Staatssekretärs im Innenministerium, von allen Flics gefürchtet – nur von einem nicht, der so leichtsinnig gewesen war, eine hoffnungslose Affäre mit ihr einzugehen. Eine Affäre, die noch nicht allzu lange erloschen war. Er nahm sich zusammen und blieb förmlich; war ja doch möglich, dass einer der Kollegen das Gespräch hören könnte. Er berichtete ihr von dem Mord und dem jungen Taschendieb, den sie verhaftet hatten.
Er hörte, wie Aveline an einer Zigarette sog. Sie schwieg einen Moment lang. Vielleicht hatte sie noch mehr von ihm erwartet? Vielleicht ganz andere Sätze? Absurd. Als sie endlich antwortete, war sie so kühl wie meistens. »Ermitteln Sie in alle Richtungen. Sie haben freie Hand. Aber, mon Capitaine«, wieder ein kurzes Zögern, »Ihnen ist schon klar, dass dieser Fall politische Implikationen hat?«
Blancs Puls ging hoch, allerdings nicht aus Liebe und Leidenschaft. »Politische Implikationen« – das war nicht schwer zu übersetzen: Im Midi wählte fast die Hälfte der Menschen den Front National, der sich jetzt Rassemblement National nannte, was aber nichts anderes war als neue Schminke auf einer alten Partei. Weit rechts und nicht gerade freundlich zu den Gitanes. »Zigeuner schlitzt französischem Touristen die Kehle auf« wäre die Schlagzeile, die der RN aus diesem Fall machen würde. Und Avelines Gatte, Staatssekretär Jean-Charles Vialaron-Allègre, war durchaus sensibel für die Stimmung am rechten Rand der Wählerschaft. »Politische Implikationen« bedeutete deshalb: Gendarmerie und Justiz mussten die Lage jederzeit unter Kontrolle haben, und wenn verflucht noch mal der Mörder nicht schnell überführt werden würde, dann wäre es für Vialaron-Allègre besser, Bonati zum Schuldigen zu erklären, als niemanden.
»Ich kümmere mich um Indizien, nicht Implikationen«, antwortete Blanc frostig.
»Genau aus diesem Grund erinnere ich Sie an die Implikationen«, entgegnete sie, und nur weil Blanc sie so gut kannte, hörte er heraus, dass sie nicht ganz so gelassen war, wie sie sich gab. »Ein Taschendieb landet normalerweise nach vierundzwanzig Stunden Untersuchungshaft vor einem Schnellrichter«, fuhr sie fort. »Doch im Fall von Monsieur Bonati werde ich ein ordentliches Gerichtsverfahren beantragen. Das dauert länger, und so können wir ihn einige Tage in Untersuchungshaft behalten. Es wäre hochgradig peinlich für uns, wenn Sie in nächster Zeit doch noch Indizien dafür fänden, dass Bonati der Mörder ist, dieser Mann aber in der Zwischenzeit untergetaucht wäre.«
»Sobald ich mehr weiß, melde ich mich wieder bei Ihnen, Madame le Juge.«
»Ich kann es kaum erwarten, wieder von Ihnen zu hören.« Aveline hatte aufgelegt, bevor Blanc darauf noch etwas erwidern konnte.
Blanc verbrachte den Rest des Tages im Val d’Enfer. Die Kollegen der Spurensicherung benötigten noch Stunden, um das zerklüftete Gelände um die Carrières de Lumières abzusuchen – ohne Ergebnis. Über dem Eingang zum Steinbruch hing eine Überwachungskamera, doch die war, wie Direktor Pavy kleinlaut gestand, seit fast einem Monat defekt. Im Ort Les Baux selbst waren ebenfalls diskret einige Kameras angebracht. Blanc hatte Marius zur dortigen Mairie geschickt, um die Aufnahmen auszuwerten, in der schwachen Hoffnung, dass Ripert dort vielleicht irgendwo gefilmt worden sein könnte, womöglich gar in Begleitung eines anderen Menschen. Vergebens. Ripert, so schien es, war am Tag seines Todes nicht im Dorf gewesen. Sie hatten schließlich einen Wagen entdeckt, der auf einem Parkplatz dreihundert Meter jenseits der Carrières de Lumières abgestellt worden war, in den der Autoschlüssel passte. Auf der Heckscheibe des schwarzen Nissan Micra klebte der Name eines großen Autoverleihers. Das Fahrzeug selbst war abgeschlossen und unbeschädigt, nichts deutete darauf hin, dass jemand sich an ihm zu schaffen gemacht hätte. Trotzdem nahmen ihn sich die Kriminaltechniker vor. Bevor sie ihn ins Labor abschleppten, durchsuchten sie schon einmal das Handschuhfach und stießen auf einen Mietvertrag: Ripert hatte den Wagen vor vier Tagen am TGV-Bahnhof von Aix-en-Provence übernommen, nachdem er im Schnellzug aus Paris angereist war.
Fabienne rief bei der Firma an und erfuhr, dass Ripert den Wagen übers Internet für zwei Wochen reserviert hatte. Als er ihn abgeholt hatte, war er allein gewesen. Kein Angestellter erinnerte sich an irgendein außergewöhnliches Zeichen, keine Eile, keine Angst, keine Unhöflichkeit; Ripert sei ein ganz normaler Kunde gewesen. Aber er hatte keine Adresse in der Provence angegeben, nur seine Handynummer als einzige Kontaktmöglichkeit. Als Fabienne diese Nummer wählte, summte das Smartphone im Plastikbeutel. »Jetzt weiß ich wenigstens, dass ich das richtige Handy hacke«, erklärte sie.
Lange nachdem der Leichenwagen davongefahren war, nachdem er Pavy entlassen und die meisten Kollegen nach Hause geschickt hatte, setzte sich Blanc endlich in den alten Mégane. Es stank noch immer aus den Polstern. Marius saß neben ihm, Fabienne hatte sich erschöpft gegen die Rückbank gelehnt. Blanc zögerte zu starten, aber seine beiden Kollegen beschwerten sich nicht über die unnütz vertickenden Sekunden. Sie starrten alle auf die Felswände. Die Sonne stand inzwischen tief. Schatten verschluckten die Steine, schwarze Tinte, die sich langsam über die Felsen ergoss. Im Zwielicht schien sich der Berg zu bewegen, weil sich die soliden Formen auflösten, weil Farben und Umrisse ineinanderflossen. Löcher verwandelten sich in Augen, Risse in grinsende Münder, und Blanc glaubte, dass ihn ein Dutzend Fratzen höhnisch anblickte. Höllental, sagte er sich, eh merde. Er startete endlich den Wagen und gab mehr Gas als nötig.
Mandelblüten
Am Samstagmorgen joggte Blanc noch vor Sonnenaufgang durch den Wald hinter seiner Ölmühle. Die immergrünen Eichen und die Fichten standen so dicht beisammen, dass er das Gefühl hatte, er würde in eine schwarze Wand hineinlaufen. Das Unterholz war satt vom Tau, sodass seine Füße rasch so nass waren, als würde ihn sein Weg durch Pfützen führen. Er achtete nicht darauf und beschleunigte seine Schritte. An manchen Stellen ragten Steine oder eisenharte Baumwurzeln ein paar Zentimeter weit aus dem weichen Boden, doch er hatte diese Strecke inzwischen oft genug zurückgelegt und stolperte nie. Zuerst dachte er an nichts, er liebte es, sich den Kopf freizulaufen. Doch plötzlich schrie irgendwo in einem Wipfel über ihm eine Eule. Ein Schrei … In seinem Geist sah er wieder Riperts schreckliche Wunde. Vielleicht war der Mord nicht einfach bloß brutal, sondern auch symbolisch gemeint? Eine durchgeschnittene Kehle, damit Ripert nie wieder schrie, nie wieder etwas sagte – nie wieder etwas verriet?
Später duschte Blanc und zog sich um, gönnte sich aber keine Zeit mehr für ein Frühstück, sondern stürzte bloß einen Espresso hinunter. Er war um acht Uhr in der Station von Gadet und nickte Marius zu, der ihm eine Tüte Croissants über den Schreibtisch schob, eine Tüte, die, den Fettspuren auf dem Papier nach zu urteilen, noch kurz zuvor mit deutlich mehr Gebäck gefüllt gewesen war.
»Bist du schon lange hier?«, fragte Blanc verwundert, weil sein Kollege eigentlich kein Frühaufsteher war, schon gar nicht am Wochenende.
»Erst seit fünf Minuten. Aber die Croissants haben so verdammt gut geduftet, dass ich mich nicht beherrschen konnte. Ich habe die Dinger praktisch inhaliert.«
Fabienne kam herein und schwenkte eine Rose. »Die hat mir meine Liebste geschenkt!«, rief sie. Als darauf keine Reaktion erfolgte, blickte sie die beiden entgeistert an. »Mon Dieu, es ist Valentinstag!«
»Na und?«, brummte Marius.
»Was soll das denn heißen? Du schenkst deiner Frau eine Blume, ein Herzchen aus Stoff, Reizwäsche, was weiß ich. Und wenn du keine Frau hast, dann schenkst du das halt der Frau, von der du hoffst, dass sie deine Frau wird, wenn du verstehst, was ich meine.« Sie starrte Blanc und Marius an, schließlich schüttelte sie den Kopf. »Ihr habt vergessen, dass heute Valentinstag ist, stimmts?«
»Man kann sich nicht alles merken«, murmelte Blanc. Er hätte zudem nicht einmal gewusst, wem er eine Rose schenken sollte, aber das musste er ja nicht auch noch kundtun.
»Na schön, ihr Vollblutromantiker«, seufzte Fabienne, »zurück zum Job.« Sie legte ihnen einen Zettel auf den Tisch, bevor sie sich das letzte Croissant griff. »Die Adresse von Riperts Hotel«, erklärte sie kauend. »Die Kollegen vom Nachtdienst hatten keinen Erfolg. Wie es scheint, hat die eine Hälfte der Hotels in der Provence überhaupt keinen Nachtportier mehr, zumindest außerhalb der Saison. Und die andere Hälfte hat Nachtportiers, die keinen Zugriff auf die Daten ihrer Gäste haben. Wir mussten warten, bis die Rezeptionen ordentlich besetzt waren.«
Blanc las die Notiz vor: »Domaine de Manville.«
Marius pfiff durch die Zähne. »Das kenne ich, aber nur von außen: fünf Sterne, Golfplatz, Spa, Feinschmeckerrestaurant. Ripert hatte Stil, das muss man ihm lassen.«
»Ich habe es schon gecheckt«, ergänzte Fabienne. »Das Hotel liegt in der Ebene unterhalb von Les Baux. Gerade mal zweieinhalb Kilometer von den Carrières de Lumières entfernt. Der Mann hätte zu Fuß dahin gehen können, aber wahrscheinlich wollte er seine schicken Lederschuhe schonen.«
»Oder er war mit seinem Mietwagen vorher schon woanders«, erwiderte Blanc. Er hatte auf seinem Schreibtisch den Bericht der Kriminaltechniker über den Nissan entdeckt, den Ripert gemietet hatte: keine Auffälligkeiten. Aber in den vier Tagen, die Ripert das Auto gefahren hatte, hatte er mehr als sechshundertfünfzig Kilometer zurückgelegt. »Monsieur Ripert ist viel unterwegs gewesen.«
Fabienne nickte. »D’accord. Ich gebe Kennzeichen und Wagenbeschreibung an die Autobahngesellschaft des Départements durch. Vielleicht hat ihn ja eine Péage-Station gefilmt.«
»Ripert kann seine Provencereise jedenfalls nicht zum Familienbesuch genutzt haben«, ergänzte Marius. »Ich habe die halbe Nacht am Computer und am Telefon verbracht. Er hat tatsächlich seine ganze Kindheit und Jugend in dieser Kleinstadt und die letzten zwanzig Jahre seines Lebens in Paris gewohnt. Dort und in Montmorillon leben etliche Familien mit diesem Namen, doch ich habe nirgendwo einen Hinweis auf einen Partner, auf Kinder oder Geschwister eines Patrick Ripert gefunden. Der einzige Mensch, der Ripert kannte, war die Sekretärin seiner Detektei. Ich habe heute Morgen mit ihr telefoniert. Sie war schockiert, als ich ihr die Neuigkeit eröffnet habe, aber sie ist auch nicht gerade in Tränen ausgebrochen. Sie wusste nicht einmal, dass ihr Chef in der Provence war, behauptete aber, dass es häufig vorkam, dass Ripert mehrere Tage verschwand, ohne ihr Bescheid zu sagen. Als ich sie nach Angehörigen, Freunden oder wenigstens Bekannten von Ripert gefragt habe, hat sie ziemlich lange nachgedacht und mir dann keinen einzigen Namen nennen können. Der Typ war entweder ein Einzelgänger, oder er hat alle Menschen, die ihm nahestehen, sehr gut vor fremden Blicken verborgen.«
Blanc erhob sich und nickte seinen Kollegen zu. »Dann wird es Zeit, dass wir dieses Hotel mal von innen kennenlernen.«
Eine gute Dreiviertelstunde später standen sie am Empfang der Domaine de Manville. Das Hotel war ein zweistöckiges, großes altes provenzalisches Landgut, die Wände in einem warmen Gelbton verputzt, die Fensterläden blau, gepflegter Park, ein riesiger Wintergarten, der sich über den Speiseraum wölbte, ein Schwimmbad im Innenhof. Die Luft schmeckte nach Frühling, der Himmel war makellos; Blanc spürte einen Moment die Sehnsucht, diesen stillen Luxus zu genießen, sich hier verwöhnen zu lassen, ein romantisches Wochenende zu zweit in diesem Refugium zu genießen – außer dass es niemanden gab, mit dem er dieses Wochenende hier hätte verbringen können. Er straffte sich und präsentierte seinen Gendarmerie-Ausweis am Tresen.
Eine schöne, junge Frau, deren Namensschild auf ihrer Bluse sie bloß als »Natasha« auswies, betrachtete das Dokument. Sie war so professionell, dass ihr freundliches Lächeln nur für einen Sekundenbruchteil entgleiste, als sie erkannte, dass da keine gewöhnlichen Gäste vor ihr standen. »Was kann ich für Sie tun, mon Capitaine?« Sie klang fröhlich, ihre Stimme hatte einen ganz leichten osteuropäischen Einschlag. Ihre hellblauen Augen jedoch waren wachsam.
»Unser Besuch hat nichts mit Ihnen oder Ihrem Haus zu tun«, versicherte Blanc und stellte auch seine beiden Kollegen vor. Wo auch immer Natasha herkam, es war offenbar ein Land, in dem man sich vor Ordnungshütern fürchtete. »Es geht bloß um einen Ihrer Gäste, der gestern leider«, er wog seine Worte sorgfältig ab, »ums Leben gekommen ist.«
»Oh.« Natasha schlug die Hand vor den Mund, wie es zweitklassige Schauspielerinnen tun würden, nur wirkte es bei ihr echt. Schockiert, dachte Blanc, weil sie so plötzlich mit dem Tod konfrontiert wurde, aber auch erleichtert, weil es tatsächlich nicht um sie ging.
»Monsieur Patrick Ripert«, fuhr er fort. »Er war doch Gast in Ihrem Haus?«
»Seit fünf Tagen, ja. Er hat sein Zimmer für zwei Wochen reserviert. Sein Schlüssel hängt hier. Er ist gestern Abend nicht zurückgekommen, aber manchmal reisen die Gäste durch die Provence, treffen Leute und, nun ja …«
»Machen Sie sich keine Vorwürfe«, beruhigte sie Marius. »Sie sind ja nicht die Gouvernante Ihrer Gäste, Natasha. Würden Sie uns freundlicherweise Monsieur Riperts Zimmer öffnen?«
»Selbstverständlich.« Sie kam aus dem Empfangsbereich heraus. »Würden Sie mir bitte folgen?« Natasha stolzierte über den Flur wie ein Mannequin über den Laufsteg. Sie gingen ihr hinterher, Fabienne schob sich zwischen Blanc und Marius und schaffte es mit einer geschickten Bewegung, gleichzeitig ihren linken Ellenbogen in Marius’ und ihren rechten Ellenbogen in Blancs Rippen zu rammen. »Ich bin Telepatin. Ich höre, was ihr denkt«, zischte sie.
Marius seufzte. »Wir sind geschiedene Flics. Du kannst uns wenigstens ein bisschen Vergnügen gönnen«, antwortete er genauso leise.
Blanc räusperte sich. »Haben Sie Monsieur Ripert einmal in Begleitung gesehen?«, fragte er laut.
Natasha drehte sich im Gehen um und schüttelte den Kopf. »Monsieur Ripert ist ein stiller Gast. War es.« Sie errötete. »Höflich, freundlich, ein Kunde ohne Extrawünsche. Er kam morgens gegen acht Uhr zum Frühstück in den Speiseraum und verließ kurz darauf unser Haus. Abends kehrte er zurück und aß in unserem Restaurant. Bis auf gestern Abend.«
»Sie können sich gut an Monsieur Ripert erinnern«, stellte Fabienne fest.
»Ich erinnere mich an alle Gäste, das gehört zu meinem Beruf.« Natasha lächelte. »Außerdem ist noch Nebensaison, und in den letzten Tagen haben viele chinesische Touristen abgesagt, Sie wissen ja, warum. Das Hotel ist jedenfalls halb leer. Da fällt es nicht sonderlich schwer, sich Gesichter zu merken. Hier, bitte.« Sie öffnete ihnen eine Tür und ließ sie eintreten.
Das Zimmer war groß, sauber, still. Ein Doppelbett, Schreibtisch, Stuhl, alles in einem Stil, der zugleich modern und wie aus der guten alten Zeit wirkte. »Warten Sie bitte draußen«, sagte Blanc zu der Angestellten und zog sich Gummihandschuhe über. Marius’ und Fabiennes Hände steckten bereits in blauem Kunststoff.
Sie durchsuchten das Zimmer rasch und systematisch. Marius nahm sich das angrenzende kleine Badezimmer vor, Fabienne den Schrank, Blanc den Schreibtisch und die Kommode neben dem Bett. Es dauerte nur wenige Minuten.
»Zahnbürste, Rasierer, Deo, das Übliche«, verkündete Marius und kam wieder aus dem Bad. »Keine Drogen, keine Medikamente, nichts, was da nicht hingehört.«
»Das kann ich auch vom Schrank sagen«, ergänzte Fabienne. »Schicke Klamotten. Monsieur Ripert hielt Ordnung. Alle Sachen sind sauber auf den Regalen gestapelt. Und selbst seine Schmutzwäsche hat er gefaltet auf das unterste Regal gelegt. Ich habe nachgezählt: vierzehn Boxershorts. Er hat seinen Wagen für vierzehn Tage gemietet, er hat vierzehn Unterhosen dabei, der Typ wusste genau, wie lange er in der Provence bleiben wollte.«
»Hast du Badehosen gefunden?«, fragte Blanc.
Fabienne schüttelte den Kopf. »Nein. Wieso?«
»Das Hotel ist ein Spa, aber deswegen war Monsieur Ripert offenbar nicht hier.«
»Die Domaine de Manville ist das erste Haus am Platz. Deshalb war er hier. Ripert hat irgendwas in Les Baux zu tun gehabt«, vermutete Marius.
»Gut möglich.« Blanc deutete auf den Schreibtisch. »Kein Reiseführer. Keine Eintrittskarten. Keine Stadtpläne, keine Kamera. Er war auch kein Tourist.«
»Das hat man heute alles auf dem Handy«, erwiderte Fabienne und rollte mit den Augen. »Doch du hast vermutlich trotzdem recht. Im Schrank sind auch keine Wanderschuhe oder Funktionskleidung. Nur Klamotten, die du zu Geschäftsterminen trägst, nicht zum Vergnügen.«
Marius deutete auf den Notizblock mit der Aufschrift des Hotels auf dem Schreibtisch und dem Bleistift daneben. »Versuch es mit dem ältesten Trick der Welt«, riet er.
Blanc schraffierte mit dem Bleistift das oberste Blatt, doch glaubte er nicht, dass dabei eine Notiz zum Vorschein kommen würde, die Ripert auf das oberste, nun fehlenden Blatt geschrieben und die sich auf das nächste Blatt durchgedrückt hatte. Zu seiner Überraschung erkannte er in der Schraffur nach und nach zwar tatsächlich kaum ein Schriftzeichen, aber doch ein Muster: Jemand musste Pfeile, Striche und Zahlen notiert haben. Ein Pfeil nach rechts, eine »50«, eine »250«, Linien, dann doch winzige Buchstaben, in einer klaren kleinen Handschrift: »a.g.«, »a.d.«, mal hier, mal dort auf dem Blatt.
»Habt ihr irgendeine Idee?«, fragte Blanc.
»Ich habe keine Ahnung, was das sein soll«, gestand Fabienne.
»Wenn eine Frau nicht weiterweiß: immer einen Mann fragen!«, erwiderte Marius und fing sich den zweiten Ellenbogenstoß ein. Trotzdem lächelte er triumphierend. »Das ist eine Wegbeschreibung«, verkündete er. »Ripert hat telefoniert, jemand hat ihm am Telefon erklärt, wie er zu einem bestimmten Ort kommt. Die Zahlen sind Distanzen, die Pfeile verraten, wann er abbiegen soll, auch ›a.g.‹ und ›a.d.‹ bedeuten nichts anderes, ›à gauche‹ und ›à droite‹, ›nach links‹ und ›nach rechts‹.«
Blanc pfiff anerkennend. »Das könnte hinkommen.«
»Warum hat Ripert dann nicht einfach die Adresse aufgeschrieben und den Rest seinem Navi überlassen?«, fragte Fabienne, sie war noch immer leicht verstimmt über Marius’ Spruch.
»Weil das Ziel offenbar nicht ganz so einfach zu finden ist. Hol doch mal dein Wunderhandy raus.«
Fabienne seufzte, legte ihr iPhone auf den Schreibtisch und öffnete die Navigations-App. Der Pfeil wies auf die Position des Hotels.
»So«, sagte Marius zufrieden. »Und jetzt fahren wir die Karte mal virtuell ab, indem wir den Anweisungen folgen. Wenn Ripert so getickt hat, wie wir alle ticken, dann hat er seine Notizen von links oben nach rechts unten geschrieben. Also arbeiten wir an deinem Navi die Anweisungen in derselben Reihenfolge ab.«
»Das ist schwachsinnig«, murmelte Fabienne, doch sie fing an, mit dem Zeigefinger die Karte zu bewegen. »Fünfzig Meter die Straße entlang«, sagte sie, »dann rechts … links … zweihundert Meter … wieder rechts …« Ihre Stimme verlor sich. Als sie die Angabe des letzten Zeichens umgesetzt hatte, blickte sie auf und starrte Marius an. »Entweder bist du genial, oder wir machen uns gleich ziemlich lächerlich.« Ihre Fingerkuppe zeigte genau auf ein Haus, das an einem unmarkierten Zufahrtsweg etwas abseits einer Route Départementale lag – nicht weit von Les Baux entfernt.
»Dann fahren wir doch da mal hin und sehen uns das Haus an«, sagte Blanc grinsend.