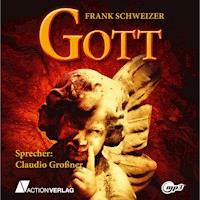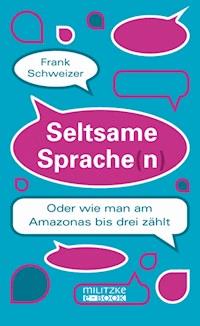
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Militzke
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Weltweiter Wortsalat Gibt es eine Sprache, in der Namen so heilig sind, dass keine Vornamen zweimal vorkommen dürfen? Kann eine vollständig neue Sprache innerhalb von drei Jahren entstehen? Diese und weitere unglaubliche Fragen im Zusammenhang mit der menschlichen Sprache werden in diesem Buch beantwortet. Der Germanist und Philosoph Frank Schweizer vermittelt kuriose und interessante Fakten, die weit über das übliche Allgemeinwissen hinausgehen und erzählt kurzweilig über die ersten Sprachversuche des Menschen bis hin zur Entwicklung der eigenen Sprachfähigkeit von der Geburt bis ins Erwachsenenalter. Kaum jemand aus dem westlichen Sprachraum kann sich die Existenz einer Sprache vorstellen, die, das Vokabular und Regelwerk betreffend, zwischen einem männlichen und weiblichen Sprecher unterscheidet. Dem Autor gelingt es auch, den größten Unterschied zwischen Mensch und Tier - Kommunikation, mittels umfangreicher Worte - unterhaltsam wiederzugeben. Dieses Buch ist gespickt mit lehrreichen Details ohne belehrend zu wirken und lädt dazu ein, sich näher mit der eigenen Sprache zu befassen. Frank Schweizer, der selbst acht Sprachen spricht, begegnet dem Vorurteil, die Beschäftigung mit Sprache sei eine staubtrockene Tätigkeit, durch anschauliche Erläuterungen und faszinierende Details.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Angaben sind im Internet überhttp://dnb.ddb.de abrufbar. © Militzke Verlag GmbH, Leipzig 2011 Lektorat: Viktoria Sauer, Julia Lössl Umschlaggestaltung: Thomas Butsch Layout und Satz: Thomas Butsch eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Fonteinbettung der Schrift LinLibertine nach Richtlinie der GPL.
ISBN 978-3-86189-788-0www.militzke.de
Wie die Menschen zur Sprache kommen
Die erste menschliche Sprache
Sprache und Menschsein scheint auf den ersten Blick untrennbar zusammen zu gehören: Tiere haben keine Sprache in der Art, wie sie die Menschen kennen. Schimpansen können sich allerdings unter Laborbedingungen immerhin bis zu vierhundert Zeichen merken, Bienen benutzen den Schwänzeltanz, um andere Bienen über die Entfernung, die Menge und die Richtung zu einer neuen Futterquelle zu informieren, Wale haben Gesänge, Clownfische schlagen ihre Kiefer aufeinander, um signalhaltige Töne zu erzeugen.
Tiere unterhalten sich am liebsten über das Hier und Jetzt, und sie kommunizieren unentwegt, sei es, um Weibchen anzulocken, Rivalen zu verscheuchen oder um sich mit anderen Mitgliedern einer Gruppe zu verständigen. Die Kommunikation erfolgt nach bestimmten Regeln, was im Grunde so etwas wie eine Grammatik darstellt. Bei Schimpansen, denen von Forschern Gesten beigebracht wurden, hat man beobachtet, dass sie diese Zeichen auch ihren Jungen lehren. Bei einer Schimpansengruppe in den dichten Wäldern Guineas haben Wissenschaftler entdeckt, dass sie ihre Jagden anhand einer effektiven Zeichensprache organisieren. Klaus Zuberbühler von der englischen Universität St. Andrews hat berichtet, dass Dinamerkatzen, eine Affenart, ihren Warnruf so abändern können, dass den anderen Gruppenmitgliedern die Art des sich nähernden Tieres mitgeteilt wird (Leopard, Adler, anderes Raubtier). Das alles kommt sehr nahe an Sprache heran. Trotzdem: Ein einfacher Satz wie »Das hätte ich nicht vermutet!« oder »Gestern hat es ziemlich geregnet.« kann, so weit wir wissen, von keinem Tier formuliert werden.
Der Homo sapiens, wie wir ihn in seinem natürlichen Lebensraum beobachten können, wenn wir morgens in den Spiegel schauen, wandelt seit etwa 100.000 Jahren auf der Erde. Konnten unsere Vorfahren der Gattung Homo erectus (vor einer Million Jahren) oder gar die noch weiter entfernten Verwandten wie die Australopithecinen (vor zwei Millionen Jahren) sprechen? Eine leidenschaftlich diskutierte Frage.
Um komplexer kommunizieren zu können, bedarf es zum einen der Entwicklung bestimmter Gehirnregionen. Nicht das vom Volumen aus betrachtet größte Gehirn (Elefant) entwickelt Sprache, sondern eines, das sich im Laufe der Evolution auf kognitive, also verstehende Fähigkeiten spezialisiert hat. Fünfzig Prozent unseres Gehirns sind zum Beispiel damit beschäftigt, räumliches Sehen zu ermöglichen. Die Wahrnehmung (sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken) ist das, was »Rechenkapazität« benötigt, nicht das Sprechen. Aus der kleinen Verzögerung des Schalls, der das eine Ohr in Bruchteilen von Sekunden früher erreicht als das andere, kalkulieren wir metergenau die Quelle eines Geräusches. Unter anderem dafür brauchen wir in erster Linie den Hochleistungsapparat, der in unserem Kopf steckt. Neben Erinnerung und Gefühlen produziert das Gehirn als »Beiprodukt« auch die Sprache. Dafür zuständig sind zwei Gehirnteile, die sich an einer auf den ersten Blick unauffälligen Stelle am Rand des Gehirns befinden: Über dem linken Ohr ist das Broca-Areal (Sprachproduktion) und etwas weiter hinten ist das Wernicke-Zentrum (Sprachverständnis) angesiedelt. Beide haben ein nur geringes Volumen, verglichen mit dem Rest des Gehirns. Beide liegen in der linken Hemisphäre von diesem. Aussagekräftig ist, dass das Broca-Areal und das Wernicke-Zentrum in den äußeren Schichten des Hirns zu finden sind, was ein Beleg für eine entwicklungsgeschichtlich späte Entstehung ist. Eine Vergrößerung dieser Gehirnregionen stellten Forscher bei dem Steinwerkzeug herstellenden Homo habilis fest, einem circa 1,40m großen Wesen mit langen Armen und erhöhten kognitiven Fähigkeiten, das zwei Millionen Jahre vor unserer Zeit in Ostafrika lebte– immer vorausgesetzt, man kann aus der Form eines ausgegrabenen Schädels auf dessen Inhalt schließen. Die Anthropologin Katarina Semendeferi hat gezeigt, dass zumindest das Verhältnis der Frontallappen (die im Gehirn für alle höheren Funktionen zuständig sind) zum Rest des Gehirns beim Menschen nicht ungewöhnlich klein oder groß ist. Schimpanse und Gorilla haben das gleiche »Mischungsverhältnis« höherer und niederer Hirnregionen, ebenso– nur proportional auf ein kleineres Gehirnvolumen übertragen– wie die Vorfahren des Menschen. Laut Semendeferi ist demnach, von Außen betrachtet, am menschlichen Denkorgan nichts Abnormes festzustellen, was auf unsere höheren geistigen Fähigkeiten schließen ließe.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!