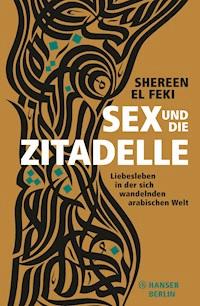
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Dieses Buch wagt sich an ein Tabu: Fünf Jahre lang hat Shereen El Feki Frauen und Männer in den arabischen Ländern, vor allem in Ägypten, befragt, was sie über Sex denken und welche Rolle er in ihrem Leben spielt. El Feki schildert bewegende Schicksale, erläutert historische Hintergründe und liefert aufschlussreiche Daten. Anhand der verschiedenen Aspekte von Sexualität eröffnet sie völlig neue Einblicke in das Innenleben der sich wandelnden arabischen Welt. Sie betont, dass den Islam eigentlich eine positive Haltung zur Sexualität auszeichnet, vertritt aber zugleich die provokante These, dass ohne einen freieren, offeneren Umgang damit die politisch-soziale Entwicklung in den arabischen Gesellschaften weiterhin stagnieren wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Ähnliche
Hanser Berlin E-Book
Shereen El Feki
SEX UND DIE
ZITADELLE
Liebesleben in der sich wandelnden
arabischen Welt
Aus dem Englischen von
Thorsten Schmidt
Hanser Berlin
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Sex and the Citadel. IntimateLifein a ChangingArabWorld bei Pantheon Books in New York.
ISBN 978-3-446-24292-0
© 2013 Shereen El Feki
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2013
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Für meine Eltern
Dabei ist sie [diese Wissenschaft] ein Gebiet, das unbedingt mehr bekannt sein sollte. Nur unwissende Dummköpfe mit geringer Einsicht werden dies leugnen oder sich darüber lustig machen.
Abu ’AbdallahMuhammadan-Nafzawi,
Der duftendeGartenzur Erbauung des Gemüts (15. Jahrhundert)
Die Sexualität [ist] doch nun einmal das Urphänomen, um das das ganze übrige Leben der Menschheit mit all seinen Einrichtungen kreist.
MagnusHirschfeld,
Die Weltreise eines Sexualforschers (1933)
INHALT
Eine Anmerkung zur Sprache
Einleitung
1 (Ein)Stellungen im Wandel der Zeiten
2 Desperate Housewives
3 Sex und der arabische Single
4 Aufklärung
5 Wa(h)re Liebe
6 Der Mut, anders zu sein
7 Die Revolution kommt
Danksagung
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Register
EINE ANMERKUNG ZUR SPRACHE
Vor ein paar Jahren war ich bei einer Stiftung für Frauenrechte in Kairo eingeladen. Die Mitarbeiter und ich unterhielten uns auf Englisch, was sie viel fließender sprachen als ich Arabisch. Am Ende einer eindrucksvollen Führung versuchte ich mich der Situation gewachsen zu zeigen. »Danke, dass Sie mich in Ihr Frauenzentrum eingeladen haben«, rang ich mir in meinem besten Arabisch ab. Betretenes Schweigen und befremdete Blicke von meinen Gastgebern, aber der Moment ging schnell vorüber, und wir verabschiedeten uns händeschüttelnd und nach allen Seiten lächelnd, ganz im Geiste der berühmten ägyptischen Gastfreundschaft.
Erst einige Zeit später, als ich ägyptischen Freundinnen die Geschichte erzählte und sie schallend auflachten, begriff ich den Grund der Verwirrung. »Aber Shereen, du hast ihnen dafür gedankt, dass sie dich in ihr Schlampen-Zentrum eingeladen haben!« Eine geringfügig fehlerhafte Aussprache des arabischen Worts für »Frau« hatte genügt, um ihre Organisation einem gänzlich anderen Wirtschaftszweig zuzuordnen.
Aufgrund solcher Abenteuer in und mit der arabischen Sprache tue ich mein Möglichstes, um dem Leser arabische Wörter in der richtigen Schreibweise zu präsentieren. Daher habe ich mich in diesem Buch bei der Transliteration ins Englische an den Goldstandard des InternationalJournal ofMiddleEastStudies gehalten; allerdings habe ich der Einfachheit halber diakritische Zeichen weggelassen. Zwei arabische Buchstaben, die mir im Lauf der Jahre eine Menge Ärger einbrachten – und die obige Episode ist ein Beispiel dafür –, werden mit ‘ für ‘ ayn und ’ für hamza wiedergegeben.
Wenn ich über Ägypten spreche, bin ich manchmal vom IJMES abgewichen und habe Wörter entsprechend ihrer lokalen Aussprache transliteriert. So schreibe ich etwa ahwa statt qahwa, Gamal statt Jamal und so weiter. Es gibt zwangsläufig Ausnahmen von dieser Ausnahme. Wenn etwa arabische Wörter Eingang ins Englische gefunden haben, werden sie nicht kursiv gesetzt, und ich habe mich in den meisten Fällen entschieden, sie nicht zu ägyptisieren – das heißt, ich verwende zum Beispiel die Form »Hijab«, nicht hegab. Das Gleiche gilt für Pluralformen. Bei Wörtern, die Eingang ins Englische gefunden haben, bilde ich den Plural mit s; im Übrigen habe ich die ursprüngliche arabische Pluralform beibehalten: also schreibe ich »Abaya« und »Abayas« (nicht Abayaat); faqih und fuqaha’ (nicht faqihs). Ich habe auch die eingebürgerte Schreibweise von Ortsnamen und von Namen bekannter zeitgenössischer und historischer Personen beibehalten.
EINLEITUNG
»Was ist das?«
Sechs dunkle Augenpaare starrten mich an. Vielmehr nicht mich, sondern einen kurzen lilafarbenen Stab in meiner Hand.
»Das ist ein Vibrator«, antwortete ich auf Englisch und zermarterte mir das Hirn nach dem richtigen arabischen Wort. »Ein Ding, das sich sehr schnell dreht«, fiel mir ein. Da diese Beschreibung aber auch auf einen Handmixer zutrifft, beschloss ich, bei meiner Muttersprache zu bleiben, um der zunehmenden Verwirrung, die ich in dem Raum spüren konnte, entgegenzutreten.
Eine der Frauen, die es sich auf einem Divan neben mir gemütlich machte, begann ihren Hijab abzustecken, worauf das schwarze Haar wie in einer Kaskade ihren Rücken herabfiel, während sie das Kopftuch sorgfältig zur Seite legte. »Was tut dieses Ding?«, fragte sie.
»Nun, es vibriert«, antwortete ich. Ich nippte an meinem Minztee und biss in ein Stück siruptriefendes Baklava, um mir vor der unvermeidlichen Nachfrage eine kurze Atempause zu verschaffen.
»Aber wozu?«
Wie es dazu kam, dass ich bei einem morgendlichen Kaffeeklatsch von Hausfrauen in Kairo Sextoys vorführte, ist eine lange Geschichte. In den letzten fünf Jahren habe ich viele Länder der arabischen Welt bereist und Menschen Fragen rund um das Thema Sex gestellt: Was sie selbst tun, was sie nicht tun, was sie über Sexualität denken und warum. Je nach Sichtweise mag sich dies nach einem Traumjob oder aber nach einer recht anrüchigen Beschäftigung anhören. Für mich ist es etwas völlig anderes: Sex ist die Linse, durch die ich die Vergangenheit und Gegenwart eines Teils der Welt betrachte und analysiere, über den so viel geschrieben und der zugleich noch immer so wenig verstanden wird.
Zugegeben: Angesichts der spektakulären Volksaufstände überall in der arabischen Welt seit dem Jahr 2010, bei denen einige der Regime, die besonders fest im Sattel zu sitzen schienen – Ägypten, Libyen, Tunesien und Jemen in vorderster Reihe –, hinweggefegt und andere aufgerüttelt wurden, mag Sex als eine etwas eigenartige Themenwahl erscheinen. Einige Beobachter gingen jedoch sogar so weit zu behaupten, die Proteste seien überhaupt erst von der starken sexuellen Energie der Jugend entfacht worden.1 Ich bin da nicht so sicher. Obwohl ich Ägypter oft sagen hörte, ihre Landsleute verbrächten 99,9 Prozent ihrer Zeit damit, an Sex zu denken, waren in den stürmischen Tagen Anfang 2011 Liebesspiele ausnahmsweise mal das, was die Menschen am wenigsten interessierte.
Trotzdem glaube ich nicht, dass Sex völlig in den Hintergrund getreten war. Sexuelle Einstellungen und Verhaltensweisen sind eng mit Religion, Tradition, Kultur, Politik und Ökonomie verknüpft. Diese sind ein integraler Bestandteil der Sexualität – das heißt des Sexualaktes und all dessen, was damit zusammenhängt, einschließlich Geschlechterrollen und Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Lust und Intimität, Erotik und Fortpflanzung. Als solche ist die Sexualität ein Spiegel der Verhältnisse, die zu den Volksaufständen führten, und an ihr wird sich ablesen lassen, wie die hart errungenen Reformen in den kommenden Jahren voranschreiten. In seinen Reflexionen über die Geschichte des Abendlandes bezeichnete der französische Philosoph Michel Foucault die Sexualität als einen »besonders dichte[n] Durchgangspunkt für die Machtbeziehungen: zwischen Männern und Frauen, zwischen Jungen und Alten, zwischen Eltern und Nachkommenschaft, zwischen Erziehern und Zöglingen, zwischen Priestern und Laien, zwischen Verwaltungen und Bevölkerungen«.2 Das Gleiche gilt für die arabische Welt: Wenn Sie ein Volk wirklich verstehen wollen, beginnen Sie damit, dass Sie einen Blick in seine Schlafzimmer werfen.
Ohne die Ereignisse vom 11. September 2001 hätte ich diese Tür vielleicht nie aufgemacht. In dem Jahr, in dem die Welt aus den Fugen geriet, arbeitete ich bei dem britischen Wirtschaftsmagazin The Economist. Bevor ich Journalistin wurde, hatte ich Immunologie studiert, und als Redakteurin für Gesundheit und Naturwissenschaften war ich weit weg von den großen politischen Debatten der Zeit. Ohne direkt involviert zu sein, hatte ich die Chance, mich zurückzulehnen und meinen Kollegen dabei zuzusehen, wie sie sich mit den Komplexitäten der arabischen Welt herumschlugen. Ich sah, wie ihr fester Glaube an die angloamerikanische Macht und ihr Überschwang in dem anfänglichen Nachglanz des Irakkriegs nach und nach Zweifeln und schließlich Fassungslosigkeit wichen. Warum begrüßten die Iraker diese neue Weltordnung nicht mit offenen Armen? Weshalb folgten sie nur selten dem Drehbuch, das in Washington und London geschrieben wurde? Weshalb entsprach ihr Verhalten in keiner Weise den Erwartungen des Westens? Kurzum: Wie tickten sie?
Das sind für mich keine Fragen der Geopolitik oder der Anthropologie; vielmehr geht es hier um meine persönliche Identität. Die arabische Welt liegt mir im Blut: Mein Vater ist Ägypter, und durch ihn erstrecken sich die Wurzeln meiner Familie von der Betonlandschaft Kairos bis zu den Baumwollfeldern tief im Nildelta. Meine Mutter stammt aus einem fernen grünen Tal – einem ehemaligen Bergarbeiterdorf in Südwales. Dies macht mich zur Halbägypterin, obgleich die meisten Menschen in der arabischen Welt den Kopf schütteln, wenn ich ihnen das sage. Sie sehen darin nichts »Halbes«; da mein Vater ein hundertprozentiger Ägypter ist, bin ich es auch. Und weil er Muslim ist, bin auch ich als Muslima geboren. Die Familie meiner Mutter ist christlich: Mein Großvater mütterlicherseits war ein baptistischer Laienprediger, und mein Onkel brachte es – in einem Sprung anglikanischer Aufwärtsmobilität – sogar zum Vikar der Church of Wales. Meine Mutter konvertierte jedoch zum Islam, als sie meinen Vater heiratete. Sie hätte es nicht tun müssen; muslimische Männer dürfen ahl al-kitab (»Leute des Buches«) heiraten, zu denen auch Juden und Christen zählen. Meine Mutter wurde aus Überzeugung, nicht durch äußeren Zwang, zur Muslimin.
Ich wurde in England geboren und wuchs in Kanada auf, lange bevor »Muslime im Westen« ein Thema war. Auf der Schule und an der Uni gab es ein paar Muslime, aber ich habe nie besonders viel darüber nachgedacht. Andererseits wuchs ich auch nur mit einer Prise Islam in einem ansonsten westlichen Lebensstil heran: Ich machte einen Bogen um Schweinefleisch und Alkohol und lernte al-Fatiha– die Eröffnungssure des Korans – auswendig, die mich meine Eltern vor unseren sehr britischen Sonntagsessen aufsagen ließen. Als die einzigen Muslime in der Straße waren wir immer die Ersten, die weihnachtliche Lichterketten anbrachten, und Ostern verging nie ohne ein Nest mit Schokoeiern.
Was Ägypten anlangt, so besuchten wir jedes Jahr meine Großmutter Nuna Aziza und den großen Kreis von Tanten, Onkeln, Cousins und Cousinen. Wir fielen aus dem Rahmen: Meine Mutter war die einzige khawagayya – ägyptisches Arabisch für »westliche Frau« –, die in die Familie eingeheiratet hatte, und in meiner Kindheit waren wir die einzigen Familienmitglieder, die außerhalb Ägyptens lebten. Dank des Ansehens meines Vaters als ältester Sohn und meiner eigenen exotischen Abstammung aalte ich mich im Rampenlicht. Die Wohnung meiner nunawar ein regelrechter Gedenkschrein für den winzigen Zweig der Familie im Exil; zwischen Plastikpflanzen und Petit-Point-Bildern mit Possen treibenden Schäfern und schamhaften Jungfern steckten unsere Fotos auf Kaffee- und Wandtischchen, deren vergoldete Zierbeine für das ganze Gewicht der großmütterlichen Zuneigung zu schwach zu sein schienen. Mit zunehmendem Alter begann ich, Ägypten zu lieben und den Islam zu respektieren, aber ich dachte nie daran, hinter die Oberfläche zu blicken.
In Kanada kritisierten viele der ägyptischen Freunde meines Vaters seine Entscheidung, sein einziges Kind nicht strenger im Glauben zu erziehen. Weder brachte man mir salat bei, das muslimische Gebetsritual, noch lernte ich Arabisch. Nicht aus mangelnder Überzeugung meines Vaters. Er ist ein frommer Muslim, der fünfmal am Tag betet und jeden Morgen den Koran aus dem Gedächtnis rezitiert; er ist ein Haddsch, ein Mann, der die Pilgerfahrt in die heiligen Städte Mekka und Medina unternommen hat; in jedem Ramadan hält er penibel das Fastengebot ein, und er zahlt immer die Zakat, das Almosen für die Armen. Mein Vater sah jedoch, wie seine Freunde den Islam und ihre eigene arabische Erziehung ihren Kindern – insbesondere ihren Töchtern – aufdrängten, wie um sie gegen die vermeintlichen Übel des Westens zu immunisieren. Doch oftmals sahen die Kinder in dem, worin diese Eltern eine Gefahr erkannten, eine großartige Gelegenheit, und viele wandten sich von einem religiösen und kulturellen Erbe ab, das ihnen als eine starke Medizin in zu hoher Dosierung erschien. Meine Eltern dagegen gaben mir die Freiheit, mich zu meinen eigenen Bedingungen und dem mir geeignet erscheinenden Zeitpunkt meiner Religion und meinen Wurzeln zuzuwenden.
Dieser Zeitpunkt kam nach dem 11. September 2001. Wie so viele andere, die einen Spagat zwischen Ost und West versuchen, sah ich mich gezwungen, mich eingehender mit meiner Herkunft zu beschäftigen. Dass ich Sexualität als meine Linse auswählte, ist ungewöhnlich, aber angesichts meines beruflichen Werdegangs nachvollziehbar. Als Redakteurin beim Economist schrieb ich unter anderem über Aids, und dazu gehörte auch die betrübliche Aufgabe, über den Stand der globalen Epidemie zu berichten. Jedes Jahr publiziert UNAIDS, die für die Datenerhebung und Politikkoordinierung im Bereich Aidsbekämpfung zuständige UN-Organisation, einen aktuellen Bericht voller beängstigender Statistiken über HIV-Infektionen. Bemerkenswert fand ich allerdings nicht die sehr hohen Zahlen für Sub-Sahara-Afrika, Osteuropa und Asien, sondern die verschwindend geringen Zahlen im arabischen Raum, die nur einem Bruchteil der Infektionsraten in anderen Regionen der Welt entsprachen. Wie konnte in einem Zeitalter der Massenmigration und -mobilität ein Teil der Welt scheinbar immun gegen HIV bleiben? War es möglich, dass Menschen in der arabischen Region einfach keine risikobehafteten Verhaltensweisen praktizierten – keine gemeinsame Nutzung von Injektionsnadeln, kein Gebrauch HIV-verseuchter Blutkonserven und kein ungeschützter Sex?
Als ich damit anfing, Fragen zu stellen, stieß ich auf die Kluft zwischen öffentlichem Anschein, wie er sich in den amtlichen Statistiken niederschlug, und privater Wirklichkeit. Während viele Leute mir sogleich versicherten, Aids sei in der arabischen Welt kein Problem und könne hier auch niemals zu einem Problem wie in anderen Regionen werden, lernte ich Familien kennen, in denen alle infiziert waren, und ich lauschte den immer dringlicheren Bitten derjenigen, die sich im Stillen darum bemühten, die weitere Ausbreitung der Epidemie zu verhindern. Je genauer ich hinsah, umso deutlicher erkannte ich, dass die Kluft zwischen Anschein und Wirklichkeit hauptsächlich auf Sex und den kollektiven Widerwillen zurückzuführen ist, sich mit einem Verhalten auseinanderzusetzen, das nicht dem Ehe-Ideal genügt, ein Widerstreben, das durch religiöse Interpretation und gesellschaftliche Konvention untermauert wird.
Dieses sexuelle Klima entspricht in groben Zügen jenem, das kurz vor der sexuellen Revolution im Westen herrschte. Und viele der gleichen grundlegenden Kräfte, die den Wandel in Europa und Amerika antrieben, sind auch in der modernen arabischen Welt anzutreffen, wenn auch nur im Keim: das Ringen um Demokratie und Grundrechte, das rasche Wachstum von Städten und die zunehmende Auflösung familiärer Strukturen, die Lockerung der sozialen Kontrolle über das individuelle Verhalten, ein sehr hoher Anteil junger Menschen, deren Einstellungen sich von denen ihrer Eltern unterscheiden, die sich wandelnde Rolle der Frau, die ökonomische Expansion und Liberalisierung, die Sex zu einem Konsumgut machen. Hinzu kommt der durch Medien und Migration vermittelte stärkere Kontakt mit den sexuellen Sitten anderer Weltregionen. All dies wirft die Frage auf: Folgt auf die gegenwärtigen politischen Umwälzungen in der Region eine sexuelle Revolution?
Wegen grundlegender historischer, religiöser und kultureller Unterschiede liefert der Westen keine Orientierungshilfe hinsichtlich der Frage, wohin die Veränderungen in der arabischen Welt letztlich führen werden. Entwicklung ist ein langsamer Prozess, kein Rennen, und verschiedene Gesellschaften schlagen verschiedene Wege ein. Allerdings sind einige Ziele erstrebenswerter als andere. Ich glaube, dass eine Gesellschaft, die Menschen nicht nur erlaubt, eigenständige Entscheidungen zu treffen und ihr sexuelles Potenzial auszuschöpfen, sondern ihnen auch die Bildung, die Instrumente und die Chancen vermittelt, um dies zu verwirklichen, während sie zugleich die Rechte anderer respektiert, ein fruchtbarerer Boden für Entwicklung ist. Ich glaube nicht, dass dies grundsätzlich unvereinbar ist mit den gesellschaftlichen Wertvorstellungen in der arabischen Welt, die früher einmal offener für das gesamte Spektrum der menschlichen Sexualität war und dies wieder werden könnte. Und es widerspricht auch nicht zwangsläufig der tonangebenden Religion der Region: Durch ihre Interpretationen des Islam haben viele Muslime sich selbst und ihrer Religion Fesseln angelegt.
In diesem Buch kommen diejenigen zu Wort, die die Fesseln abstreifen wollen: Forscher, die es wagen, die gelebte Sexualität zu erforschen; Gelehrte, die altüberlieferte Texte, welche Menschen heute in ihrer Entscheidungsfreiheit stark einschränken, neu interpretieren; Juristen, die für ausgewogenere Gesetze kämpfen; Ärzte und Therapeuten, die die negativen körperlichen und seelischen Folgen aufzufangen versuchen; mutige religiöse Führer, die Toleranz predigen, statt wie früher von Verdammnis zu sprechen; Aktivisten, die auf den Straßen unterwegs sind und sich bemühen, Sex sicher zu machen; Schriftsteller und Filmemacher, die die Grenzen der sexuellen Ausdrucksmöglichkeiten hinterfragen; Blogger, die einen neuen Raum für die öffentliche Debatte schaffen. Aber wir hören auch die Stimmen derjenigen, die sich ihnen entgegenstellen; die sich wandelnde politische Landschaft der arabischen Region eröffnet nach Jahren des Stillstandes neue Chancen für beide Seiten.
Es dauerte mehr als tausend Tage, diese Geschichten zusammenzutragen, und wie in TausendundeineNacht sind sie in oftmals überraschender Weise miteinander verwoben. In Kapitel 1 helfen sie uns zu verstehen, wie sich Einstellungen zur Sexualität in Ost und West im Lauf der Zeit verändert haben; in Kapitel 2 verdeutlichen sie die Schwierigkeiten der Ehe, innerhalb und außerhalb des Schlafzimmers. In Kapitel 3 zeigen sie uns das sexuelle Minenfeld der Jugend, und in Kapitel 4 zeigen sie Möglichkeiten auf, wie man es mit Sexualerziehung, Verhütung und Abtreibung sicher durchqueren kann und was sich tun lässt, wenn man doch auf eine Mine tritt und als unverheiratete Frau Mutter wird. Kapitel 5 untersucht die vielen Nuancen der Sexarbeit in der Region und ihre mögliche zukünftige Entwicklung; in Kapitel 6 betrachten wir diejenigen, die die heterosexuelle Norm sprengen, und die Veränderungen, die sie sich wünschen. Schließlich ordnet Kapitel 7 den gegenwärtigen Zustand in eine umfassendere Perspektive ein und wendet sich der Frage zu, wie in den kommenden Jahrzehnten eine ausgewogenere und bedürfnisgerechtere Sexualkultur entstehen könnte. Trotz all der Nöte, die diese Geschichten verdeutlichen, ist dies nicht ein weiteres Buch darüber, was in der arabischen Region falsch läuft. Es zeigt vielmehr das, was gelingt: wie Menschen in den einzelnen Ländern ihre Probleme lösen, und zwar in einer Weise, die sich oftmals von den Antworten in anderen Regionen der Welt unterscheidet. Dies ist weder ein akademischer Schmöker noch ein Panoptikum arabischer Exotika. Es ist letztlich ein Album mit Schnappschüssen aus der ganzen Region, aus dem Blickwinkel einer Person, die versucht, die Region besser zu verstehen, um sich selbst besser zu verstehen. Diejenigen, die nach einer Enzyklopädie oder einer Peepshow suchen, sollten sich anderweitig umtun.
Bislang habe ich von der arabischen Welt als einer kollektiven Einheit gesprochen, so als könnte man die 22 Länder, 350 Millionen Menschen, drei Hauptreligionen, Dutzenden kleinerer Religionsgemeinschaften und ethnischer Gruppen in einen Topf werfen. Die Bezeichnung »Middle East« (Naher und Mittlerer Osten) ist geographisch sogar noch weiter gespannt und fasst nicht nur die arabischsprachigen Länder Nordafrikas, die Arabische Halbinsel und das Östliche Mittelmeer, sondern auch die nichtarabischen Länder Türkei, Iran, Afghanistan und manchmal sogar Pakistan zu einer Einheit zusammen. Zwar gibt es grundlegende Übereinstimmungen in den sexuellen Einstellungen und Verhaltensweisen zwischen den arabischen Ländern, aber es bestehen auch gewichtige Unterschiede in der Art und Weise, wie Gesellschaften diese Herausforderungen angehen oder nicht. Solche Unterschiede gehen über die Sexualität hinaus und spiegeln sich eindeutig in den verschiedenen Richtungen des politischen Wandels wider, der durch die Volkserhebungen dieses Jahrzehnts ausgelöst wurde.
Von jetzt an also genauere Angaben. Dieses Buch dreht sich um Ägypten und insbesondere um Kairo, das ein verkleinertes Abbild der Bevölkerung des ganzen Landes und ihres gesamten sozialen Spektrums ist. Ägypten ist ein Schwerpunkt, der sich von selbst anbietet, nicht nur aus Gründen meiner persönlichen Geschichte, sondern auch deshalb, weil es das bevölkerungsreichste Land in der arabischen Region ist, von strategischer geopolitischer Bedeutung, und weil es nach wie vor in der gesamten Region einen starken politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Einfluss ausübt. Als ich meine Reise begann, teilten nur wenige im arabischen Raum – soll heißen: außerhalb Ägyptens – meine Meinung. Fast sechzig Jahre Militärdiktatur nach dem Zweiten Weltkrieg hatten den Stern Ägyptens, das jahrhundertelang Zentrum der arabischen Welt gewesen war, immer tiefer sinken lassen, während die ökonomische, politische und kulturelle Bedeutung seiner Nachbarn wuchs. Ägypten war wegen seiner Armut, seines engstirnigen Islamismus, seiner zerfallenden Infrastruktur, seines kulturellen Niedergangs, der grassierenden Korruption und politischen Erstarrung als ein hoffnungsloser Fall abgeschrieben worden. Oder, wie es mein Taxifahrer in Rabat, der Hauptstadt Marokkos, mit vernichtender Einfachheit ausdrückte: »Ägypter, so selbstgefällig. Und weshalb?«
Ägypten, so hieß es, habe den Faden verloren. Aber kaum dass sich seine Millionen gegen das Regime erhoben, rühmten dieselben Stimmen das Land als ein Fanal des Wandels in der gesamten Region. Weiter entfernt versuchten Demonstranten von der Wall Street bis nach Sydney die Erhebung in Ägypten in ihre Heimatländer zu importieren. Seit 2011 haben weltweite Solidaritätskundgebungen, die Nervosität in westlichen Hauptstädten, die Ängste arabischer Führer und die anhaltende globale Medienberichterstattung sattsam bewiesen, dass das, was in Ägypten passiert, noch immer von Belang ist, nicht nur für seine eigenen Bürger, sondern auch für den Rest der Welt. Ägypten hat sein geopolitisches Selbstbewusstsein wiedergefunden und dadurch eine langfristige Chance erhalten, seine Gesellschaft einschließlich ihrer Sexualkultur umzugestalten – Veränderungen, die seine Nachbarn sehr genau beobachten werden.
Bei vielen der schwierigen Fragen im Zusammenhang mit Sexualität findet man sozusagen »vor der Haustür« Vorbilder für Veränderungen. Das ist eine Frage von Pragmatismus, nicht von Chauvinismus. Während andernorts im Globalen Süden in Fragen der Sexualität beachtliche Fortschritte gemacht wurden, aus denen sich viel lernen ließe, ist es nur verständlich, dass Ägypter Veränderungen eher schätzen und übernehmen, wenn sie diese in einer ihnen vertrauten »Verpackung« sehen. Und so habe ich mich etwas weiter weg in Marokko und Tunesien im Westen sowie im Libanon im Osten umgesehen, die Ägypten Modelle dafür anbieten, wie es zumindest einige seiner kollektiven sexuellen Probleme lösen könnte. Ich habe auch die Länder am Golf bereist – unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Katar und Saudi-Arabien. Diese Region übt durch Medien, Geld und Migration einen starken Einfluss auf Ägypten aus und hat in den letzten fünfzig Jahren die gesellschaftlichen und sexuellen Einstellungen in Ägypten maßgeblich geprägt (beziehungsweise verzerrt, wie einige behaupten würden). Schließlich werden Sie auf diesen Seiten auch Stimmen aus anderen Teilen der arabischen Welt hören, deren Situation ein Schlaglicht auf die Lage der Dinge in Ägypten wirft.
»Ich bitte um Nachsicht, wenn ich manchmal nur einen Hinweis auf die Namen der Helden meiner Anekdoten gebe und sie nicht ausdrücklich erwähne. Es genügt, wenn ich nur die Namen derjenigen nenne, die durch die namentliche Nennung keinen Schaden erleiden und deren Erwähnung uns oder ihnen keine Schande bringt; entweder weil die Angelegenheit so berüchtigt ist, dass Verschleierung und Aussparung eindeutiger Details dem Betroffenen keinen Nutzen bringen wird, oder aber aus dem einfachen Grund, dass die Person, über die berichtet wird, recht zufrieden damit ist, dass ihre Geschichte in die Öffentlichkeit getragen wird, und ihre namentliche Erwähnung in keiner Weise missbilligt.« Diese Vorbemerkung stammt von Ibn Hazm, einem muslimischen Philosophen, der im 10. und 11. Jahrhundert in Spanien wirkte und dessen berühmte Abhandlung Das Halsband der Taube den Leser sachkundig in die Kunst des Verliebens und Entliebens einführt.3 Ein Jahrtausend später werde ich es genauso halten: Wo in diesem Buch nur der Vorname erscheint, wurde der Name geändert.
Ich war zuerst Naturwissenschaftlerin, dann Journalistin, und dieses Buch spiegelt diesen Werdegang wider. Wenn möglich, habe ich persönliche Geschichten durch präzise Daten ergänzt; als stellvertretende Vorsitzende der Global Commission for HIV and the Law, einem von den Vereinten Nationen eingesetzten Gremium, das sich weltweit für die Reform von Gesetzen, einschließlich Gesetzen, die das Sexualverhalten regeln, einsetzt, erhielt ich bevorzugten Zugang zu beiden. In der arabischen Welt kommt man nur schwer an solche Informationen, weil das Sexualverhalten hier im Vergleich zu anderen Teilen der Welt noch immer wenig erforscht ist. Viele drängende Fragen harren ihrer Beantwortung, und falls es doch einmal Daten gibt, verschwinden diese oftmals in der Schublade.
Dieses Buch möchte mithelfen, dies zu ändern, und so einen Beitrag leisten zu einer neuen Ära der Offenheit und intellektuellen Freiheit, die sich Millionen von Menschen überall in der arabischen Welt erhoffen. Zu diesem Zweck habe ich, begleitend zu diesem Buch, eine Website eingerichtet, www.sexandthecitadel.com, wo Sie, gemäß den Hinweisen in den Anmerkungen, eine Fülle zusätzlicher Fakten, Zahlen und Befunde über die hier behandelten Themen finden. Diese Website soll eine Art Tauschbörse für Informationen zur Sexualität in der arabischen Region sein; ich ermuntere Leser dazu, diese Website nicht nur zu besuchen, sondern selbst etwas beizusteuern, indem sie themenbezogene Nachrichten, Ereignisse und Forschungsergebnisse in Englisch, Arabisch oder Französisch posten. Das Verständnis der Sexualität führt einen zum Kern einer jeden Gesellschaft, und Veränderungen des Sexualverhaltens haben Auswirkungen, die weit über das Schlafzimmer hinausgehen. Und so hoffe ich, dass Sex und die Zitadelle eine Ressource für all diejenigen sein wird, die die Vergangenheit und die Gegenwart verstehen und gemeinsam eine bessere Zukunft für kommende Generationen schaffen wollen. Sex und die Zitadelle ist keineswegs das letzte Wort über Sex in der arabischen Welt, sondern nur ein erster Schritt an einem Wendepunkt in der Geschichte der Region – andere mögen dieses Anliegen weiter voranbringen.
Kairo, November 2012
1 (EIN)STELLUNGEN IM WANDEL DER ZEITEN
Wer mit seiner Vergangenheit bricht, ist verloren.
Meine Großmutter über die Erinnerung an die eigenen Wurzeln
Jede Fahrt durch Kairo ist eine bewegende Lektion in Geschichte. Ich meine damit nicht die uralten Denkmäler der Stadt oder ihren mittelalterlichen Souk, ihre kolonialen Villen oder ihre Wolkenkratzer des 21. Jahrhunderts. Und auch nicht die außerordentliche modische Vielfalt ihrer mindestens 20 Millionen Einwohner – Männer in Turbanen und Galabiyas (Dschellabas, traditionellen Gewändern) neben Jungs in abgewetzten Jeans und trendigen T-Shirts, Frauen in Abayas und Niqabs (langem Umhang und Gesichtsschleier), kulturellen Importen vom Persischen Golf und Zeichen wachsender Religiosität, Schulter an Schulter mit Mädchen, die die neueste westliche Mode und wallendes Haar tragen.
Wenn ich mich durch das Gewühl der Stadt schlängele, konzentriere ich mich – abgesehen von den tückischen Gehsteigen und den kniehohen Bordsteinen – auf die Straßenschilder. Nicht allein deshalb, weil es, wenn man sich in Kairo verläuft, Stunden dauern kann, um aus dem Labyrinth herauszufinden, sondern auch, weil diese dunkelblauen Tafeln mit ihren weißen kalligraphischen Aufschriften so viel über die Vergangenheit des Landes erzählen. Auf einem einzigen Bummel durch die Innenstadt kann man unter der Brücke des 6. Oktober hindurchgehen, die des gesichtswahrenden Angriffs Ägyptens auf Israel im Jahr 1973 gedenkt, in der Ramses Street prächtige Zeugen aus der Zeit der Pharaonen bewundern, ehe man in die Straße des 26. Juli einbiegt, die an den Sturz des letzten Monarchen Ägyptens erinnert. Auf der Champollion Street, die nach dem Mann benannt ist, der den Stein von Rosetta entzifferte, wird man dann in die Zeit des Ägypten-Feldzugs Napoleons versetzt, bevor man auf dem Tahrir(Befreiungs)-Platz landet, der an den Aufstand der Ägypter gegen die britischen Besatzer und deren autokratische Herrschaft erinnert.
Tahrir macht heute Überstunden. Im Winter 2011 strömten Hunderttausende von Ägyptern auf diesen sonst von Verkehrslärm erfüllten, von Abgasen verpesteten Platz, eine berüchtigte Todesfalle für Fußgänger im Herzen Kairos, und verlangten nichts Geringeres als eine nationale Erneuerung. Der Tahrir-Platz war das Epizentrum der Volkserhebung gegen die dreißigjährige Herrschaft von Präsident Hosni Mubarak. Während sich der Aufstand rasch immer weiter im Land ausbreitete, zog der Tahrir-Platz die Aufmerksamkeit der Welt auf sich – und das, was Millionen von Demonstranten taten, wurde live im Fernsehen gesendet, getweetet und gebloggt. Der Tahrir-Platz wurde zu einer achtzehntägigen revolutionären Realityshow, in der man mitverfolgen konnte, wie sich die Protestierer verschanzten, im Freien kampierten und sich gegen ihren eigenen Big Brother, das Regime Mubarak, wehrten. »Wir sind ein Ägypten«, riefen die Menschen, als die jahrzehntelange Frustration über die politische und gesellschaftliche Erstarrung Reich und Arm, Muslime und Christen, Männer und Frauen, Eltern und Kinder zu einer geschlossenen Front zusammenschmiedete. Der Erfolg des Tahrir-Platzes war nicht bloß seine großartige politische Bewegung, sondern die vielen kleinen persönlichen Schlachten, die gegen die Verwerfungen geschlagen und gewonnen wurden, die die ägyptische Gesellschaft zermürbten: zwischen Religionen, Schichten, Geschlechtern und Generationen.
In den kommenden Jahren wird der Erfolg der jüngsten Erhebung in Ägypten weitgehend danach beurteilt werden, wie diese Millionen von Minisiegen aus dem Treibhaus des Tahrir-Platzes in die kalten Realitäten des Alltagslebens übertragen werden. Dies gilt auch für den Rest der arabischen Region, wo Nationen ihren je eigenen Weg durch die politischen Umwälzungen suchen, die in diesem Jahrzehnt begannen. Um ermessen zu können, ob es womöglich zu einer Blütezeit kommen wird, müssen wir den Boden kennen, in dem diese Errungenschaften Wurzeln treiben. Und einer der steinigsten Orte ist dabei das Sexualleben.
In der heutigen arabischen Welt ist der einzige allgemein akzeptierte, gesellschaftlich anerkannte Rahmen für Sexualität die staatlich registrierte, von der Familie abgesegnete, religiös sanktionierte Ehe. Alles andere ist ‘ayb (schändlich), illit adab (ungehörig), haram (verboten) – ein endloser Wortschatz des Tadels. Die Tatsache, dass es weiten Teilen der Bevölkerung in den meisten Ländern der Region schwerfällt, dieser Norm zu genügen – jungen Menschen, die es sich nicht leisten können zu heiraten, Karrierefrauen, die nicht den Geschlechterrollenerwartungen entsprechen, Männern und Frauen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, denjenigen, die Sex verkaufen, um über die Runden zu kommen –, wird in zunehmendem Maße anerkannt, aber es gibt einen verbreiteten Widerstand gegen jegliche Alternative. Selbst im Ehebett ist Sex etwas, das man tut, nichts, worüber man spricht. Dieses kollektive Unbehagen gegenüber Sexualität macht es umso schwerer, die negativen Auswirkungen zu bewältigen, etwa Gewalttätigkeit, erhöhte Infektionsrisiken, Ausbeutung, sexuelle Funktionsstörungen, Unzufriedenheit in der Ehe und völlige Unwissenheit. »In der arabischen Welt ist Sex das Gegenteil von Sport«, sagte mir ein ägyptischer Gynäkologe. »Jeder spricht über Fußball, aber kaum einer spielt Fußball. Sex dagegen hat jeder, aber niemand will darüber sprechen.«
Wer in der arabischen Welt aufwächst, dem wird schon frühzeitig beigebracht, sich von den »roten Linien« fernzuhalten; gemeint sind damit Tabus rund um Politik, Religion und Sex, die in Wort oder Tat nicht in Frage gestellt werden dürfen. Diese Linien sind freilich keine isolierten Striche. Wie kalligraphische Schriftzüge fließen sie ineinander und vermischen sich; wenn man einen Teil davon entfernt, ändert sich die Bedeutung des Restes. Das »Erwachen Arabiens«, das in diesem Jahrzehnt begann, setzte einen Meißel an die rote Linie der Politik und begann mit dem langwierigen Prozess, altüberkommene Überzeugungen abzutragen: Die Demokratie sei für die Völker der arabischen Region aufgrund ihrer Religion, Kultur und Tradition eine ungeeignete Regierungsform; sie würden die Obrigkeit niemals in Frage stellen; ihre Furcht vor instabilen Verhältnissen sei stärker als ihr Wunsch nach Veränderung und den damit einhergehenden Unsicherheiten; sie könnten nicht mit Freiheit umgehen. Jetzt, da diese Ketten zerbrochen sind, ist es nur natürlich zu fragen, ob andere Tabus folgen werden.
Seit der Erhebung ist Kairo zu einer großen Anschlagtafel für Menschenrechte geworden. »Freiheit«, »Gerechtigkeit« und »Würde« sind nur einige der Schlagwörter in den Graffiti, die man überall in der Stadt sieht. Aber die Ausweitung dieser Rechte – sowie von Gleichheit, Achtung der Privatsphäre, Selbstbestimmung und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit – auf das Liebesleben aller Bürger ist eine ganz andere Sache. »Sexuelle Rechte« bedeuten in der Praxis die Freiheit, sexual- und reproduktionsmedizinische Dienstleistungen zu nutzen, Ansichten über Sexualität offen zu äußern und zu veröffentlichen und sich ungehindert Informationen zu verschaffen. Es ist das Recht, sich seinen Partner/seine Partnerin selbst zu wählen und in einvernehmlichen Beziehungen sexuell aktiv zu sein oder nicht. Es ist die Freiheit zu entscheiden, ob und wann man ein Kind haben will. Es ist das Recht, über den eigenen Körper frei zu verfügen, und die Freiheit, nach einem befriedigenden, geschützten und lustvollen Sexualleben zu streben. All dies ohne Zwang, Diskriminierung oder Gewalt – das ist überall auf der Welt ein sehr hoher Anspruch.1
Sexuelle Rechte sind unveräußerliche Menschenrechte; sie sind keine nachrangigen Rechte, die man nach Belieben annehmen oder ablehnen könnte, ohne die Freiheit und Menschenwürde des anderen zu missachten. Die Ausübung des »sexuellen Bürgerrechts« – die Freiheit, Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen und Rechenschaft von den Trägern öffentlicher Gewalt zu fordern, und zwar unabhängig von der Hautfarbe, von Schicht- und Religionszugehörigkeit, Geschlecht oder sexueller Orientierung – ist mehr als nur Ausdruck eines demokratischen Systems. Es ist ein Mittel, um ein solches System aufzubauen, indem man diese Prinzipien im Kern der menschlichen Existenz verankert, wo sie ihrerseits Einstellungen und Handlungen in anderen Bereichen prägen.
»Sexuelle Rechte« aber sind in der arabischen Welt ein Minenfeld; für viele Menschen sind sie ein Kürzel für eine westliche gesellschaftspolitische Agenda, die gleichbedeutend ist mit Homosexualität, freier Liebe, Prostitution, Pornographie und einer gefährlichen Tendenz zur Unterminierung des Islam und »traditioneller« arabischer Werte. Solche Unterschiede spiegeln sich in World Values Surveys – in bestimmten Abständen erfolgende weltweite Umfragen über Wertvorstellungen – wider, bei denen Einstellungen zu einem breiten Spektrum von Fragen in über neunzig Ländern erfasst werden. Als Pippa Norris und Ronald Inglehart, zwei amerikanische Wissenschaftler, die Ergebnisse von Erhebungen, die zwischen 1995 und 2001 durchgeführt wurden, auswerteten, stellten sie fest, dass die größten Meinungsunterschiede zwischen den islamischen Ländern, in denen Umfragen durchgeführt wurden (unter anderem Marokko, Jordanien und Ägypten), und dem Westen (Nordamerika, Australasien und Westeuropa) nicht demokratische Werte betrafen, sondern Geschlechterrollen und Sexualität – etwa die Akzeptanz von Abtreibung, Scheidung und Homosexualität. Bei anschließenden Erhebungen der World Values Surveys zeigten sich kaum Veränderungen in diesen Einstellungen.2 Die Autoren zogen das Fazit: »Die kulturelle Kluft, die den Islam vom Westen trennt, betrifft Eros viel stärker als Demos.«3
Platztausch
Schon seit langem zieht die Sexualität einen Graben zwischen der arabischen Welt und dem Westen. Heute scheint Erstere vor allem damit beschäftigt zu sein, die Fleischeslust zu verleugnen, während sich Letzterer darin zu gefallen scheint, sie hemmungslos zur Schau zu stellen. Was bei diesen gegenseitigen Beschuldigungen oftmals übersehen wird, ist indes die Tatsache, dass solche Einstellungen wandelbar sind; zu anderen historischen Zeiten haben Ost und West die Plätze getauscht.4 Zwei Reisen, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stattfanden – die eine unternahm ein Franzose, die andere ein Ägypter –, verdeutlichen diesen Wandel.
Im Jahr 1849 bereiste Gustave Flaubert, der Autor von Madame Bovary und anderen klassischen Romanen, Ägypten, von Alexandria im Norden bis Wadi Halfa im Süden. Abgesehen von den Ruinen in Luxor war Flaubert von Denkmälern nicht sehr beeindruckt (»Überlegung«, schrieb er im März 1850 in sein Tagebuch, »die ägyptischen Tempel gehen mir furchtbar auf die Nerven.«)5, noch interessierte er sich besonders für seinen offiziellen Auftrag, Informationen für das französische Landwirtschafts- und Handelsministerium zu sammeln. (»Ganz nah, etwa zehn Millimeter entfernt, liegen meine ministeriellen Anweisungen, die scheinbar kaum den Tag erwarten können, an dem ich sie als Toilettenpapier benutzen werde«, schrieb er an einen Freund in Frankreich.)6
Für einen Mann von Flauberts romantischen Neigungen und breitgefächerten Gelüsten war das Zusammentragen trockener wirtschaftlicher Daten eine unbefriedigende Beschäftigung. Was den angehenden Schriftsteller wirklich interessierte, waren intime Einblicke in die derberen Seiten des Lebens der Einheimischen. Zu Flauberts großer Freude schenkte ihm Ägypten in dieser Hinsicht »Farbe satt«, wie er es ausdrückte.7 Besonders unternehmungslustig war ein bestimmtes Körperteil. Kaum in Kairo angekommen, verbrachte Flaubert die erste Nacht in einem Bordell mit türkischen Prostituierten, die er lakonisch skizziert. »Auf dem Mattengeflecht: festes Fleisch, bronzefarbener Arsch, rasiertes Möschen, trocken, wenn auch fett …«8
Flaubert fickte sich sozusagen nilaufwärts. Er schreibt ausführlich über die Prostituierten in dem südägyptischen Dorf Esneh und vor allem über sein Zusammentreffen mit Ruchiouk-Hanem: »ein großes, prächtiges Geschöpf, hellhäutiger als eine Araberin … ihre Haut, besonders am Körper, ist leicht kaffeebraun. Wenn sie sich seitlich setzt, zeigen sich an ihren Hüften bronzene Polster. Ihre Augen sind schwarz und übergroß … feste Schultern, üppige Brüste, Adamsapfel.«9 Der Besuch in Hanems Freudenhaus schloss Musikspiel und Striptease mit ein (eine gänzlich entblößte Version eines traditionellen ägyptischen Tanzes, des »Bienentanzes«), bevor man zum anstehenden Geschäft kam.10
Wenn Flaubert keinen Sex hatte, beobachtete er ihn auf Schritt und Tritt. Kairos unzüchtiges Straßenleben beflügelte seine Phantasie – Skizzen über Huren und arschfickende Esel; spielende Kinder, kleine Mädchen, »die mit ihren Händen Fürze erzeugten«, und ein Knirps, der seine Mutter verkuppelt: »Wenn Sie mir fünf Paras* geben, bring ich Ihnen meine Mutter zum Ficken. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste, vor allem eine lange Latte.«11 Zusätzlich zu dem üblichen Rundgang durch Moscheen und Pyramiden besichtigte Flaubert auch einige eher ungewöhnliche Orte. Im Qasr-al-Aini-Krankenhaus, wo Verwandte von mir noch heute als Ärzte tätig sind, machte er einen Rundgang durch die Syphilis-Station; auf ein Zeichen des Arztes hin »stellten sich [die männlichen Patienten] aufrecht in ihren Betten, lösten ihre Hosengürtel (es wirkte wie ein Militärmanöver) und öffneten mit den Fingern den Anus, um ihre Schanker zu zeigen«.12
Dies schreckte Flaubert aber keineswegs von gleichgeschlechtlichen Abenteuern ab. Wie er einem Freund schrieb: »Hier ist es weitgehend akzeptiert. Man steht zu seiner Sodomie, und bei Tisch im Hotel spricht man darüber. Manchmal leugnet man es ein bisschen, und dann wird man von allen geneckt, bis man schließlich gesteht. Da wir zu Bildungszwecken reisen und einen Auftrag der Regierung haben, hielten wir es für unsere Pflicht, uns diese Form des Ergusses zu gönnen. Bislang hat sich die Gelegenheit noch nicht geboten. Wir halten aber weiterhin danach Ausschau.«13 Flauberts Feldforschungen bezogen auch die Tanzdarbietungen von männlichen Prostituierten in Kairo ein (»… die Augen waren mit Antimon geschminkt … laszive Körperbewegungen … ähnlich einer Frau, die sich hingibt …«) sowie einen interessanten Aufenthalt im Hammam, dem öffentlichen Bad, wo der Masseur »meine boules d’amour anhob, um sie zu säubern, während er dann fortfuhr, meine Brust mit der linken Hand abzureiben, begann er, mit der Rechten an meinem Schwanz zu ziehen, und während er ihn hoch- und runterzog, lehnte er sich über meine Schulter und sagte: ›Bakschisch, Bakschisch**‹« – ein Angebot, das Flaubert ablehnte, weil der Mann für seinen Geschmack nicht jung oder hübsch genug war.14
Heute stehen Flaubert und andere Kommentatoren der arabischen Sexualkultur im 19. Jahrhundert ganz weit oben auf der »orientalistischen« Hitliste. Orientalismus, ehedem ein neutraler Terminus, der die Verwendung nah- und fernöstlicher Motive in der bildenden Kunst bezeichnete, wurde zu einem regelrechten Schimpfwort, nachdem Edward Said Ende der siebziger Jahre sein gleichnamiges Werk veröffentlichte. Darin tadelte Said Generationen westlicher Gelehrter dafür, dass sie die arabische Region durch ihr Prisma rassischer und religiöser Vorurteile und politischer Interessen dargestellt hätten und so den Orientalismus zu einem »westlichen Stil der Beherrschung, Beschränkung und des Autoritätsanspruchs über den Orient« machten.15 Dies führte laut Said dazu, dass der Orient in ein »lebendes Tableau der Fremdartigkeit« verwandelt wurde, das auch seine sexuellen Sitten betraf; dadurch habe der Westen seine Überlegenheit zur Geltung gebracht und seine Vorherrschaft über die Region und ihre Menschen gerechtfertigt. Said kritisierte insbesondere westliche Kommentatoren und ihre verklärenden Schilderungen des Lebens in Arabien; sie hätten die Kolonien auf der Suche nach prickelnden sexuellen Abenteuern bereist, die sie in der sittenstrengen Atmosphäre ihrer Heimatländer nicht finden konnten.
Während Flaubert und seine Zeitgenossen der sexuellen Ungezwungenheit des Orients viel Beifall zollten, fanden einige arabische Besucher, aus entgegengesetzten Gründen, manche Aspekte der europäischen Sexualkultur bewundernswert. Im Jahr 1826 traf Rifa‘a Rafi‘ al-Tahtawi, ein ägyptischer Imam, als Mitglied einer vierzigköpfigen Delegation ägyptischer Studenten in Paris ein, wo sie während eines fünfjährigen Aufenthalts die Sprache lernen und sich andere nützliche Fertigkeiten aneignen sollten. Al-Tahtawi war einer der begabtesten Schüler, ein fähiger Schriftsteller und Übersetzer, der später einer der Wegbereiter der Bildungsreform in seinem Heimatland wurde. Sein Bericht über diese staatlich finanzierte Bildungsreise ist teils aufschlussreiche Beobachtung, teils banaler Führer durch Europa. Al-Tahtawi war unglaublich wissbegierig und schrieb über alles Mögliche, von Politik bis zu Restaurants, von Galabällen bis zu Schlachthöfen. Bestimmte Seiten des französischen Nationalcharakters lobte er (Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Dankbarkeit), während er andere verachtete (Zuchtlosigkeit sowie die Tatsache, dass man Philosophen hier mehr Glauben schenkte als Propheten).
Al-Tahtawi betrachtete die Beziehungen zwischen Männern und Frauen in seiner neuen Heimat mit Skepsis. »Unter den französischen Frauen sind solche von großer Tugendhaftigkeit und andere, die eher das Gegenteil zeigen. Letztere sind in der Mehrzahl, da die Herzen der meisten Menschen in Frankreich, ob Männer oder Frauen, der Liebeskunst hörig sind.«16 Auch war er nicht sonderlich erbaut von ihrer Einstellung zu vorehelichen Beziehungen, die sie »zu den [menschlichen] Fehlern und Lastern zählen, statt darin eine Todsünde zu sehen«.17 Trotzdem schien al-Tahtawi eine Schwäche für die Damen zu haben, diese »Inbilder von Schönheit und Anmut«, und er machte in erster Linie die Schwäche ihrer Männer, die ihnen seines Erachtens zu viele Freiheiten gaben, für ihre Unzulänglichkeiten verantwortlich.18
Mochten ihre Beziehungen zu Frauen auch fragwürdig sein, so hatte al-Tahtawi doch nichts als Lob für die Standhaftigkeit der französischen Männer in ihrem Verhältnis zueinander. »Sie haben keinerlei Neigung zur Knabenliebe oder zur Verklärung dieses Zeitvertreibs. Dies ist eine Regung, die sie nicht kennen und die ihrer Natur und Moral zutiefst widerstrebt. Zu den Vorzügen ihrer Sprache und ihrer Poesie gehört es, dass sie die homosexuelle Liebe nicht rühmen. Tatsächlich ist es in Frankreich für einen Mann gänzlich unziemlich zu sagen: ›Ich habe mich in einen Knaben verliebt.‹ Dies würde als abstoßend und peinlich angesehen werden.«19
Al-Tahtawi ging ausführlich auf die Null-Toleranz der Franzosen in diesem Punkt ein. »Die Franzosen halten die Homosexualität für eine der widerwärtigsten Obszönitäten. Daher erwähnen sie diese auch nur sehr selten in ihren Büchern, und wenn sie es tun, dann immer verhüllt. Man wird nie Menschen darüber sprechen hören.«20 In seinem Bericht wies al-Tahtawi darauf hin, dass die Abneigung der Franzosen gegen die Homosexualität »die einzige Sache ist, die sie wirklich mit den Arabern gemeinsam haben«.21 Das ist jedoch eine Beschönigung, wenn man bedenkt, wie gut gleichgeschlechtliche Beziehungen im Kairo des 19. Jahrhunderts dokumentiert sind, nicht nur bei neugierigen Ausländern wie Flaubert, sondern auch bei lokalen Chronisten.22
Das Interessante an dieser Ebbe und Flut der Geschichte ist der Wandel der Stereotype. Die arabische Welt, die einst im Westen für sexuelle Freizügigkeit berühmt war, beneidet von einigen, von anderen verachtet, wird heute wegen ihrer sexuellen Intoleranz weithin kritisiert. Nicht nur westliche Liberale sind dieser Auffassung; es ist auch ein Leitmotiv in einigen der »islamophoben« Diskurse von Konservativen in Amerika und Europa geworden, das selbsterklärte letzte Gefecht in einer Schlacht um »westliche« Werte und die Verwüstungen des »radikalen« Islam, insbesondere in Bezug auf die Rechte von Frauen.23 Und der Westen, den früher manche in der arabischen Welt für seine unnachgiebige Haltung zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen rühmten, gilt heute vielen als eine Strahlenquelle der sexuellen Ausschweifung, gegen die die Region abgeschirmt werden müsse. Wahrnehmungen, wie verzerrt sie auch sein mögen, werden maßgeblich von der Einstellung geprägt. Die westliche Sicht der arabischen Sexualität und umgekehrt hat sich zum Teil deshalb verändert, weil sich auch die Einstellungen innerhalb ihrer jeweiligen Gesellschaften gewandelt haben.
Die Ereignisse in der westlichen Welt sind allgemein bekannt. Ich habe die Sexuelle Revolution nicht selbst erlebt, aber aus Erzählungen meiner Mutter weiß ich, was für ein dramatischer Bruch mit der Vergangenheit sie gewesen ist. Als sie in den 1930er und 1940er Jahren im ländlichen Wales aufwuchs, war Sex ein absolutes Tabu, aber alle wussten, dass züchtige Mädchen bis zur Hochzeit damit warteten. Im Zeitalter vor der Pille, als Verhütung eine unsichere Sache war und Abtreibung verboten und schwer zugänglich, war dies ebenso sehr eine Frage der praktischen Durchführbarkeit wie der Moral. Als meine Mutter im Teenageralter war, wurde jeglicher Kontakt mit jungen Männern streng überwacht, Ausgehverbote wurden rigoros durchgesetzt, und bei dörflichen Tanzveranstaltungen waren Begleitpersonen die Regel. Homosexualität war ein großes, dunkles Geheimnis, und meine Mutter, die einmal von einer Lehrerin angemacht wurde, war umso perplexer, als sie von einem solchen Verhalten noch nie gehört hatte.24
Wenn ich diese Geschichte meinen unter vierzigjährigen ägyptischen Freundinnen erzähle, staunen sie. Als eine Generation, die mit amerikanischen Filmen, später Musikvideos und heute dem Internet – allesamt nach der sexuellen Revolution aufgekommen – groß geworden ist, können sie einfach nicht glauben, dass die westliche Gesellschaft in sexuellen Dingen einmal so konservativ gewesen ist, wie es ihre eigene heute ist. Die Parallelen sind verblüffend: Vorehelicher Sex, Masturbation, Homosexualität, uneheliche Kinder und Abtreibung sind in der heutigen arabischen Welt tabuisiert, und eine Kultur der (Selbst-)Zensur und des Schweigens, die von der Religion gepredigt und durch soziale Konventionen verstärkt wird, ist dort genauso wirkmächtig, wie es in der Jugend meiner Mutter im Westen der Fall war.
Gleichermaßen überrascht sind sie aber auch, wenn ich ihnen Geschichten aus der Jugend meines Vaters im Kairo der 1930er bis 1950er Jahre erzähle oder ihnen die reiferen Sprüche meiner Großmutter auftische – Anekdoten und Redensarten, die sich durch dieses Buch ziehen und in denen sich sexuelle Einstellungen und Eskapaden widerspiegeln, die nicht weit von Flauberts Beschreibungen entfernt sind, wie sehr Anti-Orientalisten auch dagegen protestieren mögen. »Faszinierenderweise waren unsere arabischen Vorfahren nicht so wie wir, und ihre Einstellung zur Sexualität war sehr frei und offen«, schrieb Salah al-Din al-Munajjid, einer der ersten modernen arabischen Historiker, die sich das sexuelle Erbe der Region genauer ansahen und dabei die 1950er Jahre mit früheren Zeiten verglichen. »Es war ihnen nie peinlich, über Frauen und über Sex zu reden oder darüber zu schreiben. Ich glaube, dass diese große Freiheit, die sie genossen, die Ursache der Strenge ist, die wir heute vorfinden.«25
Niedergang und Fall
Was ist der Grund für diese Reaktion? Wieso kam es in der arabischen Welt zu einer solchen Kehrtwende in Sachen Sexualität? Auf der Suche nach Antworten begab ich mich zu dem Mann, der ein Buch über genau dieses Thema geschrieben hat. Abdelwahab Bouhdiba ist ein tunesischer Soziologe, der sich vor allem mit seinem 1975 erschienenen Buch La Sexualité en Islam einen Namen machte. Zwar hatten vor ihm schon andere Bücher über dieses Thema geschrieben, und seither sind viele weitere erschienen, aber Bouhdibas Werk ist zweifellos das bekannteste und wurde in mehr als ein halbes Dutzend andere Sprachen übersetzt.
Ausgehend von seiner Interpretation des Korans und der Hadithe – Überlieferungen der Worte und Taten des Propheten Mohammed – sowie anderer Quellen behauptete Bouhdiba, dass die Sinnlichkeit im Allgemeinen und die Sexualität im Besonderen nicht nur mit dem Islam vereinbar, sondern dass sie wesentliche Elemente des Glaubens seien. »Die Ausübung der Sexualität war ein Gebet, ein Sichschenken, ein Akt der Nächstenliebe«, schrieb er. »Den Sinn der Sexualität wiederzuentdecken bedeutet, den Sinn Gottes wiederzuentdecken und umgekehrt.«26 Aber im Lauf der Zeit hätten die Araber diese spirituelle Dimension verloren: »Diese offene Sexualität, die mit Blick auf die Erfüllung des Daseins voller Freude praktiziert wurde, wich nach und nach einer verschlossenen, lustfeindlichen, unterdrückten Sexualität … Verstohlenes, heimlichtuerisches, heuchlerisches Verhalten nahm einen immer größeren Raum ein … Die ganze Frische und Spontaneität wurden schließlich wie von einer Dampfwalze plattgemacht.«27 Um in politischer, gesellschaftlicher, ökonomischer, spiritueller und sexueller Hinsicht wieder auf den richtigen Weg zu kommen, bedarf es laut Bouhdiba eines tiefgreifenden Umdenkens: »Um diesen Missstand zu überwinden, müssen wir um jeden Preis den Sinn der Sexualität, das heißt den Sinn des Dialogs mit unserem Partner und den Sinn des Glaubens neu entdecken, das heißt den Sinn des Dialogs mit Gott … denn eine Sexualität, die angemessen praktiziert wird, ist gleichbedeutend mit gelebter Freiheit.«28
In brauner Cordhose und Jacke mit Hahnentrittmuster, akkurat gebundener Krawatte und kurzgeschnittenem grauem Haar sieht Bouhdiba nicht wie jemand aus, der in Fragen der Sexualität radikale Ansichten vertritt. Mit seinen sorgsam gewählten Worten und wohlüberlegten Pausen wirkt er eher wie ein Universitätsprofessor – was er bis zu seiner Emeritierung tatsächlich auch war. »Ich bin niemand, der provoziert … mein Stil ist maßvoll, ich sage schockierende Dinge, aber mit viel Diskretion«, erklärte er. Es hat sich als ein erfolgreiches Rezept erwiesen: LaSexualité enIslam wurde selbst im arabischen Raum gut aufgenommen. Bei allem Lob, welches das Buch in akademischen Kreisen fand, kam die für Bouhdiba erfreulichste Rezension von unerwarteter Stelle. »Ich war gerade in Djerba [in Südtunesien] und wartete auf die Fähre nach Tripolis [in Libyen]«, erinnerte er sich. »Da sagte jemand: ›Sind Sie nicht Bouhdiba? Autor des Buches LaSexualité enIslam?‹, und er begann mich zu umarmen. Er war Professor an der Universität Sarajewo. Er sagte, er habe mein Buch bei Kerzenschein übersetzt, mit einem Gewehr in einer Hand und einem Kuli in der anderen. Er verkaufte innerhalb von fünfzehn Tagen 2000 Exemplare. Er sagte: ›Ich habe in diesem Buch zwei Dinge gefunden: Stolz auf unsere Zugehörigkeit zu einer offenen Religion und eine joiedevivre, zwei Dinge, die wir heute dringend benötigen.‹«
Bouhdiba weist darauf hin, dass beides im Abbasiden-Reich, dessen Goldenes Zeitalter vom 8. bis zum 10. Jahrhundert währte und das sich einst von den Küsten des Mittelmeers bis an die Grenzen Indiens erstreckte, reichlich vorhanden war. In seiner Hauptstadt, Bagdad, entfaltete sich eine Blüte des arabischen Denkens und der arabischen Hochkultur, wie sie die Region seither nie mehr erlebt hat. Die Stadt beherbergte das Baytal-hikma, das Haus der Weisheit, eine Akademie, deren Gelehrte die klassischen Werke des griechischen und persischen Denkens vor dem Vergessen bewahrten. Die antiken Giganten der Mathematik, Medizin, Astronomie, Chemie und Technik boten breite Schultern, auf denen nachfolgende Generationen stehen sollten. Die Epoche der Abbasiden war eine Zeit der lebhaften religiösen Debatte, als die vier Hauptschulen der islamischen Rechtsgelehrsamkeit (fiqh), die die Grundsteine der Rechtsprechung in der heutigen arabischen Welt bilden, entstanden und die eigenständige, vernunftgeleitete Auslegung religiöser Schriften (ijtihad) gepflegt wurde. Dichtkunst und Literatur – darunter auch Werke mit einem starken sexuellen Einschlag – erlebten eine Blütezeit.
Es gibt eine lange, glanzvolle Geschichte arabischer Schriften über Sexualität – Literatur, Poesie, medizinische Abhandlungen, Selbsthilfe-Handbücher –, die in einem Großteil der arabischen Welt in Vergessenheit geraten ist. Viele dieser bedeutenden Werke wurden von religiösen Persönlichkeiten verfasst, die Glaube und Sexualität nicht als unvereinbar ansahen. Tatsächlich geziemte es sich für sie als Gelehrte, über sexuelle Praktiken und Probleme genauso umfassend Bescheid zu wissen wie über die kniffligen Fragen der islamischen Glaubenslehre. Diese Schriften haben keinen akademischen Charakter: Mit erstaunlicher Offenheit und oftmals entwaffnendem Humor behandeln sie praktisch alle sexuellen Themen, die man sich vorstellen kann, und noch einiges mehr. In Playboy, Cosmopolitanoder FreudeamSex – jedem beliebigen tabubrechenden Werk der sexuellen Revolution und darüber hinaus – findet sich herzlich wenig, was diese Schriften nicht schon vor über tausend Jahren berührten.
Für Bouhdiba ist diese sexuelle Aufgeschlossenheit ein wesentliches Element der geistigen Blüte jener Zeit. In ihrem Zenit in der frühabbasidischen Epoche waren die Araber ein selbstbewusstes und kreatives Volk, und in dem vorurteilsfreien Nachdenken über Sexualität spiegelte sich dies wider. »Es ist kein Zufall, dass die Hochzeit der islamischen Kultur zugleich eine sexuelle Blütezeit war«, sagt er. »Es ist eine Synthese aller Gebiete. Die Rehabilitierung der Sexualität ist die Rehabilitierung der Wissenschaft innerhalb der Rehabilitierung des Islam.« Heute dagegen gibt es eine tiefverwurzelte Tendenz, den Zusammenhang zwischen diesen Elementen zu bestreiten, und viele Menschen, die sich die Geschichte der arabischen Welt nach eigenem Gutdünken zusammenstückeln wollen, indem sie sich das herauspicken, was heute als die respektable Seite des Goldenen Zeitalters Arabiens gilt – Wissenschaft und Technik zum Beispiel –, und den Rest beiseitelassen. Bouhdiba dagegen ist der Meinung, diese Facetten ließen sich nicht voneinander trennen.
Man liest leicht zu viel in die arabische erotische Literatur hinein. Spiegelte ihre Offenheit tatsächlich die der Gesellschaft insgesamt wider oder bloß die Anschauungen der sexuell verfeinerten Elite? Schließlich wurden viele der berühmtesten Bücher der arabischen Liebeslehre für Herrscher geschrieben. Bouhdiba ist überzeugt davon, dass diese Werke nicht bloß Esoterika für die Elite waren, sondern etwas Allgemeines über den Zeitgeist aussagen. Um diesen Punkt zu verdeutlichen, führt er die Religion ins Feld: »Diese Eliten wurden von den Massen nie angeprangert; ihre Gesellschaften akzeptierten sie mehr oder weniger, vielleicht nicht aktiv, aber jedenfalls passiv. Es ist ein wenig wie der Sufismus, der eine Elite repräsentierte, aber schließlich anerkannt wurde. Manchmal wurden sie als Häretiker behandelt, manchmal wurden sie ausgepeitscht, aber letztlich standen sie für eine tiefe Strömung in der Gesellschaft.« Bouhdiba hat keine Zweifel daran, dass diese Werke in weiten Kreisen gelesen wurden: »Diese Bücher wurden für Herrscher geschrieben, aber sie zirkulierten im einfachen Volk.«
Am Ende des 19. Jahrhunderts jedoch war dieses freimütige und oftmals lobpreisende Schreiben über Sexualität dann so gut wie versiegt. Bouhdiba meint, dieser sexuelle Winterschlaf sei nur ein Element eines umfassenderen geistigen Niedergangs, der während der Kolonialzeit an Dynamik gewann. »Seit Napoleon erleben wir eine negative Entwicklung muslimischer Gesellschaften. Insbesondere in den letzten fünfzig Jahren, seit dem Zusammenbruch des Nasserismus und Nationalismus [im Anschluss an die Niederlage der arabischen Streitkräfte im ›Sechstagekrieg‹ von 1967 gegen Israel], sind unsere Gesellschaften in der Defensive, in einem Prozess der Selbstabschottung«, bemerkt er, insbesondere sei alles, was das Leben in der Familie und Frauen betreffe, streng tabuisiert worden.
Es gibt in Ägypten einen Ausdruck, der diesen Zustand sehr gut auf den Punkt bringt: ‘uqdit al-khawaga – »Ausländerkomplex«. Es ist ein Gefühl der Unterlegenheit gegenüber dem Westen, und sein Ursprung liegt im Jahr 1798, als Napoleon in Ägypten einmarschierte. In einem Feldzug, der an den Irakkrieg von 2003 erinnert, kam Napoleon mit dem Versprechen nach Ägypten, ein Volk zu befreien, das von einer grausamen und unberechenbaren Militärdiktatur unterdrückt wurde – in diesem Fall einer importierten Kaste von Militärsklaven, den sogenannten Mamluken, die schließlich die Macht in einem Großteil des Abbasiden-Reichs an sich rissen. Die Mamluken waren sich ihres Sieges über die Franzosen völlig sicher: Schließlich erinnerten sie sich daran, dass die letzte Begegnung mit Europa – die Kreuzzüge – für die Gäste kein gutes Ende genommen hatte. Doch diesmal bereiteten die Franzosen mit ihrer überlegenen Waffentechnik und ihrer auf massive Demoralisierung abzielenden »Schocktaktik« den Mamluken eine vernichtende Niederlage. Obgleich sich das Blatt für Napoleon dann sehr schnell wieder wendete, markierte dieser Sieg auf arabischem Boden eine neue Phase der Konfrontation, in der die arabische Welt schnell gegenüber dem Westen an Einfluss verlor. Die in Wellen verlaufende koloniale Expansion der europäischen Mächte begann mit der Invasion Algeriens durch Frankreich im Jahr 1830 und schwappte 1882 mit der britischen Okkupation über Ägypten hinweg.
Als arabische Denker im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert nach den Gründen für den Aufstieg Europas suchten, fragten sie sich, ob ihre Neigungen – insbesondere Homosexualität – etwas mit ihrem Niedergang zu tun hätten. Die Abbasiden-Dynastie, die einst die islamische Welt beherrschte, begann um das 10. Jahrhundert herum an Einfluss zu verlieren; während einige Autoren in der sexuellen Freizügigkeit unter den Abbasiden ein Symptom von Dekadenz und Niedergang sahen, erkannten andere darin eine direkte Ursache dafür.29 Als arabische Intellektuelle sich mehr und mehr durch fremde Augen betrachteten, fingen sie nach Meinung einiger Historiker auch damit an, die eigene Sexualgeschichte nach einer europäischen Vorlage umzuschreiben.30
Mit dem Aufkommen des islamischen Fundamentalismus beschleunigte sich dieses Umschreiben. Die Gründung der Muslimbruderschaft im Ägypten der 1920er Jahre war weitgehend eine Reaktion auf die koloniale Besatzung, und auch ihre Vertreter sahen in der sexuellen Sittenlosigkeit eine der Ursachen für den Niedergang des Landes. Hassan al-Banna, ihr Gründer, gelangte zu der Überzeugung, Ägypten habe seine Unabhängigkeit verloren, weil die Menschen vom rechten islamischen Weg abgekommen seien, und dem könne man nur durch die Rückkehr zur Scharia, zum islamischen Gesetz, abhelfen. Der Islamismus in seinen vielen modernen Schattierungen nimmt eine harte Haltung gegenüber der Sexualität ein, die er oftmals in bewusster Opposition zu westlichen Sichtweisen konstruiert. Der Mann, der diese Ansichten maßgeblich prägte, Sayyid Qutb, war ein Lehrer und Autor, der sich in den 1950er Jahren den Muslimbrüdern anschloss. Er wurde rasch zu einer bekannten öffentlichen Figur, bevor er zusammen mit den Muslimbrüdern während der Regierungszeit von Staatspräsident Gamal Abdel Nasser in Ungnade fiel; Qutb wurde inhaftiert und schließlich 1966 gehängt.
Im Gefängnis schrieb Qutb eine Reihe von Büchern, die wichtige Inspirationsquellen für einige der Ableger des glühenden islamischen Fundamentalismus wurden, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden. Seine Ideen sind bekannter als sein Name. Vielleicht haben Sie noch nie von Qutb gehört, aber dank al-Qaida ist Ihnen vermutlich sein Denken vertraut; Ayman al-Zawahiri, die graue Eminenz der Organisation und der Nachfolger von Osama Bin Laden, wurde stark von Qutbs Werk beeinflusst.
Obwohl Qutb seine Ansichten in Nassers Gefängnissen ausarbeitete, wurden sie maßgeblich durch eine Reise geprägt, die ihn in den späten 1940er Jahren in die Vereinigten Staaten führte. Als entschiedener Gegner der britischen Herrschaft über Ägypten stand Qutb, schon lange bevor er seinen Fuß auf westlichen Boden setzte, den Europäern und ihrem Einfluss auf die Kultur und die Werte Ägyptens sehr ablehnend gegenüber. Sein Besuch in Amerika bot ihm die Gelegenheit, sich aus direkter eigener Anschauung ein Bild von der westlichen Gesellschaft zu machen, und je mehr er sah, desto mehr fühlte er sich in seinen Überzeugungen bestätigt. »Amerika ist nichts Besonderes, sondern nur ein Ast des satanischen Baums und ein Zweig der verdorbenen Pflanze«, schrieb er 1949 an Freunde in Ägypten.31
In Briefen, Aufsätzen und Büchern geißelte Qutb mit glühender Schärfe die »Primitivität« Amerikas, wie er es nannte – eine verkommene, brutale Gesellschaft ohne spirituelles oder moralisches Fundament, die besessen war von materiellem Gewinnstreben. Qutb war entsetzt über die sexuelle Freizügigkeit, die »Zuchtlosigkeit« der Amerikaner, der er bereits auf der Überfahrt begegnete. Auf dem Weg nach New York tauchte an seiner Kabinentür eine hübsche, leichtbekleidete und stark angetrunkene Dame auf, die nach einer Übernachtungsmöglichkeit suchte. »Ihre körperlichen Vorzüge waren sehr verlockend«, schrieb Qutb, da ihre Einladung jedoch mit seinem frisch erwachten islamischen Glaubenseifer kollidierte, wies er sie ab.32
Solche sexuellen Abenteuer gingen an Land weiter. Selbst in Greeley, Colorado, der Kleinstadt, die er besuchte, waren junge Frauen sexuell sehr aufgeschlossen, wie ihm eine College-Studentin verriet: »Die Frage der Sexualität ist keine Frage der Moral, es ist ausschließlich eine biologische Frage. Und wenn wir sie unter diesem Aspekt betrachten, stellen wir fest, dass man die Sexualität, wenn man Wörter wie Sünde und Tugend, gut und schlecht für sie verwendet, falsch einordnet; und wenn man dies tut, dann wirkt das auf uns sehr komisch.«33 Qutb seinerseits war eher bestürzt als amüsiert. Auf Schritt und Tritt sah er zur Schau gestellte Körper, Männer, die mit ihren Muskeln protzten, und Frauen, die offen ihre Reize darboten. Laut Qutb setzten sogar die Kirchen auf Sex. Die Priester seien ganz versessen auf den regelmäßigen Kirchgang hübscher Mädchen, weil diese Jungs anlockten und so dafür sorgten, dass sich die Bänke füllten. Nach dem Gottesdienst würden oft Kirchentänze aufgeführt, bei denen »Arme sich in Arme einhaken, Lippen Lippen berühren, Brüste Brüste, und eine buhlerische Atmosphäre herrscht«.34
Diese Aktivitäten überschritten nicht nur die Grenze des halal (dessen, was im Islam als erlaubt angesehen wird), die Einstellung der Amerikaner zur Sexualität raubte dieser nach Qutbs Überzeugung auch ihre moralischen und spirituellen Dimensionen und reduzierte sie auf einen körperlichen Vorgang des Lustgewinns, wie es in dieser hypermaterialistischen Gesellschaft mit allem geschah. Die Folge dieses ausschweifenden Lebenswandels, so sagte er vorher, sei die »vollständige Auslöschung« Amerikas: Familien, die durch Scheidung zerrissen würden, die junge Generation, die durch Drogen, Alkohol und sexuelle »Abweichung« verdorben würde, gefolgt von einem massiven Bevölkerungsrückgang, sobald die Fortpflanzung zum Erliegen komme. »Ich habe Filme gesehen, die von dem Leben im Dschungel handeln … Männer bespringen Frauen, und Frauen springen auf Männer, Paar für Paar und Gruppe für Gruppe … dieser große sexsüchtige Wald, diese fiebrigen Körper und gierigen Blicke, tierische Lust«, schrieb er. »Hier in Amerika ist es genau wie im Dschungel, nur dass der Dschungel nicht voller Fabriken, Labore, Schulen und Bars ist.«35
Zurück zu den Wurzeln
Qutbs Darstellung des Westens als einer Jauchegrube des sexuellen Chaos und moralischen Zerfalls – eine Art von umgekehrtem Orientalismus – klingt noch heute in der Rhetorik vieler islamischer Konservativer nach. Nur eine Wiedergeburt der muslimischen Gesellschaften, so Qutb, könne sie gegen eine Ansteckung schützen, und hierzu bedürfe es einer Rückbesinnung auf die Lehren der salaf – das heißt der Gründungsväter des Islam – beziehungsweise einer Interpretation, die sich an der Zeit des Propheten orientiert.
Die Jahrzehnte währende Diktatur in Ägypten wirkte wahre Wunder, was die Stärkung dieser konservativen Strömung anlangt. Die Menschen wandten sich dem Islam und seinen sozialen und politischen Organisationen zu, nicht nur, um darin Trost angesichts des sich verschärfenden alltäglichen Überlebenskampfes zu finden oder um grundlegende Güter und Dienstleistungen zu erhalten, die der Staat nicht bereitstellte, sondern auch als eine Form des Protests und eine Gelegenheit zu bürgerschaftlichem Engagement in einem Land, dessen politisches Regime wenig Raum für beides ließ. Die Folge davon sind die überwältigenden Siege islamistischer Kandidaten bei etlichen der ersten Wahlen nach den Volkserhebungen, von Parlamenten bis zu Berufsverbänden, in den Ländern, die direkt Revolten erlebt haben – unter anderem Ägypten und Tunesien –, und denjenigen, die indirekt betroffen waren, darunter Marokko und Kuwait.
Es ist eine Wissenschaft für sich, den islamischen Konservatismus in seinen vielfältigen Erscheinungsformen verstehen zu wollen. Aber vor Ort, im Ägypten nach Mubarak, zeichnet er sich vor allem durch Stärke und Schnelligkeit aus. Die sichtbarste Manifestation ist die besonders starke, ultraschnelle Salafisten-Bewegung, die in den letzten Jahrzehnten in Ägypten immer mehr Zulauf erhielt, sich offiziell aber erst nach der Revolution von 2011 mit wehenden Bärten und Gesichtsschleiern »outete«. Diese Männer und Frauen wollen Ägypten schnellstmöglich gemäß ihrer Interpretation des Islam umgestalten, wobei sie stark von religiösen Strömungen in den Golfstaaten beeinflusst werden. Und das beinhaltet auch eine Neufassung von Gesetzen gemäß einer strengen Auslegung der Scharia.





























