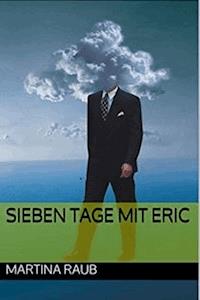
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein Mann wird nackt, blutend und ohne Erinnerung auf einem Zebrastreifen in Berlin aufgefunden. Während er in winzigen Schritten versucht, wieder an seine Vergangenheit anzuknüpfen, wollen die Menschen aus seinem Umfeld ihn mit Hochgeschwindigkeit in sein altes Leben zurückbringen. Je mehr er die ihm völlig fremde Welt erkundet, desto tiefer wird er eingesogen in einen Wirbel von Macht, Geld, Emotionen und Gewalt. Als sich die Situation zuspitzt, steht er vor der Entscheidung, ob er in diese Existenz zurückkehren kann und möchte. Schließlich geht es um nicht weniger als sein Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martina Raub
Sieben Tage mit Eric
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Tag 1 – Samstag
Tag 2 – Sonntag
Tag 3 – Montag
Tag 4 – Dienstag
Tag 5 – Mittwoch
Tag 6 – Donnerstag
Tag 7 – Freitag
Zwei Monate später
Impressum neobooks
Tag 1 – Samstag
Das erste, was ich realisierte, waren die Blicke der Menschen, die mich anstarrten. Ich war … erschreckt. Bis ins Mark. Bestimmt 10 Augenpaare lagen auf mir und ich konnte mir das nicht erklären. Nicht, wer sie waren, nicht ihr Erstaunen, ihre Abscheu. Und auch nicht, wo ich mich befand. Aber je länger mein Bewusstsein – das vorher offensichtlich abgeschaltet war – arbeitete, desto schneller wurden meine Gedanken und mein Verstehen. Ich merkte aufgrund des Winkels zu den Fremden, dass ich seitlich zusammengedreht auf dem Boden lag. Er war hart und kalt und schnitt meine Haut auf. Das nächste, was auf mich eindrang, war der Lärm von Autoverkehr. Sehr laut, so sehr, dass es wehtat. Ich wollte mir die Hände auf die Ohren pressen, doch es ging nicht. Ich konnte die Arme zu meinem Gesicht heben, aber die Hände waren wie aneinandergeklebt. Ich senkte meinen Blick und erkannte etwas Silbernes. Um meine Handgelenke, verbunden mit einer kleinen Kette.
Handschellen!
Es hatte einige Augenblicke gedauert, bis ich mich an dieses Worte erinnert hatte. Es war mir nicht völlig unbekannt, aber es schien nicht zu meinem üblichen Wortschatz zu gehören. Und es löste Emotionen in mir aus – keine positiven. Also schienen sie nicht zu einer speziellen Liebeslust zu gehören. Vielmehr empfand ich plötzlich eine sehr erhöhte Wachsamkeit. Ich konnte das Adrenalin durch meinen Körper pumpen fühlen. Meine Sinne wurden schärfer. Leider! Denn als ich die Augen gesenkt hielt und die Handschellen um meine Handgelenke noch immer betrachtete, weitete sich auch mein Blickfeld und ein weiterer Teil meines Körpers kam in Sicht. Ich war nackt! Eine neuerliche Welle von Entsetzen durchflutete mich und ich versuchte, mich aufzusetzen, um die Blöße meines Schambereiches wenigstens durch angezogene Beine zu bedecken. Das war gar nicht so einfach mit gefesselten Händen, doch nach dem zweiten Versuch hatte ich es geschafft.
Da hockte ich nun auf dem Boden, einem Zebrastreifen, wie ich inzwischen bemerkt hatte. Mit bloßen Hinterteil auf der harten Straße und den Oberkörper fest an meine aufgestellten Beine gepresst. Weil ich fror. Weil mir schlecht war vor Schmerzen. Und weil ich zunehmend fühlte, dass sich eine Welle von Angst und Gewaltbereitschaft in mir aufstaute. Mir war klar, dass ich in diesem Zustand nichts mitten auf der Straße verloren hatte. Doch ich konnte nicht aufstehen. Nicht so nackt, wie ich war. Und vor allem nicht verkrampft vor Schmerzen, die immer schlimmer wurden. Ein weiterer prüfender Blick über die Stellen meines Körpers, die ich sehen konnte, ohne mich aus meiner sicheren Haltung zu lösen, zeigte mir, dass ich geblutet haben musste. Schorfige Krusten klebten hier und dort, meine Muskeln brannten. Am schlimmsten fühlte sich mein Rücken an, aber was da los war, konnte ich natürlich nicht sagen.
Genauso wenig, wie ich wusste, wie ich auf die Straße gekommen war – in diesem Zustand. Wo ich herkam und was geschehen war.
Oder wer ich war.
Diese Erkenntnis traf mich wie ein Schlag. Wenn die letzten Minuten auch entsetzlich genug gewesen waren, war das doch schlimmer als alles andere. Schmerzen, Kälte, auch Scham waren vergessen. Genauso wie ich mich selbst vergessen hatte.
Ich blickte auf, sah die Menschen, die mich anstarrten, sah auch, dass sie die Lippen bewegten, mich ansprachen, doch nichts davon drang bis zu meinem Bewusstsein durch. Der Schreck, nicht zu wissen, wer ich war, blendete alles andere aus. Ich versenkte mich ganz in meinen Geist, in mein Ich, doch da war nichts. Nur Schwärze. Kein Name, kein Erinnern, keine Vergangenheit. Ich wusste nur, was ich sah und wiederkennen konnte. Dass Menschen mich umringten, dass ich mich in einer unbekannten Stadt befand. Dass ich ein nackter, blutüberströmter Mann auf einem Zebrastreifen war. Das reichte nicht aus für ein Leben! Beinahe hätte ich aufgelacht, so abstrus kam es mir vor, dass ich in meiner Situation zu philosophieren begann. Aber nur beinahe. Dafür war meine Lage doch zu ernst.
Und sie wurde noch dramatischer. Durch das Rauschen meiner Ohren drang ein Geräusch, das penetrant meine Aufmerksamkeit einforderte. Ein Einsatzwagen näherte sich. Polizei oder Rettungsdienst. Beide Sirenen heulten meiner Ansicht nach so gleich, dass ich sie nicht zu unterscheiden vermochte. Doch es war auch einerlei. Ich wollte weder von dem einen noch dem anderen Team aufgegriffen werden. Warum nicht, war mir nicht klar. Vielleicht, weil sie Fragen stellen würden, die ich mit Sicherheit nicht beantworten konnte. Oder weil es Fragen sein würden, die ich mir selbst nicht stellen wollte.
Durch die Menschenmenge hindurch drängten sich zwei Personen, ein dicklicher Mann und eine etwas kürzere schlanke Frau. Sie trugen dunkelblaue Uniformen und als sie näher kamen, konnte ich den Schriftzug „Polizei“ lesen. Gut, dann also die Polizei. Ich hatte ein wenig gehofft, dass es zumindest Sanitäter sein würden, die den Einsatzort zuerst erreichten, aber diese Hoffnung war gestorben.
Beide bauten sich vor mir auf und blickten mich für zwei Sekunden sprachlos an. Dann beugte sich der Mann zu mir herunter und fasste mich an die Schulter. Im Hintergrund konnte ich sehen, dass der Mund der Polizistin zuckte. Sie schien zwischen Lachen und Erstaunen zu schwanken.
„Na, mein Freund?“ Die Stimme des Polizisten war tief und beruhigend. Sie klang vertrauenserweckend. „Was ist denn passiert?“ Sein Blick wanderte an mir hoch und wieder herunter. „Ärger mit der Freundin?“
Ich schüttelte den Kopf. Das tat weh und hatte zur Folge, dass alles vor meinen Augen verschwamm. Als der Schwindel vergangen war, rang ich mich dazu durch, es mit einer Antwort zu versuchen.
„Ich weiß es nicht.“ Meine Stimme war rau, jedes Wort kratzte. Doch es lag Kraft in meinen Worten. Bestimmtheit. Vor allem kein Jammern.
Der Polizist drehte sein Gesicht von mir fort, wechselte wohl einen Blick mit seiner Kollegin, die aus dem Streifenwagen eine Decke geholt hatte, und schaute dann mich wieder an.
„Bisschen zu tief ins Glas geschaut?“
Die Polizistin legte mir die Decke um, während ihr Kollege sich zu mir heruntergebeugt hatte und an den Handschellen hantierte. Ob Streifenwagenbesatzungen immer einen Generalschlüssel bei sich führten, wusste ich nicht, zumindest dauerte es nicht sehr lange, bis sich mit einem befreienden Klicken der Stahl um meine Handgelenke endlich öffnete.
Währenddessen redete der Mann weiter auf mich ein, als sei ich ein einfältiges Kind, das Trost brauchte: „Oder waren es Drogen? Diese Zauberpilze haben es ordentlich in sich. Und crystal meth ist auch nicht ohne. Gar keine Erinnerung?“
„Nein.“ Einsilbig zog ich mir die Decke weiter um den Körper und versuchte dann aufzustehen. Mit kräftigen Armen half mir der Polizist auf und ich spürte, dass auch die etwas sanfteren Hände seiner Kollegin nach mir gegriffen hatten.
„Na, dann kommen Sie doch erst einmal mit auf die Wache. Da haben wir auch Kleidung für Sie.“ Und etwas leiser, als würde ich es nicht hören können, murmelte er: „Und eine schöne Ausnüchterungszelle. Die könntest du nötig haben.“
Eine kurze Fahrt später kamen wir vor einem Polizeirevier an, das in einem klassizistischen Bau untergebracht war. Es stürzte mich in eine ungeahnte Verzweiflung, dieses Gebäude zu sehen und epochal einordnen zu können. Weil mir dadurch umso intensiver bewusst wurde, dass ich während der Tour durch die Stadt nicht einen einzigen Ort wiedererkannt hatte. Ich musste mich doch durch diese Straßen bewegt haben, um auf dem Fußgängerüberweg zu enden? Warum kannte ich die Stadt dann nicht?!
Der Polizist hielt mich am Ellbogen fest, als wir die meiner Ansicht nach unendlich vielen Stufen, die sich bis zum Eingang erstreckten, hinaufstiegen. Glaubte er wirklich, dass ich fliehen wollte? Alles in mir sehnte sich danach fortzurennen. Aber mein Verstand gebot mir, dies nicht zu tun. Wenn ich wissen wollte, wer ich war, war die Polizei eine der ersten Adressen, die mir helfen konnte. Außerdem wusste ich nicht, wohin mit mir. Sachlich betrachtet sollte ich mitgehen. Doch innerlich sträubte sich alles in mir dagegen.
Sie brachten mich in eine Zelle, die nur durch deckenhohe Gitter zum Gang hin abgetrennt war. Privatsphäre gab es dort nicht. Weder von außen, denn jeder, der daran vorbei ging, konnte alles sehen. Noch von innen: Da warteten schon die übrigen Problemfälle des heutigen Tages auf mich. Jemand hatte mir eine Jogginghose und ein Sweatshirt in die Hand gedrückt und klobige Lederschuhe, die vielleicht ein Arbeiter auf einer Baustelle getragen hatte. Mit der einen Hand hielt ich weiter die Decke um meinen Körper geschlungen, mir der anderen drückte ich mir die Kleidung gegen die Brust.
„Ziehen Sie sich erst mal an. Wir kümmern uns gleich um Sie. Wenn der Arzt da ist.“
Mit diesen Worten schlug die Gittertüre hinter mir zu.
Ich dachte nicht lange darüber nach, wie ich mich unter der Decke heimlich anziehen könnte, damit die übrigen Insassen meine Blöße nicht sahen. Unnötig. Die wussten doch sowieso, wieso ich in eine Decke gewickelt war. Ein Blick über die Schulter bestätigte mir, was ich mit einer mir noch nicht bekannten Ecke des Bewusstseins begriffen hatte: Ich würde hier keine fünf Minuten ungeschoren bleiben, wenn ich mich zimperlich verhielt. Oder unvorsichtig wäre. Also suchte ich mir einen Platz an der Wand, drehte mich mit dem Gesicht zum Flur und behielt meine „Kollegen“ im Blick.
Einer der Scherzbolde musste natürlich rufen, als ich die Decke zu Boden fallen ließ: „Ey, Mann, pack mal dein Ding da weg!“
Aber das hatte ich ja sowieso vor. Möglichst gelassen faltete ich die geliehene Kleidung auseinander und schlüpfte hinein. Sie passte und war warm. Das krampfhafte Zittern meiner Muskeln hörte auf, als mein Körper langsam auftaute. Das war mehr, als ich erhofft hatte, während ich auf dem Zebrastreifen gehockt hatte.
Ich ließ mich auf der Decke auf dem Boden nieder, denn es gab keine Bank, keinen Stuhl, auf dem ich sitzen konnte. Es störte mich nicht. Sehr analytisch, beinahe wie von außen, stellte ich fest, dass ich auch in einer derart verzweifelten Lage ruhig und gefasst bleiben konnte.
Dann machte ich eine mentale Bestandsaufnahme: Ich hatte keine Erinnerung an mich, mein Leben, die vergangene Zeit vor dem Zebrastreifen oder an das Ereignis, das mich dort hingebracht hatte. Aber seit dem Augenblick meines „Aufwachens“ hatte ich alle Geschehnisse um mich herum ununterbrochen registriert, konnte mich an jede Minute der Fahrt zur Wache erinnern und hätte sogar den Weg zurück fehlerfrei finden können. Ich konnte Alltagsgegenstände beim Namen nennen und war mir ihrer Verwendung bewusst. Ebenso hätte ich die Gesichter der Personen, die mich beim Aufwachen umringt hatten, bis ins Details beschreiben können, oder ich hätte mich daran versuchen können, durch ihr pures Auftreten die Charaktere meiner Mitgefangenen einzustufen. Dies alles ließ darauf schließen, dass ich nicht an einer Geisteskrankheit litt. Ich hatte im Moment wohl auch keine Bewusstseinsstörung. Nachwirkungen eines extremen Alkoholexzesses spürte ich nicht, keinen Kater, keinen Nachdurst. Ich glaubte auch nicht, dass ich durch Alkohol einem Totalausfall zum Opfer fallen würde. Noch kannte ich meinen Körper ja nicht, aber es fühlte sich einfach nicht richtig an. Drogen? Ich schob beide Ärmel hoch und untersuchte meine Arme auf Einstiche. Nichts. Meine Nase fühlte sich auch okay an. Die Nasenscheidewand hatte ich mir zumindest nicht weggekokst. Das war doch schon einmal verheißungsvoll. Half mir aber auch nicht weiter bei dem Versuch herauszufinden, was geschehen war.
Sehr viel mehr Zeit hatte ich aber auch nicht, um zu versuchen, mich wiederzufinden, denn da trat die kleine Polizistin schon an das Gitter heran.
„Der Bereitschaftsarzt ist da. Er will mal einen Blick auf Sie werfen.“
Mit den Worten winkte sie mich zur Tür und schloss die Massenzelle auf. Schnell trat ich neben sie auf den Gang, sah zu, wie routiniert sie die Türe wieder zuwarf und abschloss, und ging dann hinter ihr her den Flur hinab, um mehrere Ecken herum, bis wir vor einem Raum mit einem roten Kreuz standen. Das globale Zeichen für erste Hilfe. Das ließ mich darüber nachgrübeln, in welcher Sprache wir uns unterhalten hatten. Das hätte mir doch schon einmal einen Anhaltspunkt über meinen Aufenthaltsort gegeben. Die wenigen Worte, die ich gesprochen hatte, waren mir leicht über die Zunge gegangen und ich hatte die Polizisten einwandfrei verstanden. Mit ein wenig Anstrengung kam ich zu der Überzeugung, dass wir Deutsch gesprochen hatten und wir uns folglich in Deutschland befinden mussten. Vielleicht.
Die Polizistin bedeutete mir, in den Raum zu gehen, und schloss die Türe dann hinter mir.
Vor mir breitete sich ein kleines Untersuchungszimmer aus, das allein schon durch die helle Wandfarbe ein wenig freundlicher wirkte als der Rest der heruntergekommenen Polizeiwache. Untersuchungsliege, Schreibtisch mit Notebook, ein gut gesichertes Medizinschränkchen. Die ganze Ausstattung. Vor der Pritsche auf einem runden Hocker mit Rollen saß ein ältlicher hagerer Mann, der mich erst eingehend musterte und dann einladend mit der Hand auf die Pritsche klopfte.
„Dann kommen Sie mal her. Die Kollegen haben gesagt, man hätte Sie verletzt auf der Straße aufgefunden. Eigentlich hätten die Sie sofort ins Krankenhaus bringen sollen. Naja.“
Schweigend trat ich näher, ging an ihm vorbei und ließ mich auf der Kante der Liege nieder.
„Wo sind Sie denn verletzt?“, fragte er weiter und als ich nicht reagierte: „Verstehen Sie, was ich sage?“
„Ja, das tue ich.“ Meine Stimme war noch immer rau und das Sprechen schmerzte.
Das musste der Arzt auch gemerkt haben, denn er bedeutete mir, den Mund zu öffnen, und schaute mit einem Leuchtspiegel hinein.
„Naja, ein bisschen wund, aber nichts Schlimmes. Sie haben vielleicht viel geschrien? Bei einem Fußballturnier?“
„Ich weiß es nicht“, rang ich mich endlich durch zu sagen.
Der Mediziner horchte auf. Wenn ich ihm anfangs nicht geheuer gewesen war, so weckte ich nun sein Interesse.
„Sie wissen es nicht?“ Mein Kopfschütteln war minimal. „Wissen Sie denn, wie Sie auf die Straße gekommen sind?“ Diesmal bewegte sich mein Kopf beinahe noch weniger.
Er begann, meinen Schädel abzutasten und mir in die Augen zu leuchten. Es hatte mich große Mühe gekostet zu begreifen, dass ich so gut wie gar nichts mehr wusste. Es auszusprechen bereitete mir beinahe körperliche Schmerzen.
„Um ehrlich zu sein, kann ich mich an gar nichts erinnern.“
Seine tastenden Hände verharrten augenblicklich, dann rollte der Arzt auf seinem Hocker einen halben Meter nach hinten und schaute mich erstaunt, aber auch misstrauisch an.
„Was soll das bedeuten? Die Polizisten haben nichts davon gesagt. Man hat mich geholt, weil ich einen alkoholisiert aufgefunden Mann begutachten sollte, ob er haftfähig ist.“
„Wirke ich auf Sie alkoholisiert? Oder high?“ Meine Coolness war nicht vorgespielt. Ich war tatsächlich so ruhig.
„Eigentlich nicht.“ Mit verschränkten Armen blickte er mich weiterhin taxierend an. Als ob ich ihm etwas vormachen würde, um hier herauszukommen. „Welcher Tag ist heute?“
Ich dachte nach, ob ich irgendwo einen Kalender gesehen hatte, eine Uhr. Irgendetwas. Mit geschürzten Lippen schüttelte ich den Kopf.
„Das Jahr?“
Noch immer schüttelte ich den Kopf.
„Wissen Sie, wie unsere Bundeskanzlerin heißt“
Ich fiel aus allen Wolken: „Eine Frau ist Regierungschef? Echt?“
Der Arzt schmunzelte vor sich hin, wurde aber sofort wieder ernst.
„Was ist mit Ihrem eigenen Namen?“ Das war die Schlüsselfrage.
„Nein.“ Das leicht enttäuschte Seufzen unter diesem kurzen Wort konnte er nicht überhört haben. „Gar nichts.“
„Was ist das erste, woran Sie sich erinnern?“
„Dass ich auf einem Zebrastreifen aufgewacht bin.“
„Geht Ihnen irgendetwas Besonderes durch den Kopf? Ein Wort, das sich ständig wiederholt oder so etwas? Hat irgendetwas, was Sie hier sehen oder hören, eine herausragende Bedeutung?“
In der Tat hatte ich die ganze einen Satz auf der Zunge liegen, der sich wie ein Karussell in meinen Gedanken drehte: „Ein Weiser prüft und achtet nicht, was der gemeine Pöbel spricht.“
Der alte Arzt schüttelte den Kopf und quirlte sich mit dem Finger im Ohr: „Wie war das?!“
Ich wiederholte: „Ein Weiser prüft und achtet nicht, was der gemeine Pöbel spricht. Und wissen Sie was: Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.“
Der Mediziner schüttelte wieder nur stumm den Kopf und stand auf: „Ziehen Sie sich bitte aus. Komplett. Ich möchte Sie vollständig auf Wunden untersuchen.“
Die Jogginghose flatterte sowieso viel zu weit um mich herum und fiel quasi von selbst zu Boden, das Sweatshirt war schon deutlich enger und spannte um meinen Brustkorb, aber auch das Shirt landete schnell auf der Liege. Der Mediziner hatte inzwischen ein Diktiergerät zur Hand genommen, schaltete es ein und ging um mich herum. Als er hinter meinem Rücken wieder auftauchte, glaubte ich, dass sein Gesicht etwas fahler geworden war.
„Der Patient erklärt, sich an nichts erinnern zu können. Es folgt eine körperliche Untersuchung.“ Er griff mit einer Hand zu meinem Arm. „An beiden Handgelenken sind frische Schürfwunden zu erkennen. Der Patient muss längere Zeit gefesselt gewesen zu sein und sich dagegen gewehrt haben.“
„Handschellen“, nickte ich. Ich konnte noch immer den Stahl auf der Haut spüren.
„Handschellen also.“ Er beschrieb weiter, was er sah: „Über den muskulär deutlich definierten Oberkörper ziehen sich sowohl alte Narben als auch frische Wunden. Sowohl alte als auch neue Wunden scheinen von Messern, aber auch von Schlaginstrumenten zu stammen. Es sind Schnitte, Schürf- und Platzwunden zu erkennen. Auf Höhe der dritten Rippe rechts ist eine Narbe wie von einer Schussverletzung zu sehen. Der Genitalbereich ist unverletzt. Am rechten Fuß fehlte der fünfte Zeh. Das Gewebe ist gut verheilt. Die Verletzung ist ebenfalls schon älter.“
Mein Blick wanderte an mir herunter. Ich hatte nicht mehr alle Zehen? Das war mir neu und überraschte mich. Als ich nackt auf der Straße gesessen hatte, war mir das gar nicht aufgefallen.
Während ich noch nach unten starrte, diktierte er schon weiter, nahm noch weitere Blessuren auf. Das lief an mir vorüber. Ich wurde erst wieder aufmerksam, als er sagte: „Auf dem Rücken sind frische Wunden zu erkennen, die sich längs und quer über den gesamten Rücken ziehen. Der untersuchende Arzt kann auf Erfahrungen aus Afrika zurückgreifen und ist sich sicher, dass der Patient ausgepeitscht worden ist. Die Folter kann nicht länger als zwei Tage zurückliegen.“
Ich wirbelte herum und starrte den älteren Mann an.
„Folter?“ Als ich das Wort aussprach, begann mein Rücken zu brennen. Ich glaubte, die Striemen einzeln zu spüren, und begriff die Schmerzen, die ich beim Aufwachen gehabt hatte. Verstand den Blick der Umstehenden.
„Es tut mir leid, mein Junge. Ich war zehn Jahre lang für Ärzte ohne Grenzen da unten im Einsatz. Ich habe tausendfach gesehen, wie sich die Haut nach Peitschenhieben ablöst. Die charakteristischen Risse bis ins Fleisch. Ich wünschte, ich würde mich irren.“
Seine Hand ruhte warm und tröstend auf meiner nackten Schulter, aber es gab mir nicht das Gefühl von Beistand. Ganz im Gegenteil hätte ich seine Hand am Liebsten fortgewischt, seine Finger gegriffen und verdreht. Mir war klar, dass das ein Abwehrgriff war, wie man ihn bei asiatischen Kampfsportarten verwendete, doch wieso ich so etwas kannte, wusste ich nicht. Ich hätte diesen alten Mann – oder jeden, der mir unangenehm nahe kam – mit bloßen Händen auseinandernehmen können, ohne dass ich ahnte, welche Kampfkünste ich noch beherrschte oder woher diese nahezu unbändige Abwehrhaltung kam, die sich wie eine Rüstung um mich gelegt hatte.
Der Arzt bedeutete mir, dass ich mich wieder anziehen könne, während er auf den Gang hinaustrat. Ich nutzte die Gelegenheit, mich in dem mannshohen Spiegel, der auf der Türinnenseite klebte, zu betrachten. Vor mir stand ein durchtrainierter Mann von bestimmt 1,85 m Größe. Ich staunte über meine breiten Schultern, die starken Muskeln an den Oberarmen, den Beinen und über dem Brustkorb. Mein Gesicht war markant, mit einem präsenten Kinn – das jetzt von einem ungepflegten und wohl nicht beabsichtigten Mehr-Tage-Bart überzogen war; viele Frauen würden mich wohl trotzdem als gutaussehend bezeichnen. Obwohl ich dunkle Augen und etwas mehr als modisch lange dunkelbraune Haare hatte, war es ganz offensichtlich, dass ich eher nord- als südeuropäischer Herkunft war. Meine Haut war von einer gesunden frischen Farbe, die darauf schließen ließ, dass ich oft genug an der frischen Luft und Sonne war und wohl nicht als PC-Nerd in Kellerräumen hockte.
Die ganzen Wunden und Verletzungen auf meinem Körper waren erschreckend. Als sei ich mehr als nur hin und wieder in eine Straßenschlägerei geraten. Allein, dass ich nicht wusste, wie es dazu gekommen war. Am schlimmsten aber war der Blick in meine Augen. Das Ausbleiben des Erkennens, dass ich dort stand. Die Person, die mich aus dem Spiegel heraus anblickte, hatte nicht zu tun mit der Persönlichkeit, die ich in mir spürte.
Als der Arzt wieder die Türe öffnete, um einzutreten, konnte ich ganz kurz die Polizistin sehen, die den Gang hinunterging.
„Ich habe veranlasst, dass Sie als mutmaßliches Opfer eines Verbrechens geführt werden“, erklärte er mir, als er sich mit verschränkten Armen gegen den Türsturz lehnte.
„Woher wollen Sie wissen, dass ich Ihnen nichts vormache? Dass ich nicht jemanden getötet habe und jetzt eine besonders clevere Verteidigungsstrategie aufbaue?“
Der Mediziner schaute mich von oben nach unten an und fand dann meinen Blick. Er schüttelte den Kopf und schürzt die Lippen: „Menschenkenntnis, mein Junge. Ich mache das hier schon zu viele Jahre. Sie sind kein Mörder. Auch wenn Sie es nicht wissen, bin ich mir ziemlich sicher.“
„Aber ich fühle Gewaltbereitschaft in mir“, rutschte es mir heraus, bevor ich es verhindern konnte. Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt, mich einem Fremden derart zu öffnen. Aber er war der einzige Mensch in meiner Umgebung, zu dem ich wenigstens ein bisschen Vertrauen gefasst hatte.
„Das kann ich sogar ein wenig verstehen. Alles in Ihnen ist zurzeit in einer nahezu prähistorischen Angriffs- und Verteidigungshaltung. Je mehr Sie feststellen, dass Sie nicht mehr in Gefahr sind, wird das nachlassen.“ Er taxierte mich noch einmal durchdringend. „Ihnen ist klar, dass wir Sie in ein Krankenhaus bringen müssen?“
Darüber hatte ich auch schon nachgedacht, aber das fühlte sich für mich noch schlechter an als mein Aufenthalt bei der Polizei.
„Kein Hospital.“
„Sie müssen sich untersuchen lassen“, drang er auf mich ein. „Ein Hirnscan und eine toxikologische Untersuchung sind dabei nur zwei Wege, die dringend beschritten werden müssen. Eine Amnesie ist kein Scherz.“
Keines der medizinischen Wörter war mir fremd. Ich verstand genau, was er sagte und meinte. Und doch schüttelte ich noch immer den Kopf.
„Nein, kein Krankenhaus.“ Ich zögerte. „Ich habe doch keine Wunde am Kopf? Oder eine Gehirnerschütterung? Dann lassen Sie mich gehen.“
„Naja, wir werden sehen.“ Er stieß sich von der Wand ab. „Himmel, ich könnte der Streife in den Hintern treten, dass man Sie hier in den Knast gesperrt hat! Das war eine völlige Fehleinschätzung.“
„Lassen Sie gut sein. Ich will kein Krankenhaus und keinen Arzt. Ich will nur … ich brauche nur ein bisschen Ruhe. Um nachdenken zu können.“
Und genau das würde ich tun, sobald ich hier raus war. Mich hinsetzen und denken, bis ich wieder wusste, werde ich war.
„Jetzt kommen Sie erst mal mit nach vorne. Wir gehen die Vermisstenkartei durch. Vielleicht hat man Sie ja gemeldet?“
Mit einem schwachen Lächeln zog ich mir das Sweatshirt gerade und ging hinter dem ältlichen Mediziner her. Ein wenig hatte ich ihn ins Herz geschlossen. Der Mann machte auf mich den Eindruck, als versuchte er immer, die Welt wenigstens etwas besser zu machen. Einsatz in Afrika. Mitarbeit bei der Polizei. Das alles hinterließ ein gutes Gefühl in mir. Es ließ zaghafte Zuversicht in mir aufkommen. Vielleicht erinnerte er mich ja auch an einen Menschen aus meiner Vergangenheit, der gut zu mir gewesen war. Wer weiß?
Etwas verlegen bedeutete mir der Polizist, der mich von den Handschellen befreit hatte, auf der ihm gegenüber liegenden Seite eines alten und mit offensichtlichen Gebrauchsspuren überzogenen Schreibtischs Platz zu nehmen. Ich konnte über die Geräuschkulisse hinweg, die in dieser Polizeiwache herrschte, die Festplattenbewegung des PCs hören, der gerade aus dem Ruhezustand hochfuhr. Es klang altersschwach und unterstrich ein weiteres Mal, dass alles hier hinfällig bis schrottreif war. Mein Gott, mit solch einen Equipment sollte die Polizei für Recht und Ordnung sorgen?! Dass war in meinen Augen ein aussichtsloser Kampf und ich konnte es keinem Polizisten verübeln, dass er angesichts dieser Situation resignierte und Dienst nach Vorschrift machte. Woher sollten die denn die Energie oder Motivation nehmen, einen Tick mehr zu geben als gefordert?! Ich konnte es sogar verstehen, dass sie mich ohne weitere Fragen mit auf die Wache genommen hatten. Sie hatten wahrscheinlich schon so viel gesehen, dass sie nichts mehr überraschte. Und dem Geruch der Zelle und eigentlich der ganzen Wache nach zu urteilen, hatten sie hier vor allem mit Junkies und Säufern zu tun. Ich konnte Erbrochenes und Urin riechen. Hier hätte ich nicht einen Tag arbeiten können.
Obwohl tief in Gedanken versunken, hatte ich trotzdem bemerkt, dass der Polizist nun endlich das richtige Programm gestartet hatte.
„So, dann schauen wir doch mal.“ Mit dem Zwei-Finger-Suchsystem tippte er auf der Tastatur herum und murmelte dabei: „Geschlecht: männlich, Alter ca. 40 Jahre, Haare braun, Augen braun, Größe …“
Sein Gebrummel wurde leiser, als er weitere Merkmale eingab. Ich machte mir auch nicht die Mühe, ihn verstehen zu wollen – wie ich aussah, wusste ich inzwischen. Aber ich merkte auf, als er zu anderen Angaben kam: „Aktueller Aufenthaltsort: Berlin.“
Das war die erste Information, die für mich von Wert war. Bevor ich die Bedeutung des Ortes begreifen konnte, ging es schon weiter: „Aufgegriffen am: 23. August 2016, 16.30 Uhr.“ Es war also Sommer und es war Nachmittag – in Anbetracht der Zeit, die bisher vergangen war, wahrscheinlich schon früher Abend.
„Dann wollen wir doch mal sehen.“ Eindeutig final ließ er einen Finger auf die Entertaste fallen und starrte auf den Bildschirm – mich hatte er während der Datenaufnahme ja auch schon lang genug angeschaut.
„Himmel, Sie glauben ja gar nicht, wie viele Menschen in Deutschland verloren gehen und vermisst gemeldet werden. Allein hier in Berlin gibt es 17 Treffer auf Ihre Beschreibung. Sie können sich 17 Namen aussuchen.“ Er scrollte mit der Maus durch die Liste.
„Na vielen Dank. Ich hätte aber gerne meinen eigenen Namen zurück – und nicht irgendeinen.“
Im Hintergrund sah ich wieder die junge Polizistin. Sie schmunzelte bei meinen Worten. Ich hatte zwar nicht witzig sein wollen, aber ihr Lächeln gefiel mir.
Dann richtete sich meine Aufmerksamkeit wieder auf ihren Kollegen vor mir. Etwas in seinem Gesicht, vielmehr in seinem Blick, hatte sich verändert. Eine Mischung zeigte sich dort: Erfolgstriumph, Verwirrung und – zu meinem Erstaunen – eine gewisse respektvolle Unterwürfigkeit. Doch anstatt mir zu sagen, was auf seinem Bildschirm aufgetaucht war, das ihn so veränderte, drehte er sich von mir weg: „Andrea, schaust du mal bitte.“
Das war keine Frage gewesen. Jedes seiner Worte machte immer deutlicher, dass er ihr Vorgesetzter war.
Andrea machte ein paar schnelle Schritte zu seinem Schreibtisch und blickte über seine Schulter auf den Monitor.
„Meinst du, das ist er?“, fragte sie der Ranghöhere. Es musste eine Suchanzeige aufgetaucht sein, die sein Interesse geweckt hatte.
„Naja, wenn man sich den Bart wegdenkt. Und das Blut im Gesicht… Ja, Jürgen, ich denke, dass ist er.“
Offensichtlich hatten die sogar ein Bild eines Vermissten auf dem Bildschirm und verglichen mich mit ihm.
Jürgen machte sich nun doch die Mühe, mich in die Aktion miteinzubeziehen und drehte den Flatscreen zu mir um. Ein eingescanntes Foto, das wohl aus einer Tageszeitung abkopiert worden war, starrte mich an. Mein erster Impuls war zu sagen: „Nein, das bin doch nicht ich!“.
Aber zwei Aspekte ließen mich schweigen: Erstes wäre es schon ein Zeichen von Selbstüberschätzung gewesen, wenn ich – ein Mann ohne Gedächtnis und ohne Vergangenheit – so schnell hätte entscheiden wollen, ob ich das bin. Wie sollte ich wissen, ob der Gezeigte ich war – wenn ich doch gar nicht wusste, wer „ich“ überhaupt sein sollte. Zweitens konnte ich offensichtlich schon immer eine kühle Sachlichkeit mein Eigen nennen und so wollte ich erst nach einem zweiten und dritten prüfenden Blick entscheiden, ob die Fotografie Ähnlichkeiten mit mir hatte.
Diese Momente des Prüfens und Abwägens gönnte ich mich. Ich tastete mit den Augen über jedes identifizierende Merkmal, die Form der Ohren, die ich im Spiegel erblickt hatte, die Augenbrauen, die ich noch vor wenigen Minuten in dem kleinen Untersuchungszimmer angestarrt hatte. Die Knochenstruktur der Wagen auf dem Foto verlief so, wie sie sich in meinem Gesicht darstellte. Was aber das wichtigste war: Je länger ich auf das Gesicht auf dem Bildschirm anstarrte, desto mehr fühlte es sich an, als würden zwei zueinander gehörende Schichten übereinandergleiten und zu einer werden. Er war ich und ich war er. Ich konnte es nicht mit Sicherheit beweisen. Ich fühlte es einfach.
Obwohl wir so verschieden waren! Mehr als deutlich war mir bewusst, dass ich eigentlich wie ein Penner aussah, den man in frische Kleidung gesteckt hatte. Der Mann, der mir vom Monitor aus entgegenblickte, war das völlige Gegenteil: Die Haare offensichtlich frisch geschnitten, mit einem vollkommen glattrasierten Kinn, das noch nie einen 3-Tage-Bart gesehen hatte, die Haut war vor allem nicht blutverschmiert. Natürlich war es nur ein Porträtfoto, aber ich konnte erkennen, dass seine – oder meine – Kleidung edel und teuer war. Der Kragen eines gestärkten weißen Hemdes war zu erahnen, der Windsor-Knoten einer modisch-schlanken schwarzen Krawatte, zu alldem ein dunkles Jackett, das sich über so breite Schultern spannte, dass sie nicht vollständig auf dem Bild zu sehen waren. Die Schultern waren ein weiterer Aspekt, der mich sicher machte. Der Kerl, der mich so furchtbar siegesgewiss und selbstwusste anstarrte, war ich.
„Das bin ich“, presste ich hervor, in der Hoffnung, dass es sich besser anfühlte, wenn ich es aussprach. Aber es änderte nichts. Ich kam mir vor wie in einem bunten und wirbelnden Wirbelsturm, der mich hin- und herschleuderte. Es ist ein beunruhigendes Gefühl, sich selbst nur auf einer Fotografie wiederzufinden. Vor allem, wenn sich zwar die Gewissheit über die eigene Identität einstellte, ohne aber die Erinnerung an das eigene Leben zurückzubringen. Ich kannte immer noch nicht meinen Namen, meine Vergangenheit. Aber ich wusste, dass der Kerl auf dem Bild ich war. Und ich er.
Jürgen runzelte die Stirn: „Sind Sie sicher?“ Doch er war ein guter Polizist, mit Menschenkenntnis und dem Blick für wesentliche Dinge: „Wieso sind Sie so sicher?“
Sollte ich ihm etwas erzählen von meinem Gefühl? Meiner emotionalen Erkenntnis? Das wollte ich nicht zu Protokoll geben. Das war viel zu persönlich.
Stattdessen sagte ich: „Schauen Sie sich die Ohrformen an. Sie stimmen überein. Wie bei einem biometrischen Ausweis.“
„Wieso kennen Sie Ihre Ohrenform?“
„Weil ich mich doch eben im Spiegel gesehen habe. Im Arztzimmer.“
Jetzt schaltete sich Andrea an: „Sie wollen uns weiß machen, dass Sie nach nur einem Blick in den Spiegel ihre Ohrenform mit der auf dem Foto vergleichen können? Haben Sie ein fotografisches Gedächtnis, oder was?“
Ich wurde steif, entspannte mich dann aber wieder in der Sekunde, in der ich erkannte: Ja! Ich hatte ein fotografisches Gedächtnis. Ich memorierte jede Kleinigkeit zwischen hier und meinem unliebsamen Aufwachen auf der Straße. Das war toll! Umso erschreckender war, dass von meinem Leben nicht die kleine Erinnerung geblieben war.
Interessant fand ich aber – irgendwo auf einer zweiten Ebene – auch die Tatsache, dass ich vertraut war mit Gesichtserkennungsmerkmalen. Vielleicht gehörte das zu meiner Arbeit? Was ich Maskenbildern an einem Theater? Hier in Berlin? Vielleicht war ich hier zu Hause – in der pulsierenden Stadt der Künste?
„Okay, dann mal los.“ Jürgen stand auf, warf sich seine Uniformjacke über und griff nach dem Autoschlüssel vom Dienstwagen. Auch Andrea zog sich an und sagte: „Bitte, stehen Sie auf.“ Meinen verständnislosen Blick bemerkte sie sofort: „Hier steht, dass ein Hoteldirektor Sie als vermisst gemeldet hat. Wir werden Sie zu diesem Hotel bringen und schauen, ob er Sie zweifelsfrei identifizieren kann.“
Das wollte ich natürlich gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen. Dennoch gab es etwas, was mich noch mehr interessierte: „Wollen Sie mir nicht wenigstens sagen, welchen Namen ich nach dieser Vermisstenmeldung trage? Neben dem Bild stand kein Name.“
Jürgen drehte sich noch einmal zu mir um und er hatte sich nicht schnell genug in den Griff bekommen. Wieder hatte er diesen respektvollen, leicht unterwürfigen Blick: „Wenn … wenn die Anzeige auf Sie zutrifft, dann sind Sie Eric Alexander van den Heuvel.“
Dann stieß er ein kurzes, freudloses Lachen aus, schüttelte den Kopf und setzte hinzu: „Grade Sie! Das hätte ich nicht gedacht.“
Scheinbar hatte ich meine Mimik und meine Gefühle gut unter Kontrolle. Ich ließ mir die Verwirrung nicht anmerken, die er damit hervorbeschworen hatte. Ich kannte viele alltägliche Sachen, Namen, Orte. Aber der Name sagte mir nichts. Was eigentlich ein gutes Zeichen war, da ich offensichtlich nur meine private Vergangenheit vergessen hatte. Wenn der Name mir nichts sagte, war die Chance groß, dass wir tatsächlich auf den ersten Versuch hin einen Treffer gelandet hatten. Vielleicht war dieser van den Heuvel aber auch nur jemand, der mir auch sonst in meinen Leben nichts gesagt hätte, und ich klammerte mich hier an eine Hoffnung, die mich keine Stunde tragen würde.
Auf der Rückbank des Streifenwagens sitzend, schweigend und konzentriert, bemühte ich mich darum, mich darauf vorzubereiten, einem Menschen entgegenzutreten, der mich vielleicht identifizieren konnte, den ich aber mit Sicherheit nicht wiedererkennen können würde. Aus meinem tiefsten Inneren stieg eine Meditationsübung auf. Ich sah mich selbst wieder vor dem Spiegel im Untersuchungszimmer stehen, beobachte wie schwebend von oben, dass mein anderes Ich die Kleider ablegte und in den Spind griff, aus dem der Arzt das Diktiergerät geholt hatte. Zu meinem Erstaunen war der Spind mehr als geräumig und ich zog Stück um Stück hervor. In meinem Geist kleidete ich mich um, stieg langsam und bedächtig in eine Wildlederhose, die maßgeschneidert zu sein schien. Beinahe konnte ich den weichen Stoff auf meinen Beinen fühlen, obwohl alles nur in meinen Gedanken geschah. Ich war mir wohl bewusst, dass ich in einem Streifenwagen durch Berlin schaukelte, doch in meinem Kopf spielte sich etwas ganz anderes ab. Dort hatte ich inzwischen auch ein weites, tiefrotes Leinenhemd übergestreift und vor meiner breiten Brust mit einem Kordelband zugezogen. Mit leichtem Erstaunen sah – und fühlte – ich das schwere Kettenhemd, das ich nun als nächstes hervorholte. Taxierend hielt ich es von mir weggestreckt und meine Oberarmmuskeln zitterten unter dem Gewicht. Mir war bewusst, dass dieses Stück etwas ganz besonderes war. Die Kälte, die es verströmte, als ich es vor meinem geistigen Auge über den Oberkörper streifte, ergriff mich auch in der Realität und vermittelte mir eine wohltuende Ruhe. Gemächlich schloss ich Schnalle um Schnalle an der Seite und mit jedem Riemen, den ich verknotete, schloss ich mein Ich immer weiter ein. Ich spürte, wie sich mein Herzschlag beruhigte, wie sich mit dem nächsten Handgriff meine Emotionen in den Hintergrund traten, wie ich mich aufrichtete und vorbereitete. Ich war bereit. Sollte die Konfrontation mit dem Mann, der behauptete mich zu kennen, nur kommen. Mich würde nichts verletzten können, denn ich war gegürtet, gerüstet und gepanzert, gegen die Welt da draußen und alles, was mich tangieren könnte.
„Und, kommt Ihnen hier irgendwas bekannt vor“, kam die Stimme von vorne, aber sie riss mich nicht mehr aus meiner Meditation. Ich war schon wieder in die Wirklichkeit eingetaucht, noch immer in diese schäbigen Kleidungsstücke aus dem Polizeigewahrsam gekleidet, doch eigentlich spürte ich, dass ich meine Rüstung trug. Und ich fühlte mich sicher und geschützt.
„Natürlich! Alles hier! Das ist lebendige Geschichte! Nur weil ich nicht weiß, wer ich bin, sollten Sie mich nicht für dumm halten!“ Soeben passierten wir die Siegessäule und fuhren auf das Brandenburger Tor zu. Naja, fuhren? Wie immer auf Berlins Vorzeigeboulevard ging es nur im Schritttempo voran. Aber das störte mich heute nicht. Vielmehr zeigte es mir an, dass ich mit der Berliner Verkehrssituation vertraut war. Mit einer gewissen Siegesfreue sah ich dem Hotel entgegen. Wir waren auf dem richtigen Weg, da war ich mir sicher. Denn alles hier war mir vertraut.
„Welches Hotel ist es denn? Hier gibt es ja so viele“, fragte ich meine persönlichen Schutzengel, die mich nicht nur von der Straße aufgelesen hatten, sondern mir auch halfen, mich selbst wiederzufinden.
„Adlon. Was denn sonst?“, lautete die knappe Antwort von Andrea und in ihrer Stimme klang eine ungehaltene Frustration mit. Wahrscheinlich war es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie die Chance bekam, das Adlon zu betreten. Und das auch nur in Uniform. Ich fühlte in mir nach. Der Gedanke, jetzt gleich ins Adlon zu gehen, machte mir keine Angst, schien nichts Unbekanntes zu sein. Ein Punkt mehr auf der Liste, der mir bestätigen sollte, dass wir auf der Zielgeraden zu meiner Erinnerungen waren.
Der livrierte Türsteher am Adlon riss uns nicht gerade die Türe auf, als wir aus dem Streifenwagen stiegen und den Haupteingang ansteuerten. Es war offensichtlich, dass man hier nicht gerne die Polizei im Haus hatte. Dennoch gingen Jürgen und Andrea selbstbewusst durch die Lobby. Ihre Schritte klangen laut auf dem Marmorboden, als sie die Rezeption ansteuerten. Ich lief mehr oder weniger unbeachtet hinter ihnen her und schaute mich um. Fremd war mir das Interieur nicht, aber der große Augenblick des Erinnerns trat leider auch nicht ein.
Die Hotelangestellte am Empfang schaute etwas pikiert, zwang sich aber ein Lächeln ins Gesicht.
„Wir sind mit dem Hoteldirektor verabredet“, platzte Jürgen los, ohne eine Gruß oder eine Erklärung.
„Und wer sind Sie bitte?“, fragte die nicht mehr ganz junge Rezeptionistin schnippisch.
„Mein Name ist Langemann, das ist meine Kollegin Hasazy. Wir sind“, er tippte sich mit dem Finger auf der Abzeichen auf seiner Uniform, „von der Berliner Polizei, wie Sie sehen können.“
Die Antipathie beruhte offensichtlich auf Gegenseitigkeit.
„Ja, ja, das sehe ich.“ Mit einer Hand griff sie zum Telefonhörer, mit der anderen wedelte sie in eine Ecke hinter dem Counter. „Wenn Sie bitte dadrüben warten würden.“
Offensichtlich war Andrea aber nicht bereit, sich so einfach fortschieben zu lassen.
„Ach, wissen Sie, ich glaube, wir setzen uns lieber an einen der Tische in der Lobby. Und wir nehmen drei Wasser. Vielen Dank.“
Nach diesem Statement drehte sie sich um, ließ ihren Pferdeschwanz dabei ganz apart wippen und nahm genüsslich in einem der tiefen Ledersessel Platz.
Wir mussten nicht lange auf das Wasser warten. Und noch während ich genoss, wie es kühl durch meine Kehle rann, sah ich in den Augen von Langemann, dass sich jemand hinter meinem Rücken unserem Tisch näherte. Die Schritte verrieten, dass es sich um einen Mann handelte. Einen stattlichen Mann.
Auch seine Stimme war laut und polterig, doch er bemühte sich, sie gedämpft zu halten, als er sagte: „Wie wunderbar, dass Sie hier sind. Ich hoffe so sehr, dass Sie gute Nachrichten haben. Ich … oooh!“
Ich hatte mich genau wie meine Begleiter erhoben und nun auch umgedreht, um den Hoteldirektor anzuschauen. Ein großgewachsener, leicht übergewichtiger und bärtiger Mann, der in einem maßgeschneiderten Nadelstreifenanzug steckte. Trotz seiner Fülle wirkte er nicht abstoßend fett, sondern vielmehr wie eine menschliche Trutzburg, bei der man sich verbergen konnte. Jeder seiner massenhaften Zentimeter war vertrauenswürdig.
„





























