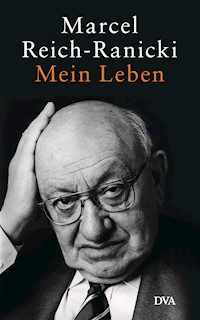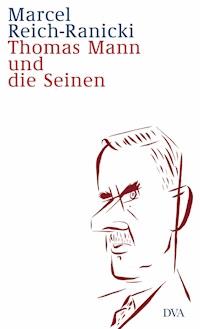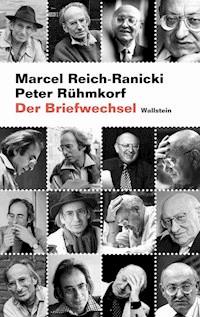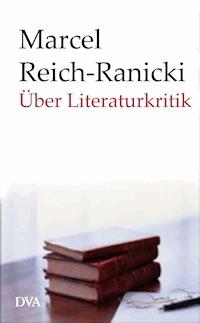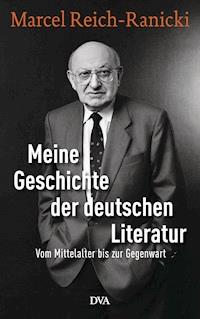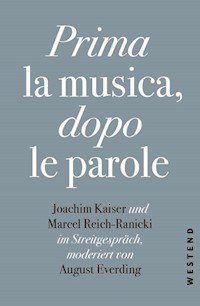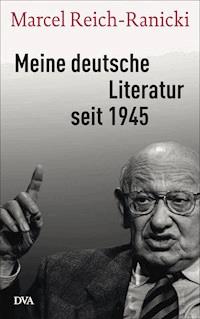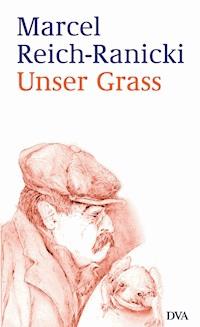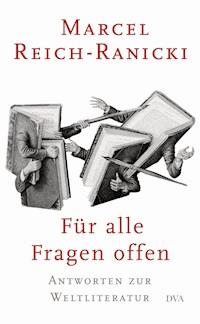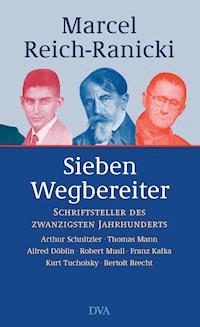
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Schon in seiner Schulzeit im Berlin der dreißiger Jahre hatte er ihre Bücher gelesen, bewundert und geliebt. Auf allen Etappen seines bewegten, dramatischen Lebens war er zu ihnen zurückgekehrt - staunend, gelegentlich auch zweifelnd und letztlich stets aufs neue überwältigt.
Was wird bleiben von der deutschen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts? Zunächst die drei Genies, die in der Epik, der Lyrik und im Drama das Jahrhundert auf den Begriff gebracht haben: Thomas Mann, Kafka und Brecht; dann, zumindest teilweise, das Werk der Romanciers Döblin und Musil, des Erotikers Schnitzler und des Feuilletonisten Tucholsky. Reich-Ranicki zieht in seinen Essays die Bilanz einer lebenslangen Passion, aus der eine Profession wurde. Er zeigt, dass jene, denen wir Verse und Prosa von höchster Qualität verdanken, allesamt schwache Menschen waren, leidend und einsam, gequält von Ehrgeiz und Eitelkeit. Er zeigt ihre Lächerlichkeit, ihre Originalität, doch vor allem ihre Größe, ja ihre Erhabenheit. Dieses Buch ist ein polemisches Plädoyer für die deutsche Literatur, eine so ungewöhnliche wie leidenschaftliche Liebeserklärung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Ähnliche
Marcel Reich-Ranicki
Sieben Wegbereiter
SCHRIFTSTELLERDESZWANZIGSTEN JAHRHUNDERTS
Arthur Schnitzler · Thomas MannAlfred Döblin · Robert Musil · Franz KafkaKurt Tucholsky · Bertolt Brecht
Deutsche Verlags-AnstaltStuttgart München
FürRüdiger Volhardsehr herzlichund diesmit gutem Grund
Inhalt
Vorbemerkung
ARTHUR SCHNITZLER
Auch das Grausame kann diskret sein
THOMAS MANN
Die Liebe ist nie unnatürlich
»Wir verlorenen Kinder Deutschlands«
Seine letzte Liebe
»O sink hernieder, Nacht der Liebe«
Bin ich am Ende?
Glück und Unglück der Alleinreisenden
ALFRED DÖBLIN
Ein Heldenvater
Der geniale Amokläufer
Unser Biberkopf und seine Mieze
ROBERT MUSIL
Der Zusammenbruch eines großen Erzählers
FRANZ KAFKA
Seine geschriebenen Küsse
KURT TUCHOLSKY
Ein Deutscher ohne Deutschland
Einer von uns
BERTOLT BRECHT
Ungeheuer oben
Nachweise und Anmerkungen
ARTHUR SCHNITZLER
THOMAS MANN
ALFRED DÖBLIN
ROBERT MUSIL
FRANZ KAFKA
KURT TUCHOLSKY
BERTOLT BRECHT
Personenregister
Vorbemerkung
Wegbereiter – das ist ein schönes, altes Wort, gebräuchlich schon im späten Mittelalter. Doch was hat es besagt? Wurden mit ihm jene bezeichnet, die uns einen Weg bereiteten, wohin auch immer? Ja und nein. Denn zunächst war es, wenn wir uns auf die Literatur verlassen können, nur für einen Einzigen bestimmt und reserviert: für Jesus Christus. So wurde es im sechzehnten Jahrhundert verwendet (vor allem von Hans Sachs), so auch im siebzehnten Jahrhundert, zumal von Simon Dach.
Aber im achtzehnten Jahrhundert ist die Bedeutung dieser Vokabel stark erweitert: Nicht nur Jesus war es, der nun den Weg bereitete, dies taten jetzt auch die großen Repräsentanten des Geistes. Herder sprach von einem »wegbereitenden Herold der Wissenschaften« und Hegel, etwas später, von der »Wegbereitung für den Einzug wahrer Philosophie«. Mittlerweile ist mit dem Wort nichts anderes gemeint als ein Mensch, der mit Erfolg für etwas Neues eintritt – in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Literatur und auch in der Politik.
Die sieben Schriftsteller, die in diesem Buch unter dem Stichwort »Wegbereiter« zusammengefaßt sind, haben mich schon in meiner Schulzeit, im Berlin der dreißiger Jahre, interessiert und irritiert und auch fasziniert. Die Novellen Arthur Schnitzlers, die Romane Thomas Manns und Alfred Döblins, die frühe Prosa Robert Musils, die Gleichnisse Franz Kafkas, die Feuilletons Kurt Tucholskys und schließlich die Lyrik des jungen Bertolt Brecht – das alles übte auf mich eine besondere, eine beinahe magische Anziehungskraft aus.
Zunächst hat das natürlich mit der außerordentlichen Qualität dieser Literatur zu tun. Hinzu kam noch ein aktueller Umstand, den ich nicht ignorieren konnte und wollte: Es handelte sich um Autoren, die im »Dritten Reich« verboten oder zumindest unwillkommen waren und die man auf jeden Fall in den Bibliotheken nicht erhalten und in den Antiquariaten nur mühselig finden konnte. Denn Thomas Mann und Alfred Döblin, Kurt Tucholsky und Bertolt Brecht gehörten zu den politischen Emigranten, der Österreicher Robert Musil schloß sich ihnen 1938 an, Franz Kafka und Arthur Schnitzler waren schon tot, doch als Juden verfemt.
Zur Attraktion, die man immer verbotenen Früchten nachsagen kann, gesellte sich bald ein anderer, keineswegs schwächerer Reiz – jener der Modernität. Wahrscheinlich habe ich es damals eher gespürt und geahnt als tatsächlich begriffen, daß mit den frühen Büchern Schnitzlers, Thomas Manns und Musils und der noch vor dem Ersten Weltkrieg folgenden Prosa Döblins und Kafkas eine neue Epoche der deutschen Literatur begonnen hatte.
Schnitzlers »Leutnant Gustl« und Thomas Manns »Buddenbrooks«, 1901 gleichzeitig erschienen, stehen, so unterschiedliche Werke es auch sind, am Anfang dieses Zeitalters. In Schnitzlers bahnbrechender Novelle sehen wir alles, anders als bis dahin in der erzählenden deutschen Prosa, mit den Augen der im Mittelpunkt befindlichen Figur. Wichtiger noch: Was sich hier abspielt, ereignet sich nahezu ausschließlich im Bewußtsein eben dieser Figur. So erhebt die Geschichte des Leutnants Gustl den inneren Monolog (zum ersten Mal in unserer Literatur und übrigens viele Jahre vor dem »Ulysses« von James Joyce) zum einzigen Ausdrucksmittel der erzählenden Prosa und erreicht mit ihm – auf wahrhaft überwältigende Weise – alle angestrebten Wirkungen.
Mit dem »Leutnant Gustl« und mit den »Buddenbrooks« beginnt in der deutschen Literatur die Epoche der Psychologie. Freuds gern zitierte Feststellung, was er »in mühseliger Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe«, das wisse er, Schnitzler, dank »Intuition und Selbstwahrnehmung«; im Grunde seines Wesens sei Schnitzler »ein psychologischer Tiefenforscher«. Dieses Wort gilt auch für Thomas Mann, für Döblin und Musil, für Kafka.
Die Erkenntnisse der Psychologie ermöglichten die Verfeinerung und Vertiefung auch und vor allem der erotischen Geschichten. Das Sexuelle, bisher verschwiegen und ausgespart oder nur knapp angedeutet, wurde nun in den Themenkreis der Literatur einbezogen. Thomas Mann vergegenwärtigte in seiner Erzählung »Der kleine Herr Friedemann« (1898) die Leiden seines unglücklichen, seines untergehenden Helden an der Geschlechtlichkeit, er zeigte mit einer in der deutschen Sprache noch nie gekannten Virtuosität die Sexualphantasien, die Masturbationsvisionen des pubertierenden Hanno Buddenbrook.
Wie Intellektualität in den Sadismus übergehen kann und der Ästhetizismus in den Terror, verdeutlichte Musil in den »Verwirrungen des Zöglings Törless« (1906). In seiner Erzählung »Das verzauberte Haus« (1908) und in dem Band »Vereinigungen« (1911) beobachtete Musil, ein ausgebildeter Mathematiker, mit nahezu mathematischer Genauigkeit die sexuellen Regungen und Qualen seiner Gestalten. Döblin, von Beruf Psychiater, drang in seiner Erzählung »Die Ermordung einer Butterblume« (1913) in die tiefsten Schichten des Unbewußten vor und zeigte die Voraussetzungen, die Symptome und auch die Folgen einer Geisteskrankheit.
Für die einsamen Menschen, die sich in dieser Literatur gegen das Dasein wehren, zerfällt die Welt in eine Fülle von Einzelheiten. Sie lassen sich zwar beobachten, doch haben sie keinen Sinn, sie ergeben keinen Zusammenhang. Die Welt erweist sich als absurd. Das ist das zentrale Motiv Kafkas. In seiner Prosa ist das Ungeheuerliche banal und das Gewöhnliche unheimlich. Er zweifelte die rational erfaßbare Wirklichkeit an und gab dem Irrationalen und Dämonischen wirkliche Züge. Er verwandelte die Realität in einen Tagtraum, der wiederum eine Realität ist.
Neue Wege ging auch Bertolt Brecht, der als Dramatiker gegen die Tradition rebellierte und das epische Theater verwirklichte und der als Lyriker, meist an traditionelle Formen anknüpfend, gleichwohl und vielleicht in noch höherem Maße ein Wegbereiter war. Und Kurt Tucholsky? Gehört er wirklich hierher? Ja, ich bin dessen sicher. Denn er hat das Feuilleton wie kein anderer Autor im zwanzigsten Jahrhundert modernisiert, er hat dank ungewöhnlicher Treffsicherheit und Anschaulichkeit seiner betont flotten und bisweilen auch kokett-ungezwungenen Diktion einen Einfluß ausgeübt, der, obwohl auf Schritt und Tritt erkennbar, immer noch unterschätzt wird.
Allerdings sollte man nicht meinen, ich hätte die Werke dieser Schriftsteller in meiner Jugend gelesen, weil sie eine außerordentliche Rolle in der deutschen Literaturgeschichte gespielt haben. Die Wahrheit ist viel simpler: Ich habe sie benötigt, weil ich auf der Suche nach Unterhaltung und Vergnügen war. Und sie haben mich in der Regel durchaus nicht enttäuscht.
Zu allen diesen Schriftstellern kehrte ich an den verschiedenen Abschnitten meines Lebens immer wieder zurück – staunend und bewundernd, bisweilen zweifelnd und letztlich stets aufs neue begeistert. Die Wegbereiter wurden meine Wegbegleiter.
Frankfurt am Main, im Juli 2002M. R.-R.
ARTHUR SCHNITZLER
Auch das Grausame kann diskret sein
Als Arthur Schnitzler sechzig Jahre alt wurde, veröffentlichte die »Neue Rundschau« zusammen mit anderen Geburtstagsartikeln auch einen kurzen Gruß von Thomas Mann. Neben einigen eher konventionellen Wendungen – so über »die Vereinigung von Leidenschaft und Weisheit, Strenge und Güte« – fällt hier der Versuch auf, den Jubilar in die Nähe eines ebenfalls 1862 geborenen Dichters zu rücken, nämlich Gerhart Hauptmanns. Beide seien, meinte Thomas Mann, »in eine ähnlich repräsentative Stellung hineingewachsen«1. Hauptmann und Schnitzler als ebenbürtige Figuren der zeitgenössischen Literatur? Damit deutete Thomas Mann nur an, wie es seiner Ansicht nach sein sollte, nicht aber, wie es tatsächlich war. Denn die Rolle, die Schnitzler damals, 1922, in der Öffentlichkeit spielte, ließ sich mit dem hohen Ansehen, in dem Hauptmann stand, kaum vergleichen.
»Wie ein Baum zieht er seine Säfte aus der schlesischen Erde, aber seine Krone ragt in den Himmel …« – heißt es über Hauptmann in Klabunds populärer Literaturgeschichte.2 Bei dem Namen Schnitzler dachte man nicht gerade an die Säfte der Erde, sondern eher an das Pflaster der Großstadt; und nicht die Erinnerung an den Himmel rief er wach, sondern an die Dachkammer des süßen Mädels und an das Boudoir der Femme fatale.
Der eine galt als Poet aus dem sagenumwobenen Riesengebirge, der andere nur als Literat aus dem Wiener Kaffeehaus. Hauptmann feierte man als Seher, der tastend und raunend den Weg zu den Müttern suche und zugleich die deutsche Zwietracht mitten ins Herz zu treffen wisse. Schnitzler hingegen hatte den Ruf eines mehr oder weniger charmanten Leichtgewichtlers, ja, eines Erotikers, was in der Vorstellung vieler deutscher Leser gleichbedeutend war mit dem Zug zum Frivolen und der Neigung zum Schlüpfrigen.
Wurde der Autor der »Weber« und der »Ratten« mit der Kennmarke »Dichter des Mitleids« versehen, so hatte man den anderen als Dichter nicht etwa der Liebe abgestempelt, sondern bloß der Liebelei. Und während Hauptmann, der mit den Idealen seiner Sturm- und Drangzeit längst nichts mehr zu tun haben wollte und sich in den zwanziger Jahren politischer Enthaltsamkeit befleißigte, gern als Repräsentant der Weimarer Republik anerkannt wurde und allmählich zum Klassiker aufstieg, sah sich Schnitzler in jener Zeit in die Rolle eines liebenswürdig-harmlosen, auf jeden Fall aber antiquierten Außenseiters gedrängt.
Noch hatte er zahlreiche Leser – seiner 1924 erschienenen Novelle »Fräulein Else« war ein großer Publikumserfolg beschieden; noch wurden einige seiner Stücke, ältere zumal, von vielen Bühnen gespielt. Symptomatisch ist allerdings, aus heutiger Sicht, ein Vorfall, der sich im Herbst 1924 in einem Berliner Theater ereignet hatte: Zwei Männer störten die Vorstellung des Dramas »Der einsame Weg« mit, wie berichtet wird, »überaus lautstarken« Bekundungen ihres Mißfallens – es sei, riefen sie, unbegreiflich, daß man derartigen »Schund« aufführe. Die so stürmisch gegen Schnitzlers Stück protestierten, waren zwei jüngere Dramatiker: Bertolt Brecht und Arnolt Bronnen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!