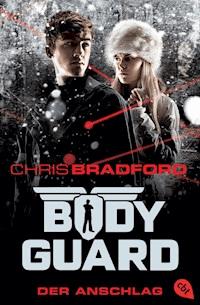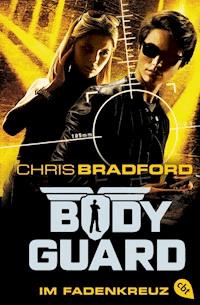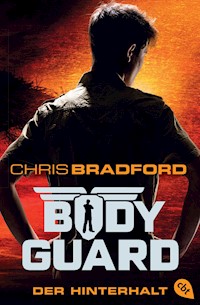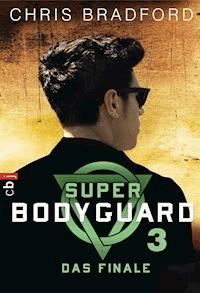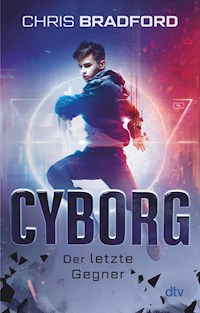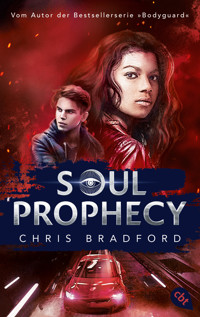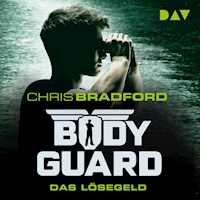6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Soul-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Hattest du schon mal einen Traum, der so echt war, dass du wusstest, du musst das schon mal erlebt haben?
Als die junge Genna eines Abends von einer Gang überfallen wird und ihr ein Fremder zu Hilfe eilt, glaubt sie an einen Zufall. Aber als sie kurz darauf Opfer einer Entführung wird und ihr wieder der junge Held zur Seite springt, wird rasch klar, dass etwas echt Mysteriöses vor sich geht. Und die Erklärung, die ihr Retter Phoenix ihr auftischt, findet Genna noch verrückter: Die sie verfolgende Gang gehöre den
Soul Hunters an, einer finsteren Sekte, die hinter Gennas Seele her sei, um sie zu zerstören und damit die Welt ihrer Menschlichkeit zu berauben. Phoenix behauptet, ihr Guardian und Gennas einzige Rettung zu sein. Doch als plötzlich ein weiterer mächtiger Feind auf den Plan tritt, steht ihrer beider Schicksal auf Messers Schneide …
Ein atemberaubendes Action-Abenteuer von Bestsellerautor Chris Bradford!
Die Bände der »Soul«-Trilogie:
Soul Hunters (Band 1)
Soul Prophecy (Band 2)
Soul Survivor (Band 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Ähnliche
CHRIS BRADFORD
Aus dem Englischen von
Alexander Wagner
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2020 der deutschsprachigen Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2020 Chris Bradford
Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel: »Soul Hunters« bei Puffin, einem Verlag der Penguin Random House Verlagsgruppe, London
Übersetzung: Alexander Wagner
Covergestaltung und Artwork: Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung der Motive von Shutterstock ( Chris.Tea; Tueris; Alones; Alexander Kirch; Stockphoto Mania)
MP · Herstellung: UK
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-22583-4V004
www.cbj-verlag.de
FÜR MARY –
EINE LIEBE FREUNDIN UND ALTE SEELE
ICH DANKE DIR FÜR DIE HEILUNG
0
Mesoamerika (Guatemala), 2500 v. Chr.
»Zu Ehren Ra-Kas, dem Herrn der Unterwelt und Feuer der Erde«, brüllte der Hohepriester, »bringen wir dieses Opfer!«
Ein menschliches Herz pulsierte in der Faust des Hohepriesters, dessen letzte Schläge sich mit dem Rhythmus der zeremoniellen Trommeln zu vereinen schienen, die auf der Spitze der Steinpyramide ertönten. Hinter der Tempelanlage erhob sich ein riesiger Vulkan, der grollend Lava ausspie. Ströme geschmolzenen roten Gesteins liefen wie Adern die geschwärzten Hänge hinab und in den dampfenden Dschungel darunter.
Als der Hohepriester das Herz dem feurigen Gipfel entgegenstreckte, brach ein riesiger Jubel unter den Menschen aus, die auf dem Platz am Fuß der Pyramide versammelt waren. Der Vulkan antwortete mit einem weiteren finsteren Grollen. Dann verstummten die Trommeln und Schweigen senkte sich über die Menge.
Mit großer Vorsicht legte der Hohepriester das Herz in eine Holzschale und stellte diese vor die riesige Statue einer Gottheit mit katzenähnlichen Augen und einem weit aufgerissenen, mit Reißzähnen gespickten Maul. Er selbst trug den Schädel und das gesprenkelte Fell eines Jaguars als Umhang. Sein rot bemaltes Gesicht ragte durch die geöffneten Kiefer des Schädels, dessen scharfe Zähne noch seine markanten Gesichtszüge betonten: eine Nase wie das Blatt einer Streitaxt, hohe Wangenknochen und schmale Augen, hart und obsidianschwarz. Im flackernden Licht des Feuers erschien der Hohepriester so furchterregend wie die Götter, die das Volk der Tletl verehrte.
Der Priester näherte sich dem steinernen Altar, wo noch immer die Leiche des Opfers lag: ein Junge, nicht älter als vierzehn Jahre, die Augen weit aufgerissen vor Schreck und Schmerz, die nun ein Ende gefunden hatten. Mit einem knappen Nicken befahl der Hohepriester seinen Gefolgsleuten, die Opferzeremonie zu vollenden.
Zwei muskelbepackte Männer mit nackten, geölten Oberkörpern zogen auf der obersten Plattform des Tempels eine Steinplatte zurück, und Schwaden von schwefligem Dampf wälzten sich in den düsteren Himmel. Vier mit Jaguarmasken vermummte Gefolgsleute hoben den schlaffen Körper des Jungen vom Altar und trugen ihn zu der Öffnung. Noch einmal entfesselten die Trommler einen schweren, donnernden Rhythmus, und die Menschen auf dem Platz begannen frenetisch dazu zu tanzen.
»Ra-Ka!«, rief der Hohepriester. »Wir opfern dir das Herz, den Körper und die Seele dieses Jungen! Verzehre sie mit deinem Feuer!«
Unter einem gewaltigen Jubelschrei der Menge wurde die Leiche in den brodelnden Lavasee geworfen. Der Hohepriester hob zum Zeichen der Ehrerbietung seine blutroten Hände, während das Trommeln zu einem Crescendo anstieg, bevor es abrupt verstummte –
Alles war totenstill. Dann begann die Erde zu vibrieren. Zuerst kaum wahrnehmbar, dann schwoll das Zittern zu einem heftigen Beben an.
Die Bäume wankten …
Vögel stoben auf …
Hütten erbebten …
Steinmauern bröckelten …
Und unten auf dem Platz barst der Boden wie ein ausgetrocknetes Flussbett, Risse schlängelten sich zwischen den Füßen der in Panik geratenen Zuschauer hindurch.
Tief unten in seinem Schlund grollte der Vulkan und spuckte Bälle flammenden Magmas und schwarze, heiße Aschewolken aus. Der mächtige Zorn ihres Gottes ließ die Menschen auf dem Platz aufschreien. Aber der Hohepriester blieb ungerührt. Furchtlos und furchterregend stand er über ihnen.
»Nun zum Hauptopfer«, verkündete er, während das Erdbeben nachließ. »Dieses reine Opfer wird unseren Feuergott besänftigen und eine neue Morgendämmerung heraufbeschwören.«
Mit einem Lächeln so scharf wie eine Sense wandte sich der Hohepriester einem jungen Mädchen zu. Sie hatte lange tiefschwarze Locken, ein ebenmäßiges goldbraunes Gesicht und selbst jetzt strahlende Augen. Festgehalten von vier Gehilfen, wand sich das Mädchen verzweifelt, trat um sich und schrie, um dem Griff der Männer zu entkommen, die sie nun zum Altar schleppten. Die Trommeln hatten ihren donnernden Rhythmus wieder aufgenommen, und die Menge verfiel in einen rituellen Gesang.
»RA-KA! RA-KA! RA-KA!«
Das Mädchen wurde auf den Altar gehoben und fühlte, wie sich der kalte harte Stein gegen ihren nackten Rücken presste. Sie spürte auch die glitschig-warme Nässe des Blutes darauf. Vor lauter Schreck verstummten nun ihre Schreie, während ihre Gliedmaßen von den vier maskierten Männern auf den Altar gedrückt wurden.
Die dunklen, scheinbar seelenlosen Augen des Hohepriesters richteten sich auf sie, und jede Hoffnung, die sie noch in sich getragen hatte, wurde von diesem Blick ausgelöscht. Der Mann schwang in seiner Hand einen verzierten Jadedolch, in dessen Griff das Bild eines Jaguarmannes eingraviert war. Nur wenige Augenblicke zuvor hatte das Mädchen verfolgen müssen, wie diese Klinge ihren Freund aufgeschlitzt hatte. Sie war gezwungen gewesen, zuzusehen, wie der Hohepriester in den Körper des Opfers gegriffen und ihm das noch schlagende Herz aus der Brust gerissen hatte.
Doch ihr eigenes Herz schlug noch und das Mädchen wusste, dass es mit aller Kraft kämpfen musste. Sie bäumte sich in einem letzten verzweifelten Befreiungsversuch auf, aber es war zwecklos, und während der Hohepriester eine Beschwörungsformel ausstieß, in einer Sprache, die so alt war, dass sie wie dunkle Magie klang, fühlte sie jeden Widerstand schwinden.
»Rura, rkumaa, raar ard ruhrd,
Qmourar ruq rouhk ur darchraqq,
Ghraruq urq kugr rour ararrurd …«
Der Klang der Trommeln dröhnte in ihren Ohren und der Gesang der Menge wurde immer lauter und wilder.
»RA-KA! RA-KA! RA-KA!«
Durch die Bannformel des Hohepriesters versank das Mädchen in eine Art Trance. Ihre Seele schien sich von ihrem Körper zu lösen und aufwärtszuschweben, sodass sie wie aus großer Höhe verfolgte, wie der mit einem Jaguarschädel maskierte Priester mit dem Jadedolch ausholte, der immer noch vom Blut ihres Freundes triefte.
Mit hocherhobener Klinge warf der Hohepriester einen Blick zum Horizont und wartete auf den genauen Zeitpunkt, an dem die Sonne untergehen und die letzten Lichtstrahlen verlöschen würden … für immer.
1
London, Gegenwart
Als ich mich dem Museum nähere, bemerke ich in der Dunkelheit eine Gruppe von Teenagern, die abrupt ihre geflüsterte Unterhaltung unterbrechen und mir nachstarren, während ich die Stufen zum Vordereingang hinaufsteige. Ich klingele an der Tür und warte. Ein entferntes Trommeln klingt in meinen Ohren … oder vielleicht ist es mein Herzschlag …
Ich kann ihre Blicke auf mir spüren und das Schweigen ist unheimlich, aber ich will mich nicht nach ihnen umdrehen, aus Furcht, ich könne sie provozieren. Dann öffnen sich die Pforten des Museums, Licht fällt auf die Straße, und nachdem ich meine Einladungskarte vorgezeigt habe, werde ich hineingebeten.
Ich lasse die gruselige Gruppe hinter mir zurück, hänge meinen Mantel auf und betrete ein lärmerfülltes Foyer, in dem sich schick gekleidete Gäste tummeln.
»Genna! Du bist da!«, ruft Mei. Sie umarmt mich und flüstert mir ins Ohr: »Danke, dass du gekommen bist. Dieser Abend wäre ohne dich so öde geworden!«
Ich blinzle verblüfft. »Öde?«
Mein Blick schweift durch den Raum und registriert die erstaunliche Vielfalt der ausgestellten Artefakte: eine geschnitzte Lulua-Stammesmaske aus dem Kongo, ein schimmernder griechischer Bronzeschild mit dem Gesicht der Medusa, eine glänzende Goldstatue des Buddha, ein Paar Samurai-Schwerter mit elfenbeinweißen Griffen. Der Raum ist erfüllt von atemlosem Geplapper, während sich Gäste, Reporter und Fotografen um die verschiedenen Ausstellungsstücke drängen. In einer Ecke spielt ein DJ diskret einen bunten Mix aus lateinamerikanischer, afrikanischer und asiatischer Musik, was zur lebhaften Atmosphäre beiträgt.
»Wie sollte das hier öde sein? Ich meine, das ist einfach – es ist fantastisch!«, rufe ich. »Tausend Dank, dass du mich eingeladen hast!«
Mei verdreht die Augen und lacht. »Mensch, kein Wunder, dass meine Eltern dich so mögen. Wenn du so weitermachst, werden sie mich durch dich ersetzen wollen!«
Ich werfe ihr einen fragenden Blick zu. »Bist du denn überhaupt nicht an ihrer Ausstellung interessiert?«
Sie zuckt gleichgültig mit den Achseln. »Wir haben zu Hause Tonnen von diesem alten Kram rumliegen. Ich sehe so was jeden Tag. Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum alle deswegen so aus dem Häuschen sind.«
»Mei, deine Eltern sind wie Indiana Jones und Lara Croft im wahren Leben!«, rufe ich. »Sie reisen um die Welt, um verschollene Schätze zu entdecken, und heute Abend zeigen sie ihre Privatsammlung. Es ist kein Wunder, dass die Leute aus dem Häuschen sind.«
»Nun, du bist es offensichtlich!«, bemerkt Mei spöttisch. »Aber es ist nicht so wunderbar, dass sie die ganze Zeit weg sind.«
Ich zucke zusammen. »Sorry … Ich weiß, wie schwer das für dich und deinen Bruder ist.«
»Keine Sorge«, erwidert Mei und setzt ein Lächeln auf. »Lee und ich wissen, dass wir in ihrem Leben nur den zweiten Platz einnehmen. Wir haben es akzeptiert –«
»Genna! Wie schön, dich zu sehen«, ruft Meis Mutter, die in einem eleganten lila Kleid und mit einem Champagnerglas in der Hand herübergeschwebt kommt. »Ich freue mich so, dass du kommen konntest.«
Mei strafft sich, als ihre Mutter näher kommt. Sie mag ihre Interessen nicht teilen, aber ihr Aussehen sehr wohl: beide haben langes, seidiges schwarzes Haar, aufmerksame bernsteinfarbene Augen, hohe Wangenknochen und einen makellosen Teint.
»Das würde ich um nichts in der Welt verpassen wollen, Mrs Harrington«, antworte ich und begrüße sie mit einem Lächeln.
»Lin, ich glaube, wir haben unsere verlorene Tochter wiedergefunden«, sagt Meis Vater, lächelnd und mit einem Augenzwinkern, als er an meiner Seite erscheint. Groß, mit breiten Schultern, einem kantigen Kiefer und in einen schicken Khaki-Anzug gekleidet, sieht er aus wie die Idealbesetzung für die Rolle eines Abenteurers.
»Siehst du? Hab’s dir doch gesagt!«, murmelt Mei und rollt die Augen. »Die tauschen uns im Handumdrehen aus!«
»Băobèi, du wirst immer unser größter Schatz sein«, sagt ihre Mutter beruhigend zu Mei. »Und ich bin sicher, dass Genna jetzt unbedingt unsere neuesten Entdeckungen bewundern möchte. Bitte gib ihr eine kompletteFührung. Oh, und sag deinem Bruder, dass seine Freunde nicht draußen warten müssen.«
Mei nickt gehorsam und führt mich dann in den ersten Raum, in dem sich eine erstaunliche Sammlung von Schätzen aus dem Nahen Osten befindet. Während Mei ihrem Bruder eine Nachricht zukommen lässt, wende ich mich dem ersten Ausstellungsstück zu: einer viertausend Jahre alten persischen Vase.
»Warst du nur höflich zu meinen Eltern?«, fragt Mei und blickt von ihrem Handy auf. »Oder findest du dieses Zeug echt interessant?«
»Natürlich tu ich das.« Ich nicke begeistert und betrachte das zarte blaue Muster, das auf die Oberfläche der Vase gemalt ist. »Du weißt, ich liebe Geschichte.«
Mei neigt den Kopf zur Seite, betrachtet die Vase und wirkt wenig beeindruckt. »Aber es ist so todlangweilig. Das ist alles Vergangenheit!«
»Fühlt sich für mich nicht so an«, antworte ich, während ich zu einer Vitrine mit einer ägyptischen Steintafel gehe.
»Die Geschmäcker sind einfach verschieden, schätze ich«, sagt Mei. »Magst du was zu essen?«
Ich reiße meinen Blick von den komplizierten Hieroglyphen der Tafel los. »Eigentlich nicht.«
»Also, ich brauche was, um mir die Langeweile zu vertreiben«, sagt Mei seufzend und steckt ihr Handy ein. »Tu dir keinen Zwang an, während ich uns was vom Buffet hole.«
Mei schlendert auf den Bewirtungsbereich zu, gerade als Lees Freunde das Foyer betreten. Auch sie steuern direkt auf das Buffet zu und interessieren sich eindeutig mehr für das Essen als für die Ausstellung. Ich wende meine Aufmerksamkeit wieder der Steintafel zu, und während ich meinen Kopf gegen das Glas der Vitrine lehne, wird mir das entfernte Trommeln wieder bewusst. Der Rhythmus ist hypnotisierend. Zuerst denke ich, es muss der DJ sein, dann merke ich, dass dieses Geräusch aus einem Gang kommt. Neugierig, und zugleich wie magnetisch angezogen, folge ich dem Beat in einen Raum am anderen Ende des Flurs. Sobald ich eintrete, hört das Trommeln auf.
Wie seltsam, denke ich, während ich nach der Geräuschquelle suche. Im Raum herrscht eine schummrige Atmosphäre, nur die Vitrinen sind beleuchtet. Da er am weitesten vom Foyer entfernt ist, sind noch keine Besucher hier. Hier ist alles voller Kunstschätze aus Südamerika. Neugierig blicke ich auf das erste Artefakt, die kleine Tonfigur einer schwangeren Frau. Daneben eine aztekische Totenmaske mit Einlegearbeiten aus Türkis und Perlmutt, und daneben – bei dem Anblick ziehe ich eine Grimasse – ein mumifizierter Schrumpfkopf! Dann bemerke ich in einer eigenen Vitrine einen Dolch aus reiner Jade. Die etwa fünfzehn Zentimeter lange Klinge ist so grün, dass sie fast glüht.
Aus irgendeinem Grund kann ich meine Augen nicht von dem Dolch abwenden. Auf den Griff ist eine bizarre Symbolfigur geschnitzt, die aussieht, als sei es … eine Kreuzung aus Jaguar und Mensch. Wie von selbst greifen meine Finger nach dem Riegel des Glasschrankes, und da er überraschenderweise nicht verschlossen ist, ziehe ich ihn auf. Sofort dröhnt es mir in den Ohren. Ist das der Lärm aus dem Foyer? Aber nein, es ist verzerrt, als würde es über einen defekten Lautsprecher wiedergegeben. Ich höre etwas, das wie der Schrei eines Mädchens klingt, dann ertönt wieder der schwere Schlag von Trommeln, gefolgt vom Grollen eines fernen … Donners?
Noch immer strecken sich meine Finger nach dem Dolch aus, dessen gebogene Klinge wie eine grüne Feuerzunge aussieht. Der Raum um mich herum verschwimmt, wirkt seltsam unwirklich, das Dröhnen in meinen Ohren wird immer intensiver. Ein scharfer, beißender Geruch wie nach … versengtem Haar … steigt mir in die Nase. Ich bin kurz davor, den Griff des Dolches zu packen, als –
»An deiner Stelle würde ich das nicht anfassen.«
Erschrocken wirble ich herum. Der Raum rückt wieder scharf in mein Blickfeld, und der Lärm aus dem Foyer wird plötzlich lauter. Ein Junge in einem dunkelgrauen Adidas-Kapuzenpulli und Jeans steht in der offenen Tür und fixiert mich.
Ich fühle mich schuldig, als hätte man mich beim Klauen erwischt.
Er bemerkt den ängstlichen Ausdruck in meinem Gesicht und grinst. »Oh, mach dir keine Sorgen. Ich werde es niemandem verraten«, meint er, schließt dann leise die Tür hinter sich und schlendert zu mir rüber. »Aber am besten spielt man nicht mit Messern, vor allem nicht mit solchen, die unbezahlbar sind.«
»Unbezahlbar?«
Er nickt. »Das ist ein zeremonieller Dolch aus Guatemala. Über viertausend Jahre alt.«
Ich starre erstaunt auf die Klinge. Sie ist so gut erhalten, dass es den Eindruck erweckt, sie wäre erst gestern geschnitzt worden. »Für welche Art von Zeremonie wurde das Messer verwendet?«, frage ich.
»Menschenopfer.«
Meine Augen weiten sich erschrocken, und ein Schauder überläuft mich. Dann mustere ich den Jungen und überlege, ob er mich nur erschrecken will. »Das glaube ich dir nicht.«
Er zuckt mit den Achseln. »Glaub, was du willst. Aber da steht es.« Er deutet auf eine kleine Informationstafel neben der Vitrine. Dann kommt er einen Schritt näher. »Wie heißt du?«
»Genna«, nuschle ich und schaue ihn verlegen an. Mein Puls beschleunigt sich. Mit seinem wilden Schopf schwarzer Haare über den haselnussbraunen Augen und seiner blassen Haut wirkt er, als wäre er gerade eben aus dem Bett gekrochen. Aber es steht ihm – und obwohl es so aussieht, als käme er nicht viel in die Sonne, ist er fit und muskulös, auf eine sehr ansprechende Art und Weise. Ich löse meinen Blick widerwillig von seinen Oberarmen und schau ihm in die Augen.
Er schenkt mir ein Lächeln. »Hi, Genna, ich bin Damien. Am besten schließen wir die Vitrine wieder, bevor jemand rausfindet, dass wir heimlich rumgestöbert haben, oder?«
Als er hinübergreift, um den Riegel umzulegen, berühren sich unsere Körper, und ein Funke springt zwischen uns über. Die Luft scheint plötzlich zu vibrieren und meine Wangen werden heiß. Einen Moment lang starren wir uns nur an.
Ich weiche vor Verlegenheit ein Stück zurück.
»Ich kenne dich«, flüstert er.
Ich streiche eine lose Haarsträhne aus meinem Gesicht. »Ich glaube nicht«, stottere ich. Der Raum fühlt sich plötzlich übermäßig warm und stickig an.
Plötzlich packt er mein Handgelenk und schaut mir noch tiefer in die Augen. Seine Pupillen weiten sich und scheinen jetzt unnatürlich groß. Wie Tintenseen.
Ich versuche, meine Hand wegzuziehen, aber sein Griff umklammert mich nun. Auch seine Stimme wird jetzt tiefer und grollend. »Ich habe dich gesucht!«
»Was?« Jetzt bin ich verwirrt und ein wenig verängstigt. Der Druck auf mein Handgelenk schmerzt. »Aua!«, rufe ich. »Lass los!«
Aber Damien nimmt davon keine Notiz. Er beginnt mich Richtung Tür zu ziehen.
»LASS MICH LOS«, schreie ich und versuche mich aus seinem eisernen Griff zu befreien.
In dem Augenblick öffnet sich die Tür und Mei kommt herein, einen Teller mit Häppchen in der Hand.
»Da bist du ja, Genna!«, sagt sie mit einem erleichterten Lächeln. »Ehrlich, ich habe dich überall gesucht.« Doch der verängstigte Ausdruck auf meinem Gesicht lässt sie innehalten. Sie blickt zwischen mir und dem Jungen hin und her und ihr Lächeln weicht einem Stirnrunzeln. »Alles in Ordnung?«
»Ja, natürlich«, sagt Damien und lässt mein Handgelenk frei. »Ich habe Genna nur durch die Ausstellung geführt.«
Mei starrt ihn an. »Nun, ich denke, sie hat genug gesehen … und ich auch, besten Dank!«
»Wie ihr wollt«, sagt Damien mit einem Achselzucken und marschiert dicht an ihr vorbei aus dem Raum.
Ich stoße einen tiefen Seufzer aus. Mein Körper zittert und mein Mund ist staubtrocken.
Mei fixiert mich. »Genna? Alles in …?«
»Mir geht’s gut«, sage ich und weiche ihrem neugierigen Blick aus. Dann wanke ich mit weichen Knien zurück ins Foyer, hole meinen Mantel und steuere auf die Tür zu.
Mei rennt mir nach, ihr Gesichtsausdruck eine Mischung aus Verwirrung und Besorgnis. »Genna! Wohin willst du?«
»Tut mir leid, aber … I-I-Ich fühle mich nicht gut«, sage ich, schiebe mich an einer Gruppe neu ankommender Gäste vorbei und durch den Haupteingang hinaus.
Ich höre Mei mir etwas hinterherrufen, aber ich bleibe nicht stehen. Ich antworte nicht einmal. Als ich die Straße zur U-Bahnstation hinuntereile, riskiere ich einen Blick zurück.
Damien. Er steht an einem der Fenster des Museums.
Und starrt mich an.
2
Als ich den Eingang zur U-Bahn erreiche, stelle ich zu meiner Bestürzung fest, dass die Station wegen Bauarbeiten geschlossen ist. Ein Schild weist mir den Weg zu einer Bushaltestelle auf der anderen Seite des Parks. Ich könnte einen Umweg machen, aber das würde ewig dauern, und laut Fahrplan würde ich den nächsten Bus verpassen. Und ich möchte einfach nur nach Hause. Mich in die Geborgenheit meines Zimmers flüchten.
Mein Handgelenk tut immer noch weh. Tatsächlich bildet sich bereits ein dunkler, ringförmiger Bluterguss. Was war nur mit diesem Jungen los? Die Art, wie er sich plötzlich … wandelte.
Anders kann man es nicht beschreiben. In einem Moment war er freundlich und charmant. Im nächsten war er wie ein Raubtier. Und dieses seltsame Erlebnis mit dem Jadedolch – das Dröhnen in meinen Ohren, die Schreie des Mädchens und der schreckliche Gestank von brennendem Haar. Was ist da nur mit mir geschehen?
Plötzlich habe ich das mulmige Gefühl, dass ich beobachtet werde. Ich schaue mich nervös um, erwarte fast, den Jungen aus dem Museum wiederzusehen. Die Straße ist dicht bevölkert. Eine Gruppe Betrunkener stolpert aus einer Kneipe, schreit und flucht. Ein verliebtes Paar schlendert Arm in Arm auf ein Restaurant zu. Gelächter kündigt eine Gruppe von Frauen in Cocktailkleidern an, die silberne Geburtstagsballons hinter sich herziehen. Ein Büroangestellter wedelt verzweifelt mit seinem Arm in meine Richtung … aber ich merke schnell, dass er gerade ein Taxi herbeiwinkt. Niemand nimmt auch nur die geringste Notiz von mir …
Dann bemerke ich eine Gestalt, die in einer dunklen Türöffnung herumlungert. Sie ist kaum mehr als ein Schatten. Aber obwohl ich ihr Gesicht nicht sehen kann, scheint sie mich direkt anzustarren.
Mein Herz schlägt schneller. Ist Damien mir gefolgt?
Ein Lkw fährt vorbei und versperrt mir die Sicht. Ich versuche, die Gestalt im Auge zu behalten. Aber als der Wagen vorüber ist, fehlt von dem Schatten in der Türöffnung jede Spur. Ich frage mich, ob ich die Gestalt tatsächlich gesehen habe. Vielleicht war es nur jemand, der seine Haustür aufgeschlossen hat …
Ich schüttele den kalten Schauder ab und studiere erneut den Fahrplan. Wenn ich den nächsten Bus verpasse, kommt eine ganze Stunde lang keiner mehr. Zögernd drehe ich mich um, betrete den Park und folge dann zügig den provisorischen Schildern aus der U-Bahn. Hier ist es viel stiller als auf der Straße. Aber ich sage mir, je schneller ich die Bushaltestelle erreiche, desto schneller komme ich nach Hause.
Der Weg verläuft diagonal durch den düsteren Park. Die Hälfte der Laternen ist defekt, sodass ich zwischen den gelben Lichtinseln immer wieder ins Dunkel tauche. Bei jedem Schritt fühle ich Blicke auf mich gerichtet. Meine Paranoia gerät außer Kontrolle. Schon als kleines Kind dachte ich oft, dass Menschen mich beobachten, und das geht mir immer noch so. Meine Eltern meinen, es sei völlig normal, Fremden gegenüber ein gesundes Misstrauen zu haben, aber das ist es nicht. Es gibt immer wieder Menschen, die mich ein bisschen zu lange anstarren, als würden sie überlegen, ob sie mich kennen. Manchmal denke ich sogar selbst, dass ich eine Person schon einmal gesehen habe. Ich erkenne sie tatsächlich wieder, obwohl ich ihr das erste Mal in meinem Leben begegne. Es ist eine sehr seltsame Art von Déjà-vu.
Tatsächlich habe ich oft Déjà-vu-Erlebnisse. Die Empfindung ist manchmal sehr stark. Ich erinnere mich noch genau, wie meine Eltern mich einmal zu einem Anwesen des National Trust mitnahmen, einem Landhaus aus dem 17. Jahrhundert in Berkshire. Damals war ich etwa acht. Wir nahmen an einer Führung teil und hatten gerade den Salon erreicht, als ich dringend auf die Toilette musste. Meine Eltern fragten die Führerin, eine ziemlich strenge alte Dame, die schmallippig antwortete, ich hätte vor Beginn der Führung gehen sollen, da die einzige öffentliche Toilette draußen am Eingang sei. Aber ich wusste – ich schwöre, das wusste ich wirklich –, dass es hinter dem Bücherregal in der Ecke eine Toilette gab. Die Führerin schaute mich durch ihre Perlmuttbrille an und sagte mir, ich solle mich nicht lächerlich machen. Aber ich blieb hartnäckig. Da kam zufällig der Chefkurator des Hauses vorbei und erklärte, dass es tatsächlich vor langer Zeit hier eine Toilette gegeben hatte, die aber zugemauert worden sei. Vor etwa hundertzwanzig Jahren! Meine Eltern hatten mich beide mit offenem Mund angestarrt. Ich hatte keine Erklärung für sie. Irgendwie hatte ich es einfach gewusst.
Mein Handy pingt in meiner Tasche. Ich bleibe stehen und schaue auf das Display. Eine Nachricht von Mei.
G, alles ok? Mach mir Sorgen um dich. Sims, wenn du zu Hause bist. x
Als ich ihr gerade antworten will, nehme ich aus den Augenwinkeln eine schemenhafte Bewegung wahr. Mein Puls geht hoch und ich spähe in die Nacht. Das Leuchten meines Handy-Displays hat mich kurz geblendet, aber ich bin mir sicher, dass ich eine Gestalt erkennen kann, die reglos mitten im Park steht. Es herrscht plötzlich eine absolute Stille und mich überläuft eine Gänsehaut. Schaudernd atme ich tief durch, um mich zu beruhigen.
Ich stecke mein Handy ein und mache mich wieder auf den Weg. Es ist völlig menschenleer hier. Wo sind denn alle? Warum nimmt niemand sonst diese Umleitung? Ich wünschte, ich wäre wieder inmitten einer trubeligen Menschenmenge. Endlich sehe ich die Bushaltestelle, auf der anderen Seite des Kinderspielplatzes, wie ein Leuchtfeuer, das Sicherheit verspricht. Ich laufe darauf zu, jede Lichtinsel der Laternen als Zufluchtsort vor der tückischen Dunkelheit nutzend.
Da huscht plötzlich eine Gestalt zu meiner Linken durch den Park. Dann sind da drei weitere Schatten.
Wie kannst du nur so dämlich sein, Genna! Wie oft haben Mum und Dad dich schon davor gewarnt, solche Risiken einzugehen? Warum zum Teufel habe ich diese Abkürzung genommen?
Jetzt erscheint die Bushaltestelle weiter weg als je zuvor. Ich beginne zu rennen. Mein Atem geht stoßweise, das Blut hämmert mir in den Ohren. Als ich den Spielplatz erreiche, tritt wie aus dem Nichts eine Gang in Kapuzenpullovern aus der Dunkelheit und versperrt mir den Weg. Sie umzingeln mich.
»Wohin so eilig?«, fragt einer von ihnen, sein Gesicht im Schatten der Kapuze verborgen.
»H-heim«, antworte ich mit zitternder Stimme.
»Nicht heute Nacht, tut uns leid.«
Ich kämpfe gegen meine Panik an, greife in die Jackentasche und ziehe meine Geldbörse raus. »Hier, nehmt«, sage ich und halte sie ihnen hin. Mein Vater sagt immer, falls ich jemals überfallen werde, soll ich ihnen einfach geben, was sie verlangen. Geld kann ersetzt werden – mein Leben nicht. Aber keiner von ihnen reagiert. Sie stehen nur da, Hände in den Taschen, Gesichter im Schatten.
Ich greife jetzt nach meinem Handy und strecke es ihnen hin. »Das ist alles, was ich habe. Bitte, nehmt es einfach und lasst mich in Ruhe.«
»Wir wollen weder dein Geld … noch dein Handy«, sagt einer der Kerle.
Mein Magen verkrampft sich. »Was wollt ihr denn?«
Er tritt ins Licht und enthüllt ein blasses Gesicht mit Augen, die so weit geöffnet sind, dass sie wie schwarze Löcher aussehen.
»Dich, Genna«, sagt Damien. »Wir wollen nur dich.«
3
Nackte Panik ergreift mich, als sich die fünf Kapuzenkerle von allen Seiten nähern und mich einkreisen. Ich bin wie erstarrt vor Angst, kann weder kämpfen noch fliehen, jeder normale Reflex ist ausgeschaltet. Der verzweifelte Versuch eines Schreis erstickt in meiner zugeschnürten Kehle. Meine Augen huschen umher und suchen nach irgendjemandem, der mir helfen könnte. Aber der Park ist vollkommen verlassen.
In einiger Entfernung sehe ich das Wartehäuschen der Busstation, Menschen laufen in ihre Handys vertieft daran vorbei, blind für alles um sie her. Der Lärm des Verkehrs und die Rufe der Nachtschwärmer dringen an meine Ohren, aber sie klingen seltsam gedämpft, als würde eine Glaswand den Park umgeben. Ich fühle mich völlig isoliert.
Als sich der Kreis weiter um mich schließt, greift einer der Kapuzenkerle sich meinen rechten Arm, ein anderer den linken. Erst jetzt finde ich meine Stimme wieder, ich rufe verzweifelt um Hilfe und bete, dass meine Schreie den Verkehrslärm übertönen. Doch sofort umschließt eine Hand meinen Mund.
Ich wehre mich und trete um mich. – Nein, nein, nein!
Weitere Hände greifen nach mir. Meine Beine werden unter mir weggerissen und sie schleppen mich auf den Spielplatz. Abseits des Laternenlichtes und der Hauptwege sind wir in völlige Dunkelheit gehüllt und vor möglichen Blicken verborgen. Grob lassen sie mich auf einen Picknicktisch fallen, halten meine Arme und Beine aber weiter fest umklammert. Mein Entsetzen wird noch verstärkt, weil die Gang in völliger Stille zusammenarbeitet. Mit ihren im Schatten der Kapuzen liegenden Gesichtern ragen sie über mir auf wie eine Bruderschaft gesichtsloser Mönche.
Damien nähert sich mir, ein dämonisches Grinsen verzerrt seine hübschen Gesichtszüge. »Keine Sorge, Genna – es ist bald vorbei.«
Er zieht ein Messer aus seiner Tasche – es ist der Jadedolch aus dem Museum! Die gebogene Klinge schimmert wie eine geschliffene Glasscherbe. Plötzlich erfüllt ein beißender Brandgeruch die Luft, und in meinen Ohren dröhnt wieder das ferne Trommeln. Alle noch verbliebenen Kräfte verlassen mich, ich liege schlaff auf dem Picknicktisch, spüre das harte Holz an meinem Rücken, während ich zu weinen beginne.
Doch plötzlich … wird einer meiner Angreifer nach hinten gerissen und landet mit ohrenbetäubendem Scheppern auf der metallenen Kinderrutsche.
Der Rest der Gang fährt herum. Eine Silhouette erhebt sich über dem gestürzten Kapuzenkerl – ein Teenager in einer ledernen Bikerjacke.
Damiens dunkle, unergründliche Augen sind nun auf den Angreifer gerichtet. »Ah, wen haben wir denn da?«, spöttelt er. »Einen Möchtegern-Helden?«
»Lasst sie gehen«, befiehlt der Junge. Der Hauch eines amerikanischen Akzents schwingt in seiner Stimme mit.
»Oh, was für ein knallharter Typ.« Damiens Tonfall ist herablassend. »Geh und spiel irgendwo anders den guten Samariter. Verzieh dich!«
Aber der Junge bleibt stehen, hoch aufgerichtet, die Fäuste geballt. »Das läuft nicht.«
Damien seufzt verärgert. »Vielleicht wirst du diese Entscheidung noch bereuen. Das heißt, falls du sie überlebst.« Und mit einem Nicken schickt er zwei von seiner Gang los, es mit dem Jungen aufzunehmen.
Meine Arme sind plötzlich frei und ich stemme mich vom Picknicktisch hoch.
»Ey, ey«, sagt Damien und deutet mit der Klinge auf mich. »Du gehst nirgendwohin.«
Ich sehe jetzt, dass die Person, die mein linkes Bein festhält, gar kein Kerl ist, sondern ein Mädchen. Jetzt löst sie ihren Griff, geht um den Tisch und packt mich stattdessen an den Haaren. Sie reißt meinen Kopf zurück, und ich zucke vor Schmerz zusammen. Mit dem Jadedolch an meiner Kehle kann ich nur zusehen, wie die beiden anderen auf meinen potenziellen Retter zumarschieren. Der an der Rutsche hat sich inzwischen ebenfalls erholt, ist wieder auf den Beinen und offensichtlich auf Rache aus. Es steht drei gegen einen, der Junge in der Lederjacke hat keine Chance. Aber als sie sich ihm nähern, nimmt er eine Art Kampfposition ein – die Beine leicht gespreizt, die Hände erhoben –, und ein winziger Funke Hoffnung regt sich in mir.
Die drei Kapuzentypen greifen gleichzeitig an. Der Junge weicht dem ersten Schlag aus und kontert mit einem Hieb, der so schnell kommt, dass ich ihn kaum wahrnehme. Seine Faust trifft das Kinn des ersten Angreifers und lässt ihn wie einen angeschlagenen Boxer taumeln.
Die nächste Kapuzengestalt attackiert ihn mit einem brutalen Tritt gegen das Bein, aber der Junge blockt mit dem Schienbein ab, bewegt sich dann blitzschnell vorwärts, packt seine Angreiferin am Arm und wirft sie über seine Schulter.
Sie landet mit einem harten, dumpfen Schlag auf dem Asphalt und ringt keuchend nach Atem.
Der dritte Schläger – der kräftigste von allen – stürzt sich wie ein Rammbock auf den Jungen. Mein Retter wird nach hinten geschleudert, die beiden donnern gegen ein mit Graffiti beschmiertes Karussell und setzen es in Gang. Das Spielgerät knarrt und ächzt, während der Kapuzentyp den Jungen mit hammerartigen Fäusten traktiert, der die Schläge abwehrt, so gut er kann. Ein Blutspritzer landet auf dem Metall des Karussells.
»Aufhören! AUFHÖREN!«, schreie ich, aber ich weiß, dass es vergeblich ist. Der Brutalo drischt nur noch wilder auf ihn ein, bis ich ein widerliches Knirschen höre und erneut Blut spritzt. Ich zucke zusammen … bevor ich begreife, dass dies nicht das Blut des Jungen ist.
Es stammt aus der Nase des Schlägers, die ihm durch einen kräftigen Stoß mit der Handfläche gebrochen wurde. Mit einem dumpfen Heulen stürzt er gegen das Karussell, die sich drehenden Stäbe knallen gegen seinen Kopf und schlagen ihn k.o.
Damien spuckt vor Verachtung über das Versagen seiner Gang aus. Er starrt das groß gewachsene Mädchen an, das mich immer noch festhält. Er befiehlt: »Mach dem ein Ende«, während mein Retter sich wieder aufrichtet.
Während Damien mir den Dolch noch fester an die Kehle drückt, huscht sie hinüber, um sich in den Kampf einzuschalten. Die ersten beiden Angreifer, die jetzt wieder im Einsatz sind, stürzen sich wie Kampfhunde auf meinen Retter. Der Junge ist so darauf konzentriert, sie abzuwehren, dass er weder das Mädchen hinter sich bemerkt – noch die Waffe in ihrer Hand.
»Vorsicht!«, rufe ich. Aber es ist bereits zu spät.
Sie schlägt ihm mit einem Stück Stahlrohr auf den Hinterkopf, und der Junge geht in die Knie. Die beiden anderen fangen an, auf ihn einzutreten, als wäre er ein Fußball.
Damien lacht grausam. »Oh ja, von Hero zu Zero!«
Seine sadistische Freude über den Sturz meines Retters lässt eine Welle der Wut in mir aufwallen. Während Damiens Aufmerksamkeit auf den Kampf gerichtet ist, verpasse ich ihm einen harten Tritt mit dem Fuß und erwische ihn in der Leiste. Er krümmt sich vor Schmerz, hält seinen Unterleib umklammert. Ich rolle vom Picknicktisch und stolpere davon. Desorientiert und mit weichen Knien taumle ich über den Spielplatz und suche einen Fluchtweg.
Damien brüllt vor Wut und macht sich an die Verfolgung.
Ich winde mich durch die Stäbe eines riesigen Klettergerüsts und versuche, ihn in der Dunkelheit abzuschütteln. Rasch wird mir klar, dass ich so meinem Peiniger niemals entkommen werde, und als ich an einem Spielhäuschen vorbeikomme, verkrieche ich mich darin. Zitternd und zu Tode geängstigt hocke ich in der Ecke, ziehe meine Beine hoch, schlinge die Arme darum und versuche, mich so klein wie möglich zu machen.
Draußen kratzt eine Klinge mit unheimlichem Geräusch über die Metallkonstruktion des Klettergerüsts.
»Verstecken ist zwecklos, Genna«, faucht Damien. »Jetzt, da ich in deine Seele geblickt habe, kannst du dich nicht länger vor mir verstecken.«
In meine Seele geblickt? Er ist ja völlig irre! Sein wahnsinniges Gerede verängstigt mich nur noch mehr.
Das Geräusch der schabenden Klinge kommt immer näher und näher, jetzt hört es sich an wie das Kreischen einer gequälten Katze. Es ertönt direkt an der Tür des Spielhauses … und bewegt sich weiter, entfernt sich schließlich von mir.
Ich kauere schlotternd in der Dunkelheit und traue mich kaum zu atmen. Das wütende Handgemenge des Kampfes dauert an. Ich möchte weinen. Ich hätte dem Jungen helfen sollen. Stattdessen bin ich weggerannt und habe mich versteckt. Scham brennt in mir. Der Junge versucht mich zu retten, und jetzt –
Plötzlich erscheint im Fenster Damiens Gesicht wie ein schrecklicher, schwarzäugiger Springteufel.
»Gefunden!«, trällert er mit einer singenden Stimme, als wäre dies alles ein lustiges Versteckspiel für ihn.
Ich stoße einen Schrei aus und zucke vor seinen krallenartigen Händen zurück. Er packt mich. Ich zappele und winde mich. Meine Jacke zerreißt, während ich mich losmache und aus dem Spielhaus flüchte. Aber in meiner Panik und Verwirrung renne ich direkt in das Netz des Klettergerüsts. Für einen Moment verfange ich mich darin, wie eine Fliege in einem Spinnennetz. Ich drehe mich um, will in die andere Richtung flüchten … nur, um zu entdecken, dass Damien mir den Ausweg versperrt.
»Oh, Genna, du machst es mir nicht leicht«, knurrt er und kommt mit dem Jadedolch in der Hand auf mich zu.
Ich bin am Ende meiner Kraft. Mein Rücken ist gegen das Netz gepresst, ich kann nirgendwo mehr hin. Außer nach oben. Ich drehe mich um, um am Netz hinaufzuklettern, als ein Blitz aus schwarzem Leder heranzischt. Damien wird gegen das Spielhaus geschleudert. Mein mysteriöser Retter rammt ihm den Ellenbogen ins Gesicht und ringt mit ihm um den Dolch. Während sie gegeneinander kämpfen, schimmert der bösartige Jadesplitter in der Dunkelheit. Die Klinge ratscht über den linken Unterarm meines Retters und durchschneidet seinen Lederärmel. Blut strömt aus der Wunde, trotzdem weigert sich der Junge, Damien loszulassen.
»Lauf, Genna! LAUF!«, schreit der Junge.
Ohne groß zu überlegen, flüchte ich vom Spielplatz. Vorbei an den reglosen Körpern der Bande, aber ich bin zu panisch, um mich zu fragen, wie der Junge es geschafft hat, sie alle zu besiegen … oder woher er meinen Namen kennt!
Ich sprinte über den Rasen zurück auf den Weg und erreiche die erste funktionierende Laterne. Erst dann halte ich inne und blicke zurück. Vor dem Klettergerüst sind nur noch zwei Silhouetten in einen erbitterten Zweikampf verwickelt, das tödliche Jademesser schnellt wie eine Schlange zwischen ihnen hin und her.
Der Junge sieht mich unter der Lampe verharren und schreit erneut: »Lauf, Genna! Renn um dein Leben!«
Auf dem Spielplatz rappelt sich einer der Kapuzenkerle langsam wieder hoch und kommt auf mich zu. Da hält mich nichts mehr. Ich hetze den Weg entlang, erreiche das Parktor und stürze hinaus auf die belebte Straße. Der Bus Nummer 37 hält gerade an der Haltestelle gegenüber. Mein Bus. Ich renne quer über die Straße. Reifen quietschen, das wütende Hupen eines Autos ertönt.
Aber ich traue mich nicht, innezuhalten. Die Türen des Busses schließen sich in dem Moment, als ich hineinspringe. Der Fahrer mustert mich finster. Ich muss ziemlich mitgenommen aussehen – Jacke zerrissen, Haare zerwühlt, Augen weit aufgerissen. Aber zweifellos kriegt er in der Nachtschicht noch viel Schlimmeres zu sehen, deshalb fragt er nicht nach, sondern murmelt nur: »Fahrkarte?«
Erschüttert durch seine Teilnahmslosigkeit fummele ich nach meinem Busticket, wobei meine Finger so stark zittern, dass ich das verdammte Ding kaum halten kann. Der Fahrer winkt mich gereizt weiter, sichtlich besorgter um seinen Fahrplan als um mein Wohlbefinden. Auch die anderen Fahrgäste sind sehr darauf bedacht, Abstand zu halten, entweder ignorieren sie mich oder wirken plötzlich von ihren Handys magisch angezogen. Als ich hinten einen freien Sitzplatz finde, lasse ich mich in die abgenutzten Polster fallen und spähe nervös durch die Heckscheibe. Vom hellen Inneren des Busses aus gesehen, liegt der Park draußen verborgen hinter dem undurchdringlichen Vorhang der Nacht.
Ich kann den Spielplatz nicht mehr sehen. Ich kann die Kapuzen-Gang nicht mehr sehen.
Und auch den Jungen nicht, der mich gerettet hat.
4
»Hast du es der Polizei gemeldet?«, fragt Mei, als wir in der Schulpause mit unseren Freundinnen Anna und Prisha zusammen auf einer Bank sitzen. Um uns herum plaudern unsere Mitschülerinnen und Mitschüler, spielen Fußball, naschen Chips und schlürfen Limonade, oder sind ganz allgemein einfach froh, nicht im Unterricht zu sein. Ich fühle mich seltsamerweise von all dem entrückt – das sorglose Verhalten und das unbeschwerte Lachen der anderen wirkt heute irgendwie befremdlich auf mich.
Ich schüttle den Kopf. »Nein. Ich habe es nicht einmal meinen Eltern erzählt«, gebe ich zu. Das ganze Wochenende musste ich darüber grübeln, ob ich es ihnen sagen soll oder nicht. Abgesehen davon, dass ich sie nicht beunruhigen will, schäme ich mich wegen des Vorfalls, weil ich so dumm gewesen bin, im Dunkeln diese Abkürzung zu nehmen. Und nach wie vor bin ich ängstlich und verwirrt, weil der Bandenchef gesagt hat, er würde mich kennen.
»Aber du wurdest überfallen!«, ruft Anna aus, ihre sommersprossigen Wangen röten sich vor Entrüstung, bis sie die Farbe ihres rotbraunen Haares annehmen. »Das ist ein Verbrechen! Du musst es jemandem melden.«
»Was würde das bringen?«, sage ich. »Es gab keine Zeugen. Wer würde mir glauben?«
»Wir glauben dir, und das reicht«, sagt Prisha. Ihre feinen Augenbrauen kräuseln sich zu beiden Seiten ihres Bindis. »Und was ist mit dem Jungen?«
Plötzlich empfinde ich eine erdrückende Schuld und meine Fingernägel bohren sich in meinen Handrücken, bis beinahe Blut fließt. Das ganze Wochenende habe ich mich wegen seines Schicksals gequält. Die Gang hatte brutal auf den Jungen eingedroschen und ihm den Arm aufgeschlitzt. Trotzdem hatte er nur meine Sicherheit im Sinn gehabt. Und alles, was ich getan hatte, war … wegzulaufen.
»Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt«, stammele ich.
Als mir die Tränen in die Augen schießen, nimmt Mei meine Hand und drückt sie beruhigend. »Ich bin sicher, dass es ihm gut geht. Du hast selbst gesagt, es fand sich nichts darüber in den Medien, also kann er nicht zu ernsthaft verletzt worden sein.«
»Und es klingt, als könne er gut auf sich selbst aufpassen«, fügt Anna hinzu.
Ich nicke und erinnere mich daran, wie der Junge es mit drei Angreifern gleichzeitig aufgenommen hatte. Er war entweder unglaublich mutig oder absolut draufgängerisch.
Prisha schenkt mir ein zaghaftes Lächeln. »Es ist irgendwie cool, seinen eigenen Schutzengel zu haben, findest du nicht auch?«
Ich trockne die Tränen ab. »Ja«, sage ich, »wenn er nicht gewesen wäre … Ich will gar nicht daran denken, was dann passiert wäre.« Ich unterdrücke ein Schluchzen. »Ich will nur wissen, ob es ihm gut geht. Und eine Chance kriegen, ihm für meine Rettung zu danken.«
»Nun, vielleicht können wir ihn finden, damit du es kannst«, schlägt Mei vor, indem sie mir ein Taschentuch reicht. »Wie sah er denn aus, dein Retter?«
Ich runzele die Stirn. »Keine Ahnung«, erwidere ich und versuche, mich zu erinnern.
»Was meinst du mit keine Ahnung?«, fragt Anna.
»Es war dunkel … Ich war in Panik … Ich konnte sein Gesicht kaum erkennen«, erkläre ich und zerknülle das Taschentuch zwischen meinen zitternden Fingern. Plötzlich sehe ich das blutbefleckte Karussell wieder vor mir, grausames Lachen hallt in meinem Kopf wider, und ein Junge mit schwarzen Augenhöhlen starrt mich an. Mich schaudert bei der Erinnerung. »Aber das Gesicht des Anführers werde ich nie vergessen«, flüstere ich, mehr zu mir selbst als zu meinen Freundinnen.
»Irgendeine Ahnung, wer erwar?«, fragt Mei.
Ich sehe sie an, halb verängstigt, halb wütend. »Ja, zufälligerweise. Der Junge aus dem Museum … Damien.«
Sofort verhärten sich Meis weiche Gesichtszüge. »Der unheimliche Typ, der deinen Arm gepackt hat? Unglaublich! Ich rufe sofort meinen Bruder an.«
»Was?«, rufe ich. »Tu das nicht!«
Aber Mei ignoriert mich einfach. Sie springt von der Bank auf und zieht ihr Handy aus der Tasche. »Mein Bruder wird wissen, wo dieser Damien wohnt«, sagt sie, wobei sie den Namen des Jungen fast ausspuckt. »Wir können ihm die Polizei auf den Hals hetzen.«
»Aber was ist, wenn sie mich dann erst recht verfolgen?«, sage ich. »Damien und seine Bande.« Ich habe Angst, dass sie Rache nehmen werden. Mir wehtun. Mich vielleicht sogar töten.
»Nein, Genna«, sagt Mei mit Nachdruck. »Wir müssen das melden.« Dann läuft sie weiter, grimmig und entschlossen, und beginnt, aufgeregt in ihr Handy zu sprechen.
Prisha legt ihren Arm um meine Schultern. »Es ist das Richtige, Gen«, versichert sie mir leise. »Wenn wir diesen Dreckskerl nicht anzeigen, wird er jemand anderen angreifen. Und die- oder derjenige könnte nicht so viel Glück haben wie du.«
Ich nicke wie betäubt, weil ich weiß, dass sie recht hat, aber immer noch besorgt über die möglichen Auswirkungen bin. Meine Freundinnen sind auf meine Sicherheit bedacht, aber der schwarzäugige Junge hatte etwas zutiefst Beunruhigendes an sich. Etwas Böses. Etwas Unerbittliches. Ich meine, wer stiehlt schon einen viertausend Jahre alten Jadedolch, nur um jemanden zu überfallen? Wer bei klarem Verstand hält dich an allen vieren auf einem Tisch fest und foltert dich? Ich habe keine Ahnung, was er von mir wollte, aber ich habe das Gefühl, er würde vor nichts Halt machen, um –
Mei steht wieder neben der Bank, die Stirn in Falten gelegt.
»Was ist los?«, frage ich zaghaft.
»Lee meint, er kenne niemanden namens Damien.«
Nach der Schule warten Mei und Prisha am Schultor auf mich.
»Ihr werdet euren Bus verpassen«, sage ich und werfe einen Blick auf die letzten einsteigenden Schüler.
Mei mustert mich besorgt. »Bist du sicher, dass du allein nach Hause gehen kannst? Sollen wir dich nicht lieber begleiten?«
»Ich bin doch kein Kind mehr!«, antworte ich. Mein Ton ist etwas schärfer als beabsichtigt, und Mei wirkt verletzt.
Prisha streckt die Hand aus und berührt sanft meinen Arm. »Du weißt, dass wir das nicht so gemeint haben.«
»Es tut mir leid«, murmele ich und schenke Mei ein entschuldigendes Lächeln. »Ich bin immer noch durch den Wind, das ist alles. Aber es wird schon wieder. Hier sind massig Leute unterwegs, es ist heller Tag und ich habe es nicht weit.«
»Also … wenn du dir absolut sicher bist«, sagt Mei, umarmt mich und lässt mich widerwillig gehen.
Mei und Prisha winken zum Abschied und steigen in ihren Bus. Ich sehe ihn abfahren und wünsche mir noch im selben Augenblick, ich hätte ihr Angebot angenommen. Als ich die Hauptstraße in die entgegengesetzte Richtung hinuntergehe, löst sich meine Tapferkeit bald in Luft auf, und ich kann nicht anders, als alle paar Schritte über meine Schulter zu schauen.