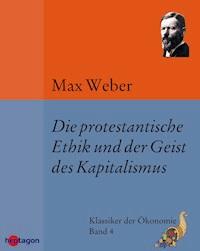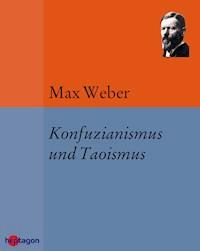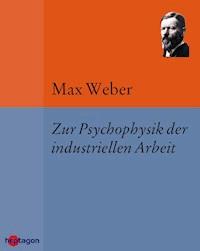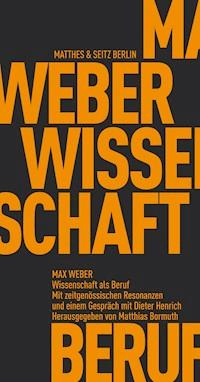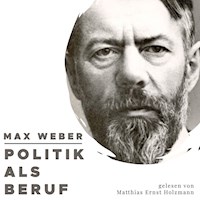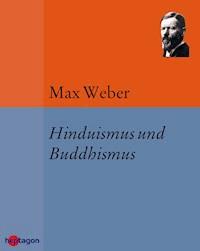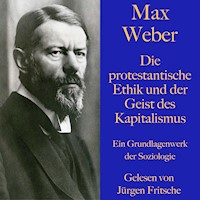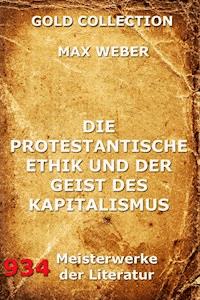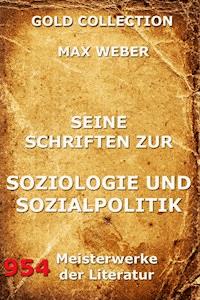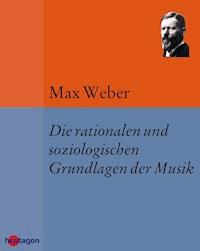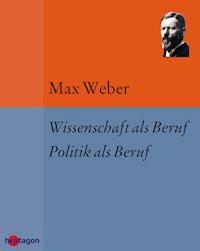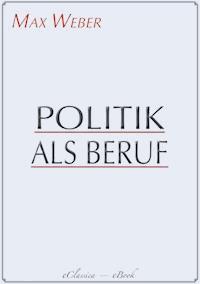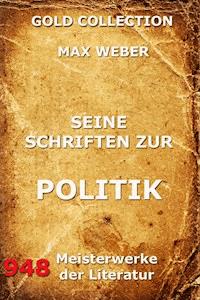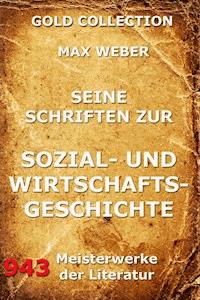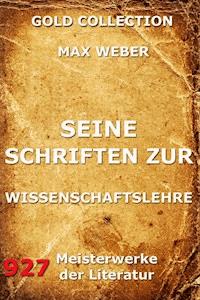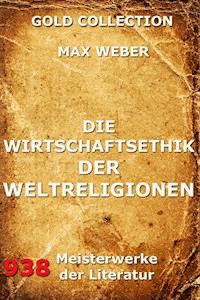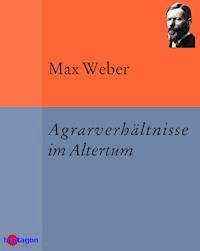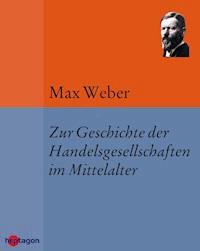Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In Max Webers 'Soziologische Grundbegriffe' werden die grundlegenden Begriffe der Soziologie auf faszinierende Weise behandelt. Weber präsentiert eine detaillierte Analyse sozialer Phänomene, darunter Macht, Bürokratie und soziale Strukturen, die bis heute relevant sind. Sein literarischer Stil ist prägnant und klar, wodurch komplexe Konzepte für den Leser zugänglich werden. Dieses Werk prägte die moderne Soziologie und wird als Meilenstein in diesem Bereich angesehen. Max Webers kritischer Ansatz und seine genaue Beobachtungsgabe machen dieses Buch zu einem unverzichtbaren Werk für Studenten und Forscher der Sozialwissenschaften. Er veranschaulicht Theorien durch Beispiele und Fallstudien, die das Verständnis vertiefen und zum Nachdenken anregen. Soziologische Grundbegriffe ist ein zeitloses Werk, das sowohl für Anfänger als auch für Experten auf dem Gebiet der Soziologie von unschätzbarem Wert ist. Es bietet einen umfassenden Einblick in die komplexen sozialen Strukturen und Prozesse, die unsere Gesellschaft prägen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 63
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Soziologische Grundbegriffe
Books
Inhaltsverzeichnis
§ I. Begriff der Soziologie und des »Sinns« sozialen Handelns.
Inhaltsverzeichnis
Soziologie (im hier verstandenen Sinn dieses sehr vieldeutig gebrauchten Wortes) soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. »Handeln« soll dabei ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. »Soziales« Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.
I. Methodische Grundlagen.
Inhaltsverzeichnis
1. »Sinn« ist hier entweder a) der tatsächlich Ρ. in einem historisch gegebenen Fall von einem Handelnden oder χ. durchschnittlich und annähernd in einer gegebenen Masse von Fällen von den Handelnden oder b) in einem begrifflich konstruierten reinen Typus von dem oder den als Typus gedachten Handelnden subjektiv gemeinte Sinn. Nicht etwa irgendein objektiv »richtiger« oder ein metaphysisch ergründeter »wahrer« Sinn. Darin liegt der Unterschied der empirischen Wissenschaften vom Handeln: der Soziologie und der Geschichte, gegenüber allen dogmatischen: Jurisprudenz, Logik, Ethik, Aesthetik, welche an ihren Objekten den »richtigen«, »gültigen«, Sinn erforschen wollen.
2. Die Grenze sinnhaften Handelns gegen ein bloß (wie wir hier sagen wollen:) reaktives, mit einem subjektiv gemeinten Sinn nicht verbundenes, Sichverhalten ist durchaus flüssig. Ein sehr bedeutender Teil alles soziologisch relevanten Sichverhaltens, insbesondere das rein traditionale Handeln (s.u.) steht auf der Grenze beider. Sinnhaftes, d.h. verstehbares, Handeln liegt in manchen Fällen psychophysischer Vorgänge gar nicht, in anderen nur für den Fachexperten vor; mystische und daherin Worten nicht adäquat kommunikable Vorgänge sind für den solchen Erlebnissen nicht Zugänglichen nicht voll verstehbar. Dagegen ist die Fähigkeit, aus Eignem ein gleichartiges Handeln zu produzieren, nicht Voraussetzung der Verstehbarkeit: »man braucht nicht Cäsar zu sein, um Cäsar zu verstehen.« Die volle »Nacherlebbarkeit« ist für die Evidenz des Verstehens wichtig, nicht aber absolute Bedingung der Sinndeutung. Verstehbare und nicht verstehbare Bestandteile eines Vorgangs sind oft untermischt und verbunden.
Für die typenbildende wissenschaftliche Betrachtung werden nun alle irrationalen, affektuell bedingten, Sinnzusammenhänge des Sichverhaltens, die das Handeln beeinflussen, am übersehbarsten als »Ablenkungen« von einem konstruierten rein zweckrationalen Verlauf desselben erforscht und dargestellt. Z.B. wird bei Erklärung einer »Börsenpanik« zweckmäßigerweise zunächst festgestellt: wie ohne Beeinflussung durch irrationale Affekte das Handeln abgelaufen wäre, und dann werden jene irrationalen Komponenten als »Störungen« eingetragen. Ebenso wird bei einer politischen oder militärischen Aktion zunächst zweckmäßigerweise festgestellt: wie das Handeln bei Kenntnis aller Umstände und aller Absichten der Mitbeteiligten und bei streng zweckrationaler, an der uns gültig scheinenden Erfahrung orientierter, Wahl der Mittel verlaufen wäre. Nur dadurch wird alsdann die kausale Zurechnung von Abweichungen davon zu den sie bedingenden Irrationalitäten möglich. Die Konstruktion eines streng zweckrationalen Handelns also dient in diesen Fällen der Soziologie, seiner evidenten Verständlichkeit und seiner – an der Rationalität haftenden – Eindeutigkeit wegen, als Typus (»Idealtypus«), um das reale, durch Irrationalitäten aller Art (Affekte, Irrtümer) beeinflußte Handeln als »Abweichung« von dem bei rein rationalem Verhalten zu gewärtigenden Verlaufe zu verstehen.
Insofern und nur aus diesem methodischen Zweckmäßigkeitsgrunde ist die Methode der »verstehenden« Soziologie »rationalistisch«. Dies Verfahren darf aber natürlich nicht als ein rationalistisches Vorurteil der Soziologie, sondern nur als methodisches Mittel verstanden und also nicht etwa zu dem Glauben an die tatsächliche Vorherrschaft des Rationalen über das Leben umgedeutet werden. Denn darüber, inwieweit in der Realität rationale Zweckerwägungen das tatsächliche Handeln bestimmen und inwieweit nicht, soll es ja nicht das Mindeste aussagen. (Daß die Gefahr rationalistischer Deutungen am unrechten Ort naheliegt, soll damit nicht etwa geleugnet werden. Alle Erfahrung bestätigt leider deren Existenz.)
4. Sinnfremde Vorgänge und Gegenstände kommen für alle Wissenschaften vom Handeln als: Anlaß, Ergebnis, Förderung oder Hemmung menschlichen Handelns in Betracht. »Sinnfremd« ist nicht identisch mit »unbelebt« oder »nichtmenschlich«. Jedes Artefakt, z.B. eine »Maschine«, ist lediglich aus dem Sinn deutbar und verständlich, den menschliches Handeln (von möglicherweise sehr verschiedener Zielrichtung) der Herstellung und Verwendung dieses Artefakts verlieh (oder verleihen wollte); ohne Zurückgreifen auf ihn bleibt sie gänzlich unverständlich. Das Verständliche daran ist also die Bezogenheit menschlichen Handelns darauf, entweder als »Mittel« oder als »Zweck«, der dem oder den Handelnden vorschwebte und woran ihr Handeln orientiert wurde. Nur in diesen Kategorien findet ein Verstehen solcher Objekte statt. Sinnfremd bleiben dagegen alle – belebten, unbelebten, außermenschlichen, menschlichen – Vorgänge oder Zuständlichkeiten ohne gemeinten Sinngehalt, soweit sie nicht