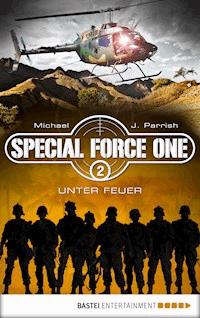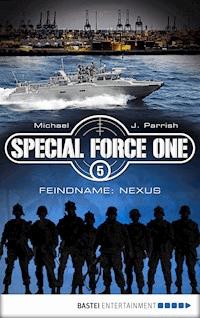1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Spezialisten
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Das Team der SFO ist auf dem Weg nach Mambutu, Afrika, um einen inhaftierten Bürgerrechtler zu befreien, als Colonel John Davidge den Befehl erhält, seine Truppe zurück zu rufen. Plötzlich scheint niemand mehr an der Befreiungsaktion interessiert zu sein. Aus welchem Grund? John Davidge verweigert den Befehl und setzt damit nicht nur seine Karriere aufs Spiel. Erst während der Befreiungsaktion, mitten im feindlichen Feuer wird vieles klarer: Der Feind stammt nicht nur aus Afrika - es sind auch Weiße, die die SFO-Kämpfer unter Beschuss nehmen ...
Special Force One - Die Antwort der Vereinten Nationen auf den Terror der heutigen Zeit. Ein Spezialkommando, allein zu dem Zweck geschaffen, korrupte Staaten, Flugzeugentführer, Attentäter und Massenmörder zu bekämpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über diese Serie
Über diese Folge
Über die Autoren
Titel
Impressum
Auf verlorener Mission
In der nächsten Folge
Extras
SFO - Die Spezialisten
Special Force One – Die Antwort der Vereinten Nationen auf den Terror der heutigen Zeit. Ein Spezialkommando, allein zu dem Zweck geschaffen, korrupte Staaten, Flugzeugentführer, Attentäter und Massenmörder zu bekämpfen.
Doch das Projekt hat nicht nur Befürworter. Auch in den eigenen Reihen gibt es Kritiker, die nur darauf warten, dass das Unternehmen fehlschlägt.
Das Alpha-Team um Colonel John Davidge und Leutnant Mark Harrer hat jedoch keine Wahl: Wenn die Vereinten Nationen um Hilfe rufen, rückt die SFO aus. Und wo sie im Einsatz sind, ist Versagen keine Option …
Folge 01: Der erste Einsatz
Folge 02: Unter Feuer
Folge 03: Drogenkrieg
Folge 04: Operation »Broken Fish«
Folge 05: Feindname: Nexus
Folge 06: Das ägyptische Grabmal
Folge 07: Südsee-Inferno
Folge 08: Schatten der Vergangenheit
Folge 09: Auf verlorener Mission
Folge 10: Piraten vor Singapur
Folge 11: Einsatz hinter Klostermauern
Folge 12: Codename: Enigma
Folge 13: Insel aus Stahl
Folge 14: Der Atem Gottes
Folge 15: Flug in den Tod
Folge 16: Der Nemesis-Plan
Folge 17: Das Delta-Protokoll
Über diese Folge
Das Team der SFO ist auf dem Weg nach Mambutu, Afrika, um einen inhaftierten Bürgerrechtler zu befreien, als Colonel John Davidge den Befehl erhält, seine Truppe zurück zu rufen. Plötzlich scheint niemand mehr an der Befreiungsaktion interessiert zu sein. Aus welchem Grund? John Davidge verweigert den Befehl und setzt damit nicht nur seine Karriere aufs Spiel. Erst während der Befreiungsaktion, mitten im feindlichen Feuer wird vieles klarer: Der Feind stammt nicht nur aus Afrika – es sind auch Weiße, die die SFO-Kämpfer unter Beschuss nehmen …
Special Force One – Die Antwort der Vereinten Nationen auf den Terror der heutigen Zeit. Ein Spezialkommando, allein zu dem Zweck geschaffen, korrupte Staaten, Flugzeugentführer, Attentäter und Massenmörder zu bekämpfen.
Über die Autoren
An der Romanserie Special Force One haben die Autoren Michael J. Parrish, Roger Clement, Dario Vandis und Marcus Wolf mitgearbeitet. Sie alle haben jahrelange Erfahrung im Schreiben von Action- und Abenteuergeschichten. Durch ihr besonderes Interesse an Militär und Polizei haben sie außerdem fundierte Kenntnisse über militärische Abläufe und ein gutes Gespür für actiongeladene Erzählstoffe.
Michael J. Parrish
Auf verlorener Mission
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2004 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Projektmanagement: Nils Neumeier/Stefan Dagge
Covergestaltung: Massimo Peter unter Verwendung von Motiven © shutterstock/kthepsu | © shutterstock/BPTU | © shutterstock/Kkulikov | © shutterstock/leungchopan | © shutterstock/Aaron Amat
E-Book-Erstellung: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7325-2435-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Auf verlorener Mission
Mambutu, Zentralafrika
Dienstag, 0248 OZ
Dr. William Markobo wagte kaum zu atmen.
Es war eng und unbequem in dem Verschlag. Es stank nach Ratten und Exkrementen; von den harten Steinen, auf denen er lag, ganz zu schweigen. Aber Markobo war klar, dass er unter diesen Bedingungen für jedes Versteck dankbar sein musste.
Gedämpft konnte er die lärmenden Motoren der Schützenpanzer hören und das herrische Gebrüll der Soldaten, die jedes Viertel der Stadt systematisch durchkämmten.
Harrutu hatte seine Elitetruppe losgeschickt, um Markobo zu verhaften. Eigentlich hätte sich Markobo darüber freuen müssen, denn es bedeutete, dass der Präsident ihn als Gegner endlich wahrgenommen hatte. Leider bedeutete es auch, dass er nicht mehr lange leben würde, wenn die Regierungstruppen ihn fassten – denn wer in Harrutus Gefängnis verschwand, der tauchte niemals wieder auf.
Schritte näherten sich.
Markobo drehte den Kopf so, dass er durch die Ritzen zwischen den Bodendielen spähen konnte, unter denen er lag. Normalerweise diente das Versteck unter dem Boden dazu, Lebensmittel vor den Regierungstruppen zu verbergen, die von Zeit zu Zeit plündernd durch das Viertel zogen. Dass nun ein Mensch darin versteckt wurde, zeigte nur, wie schlimm die Lage in Mambutu geworden war, seit das Kriegsrecht verhängt worden war.
Unter den Augen der Ausländer, die sich bis vor wenigen Monaten noch im Land aufgehalten hatten, hätte Harrutu niemals gewagt, seine Pläne durchzusetzen. Nun jedoch, nachdem sämtliche westlichen Länder ihre Botschafter abgezogen hatten und auch keine ausländische Presse mehr in Mambutu weilte, hatte Harrutu freie Hand – und das nutzte er skrupellos aus.
Markobo wusste nicht, wie viele Menschen den Razzien der Regierungstruppen allein in den letzten beiden Wochen zum Opfer gefallen waren. Unter dem Vorwand geheimdienstlicher Ermittlungen wurde entführt, geplündert, gemordet und vergewaltigt. Als einzige Stimme der Opposition hatte Markobo die Stimme gegen Harrutus Willkür erhoben.
Am Anfang hatte man ihn noch belächelt und ignoriert – aber nach dem Auftritt auf dem Platz der Afrikanischen Revolution, zu dem Zehntausende aufgebrachter Bürger erschienen waren, um gegen die Regierung zu protestieren, hatte sich dies schlagartig geändert.
Mit Waffengewalt war die Versammlung aufgelöst worden. Wahllos hatten Harrutus Soldaten in die Menge gefeuert, hatten Alte, Frauen und Kinder getroffen. Danach hatten die Verhaftungen begonnen – und es hatte bis heute nicht aufgehört. Tag und Nacht patrouillierten Panzer in den Siedlungen, Strafkommandos suchten die Dörfer heim. Wer sich widersetzte, der hatte keine Gnade zu erwarten, wer verdächtig war, der wurde verhaftet.
Es war nicht Markobos Art, sich feige zu verstecken, aber seine Anhänger hatten ihn überzeugt, dass er leben musste, wenn das Volk von Mambutu eine Chance haben sollte. Er musste versuchen, das Land zu verlassen und sich nach Europa durchzuschlagen. Dort musste er mit dem, was er wusste, an die Öffentlichkeit gehen. Die westliche Welt musste erfahren, was in Mambutu vor sich ging, dann würde sie sicher Hilfe schicken.
Europa.
Markobo verzog das Gesicht.
Im Augenblick war der europäische Kontinent für ihn so unerreichbar wie der Mond. Denn in dieser Nacht sah es so aus, als könnte er nicht einmal dieses dunkle Loch verlassen.
Das Motorengeräusch hatte plötzlich gestoppt. Der Panzer hatte unmittelbar vor Padanbas Haus angehalten.
Trotz der Enge des Verstecks versuchte Markobo, ruhig zu bleiben und sich zu entspannen. Zur Sicherheit hatte Padanba seine Frau und seine sieben Kinder hinaus aufs Land geschickt. Nur er war zu Hause – und der heimliche Gast, den er unter Einsatz seines eigenen Lebens unter dem Fußboden seiner Hütte beherbergte.
Dumpf pochte es an die Tür.
Markobo begann leise zu beten.
Padanbas Schritte waren zu hören, sein Schatten fiel auf die Bodendielen. Der hölzerne Riegel wurde zurückgezogen, und trampelnde Stiefel waren zu hören, der Fußboden erzitterte.
»Bist du Padanba?«
»J-ja.« Die Stimme des Freundes klang brüchig.
»Wo ist er? Wo hältst du ihn versteckt?«
»Wen?«
»Markobo! Wir wissen, dass er hier ist!«
Unter dem Boden hielt Markobo den Atem an.
Sie konnten es nicht wissen.
Er hatte niemandem gesagt, dass er zu Padanba gehen würde. Es war nur ein Bluff – hoffentlich fiel Padanba nicht darauf herein …
»Dann wurdet Ihr falsch informiert, Bwana«, gab Padanba klugerweise zurück und mit der Unterwürfigkeit, die die Regierungssoldaten für sich in Anspruch nahmen.
»Aber du bist sein Freund.«
»Markobo hat viele Freunde.«
»Ja, aber auch einen Feind – und der möchte ihn haben, tot oder lebendig«, gab der Sergeant zurück. »Los, Männer, durchsucht das Haus. Durchkämmt jeden einzelnen Winkel.«
»Nur zu, Bwana«, sagte Padanba und verbeugte sich. »Mein Haus ist das Eure.«
»Gut, Männer«, knurrte der Sergeant. »Wenn das so ist, dann nehmt euch, was euch gefällt. Sicher findet ihr in diesem Rattenloch auch was Essbares.«
»Aber …«
»Bist du etwa anderer Ansicht, Padanba? Möchtest du Präsident Harrutu etwa nicht jede Unterstützung zukommen lassen, die er braucht?«
»N-natürlich.«
»Also dann. Nehmt euch, was ihr haben wollt, Männer. Dann gehen wir – und sei zufrieden, Padanba, dass wir dir nicht die Bude über dem Kopf anzünden.«
Der Sergeant lachte rau, und Markobo war voller Mitleid für seinen Freund. Die Dielen erzitterten, als die Soldaten darüber hinwegtrampelten, und durch die Ritzen konnte Markobo Blicke auf ihre Uniformen und die Gewehre erheischen, die sie schussbereit über der Schulter hängen hatten – nagelneue Waffen aus russischer Produktion, nicht angerostete AK47-Gewehre, wie der Rest der Armee sie hatte.
Es rumpelte und krachte, hier und dort klirrte ein Gefäß, das die Soldaten zerschlugen. Nachdem sie die Stube und die beiden angrenzenden Schlafräume durchsucht und sich vergewissert hatten, dass Padanba niemanden unter seinem Dach verbarg, zogen sich die Soldaten wieder zurück.
»Also gut, Padanba«, hörte Markobo den Sergeanten sagen, »dann müssen wir wohl davon ausgehen, dass du ein loyaler Anhänger unseres Präsidenten bist.«
»Natürlich.« Padanba verbeugte sich untertänig. »Präsident Harrutu gehört meine ganze Loyalität, für immer und ewig.«
Der Sergeant erwiderte etwas Unverständliches und schickte sich dann an, das Haus zu verlassen. Dabei trat er direkt über die Dielen, unter denen Markobo lag.
Der Mann im Versteck hielt den Atem an.
Hatte er sich geirrt oder hatte der Sergeant für einen Moment innegehalten? Hatte er sich gewundert, warum diese Diele ein wenig hohler klang als die anderen, wenn man darauf trat?
Von den Soldaten schien es niemand bemerkt zu haben. Sie verließen das Haus, und ihr Vorgesetzter hinderte sie nicht daran. Schon wollte Markobo aufatmen, als der Sergeant seine Pistole zog und sie auf Padanba richtete.
»Eines noch, Padanba.«
»Ja, Bwana?«
»Es heißt, du wärst ziemlich gerissen. Nehmen wir nur mal an, es gäbe ein Versteck in deinem Haus.«
»Ein Versteck, Bwana? Aber es gibt kein Versteck hier.«
»Nehmen wir es nur einmal an. Und nehmen wir weiter an, Markobo würde sich darin verbergen – wie würde er es wohl finden, wenn ich ihn vor die Wahl stellen würde, sich entweder zu ergeben oder dich zu erschießen?«
Markobos Herzschlag wollte aussetzen.
Der Sergeant hatte etwas bemerkt, und nun trieb er sein sadistisches Spiel.
»Wie nun, Bwana?«, hörte er seinen Freund kaltschnäuzig sagen. »Da sich Dr. Markobo nicht in meinem Haus befindet, kann er sich auch nicht melden, wenn Ihr mich erschießt, richtig?«
»Richtig«, gab der Sergeant zurück, den Lauf der Pistole nach wie vor auf Padanbas Stirn gerichtet. »Andererseits würde ich zu gerne wissen, ob …«
Markobos Hände zitterten.
Er wusste, dass er verloren war, wenn er sich meldete, dass sein ganzes Land verloren war. Aber er wollte auch nicht, dass ein Freund seinetwegen starb, der Vater von sieben Kindern war. Was war der Kampf wert, den er führte, wenn er mit Padanbas Blut erkauft werden musste?
Die beiden Stimmen in ihm rangen noch, als plötzlich ein scharfer, durchdringender Knall erklang.
Entsetzen packte Markobo, und durch den Spalt zwischen den Dielen sah er nichts als Rot. Rotes Blut, das die Lehmwand besudelte. Dann ein dumpfer Schlag, als der leblose Körper seines Freundes auf die Dielen fiel – so, dass sein leerer, verzweifelter Blick durch die Ritze starrte.
Markobo konnte nicht anders, als vor Entsetzen laut zu schreien – und wusste, dass er sich verraten hatte.
Sofort waren die trampelnden Stiefel wieder über ihm. Padanbas lebloser Körper wurde achtlos beiseite geräumt, im nächsten Moment machten grobe Hände sich daran, die morschen Bodendielen aufzureißen.
Markobo wusste, dass es vorbei war.
Einen Augenblick lang erwog er noch, das Gift zu schlucken, das eine alte Medizinfrau ihm gegeben hatte für den Fall, dass die Regierungstruppen ihn fassten – aber im nächsten Moment wurden die schützenden Planken bereits weggerissen. Licht fiel in das Versteck, und Markobo blickte in ein halbes Dutzend schussbereiter Sturmgewehre.
»Sieh an«, sagte der Sergeant, dessen Gesicht Markobo nun zum ersten Mal erblickte – eine glatte, haarlose Visage mit kantigem, brutalem Kinn. »Je später der Abend, desto unerwarteter die Gäste.«
***
Fort Conroy, South Carolina
Eine Woche später
»Und?«
John Davidge sagte nur dieses eine Wort, während er fragend den Brief hochhielt, den er von der Schulleitung erhalten hatte.
Mit demütig gesenktem Haupt stand Ben vor ihm. Eine Antwort blieb der Junge jedoch schuldig.
Ben war Davidges Sohn – mehr oder weniger.
Davidges leiblicher Sohn Kevin war vor vielen Jahren Opfer eines Verkehrsunfalls geworden. Sein Tod gehörte zu den Dingen, über die der Colonel vermutlich nie in seinem Leben hinwegkommen würde. Aber Ben hatte ihm geholfen, den Mut zum Weiterleben zu finden.
Ursprünglich stammte der Junge aus Afrika.
Während des ersten Einsatzes der neu gegründeten Spezialeinheit Special Force One, zu deren erstem Gruppenführer Davidge bestellt worden war, war der Junge dem Colonel und seinen Leuten eine unentbehrliche Hilfe gewesen – und das, obwohl er weder Heimat noch Familie gehabt hatte. Ben war Kindersoldat gewesen, mit allen schrecklichen Konsequenzen, die dieses Wort beinhaltete.
Seine Familie war von Rebellentruppen getötet worden, er selbst zusammen mit den anderen Jungen des Dorfes in eine Uniform gesteckt und zwangsrekrutiert worden. Obwohl er noch ein Kind gewesen war, hatte Ben kämpfen und töten müssen wie ein erwachsener Soldat. Er hatte seine Freunde sterben sehen und Dinge miterlebt, die unaussprechlich waren. Dennoch hatte es der Junge irgendwie geschafft, sich einen letzten Rest an Güte und Menschlichkeit zu bewahren. Er hatte seinem falschen Ziehvater, dem General, den Rücken gekehrt und sich auf die Seite der SFO-Kämpfer geschlagen – und als es am Ende daran gegangen war, Abschied zu nehmen, hatte Davidge es nicht über sich gebracht, sich von Ben zu trennen.
Er hatte dem Jungen angeboten, ihn mit zu sich in die Staaten zu nehmen und ihn an Kindes statt zu adoptieren – und Ben hatte eingewilligt. Für den Jungen war es ein Start in ein neues Leben gewesen, und auch für Davidge und seine Frau Susan hatte der Junge nach Jahren der Trauer einen Neuanfang bedeutet. Wenn sie allerdings geglaubt hatten, es würde einfach werden, so hatten sie sich geirrt.
Nach außen mochte Ben ein aufgeweckter, freundlicher Junge sein, der jedes Geschenk, das man ihm machte, dankbar annahm und sich an alltäglichen Dingen wie einem Hot Dog oder einem Kinobesuch herzerwärmend freuen konnte. Aber die Zeit als Kindersoldat hatte bei ihm Narben hinterlassen, die tiefer lagen – Narben, die Davidge und seine Frau nicht alleine heilen konnten.
Sie hatten die Hilfe eines Psychotherapeuten in Anspruch genommen, den Ben zweimal die Woche besuchte, um seine traumatischen Erlebnisse im afrikanischen Busch zu verarbeiten. Je länger die Sitzungen dauerten, desto mehr grässliche Details kamen ans Licht, und desto mehr wunderte sich Davidge darüber, dass der Junge überhaupt noch etwas wie Liebe und Dankbarkeit empfinden konnte.
Umso argwöhnischer beobachtete er den Jungen, ob er Hinweise auf auffälliges Verhalten zeigte. Von Bens Klassenlehrer wusste Davidge, dass Ben dazu neigte, Konfliktsituationen eher mit den Fäusten als mit Worten zu bereinigen. Sie hatten mehrfach über das Problem gesprochen, und Davidge hatte eigentlich gehofft, es beigelegt zu haben.
Und nun dieser blaue Brief.
»Du weißt, was drinsteht?«
»Ja, Dad«, erwiderte der Junge leise. Er nannte Davidge seinen »Dad«, aber der Colonel fragte sich, ob Ben je gelernt hatte, was dieses Wort tatsächlich bedeutete.
»Und? Was hast du dazu zu sagen?«
»Nichts.«
»Nichts? Du verprügelst einen deiner Mitschüler derart, dass seine Nase gebrochen ist und sein Kinn mit drei Stichen genäht werden muss, und alles, was dir dazu einfällt, ist ‚Nichts’?«
Der Junge schüttelte den Kopf, was immer das heißen mochte.
Davidge seufzte. »Ben«, sagte er leise, »ich dachte, wir hätten über diese Dinge gesprochen. Man löst Konflikte nicht dadurch, dass man Gewalt anwendet.«
Ben blickte auf. »Aber du bist Soldat, oder nicht?«
»Allerdings.«
»Soldaten wenden auch Gewalt an.«
»Das stimmt, leider. Aber nicht, weil uns jemands Nase nicht passt. Wir haben eine Mission, für die wir kämpfen. Einen Auftrag. Und wir wenden Gewalt nur dann an, wenn es sich nicht vermeiden lässt.«
»Caruso hat etwas anderes gesagt.«
»Vergiss, was Caruso gesagt hat«, schnaubte Davidge. »Ich bin sein Vorgesetzter, und ich bin dein Dad. Damit habt ihr alle beide zu tun, was ich sage, verstanden?«
Ein zögerndes Nicken.
»Direktor Bentley verlangt in dem Schreiben, dass du ins Krankenhaus fährst und dich bei dem Jungen und seiner Familie entschuldigst.«
»Nein.«
»Ben!«
»Nein, Dad. Ich werde auf gar keinen Fall ins Krankenhaus fahren. Jimmy Smythe ist ein Dummkopf. Er hat bekommen, was er verdient hat.«
»Wer sagt das?«
»Ich.«
»Weil du der Stärkere bist? Weil du besser zuschlagen kannst als er?«
»Nein, weil …«
»Junge«, sagte Davidge beschwörend, »ich habe es dir schon einmal erklärt. Der Krieg ist für dich vorbei. Du brauchst hier keine Angst mehr zu haben. Du brauchst nicht mehr zu kämpfen. Wir alle sind für dich da und beschützen dich – deine Mom und ich, Lieutenant Harrer und Lieutenant Leblanc.«
»Und Caruso?«
»Meinethalben auch Sergeant Caruso«, brummte Davidge. Es gefiel ihm nicht besonders, dass sich sein Ziehsohn ausgerechnet mit dem italienischen Waffenspezialisten angefreundet hatte, dessen Mundwerk ein wenig schneller zu feuern pflegte, als sein Gehirn nachladen konnte. Aber auch Caruso war immer noch besser als ein blauer Brief von der Schule.
»Also, mein Junge – willst du mir jetzt nicht endlich erzählen, was sich auf dem Schulhof zugetragen hat? Dann fahren wir anschließend rüber ins Krankenhaus und schaffen die Sache aus der Welt.«
»Sie ist aus der Welt geschafft«, erklärte Ben kurzerhand. »Ich habe seine Nase gebrochen.«
»Und du scheinst auch noch stolz darauf zu sein, verdammt noch mal.« Allmählich wurde es Davidge zu bunt. »Habe ich dir nicht tausendmal eingeschärft, dass man nicht einfach drauflos schlagen kann, wie es einem passt? Wir sind hier in einem zivilisierten Land, verdammt noch mal, und nicht mehr im Busch.«
»Du hast selbst gesagt, dass es Gründe gibt, sich zu wehren.«
»Allerdings«, schnaubte Davidge. »Wenn dein Leben bedroht ist. Oder das eines Freundes oder deiner Familie. Hat Jimmy Smythe dich oder einen von uns bedroht?«
Kopfschütteln.