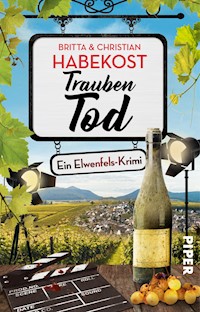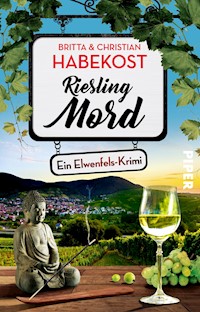9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Julien Vioric
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ein kriegsversehrter Ermittler, ein Mörder unter Künstlern und eine Stadt am Abgrund ...
Paris im Dezember 1924: Es ist ein bitterkalter Morgen, als die Leiche des sechzehnjährigen Clément Faucogney am Place du Panthéon entdeckt wird. Der Anblick des entstellten Körpers ist selbst für Ermittler Julien Vioric kaum zu ertragen – und er ist den Schützengräben von Flandern nur knapp entronnen. Die Beweise führen Vioric in die Passage de l’Opéra, zu einer jungen Frau, die sich auf der Suche nach ihrer Schwester in größte Gefahr begeben hat. Doch noch weiß sie nichts davon. Sie ist bereits dem Charme der Pariser Dichter und der betörenden Schönheit der Stadt verfallen. Nicht ahnend, dass sie der Schlüssel zu allem ist. Nicht ahnend, dass sie bereits im Visier des Mörders steht ...
Bildgewaltig schreibt Britta Habekost über das historische Paris der Surrealisten, das von einem grausamen Serienmörder heimgesucht wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Ähnliche
Britta Habekost, geboren 1982 in Heilbronn, studierte Literatur sowie Kunstgeschichte und arbeitete unter anderem als Museumsführerin. Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für surrealistische Dichter wie André Breton und Louis Aragon, die sie in ihrem historischen Kriminalroman »Stadt der Mörder« gekonnt durch die Szenerie wandeln lässt. Wenn sie nicht gerade an einem Buch schreibt, reist sie mit ihrem Mann durch Asien.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
BRITTAHABEKOST
Stadtder
Mörder
KRIMINALROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Zitat <hier> nach Lautréamont:
Die Gesänge des Maldoror. Neuausgabe.
Rowohlt Verlag. Reinbek bei Hamburg 2004, S. 223.
Zitat auf Seite <hier> nach Aragon, Louis:
Der Pariser Bauer. Suhrkamp Verlag. Berlin 2019, S. 74.
Copyright © 2021 der Originalausgabe by Britta Habekost
Copyright © 2021 by Penguin Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: Favoritbüro
Umschlagmotiv: © Dorota Gorecka/Archangel;
© Andrew Davis/Trevillion Images,
© Mark Owen/Trevillion Images ; © sommthink/shutterstock
Redaktion: Sarvin Zakikhani
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-27746-8V001
www.penguin-verlag.de
Für Christian,
der mir die Fabeltiere ans Fenster lockt.
Dieses Buch ist für dich.
Heute bringe ich euch ein Rauschgift,
das von den Randbezirken des Bewusstseins,
von den Grenzen des Abgrunds kommt.
Der Surrealismus, Sohn der Raserei und
der Finsternis. Hereinspaziert, hereinspaziert,
hier beginnen die Reiche des Augenblicklichen.
Louis Aragon
Prolog
Endlich Nacht.
Er durchpflügte die Dunkelheit, die keine war. Auf den Boulevards herrschte sogar um diese späte Stunde ein Nachglanz des Pariser Lichts, diese Mischung aus Pastell und Glas. Tagsüber schmerzte es ihm in den Augen wie Blendgranaten. Nachts war es auszuhalten. Jetzt schwappte das Licht aus den Kohlebecken der belebten Caféterrassen, tropfte von den Laternen und verwandelte die Trottoirs in matte Spiegel.
Er senkte den Kopf und lauschte den Schritten vor sich auf dem Boulevard Haussmann. Tagsüber hörten sich alle Schritte gleich an, aber jetzt, in der geschärften Klarheit der späten Stunde gelang es ihm, den Klang dieser Schritte vom Geklapper und Geschlurfe der anderen Passanten zu trennen. Er folgte der jungen Frau jetzt schon seit einiger Zeit und sah nur ab und an unter dem Schatten seiner Hutkrempe hervor, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Er verließ sich ganz auf das Echo ihrer Schritte auf dem Stein.
Er schwamm hinter ihr wie ein Hai in blutigem Kielwasser.
An einer Häuserecke blieb sie stehen und wartete darauf, die Straße überqueren zu können. Er betrachtete ihren schäbigen grauen Mantel mit den kindlichen aufgestickten Blumen unterhalb der Schultern. Viel zu dünn für den strengen Pariser Winter.
Als sie weiterlief, hatte er aufgeholt und war nun so nah, dass er die abgetretenen Sohlen ihrer ebenfalls viel zu dünnen Schuhe sehen konnte.
Ein armes Mädchen vom Land, das im Schlund dieser Stadt verschwinden würde, auch ganz ohne sein Zutun.
Aber er würde nichts übereilen. Ihm gefiel es, ihren hastigen und gleichzeitig müden Schritten zu folgen und sie wahrzunehmen, wie ein Raubvogel seine huschende Beute wahrnahm.
Die junge Frau lief weiter, und für einen Moment hatte er den Verdacht, dass sie eine dieser typischen Pariser Gestalten war, die immerzu nur liefen, die Stadt laufend durchmaßen und niemals irgendwo ankamen.
So wie er.
Er hatte einen grässlichen Nachgeschmack von Absinth in seinem Mund, und in seinen Adern breiteten sich die Wohltaten chemischer Engel aus. Er hatte genug Heroin intus, um ihr die ganze Nacht durch Paris zu folgen. Und genug, um auch andere Dinge zu tun, ohne die kleinste Kraftanstrengung, ohne Reue oder Bedauern.
In seinem Gesichtsfeld verschwammen die Schemen der anderen Passanten. Aufgekratzte Frauen in Pelzmänteln, betrunkene Exilamerikaner, großmäulige Intellektuelle. Musik drang aus den Cafés, und zufällig zusammengewürfelte Paare zogen von dannen.
Er kannte dieses Spiel, und es widerte ihn an. Er sah diese zerfasernden Schatten im Augenwinkel und kam sich vor wie jemand, der alleine die Arktis durchquert.
Diese Leute waren nur Staffage. Was ihn interessierte, war die kleine Gestalt in dem erbärmlichen grauen Mantel. Eine Weile ließ er zu, dass der Abstand zwischen ihnen etwas größer wurde, dann holte er wieder auf. An einer weiteren Straßenecke stellte er sich neben sie und sah sie offen von der Seite an. Aber ihre Augen schienen noch weniger von ihrer Umwelt wahrzunehmen als seine. Und er wusste, wenn sie seinem Blick begegnet wäre, wäre sie bis auf die Knochen erschauert.
Er betrachtete ihre kleinen Hände, die eine altmodische Gobelinhandtasche fest umklammerten, und stellte sich vor, wie diese Hände versuchen würden, sich vergeblich gegen ihn zu wehren.
Ihn überkam der Wunsch, sie jetzt schon zu berühren, nur flüchtig. Stattdessen ließ er sie wieder ein Stück vorausgehen. Die Kleine trug einen samtig schimmernden Hut, und er ertappte sich dabei, sich zu wünschen, ihre Haare zu berühren. Ihre weichen, unter dem Hut gewiss ein wenig warmen und feuchten Haare. Und dabei in ihre geweiteten Augen zu sehen.
Die Gnadenlosigkeit dieser Vorstellung beschleunigte seinen Atem.
So langsam ahnte er, wohin sie ihn führen würde. Ein Mädchen wie sie konnte sich kein anständiges Zimmer leisten, geschweige denn ein Hotel. Ihr Gang wurde entschlossener, und er wusste, sie wäre bald an ihrem Ziel.
Er holte auf.
Natürlich bog sie in eine der Passagen ab, er hatte es geahnt.
Dort, in diesen Gewächshäusern von Paris, unter den schmutzigen Glasdächern, residierten die kleinen Leute. Sie waren winzige Gefäße in dem pulsierenden Herzmuskel der Stadt. Ja, die kleine, schnöde Welt der Passage de l'Opéra. Ein perfekter Ort für das, was er mit ihr zu tun gedachte.
Sie schlüpfte in den finsteren Gang, wo ihre Schritte leise hämmerten. Hier waren die Cafés bereits geschlossen, nur vor einer tristen Bar saßen noch einige Nachtschwärmer. Unter den Dachstreben gurrten verschlafen ein paar Tauben. Dieser Ort erregte ihn auf eine dunkle, drängende Weise.
Da, jetzt bog sie in einen Gang ab. Plötzlich spürte er Ungeduld und das Bedürfnis, sich ihr nicht erst vor ihrer Zimmertür, sondern schon auf der Treppe zu zeigen. Er hatte sie aus den Augen verloren, hörte nur noch das leiser werdende Echo ihrer Schritte. Er lief schneller, eilte ihr nach und prallte im nächsten Moment gegen drei Männer, die laut johlend und singend die Passage durchquerten. Schlagartige Wut ließ seine mühsam erzwungene Ruhe beinahe zerbersten. Er wich zur Seite aus, und seine Hände krümmten sich in den Manteltaschen zu Klauen.
Die drei machten Anstalten, auszuweichen, trieben ihre Späße mit ihm und lachten. Er drängte sich an ihnen vorbei und zerbiss einen Fluch.
Natürlich hatte er sie verloren. Die Passage lag wie ein stiller Tunnel vor ihm, ihre Schritte waren verklungen. Aber er spürte, dass sie hier irgendwo war, irgendwo in einem der Treppenaufgänge, die zu den kleinen, billigen Zimmern hinaufführten.
Er hätte die drei Männer am liebsten auf der Stelle mit bloßen Händen zerrissen; ihr Johlen klang unter den Glasdächern noch immer nach. Aber dann kam ihm ein Gedanke, der ihn milde stimmte.
Er wusste nun, wo er sie finden konnte, und es würde einen besseren, einen perfekten Moment geben, um sich ihr erneut zu nähern. Er lehnte sich gegen eines der Ladenfenster und ließ seinen Atem zur Ruhe kommen. Dann stellte er sich wieder vor, ihre Haare zu berühren, aber der Gedanke war ohne Zärtlichkeit und lag wie ein aufschnappendes Messer in seinem Geist.
1
15. Dezember 1924, im Morgengrauen
Das buttergelbe Licht der Gaslaternen am Place du Panthéon spiegelte sich in den Messingknöpfen der Gendarmen und tropfte dann hinab in das Grau der Pflastersteine. Doch weder die schwachen Lichtflecken noch das unbarmherzige sechsmalige Läuten der Saint-Étienne-du-Mont waren in der Lage, diesem Dezembermorgen die Düsternis auszutreiben.
Lieutenant Julien Vioric legte den Kopf schief. Er wäre in die Hocke gegangen, um besser sehen zu können. Aber der Anblick war selbst für einen Mann, der glaubte, die fürchterlichsten Dinge bereits gesehen zu haben, zu viel. Vor ihm lag ein entstellter menschlicher Körper in einem Jutesack. Bisher hatte sich Vioric noch jede Tat erklären können, und war sie noch so grausam gewesen. Aber das hier?
Sein Freund und Kollege Tusson stieß Vioric an. »Ist das der adelige Bengel?«
Wie immer war Tusson gut informiert und wusste, dass Vioric mit der Suche nach einem verschwundenen jungen Mann betraut worden war. Bei dem Vermissten handelte es sich um den sechzehnjährigen Sohn der adeligen Familie de Faucogney.
»Das könnte wirklich jeder sein«, erwiderte Vioric. Aus dem Sack sah etwas hervor, das nach allen Regeln der Vernunft einmal ein menschlicher Kopf gewesen sein musste.
Tusson zündete sich eine Zigarette an und zog so heftig daran, dass die Glut knisterte.
»Was weißt du über den Jungen?«
»Über Clément Faucogney? Nicht besonders viel. Nur dass er zweimal wöchentlich von seiner Gouvernante zu seiner Fechtstunde begleitet wurde«, sagte Vioric leise. »Die junge Dame ist seither übrigens ebenfalls spurlos verschwunden.«
»Ein Sechzehnjähriger, der von seiner Gouvernante begleitet wird? Verwöhntes Bürschchen.« Tusson zupfte sich einen Tabakkrümel von der Zunge und wandte sich wieder der Leiche zu, bevor er hinzufügte: »Fechten! Kannst du dir das vorstellen, Julien? Alles, was heutzutage auch nur entfernt an ein Bajonett erinnert, gehört auf den Müllberg der Geschichte.«
Wie auch so manche althergebrachte Verhaltensregel in Liebesdingen, dachte Vioric. Im Hause des jungen Clément wurde hinter vorgehaltener Hand der Verdacht geäußert, die Gouvernante habe womöglich eine kopflose Liaison mit dem Bürschchen gehabt. Vioric hatte insgeheim gehofft, dass die beiden durchgebrannt waren und zumindest der Junge bald wieder reuig zur Familie zurückkehren würde. Aber das war leider nicht geschehen.
Die Polizisten sahen sich einer Wand aus Menschen gegenüber, die trotz Eiseskälte und unverschämter Frühe so aufgeregt wirkten wie Zuschauer bei einem Hundekampf. Viorics Blick glitt über die Menge. Auf Fußspitzen tänzelnde Neugierde ließ die Reihen hin und her wogen.
Vioric erkannte ein paar der jungen Frauen, die in den Cafés im fünften Arrondissement bedienten: seine flüchtigen Bekannten etlicher einsamer Mittagessen. Alle wirkten seltsam uniformiert mit ihren Glockenhüten aus Wolle und Filz, und deswegen fiel ihm Héloïse Girard, die Fotografin und Journalistin vom Figaro auch gleich auf. Auf ihrem Haupt thronte eine honiggelbe Cloche, die so leuchtete, dass sie damit das Gedränge um sie herum auf Abstand zu halten schien.
Als Girard seinen Blick auffing, warf sie ihm eine Kusshand zu und hob die Ermanox-Kamera vor ihr wie immer glamourös geschminktes Gesicht. Vioric senkte den Kopf und zog den Hut tiefer in die Stirn. Diese Frau war eine einzige Provokation, nicht bloß was ihre penetrante Farbenliebe anging. Vioric fühlte sich heute von der unbekümmerten guten Laune, die von ihr ausging, beinahe ein wenig beleidigt. Heute war ein blutig-grauer Tag und nicht durch ein paar schrille Farbtupfer zu retten.
Tusson winkte einen der umstehenden Gardiens zu sich. »Murier, mein Junge. Holen Sie mal irgendetwas, das man zwischen den Toten und die Menge stellen kann!« Der sehr junge, blasse Polizist hastete davon.
Er erleichterte eine Wäscherin, die gerade mit einem kleinen Handwagen am Rand des Platzes vorbeikam, um eines ihrer Leintücher.
»Gut gemacht«, sagte Vioric.
»Danke, Lieutenant.« Etwas dünnes, schüchternes Stimmchen. Aber seine Augen blitzten heller als die Messingknöpfe an seinem dunklen Mantel.
»Halten Sie das Tuch hoch«, befahl Tusson ihm und dem Gardien, der Murier am nächsten stand. Die beiden taten wie geheißen, die Menge murrte.
Vioric ging neben Tusson in die Hocke und wünschte sich ein Paar dieser Latexhandschuhe, die man in der Gerichtsmedizin einsetzte, aber die waren für Polizisten nicht vorgesehen. Er betrachtete bedauernd seine geliebten Lederhandschuhe und zögerte. Bring es hinter dich, dachte er. Sein Herz versank für einen kurzen Moment in einer Art Leere, ehe es mit einem raschen Stolpern wieder seinen Takt fand. Vioric warf einen Blick auf Tusson, der reglos nach unten schaute.
»Hilfst du mir, den Burschen aus dem Sack zu ziehen?« Tusson nickte widerwillig.
Als die Leiche vor ihnen auf dem Boden lag, machte Vioric dem Polizeifotografen Platz, der die Szenerie mit Blitzlicht überzog.
Tusson richtete sich wieder auf. Die nächste Zigarette fand den Weg zwischen seine dünnen, von einem rötlichen Bart umrahmten Lippen. »Ich seh mir mal die Umgebung an.«
»Vorsichtig, der Taschenkrebs!«, rief ein Gardien.
»Was?« Tusson wich dem Tier gerade noch aus. Er lag nur wenige Meter von der offenen Seite des Sackes entfernt. »Mon dieu, Vioric! Was macht der denn hier?« Er besah sich das Tier genauer. Es war tot. Ein Riss durchlief den Panzer. »Auf dem Fischmarkt im Marché Saint-Quentin und in den Fischläden in Les Halles gibt es hervorragende Tiere. Mit Gurkensalat und Rettich ergeben sie ein wunderbares Mittagessen …«
»Tusson!«
»Verzeihung die Herren«, kam es hinter dem Tuch hervor, das zwar frisch gewaschen duftete, aber nicht gegen den Gestank dessen ankam, was sich im Sack befand. »Wir können unsere Arme nicht mehr lange oben halten.«
Tusson winkte zwei weitere Gardiens zur Ablösung heran. Dann stieg er über die Leiche und näherte sich den speerartigen Eisenzacken am Zaun vor der Treppe zum Panthéon. »Ha!«, rief er und deutete mit der Zigarette auf eine der Spitzen. »Hier hängt was, ein paar Fasern vielleicht!«
»Geht’s vielleicht noch lauter?«, zischte Vioric. »Willst du, dass Mademoiselle Girard das als Untertitel für einen ihrer Schnappschüsse benutzt?«
Julien Vioric konnte den Blick kaum von dem verdrehten Körper abwenden. Er erkannte Verletzungen, wie er sie auch in Flandern gesehen hatte, aber da waren Granaten für geborstene Rippen verantwortlich gewesen. Vioric war erleichtert, als Doktor Durand von der Gerichtsmedizin endlich kam.
»Doktor Durand, können Sie mir sagen, ob der Junge ein schmetterlingsförmiges Muttermal am Steißbein hat? Dann habe ich alles, was ich für den Moment brauche.«
»Sie haben wohl schon einen Verdacht, um wen es sich hier handelt, Lieutenant?«
»Es könnte Clément Faucogney sein. Er kehrte vor fünf Tagen nicht mehr vom Fechtunterricht zurück. Wie sich herausstellte, lag sein Lehrer mit Darmkatarrh im Bett, und seit dieser abgesagten Stunde wird der Junge vermisst. Seine Mutter wurde gebeten, ein eindeutiges Körpermerkmal ihres Sohnes zu nennen, falls man eine nicht zu identifizierende Leiche findet. Sie nannte besagtes Muttermal.«
Doktor Durand nickte und wandte seine Aufmerksamkeit dem Opfer zu.
»Ich habe schon viele Leichen gesehen, aber das hier – wenn es nur ein bisschen anders aussehen würde, würde ich sagen, der Junge wurde von einem Automobil überfahren. Oder wurde vor eine U-Bahn geworfen. Warten Sie einen Augenblick.« Der Doktor nahm ein paar Untersuchungen vor, deren Anblick Vioric sich ersparte. Er stand auf und trat zu dem jungen Murier.
»Ich denke, wir sollten einander kennen, wenn uns das Schicksal schon hier bei diesem armen Teufel zusammenwürfelt. Lieutenant Julien Vioric, mein Name.«
Der junge Gardien nickte. »Stéphane Murier, Gardien de la paix stagiaire, Lieutenant Vioric!«
»Woher kommen Sie?«
»Aus Antibes.«
Vioric zuckte zusammen. »Antibes? Ist das Ihr Ernst?«
Murier nickte.
»Was zum Teufel brachte Sie dazu, sich nach Paris zu begeben?«
»Meine Eltern sind an der Spanischen Grippe gestorben. Und Paris? Lieutenant, jeder will doch nach Paris.«
Tusson gesellte sich zu ihnen. »Ja, vor allem Amerikaner, weil sie sich bei uns noch betrinken dürfen.« Tusson hatte nichts übrig für die zehntausenden Exilanten aus der neuen Welt, die neuerdings Paris bevölkerten, weil sich die Stadt seit dem Krieg auf eine Weise gemausert hatte, die Vioric nicht hätte beschreiben können.
»Manche sind auch hier, um Bücher zu schreiben«, beteuerte Murier, als müsste er die vermeintlichen Flüchtlinge der amerikanischen Prohibition in Schutz nehmen. »Mein Mitbewohner zum Beispiel schreibt einen Roman über …«
»Wie alt sind Sie?«, unterbrach ihn Vioric.
»Einundzwanzig.«
»Du meine Güte.«
»Lieutenant?«
»Nun, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, aber vielleicht kann ich Sie irgendwann dazu überreden, zurück nach Antibes zu gehen. Sie wollen doch nicht Ihr junges Leben dieser Stadt zum Fraß vorwerfen.« Er zwinkerte Murier zu und warf anschließend einen Blick über die Schulter. Der Doktor schien sich den Sack, in dem der Junge gefunden worden war, genauer anzusehen.
»Packen Sie den Taschenkrebs ein, Murier?«
»Natürlich.«
Vioric gesellte sich zum Doktor. Über die Leiche gebeugt, versuchte er seine Kenntnisse menschlicher Anatomie mit dem in Einklang zu bringen, was er vor sich sah. Aber er gab es bald wieder auf. Im Körper dieses Jungen war kein Knochen mehr heil, das erkannte er auch ohne Medizinstudium. Der Gerichtsmediziner schüttelte immer wieder den Kopf beim Anblick der blauen Flecken und Schwellungen, die Brustkorb und Oberschenkel der Leiche überzogen. Vioric ahnte, was der Fachmann dachte. Der Junge hatte noch eine Weile gelebt während der Prozedur, derer man ihn unterzogen hatte.
Der Gerichtsmediziner schob den Kiefer des Jungen auseinander und tastete sich tief bis in den Rachen vor. »Sehen Sie sich das an, Vioric.«
Durand zog ein blutiges, rundes Holzstück hervor.
»Er war geknebelt. Das lässt zumindest hoffen, dass er durch den Sauerstoffmangel recht schnell das Bewusstsein verloren hat.«
Vioric hatte genug gesehen. Er ging zu Tusson, neben dem der Polizeifotograf mittlerweile das Gitter vor der Treppe ablichtete.
»Ich glaube, hier haben wir Blutspuren.« Tusson betrachtete die Flecken wie ein Maler, der sich eine Bildkomposition ausdenkt. »Also, wenn du meine bescheidene Theorie hören möchtest, Vioric – und danach sage ich nichts mehr, weil ich hier offiziell gar nicht ermittle …«
»Stimmt, du untersuchst derzeit diese nächtlichen Einbrüche, bei denen nie etwas gestohlen und nie jemand umgebracht wird.«
»Mach dich nicht lustig darüber. Es sind mittlerweile vier Kinder, denen nachts von einem Irren die Brust zerkratzt wurde. Frag deinen Bruder doch selbst. Der Herr Polizeipräfekt wird dir bestätigen, dass diese Fälle unsere schöne Stadt ebenso in Aufruhr versetzen können wie tote adelige Bürschchen.« Tusson deutete auf die Eisenstreben. »Irgendjemand hat den Körper gegen diesen Zaun hier geschleudert. Siehst du die abgerissenen Fasern der Sackleinen hier? Und das Blut da unten? Ich würde sagen, der Täter stand hier drüben und hat den Sack in dieser Höhe gegen die Zaunstäbe geschleudert. Schau hier, diese kleine Metallverbindung ist dabei aus den Zwischenräumen gebrochen. Du kannst dir die Kraft vorstellen, mit der das hier passiert ist?«
»Das müsste ein Riese gewesen sein.« Vioric hatte Mühe, sich das groteske Schauspiel vorzustellen. »Wie soll das bitte gehen?«
Tusson klopfte sich Asche von seinem Revers. Sein Jackett war derart speckig, dass seine Oberfläche beinahe an Leder erinnerte. Vioric stellte fröstelnd den Kragen seines eigenen Mantels hoch. Die Morgendämmerung hatte dem Tag noch nicht das Feld überlassen, und der Frost schien den Dunst der Stadt in Eis zu verwandeln.
»Ein Kerl mit großer Kraft und einer gewaltigen Statur«, dachte Tusson laut nach. »Du kennst doch diesen Metzger von den Schlachthöfen in La Villette, der uns immer die Würste für die Weihnachtsfeier liefert. Diesen absurd großen Kerl mit den Schaufelhänden. Von so einem Exemplar reden wir hier. Oder von jemandem, der völlig der Raserei anheimgefallen ist.«
Vioric rammte die Hände in seine Taschen. »Wieso hat das alles eigentlich niemand mitbekommen?« Er betrachtete die Menschenmenge. Héloïse Girard war nicht mehr die einzige Frau mit auffallender Kopfbedeckung. Ein paar junge Frauen kamen gerade aus der Nacht zurück, und ihre mit Glitzer besetzten Hüte über halb geschlossenen Pelzstolen sahen falsch aus in dem bedrückenden Morgendunst.
»Du weißt doch, wie die Leute sind.« Tusson zuckte mit den Schultern. »Keiner weiß was, keiner will was gesehen haben. Vor allem nachts. Und erst recht bei dieser Kälte.« Viorics Stirn begann zu schmerzen. Er ließ seinen Blick erneut über die Menge schweifen und stellte sich dahinter das Meer bei Antibes vor, das Wintermeer mit rosigem Morgennebel, und er strengte sein Gehör auf der Suche nach Möwenschreien an. Aber er hörte nur Tusson, der weiter spekulierte. »Dieser Mistkerl steht hier vielleicht irgendwo und glotzt uns an.«
Sein Kollege hatte recht. Die ersten Gardiens hatten sich schon längst darangemacht, die Leute zu befragen. Sollte einer der Schaulustigen eine Zeugenaussage machen, würden sie sofort davon erfahren. Irgendwo unter ihnen, auf diesem riesigen, prächtigen Platz im Schatten der französischen Ruhmeshalle, stand er vielleicht. Ein Riese, der einen Winzling zerschmettert hatte. Vioric stellte fest, dass ihm der Gedanke an die kommende Ermittlung bereits jetzt auf den Magen schlug.
Was für eine Botschaft steckte hinter diesem abscheulichen Mord? Viorics Blick verlor sich in der Menschenmenge, deren Neugier nicht abebben wollte. Ihm kam wieder der Taschenkrebs in den Sinn. Hatte den vielleicht doch ein Lieferant auf dem Weg zu einem feinen Restaurant verloren, just an der Stelle, an der kurz darauf ein Mord geschehen sollte? Vioric deutete sich selbst ein Kopfschütteln an. Hinter dem Laken, das die Neugierde der Leute aussperrte, suchten einige seiner Männer das Pflaster nach weiteren Spuren ab. Warum hatte der Mörder den Jungen ausgerechnet auf dem Panthéon getötet? Dieser gigantischen Gruft für berühmte Pariser, die Viorics Meinung nach weit weniger geleistet hatten als jeder einzelne der vier Millionen Verletzten und zwei Millionen Toten, die Frankreich zu diesem Krieg beigesteuert hatte. Plötzlich kam ihm die weiße Trennwand zwischen den Polizisten und der Menge albern vor. Und warum zum Teufel musste dieser kleine Gardien mit seinem nun doch ziemlich aufdringlich duftenden Leintuch ausgerechnet aus Antibes kommen?
»Lieutenant?« Der Doktor machte Vioric ein Zeichen. »Hier unten haben wir einen kleinen Schmetterling.«
Vioric glaubte zuerst, sich die Worte nur eingebildet zu haben, ehe ihm klar wurde, dass Durand damit das Muttermal meinte. Er nickte dem Pathologen dankend zu, aber Tusson sprach aus, was er wirklich dachte. »Verdammte Scheiße. Jetzt darfst du den Mörder eines Adeligen suchen. Dein Bruder wird dich an eine noch kürzere Leine nehmen, und die Action française wird dir auf die Finger schauen. Diesen katholischen Umstürzlern sind ihre adeligen Geldgeber heiliger als ihre eigenen Mütter. Viel Spaß, mein Freund. Ich werde dich hier verlassen und wieder zu meinen zerkratzten Kindern zurückkehren.«
Die Wolken schienen sich wie neugierige Betrachter aus ihren Logen zu wölben und schwer auf Viorics Schultern zu legen. Aber es war der Gedanke an seinen Bruder Edouard Vioric, der ihn am meisten erschöpfte. Er beneidete Paul Tusson. Der klopfte ihm auf den Rücken und lächelte schon wieder süffisant. »Ich kann dir aber, wie du sicher weißt, bei einer anderen Sache behilflich sein.«
»Vergiss es, Tusson. Ich komme nicht mit dir in deine Jazzclubs und zu deinen Nackttänzerinnen.«
»Warum nicht? Nenn mir einen ehrlichen Grund. Tut der Granatsplitter in deiner Schulter zu sehr weh, wenn du dich amüsierst?« Er verzog spöttisch das Gesicht. »Oder hast du beim Anblick von schwarzen Musikern das Gefühl, dieser Krieg wäre umsonst gewesen?«
»Du verwechselst mich mit meinem Bruder, Paul. Ich bin kein Mitglied der Action française. Ich bin … dein Freund.«
»Und als mein Freund lass dir gesagt sein …« Er legte die flache Hand auf Viorics Brust. »Auch wenn das massenhafte Verrecken schon sechs Jahre hinter uns liegt, die Realität wird nach wie vor davon korrumpiert. Es gibt nur ein Mittel gegen diesen Krieg, der noch immer in unseren Körpern und Köpfen tobt.«
»Ach, was denn? Dein hohles Vergnügen, Tusson?«
Sein Kollege lachte und hustete. »Das pure, wilde Leben. Und nun entschuldige mich. Ich muss ein kleines Mädchen im Krankenhaus besuchen.«
Tusson wandte sich um und schlenderte davon. Seine rötlichen Haare leuchteten unter seinem schwarzen Fedora-Hut. Vioric hätte ihm so gerne geglaubt. Er hätte gerne gelebt. Aber er konnte nichts anderes im Leben sehen als vergebliche Mühsal, die sich um wenige genussvolle Momente drehte. Und eine aus der Feigheit zum Suizid geborenen Notwendigkeit, durchzuhalten.
Auf dem Weg zurück in die Préfecture beschloss Julien Vioric aber, dem Ratschlag seines Freundes Tusson vielleicht doch noch eine Chance zu geben. Pures, wildes Leben. Was wäre so schlimm daran, sich einmal in die ganz spezielle Umarmung einer Pariser Nacht zu werfen? Aber beim Gedanken an den rauchigen, parfümierten Dunst von Nachtschwärmern in vollgestopften Cafés und Theatern überfiel ihn ein Widerwillen, der beinahe an Übelkeit grenzte. Nein, er wusste, was er brauchte, um sein inneres Pendel ruhig zu halten. Er musste die Pariser Trottoirs unter seinen Schuhsohlen spüren, den regelmäßigen Takt seiner Schritte. Die Gewissheit, dass er ganz allein bestimmen konnte, wie schnell oder langsam er sich wohin bewegte.
Er passte seinen Schritt minimal an das Tempo der anderen Passanten an. Das gab ihm Zeit, den erwachenden Wintermorgen genau zu begutachten. Andere Polizisten hetzten mit einem Taxi Monoplace von einem Einsatzort zum nächsten oder orderten vielleicht ein Polizeifahrzeug, aber Vioric wählte, wann immer es sich einrichten ließ, den Gang durch die Stadt. In diesen Momenten war er am Leben. Er betrachtete im Vorübergehen sein Spiegelbild in Schaufenstern, in denen die diesjährigen Winteraccessoires dargeboten wurden. Ein Muff aus Fuchspelz, Stiefel aus Lammleder. Und davor der nicht enden wollende Strom reduzierter Gestalten und Nichtexistenzen. Prothesen und Krücken trommelten auf das feuchte Pflaster, und in der halb transparenten Scheibe schien ihn dieser Strom zu umspülen, ihn über die glatte Glasfläche mit sich davonzuziehen. Vioric schaute zu einem Dienstmädchen auf, das auf einem busigen Balkon Teppiche ausklopfte. Vor einem Café blieb er ein paar Sekunden stehen, um den wundervollen Duft einzuatmen, der wie eine Fahne in der eisigen Luft stand. Tauben flogen auf, und ihr hektischer Flügelschlag trieb ihn wieder zur Eile an.
In der Préfecture überquerte er ohne aufzusehen den großen Hof und dachte ein weiteres Mal, wie unpassend es doch war, dass der Eingang zu seinem Arbeitsplatz einem Triumphbogen glich. Wann hatten sie denn jemals über das Verbrechen triumphiert?
In der Eingangshalle linker Hand wollte er die Treppe in sein Büro hinaufeilen, als ihm sein Bruder entgegenkam. Edouard Vioric war ein hagerer, groß gewachsener Mann, der seine Haare seit seinem achtzehnten Lebensjahr regelmäßig dem Rasiermesser eines Barbiers opferte, weil er der Meinung war, der kahle Kopf eines Mannes wäre das sichtbarste Zeichen seiner Macht und Souveränität.
Julien blieb auf halbem Weg nach oben stehen und erwartete sein Schicksal. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Edouard sich seinem älteren Bruder in den Weg stellte, um ihn zu maßregeln und in seiner ganzen Jovialität anzuspornen, während seine Glatze den Glanz der polierten Knäufe am Treppengeländer widerspiegelte. Der Polizeipräfekt schaffte es noch jedes Mal aufs Neue, dass Julien Vioric sich fühlte, als würde er allein die Last der Verantwortung über das Wohlergehen der Hauptstadt auf seinen Schultern tragen. Erst recht, da Edouard 1913 dafür gesorgt hatte, dass sein beschauliches Zwischenspiel in Antibes durch eine unerwartete Beförderung beendet worden war. Immer, wenn Julien seinen Bruder sah, empfand er diesen Wendepunkt wie einen Riss, der seitdem durch sein Leben lief. Seit dieser Zeit schmeckte die Luft in Edouards Nähe nach Schuldigkeit und einer unausgesprochenen Verpflichtung, der Vioric niemals zu genügen schien.
Edouard Vioric sah von drei höhergelegenen Treppenstufen auf ihn herunter. »Ist er es?«
Julien wollte gerade zu einer Antwort ansetzen, als das charakteristische Schnappen einer Kameralinse ihn herumfahren ließ.
»Das wollte ich auch gerade fragen.« Héloïse Girard deutete eine Verbeugung an und zeigte Edouard ihre perlweißen Zähne. »Monsieur le Préfet.« Dann zwinkerte sie Julien zu, als hätten sie durch den Blickkontakt am Leichenfundort nun eine Gemeinsamkeit. »Lieutenant.«
»Sie haben hier nichts zu suchen!«, blaffte Edouard Vioric.
»Oh, ich habe schon gefunden, was ich gesucht habe. Der ermittelnde Lieutenant im Gespräch mit dem Leiter der Polizeipräfektur höchstpersönlich. Das wird unseren Lesern zeigen, dass die Sache ernst genommen wird. Also, ist es der Faucogney-Junge?«
Edouard setzte zu einer abwehrenden Erwiderung an. Ohne seinen Bruder aus den Augen zu lassen, sagte Julien: »Ja, er ist es. Ohne Zweifel.« Edouard versteifte sich neben ihm.
»Und dürfen unsere Leser auch erfahren, woher Sie das wissen?«
Mademoiselle Girard strahlte mit ihrem honiggelben Hut um die Wette. Julien wusste, dass Edouard in ihrer Anwesenheit jedes Mal das Gefühl hatte, als würde ihm ein nasser Lappen ins Gesicht geschleudert. Er unterdrückte ein Grinsen.
»Es gab eindeutige Anzeichen für seine Identität.«
»Nur Anzeichen?«
»Mademoiselle, würden Sie bitte gehen!«, forderte Edouard sie auf. »Sie dürfen Ihren Lesern berichten, dass Lieutenant Vioric und seine Männer alles daransetzen werden, den Mordfall gewissenhaft aufzuklären.«
»Aber natürlich! Das sind Sie Ihren einflussreichen adligen Freunden schließlich schuldig, nicht wahr, Monsieur le Préfet?« Girard ließ wie zufällig ihre langen, auffällig spitz gefeilten Fingernägel über das Objektiv ihrer Kamera gleiten.
Edouards Glatze rötete sich. Julien wusste, dass sein Bruder die Reporterin am liebsten die Treppe hinabgestoßen hätte. Er hasste weibliche Aufmüpfigkeit und hätte es lieber gesehen, wenn Frauen wie Héloïse Girard, die mittlerweile scharenweise in Büros und an öffentlichen Stellen saßen, sich um ihre Bügeleisen und Stricknadeln und Wickeltücher gekümmert hätten.
»Ganz recht«, sagte er mit bemühter Ruhe. »Sie werden eines Tages auch noch lernen, dass es nicht von Nachteil ist, wenn man sich mit dem Adel gut stellt. Irgendjemand muss dieses Land …«
»Es heißt, dass Sie gerne bei den Faucogneys dinieren«, unterbrach sie ihn. »Nach dem, was man so hört, lassen Sie sich am liebsten zu Hummer einladen.« Sie beugte sich noch ein wenig weiter zu den Männern vor. »Sagen Sie, werden Sie die Nachricht über den Tod des Jungen beim nächsten Abendessen persönlich überbringen?«
Julien biss sich auf die Unterlippe, um dem amüsierten Kitzeln in seinen Mundwinkeln nicht weiter nachzugeben. Wenn man nicht selbst unter dem Brennglas ihrer Provokation lag, war es köstlich, ihr dabei zuzusehen, wie sie ihren Gegenüber genüsslich zerlegte. Statt einer Antwort hob Edouard die Hand und winkte zwei Gardiens am Fuß der Treppe heran. »Entfernen Sie diese Frau!«
Héloïse Girard lächelte und drehte sich um. Etwas an ihrem Gang veranlasste die beiden rangniederen Polizisten, sie mit respektvollem Abstand zur Tür zu begleiten. Sie rauschte aus der Halle wie eine Nebendarstellerin von einer Theaterbühne, die genau wusste, dass sie der Hauptfigur gerade die Schau gestohlen hatte.
Edouard starrte Julien an. »Du nimmst dich vor dieser Person in Acht«, zischte er. »Wie überhaupt vor der ganzen Presse. Du überbringst den de Faucogneys die Nachricht, und du benimmst dich dabei anständig. Ich will heute Abend einen Bericht über alles, was wir bislang wissen. Du bekommst eine Ermittlungseinheit zugeteilt.«
Edouard ging zwei Stufen nach unten. »Bis heute Abend kein weiteres Wort mehr zur Presse, verstanden?«
Julien Vioric hätte gerne ein wenig Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen, seine Eindrücke vom Leichenfundort zu ordnen, aber nun musste er sich beeilen. Es wäre unentschuldbar, wenn die Familie Faucogney gerüchteweise vom Tod ihres Sohnes erfahren würde, bevor die Polizei sie offiziell informierte. Er beauftragte nur noch kurz einige Gardiens damit, Lieferanten und Abnehmer großer Taschenkrebse ausfindig zu machen. Er wollte sich gerade auf den Weg zum Stadtpalais der Familie machen, als ihm im Hof Stéphane Murier begegnete.
Vioric schnitt ihm den Weg ab und bugsierte ihn zum Tor. Im Gehen eröffnete er Murier, dass er ihn als Mitglied der neuen Ermittlungseinheit betrachtete. Der Junge quittierte diese Neuigkeit mit einer überschäumenden Euphorie.
»Also, Clément Faucogney ist vor fünf Tagen auf dem Weg zum Fechtunterricht verschwunden. Begleitet wurde er von seiner Gouvernante, einer sechsundzwanzigjährigen Frau namens Isabelle Magloire.«
»Ein Sechzehnjähriger mit einem Kindermädchen?« Murier sah Vioric zweifelnd von der Seite an.
»Das ist jedenfalls ihr offizieller Titel.«
Vioric betrachtete sehnsüchtig ein Bistrofenster, hinter dem gerade ein dampfendes Spanferkel effektvoll aufgetischt wurde, in dessen knusprigem Rücken ein Messer steckte. »Jedenfalls verschwand der Junge, und auch Isabelle Magloire kam nicht mehr wieder.«
»Sind die beiden vielleicht gemeinsam durchgebrannt?«, fragte Murier, der langsam aufzutauen schien. »Aber Clément wurde auf eine so bestialische Weise ermordet. Das passt doch nicht zusammen.«
Voiric nickte nachdenklich. »Ich möchte geklärt haben, ob es möglich ist, dass Clément gegen dieses Eisengitter geschleudert wurde. Ob der Place du Panthéon überhaupt der Ort ist, an dem er gestorben ist. Jeder kann ein bisschen Blut an einen Zaun schmieren und ein Eisenstückchen herausbrechen, um einen Tatort zu inszenieren, nicht wahr?« Vioric sah Murier prüfend von der Seite her an, der zögerlich zustimmte. »Wir wissen noch gar nichts und solange das so ist, werden wir der Presse sagen, dass der Junge schlicht erschlagen wurde.«
Vioric ging innerlich noch einmal über den Place du Panthéon, und er glaubte zu sehen, wie feine Haarrisse sich durch die Szenerie zogen, aus denen langsam der Wahnsinn in die Welt sickerte. Murier hatte recht. Irgendetwas an der Sache war merkwürdig.
In der Ferne hinter der Stadtvilla der Familie Faucogney thronten die gläsernen Kuppeln des Grand Palais, die an diesem Tag hinter dem Nebel verwässerten, als würden sie sich auflösen. Ein Dienstmädchen ließ sie ein, und Murier klopfte sich angesichts ihrer erhobenen Augenbrauen verlegen die Feuchtigkeit von den Stiefeln.
Vioric lauschte in das riesige, stille Haus hinein. Irgendwo im oberen Stockwerk hallten Schritte. Er betrachtete die wuchtigen Rahmen der Ölgemälde in der Eingangshalle, die chinesischen Vasen und die herrlich gravierten Bleiglasscheiben der Türen. All diese Pracht, die Selbstsicherheit, mit der die Ahnen der Faucogneys aus ihren Rahmen starrten, würden ihre Bedeutung verlieren angesichts der Botschaft, die er zu übermitteln hergekommen war. Als sie schließlich zu Madame und Monsieur Faucogney vorgelassen wurden, schien es Vioric, als sei Cléments Mutter seit seinem letzten Besuch vor fünf Tagen um die Hälfte geschrumpft. Vioric machte es kurz. Er nannte kein einziges der schrecklichen Details, erwähnte aber den charakteristischen Leberfleck am Steißbein der Leiche. Madame Faucogney wurde blass und klingelte, als wäre das die einzig mögliche Antwort auf diese Nachricht, nach einem Dienstmädchen, von dem sie sich mit bebenden Schultern zur Tür bringen ließ. Monsieur Faucogney dagegen wirkte gefasst, beinahe erleichtert, und führte sie auf Nachfrage Viorics in das winzige Zimmer von Isabelle Magloire im Souterrain der Villa.
»Sie meinen, Cléments Gouvernante hat etwas damit zu tun?«, fragte er und ließ seinen Blick durch das karg eingerichtete Zimmer schweifen, das Ähnlichkeiten mit einer Mönchszelle hatte.
Madame de Faucogney, so der Hausherr, könne sich noch genau daran erinnern, wie Isabelle lediglich mit ihrer Handtasche am Arm Clément zu der Fechtstunde begleitet hatte, so wie immer. Aber kurz nach ihrem Weggang war dem Zimmermädchen aufgefallen, dass Isabelle Magloires Kleider, Schuhe und alle anderen Habseligkeiten verschwunden waren. Niemand konnte sich erklären, wie sie das alles unbemerkt aus der Villa fortgeschafft hatte.
»Clément war in sie verliebt, und das verwundert nun wirklich niemanden. Sie haben ihr Bild ja gesehen.« Ein Phantomzeichner der Polizei hatte ein Abbild von Isabelles Gesicht nach Madame Faucogneys Beschreibung angefertigt. Vioric dachte an das puppenhafte Gesicht der Frau, die mit ihrem breiten Kinn und den großen Augen aussah, als gehörte ihr Gemälde in den Louvre hinter einen Bilderrahmen und nicht in die Akte einer Vermisstenanzeige.
»Und auch wenn Isabelle unnahbar war und sich der Herrschaft gegenüber immer korrekt verhalten hat, hatten sie und Clément sicher ihre Geheimnisse.«
»Gab es vielleicht Streit zwischen den beiden?«
»Gut möglich. Sie wissen doch, wie die Jugend ist, Lieutenant. Und Sie wissen auch, wie die Frauen sind. Vor allem die mittellosen unter ihnen.«
Vioric überging die arrogante Bemerkung.
»Monsieur de Faucogney, woher stammte Isabelle Magloire?«, fragte Murier, dem Vioric aufmunternd zugenickt hatte. Edouard hätte mit den Zähnen geknirscht, wenn er erfahren hätte, dass Vioric einem einfachen Gardien ein paar Ermittlungsfragen zugestand. »Was können Sie uns über die Frau und ihren Hintergrund sagen? Wann wurde sie eingestellt und mit welchen Referenzen?«
Faucogney knöpfte sich die Weste auf, als würde er nur noch schlecht Luft bekommen.
»Das fragen Sie besser meine Frau. Sie hat Isabelle vor etwa einem Jahr eingestellt. Sie hat normalerweise ein Händchen für … so was.« Er bewegte sich auf die Türschwelle zu. »Ihnen ist sicherlich bewusst, dass es hier nicht bloß um den tragischen Verlust geht, den diese Familie zu verkraften hat, sondern vor allem auch um unsere Ehre. Das hat man davon, wenn man den erstbesten Dahergelaufenen eine Chance gibt und darauf vertraut, dass sie dankbar und anständig sind. Dass sie es verstehen, Anstand und Respekt zu wahren und nicht den Kindern der Herrschaft den Kopf zu verdrehen.«
»Hat Isabelle Magloire auch Ihnen den Kopf verdreht, Monsieur Faucogney?« Der Hausherr erstarrte. Vor seinem inneren Auge sah Vioric seinen Bruder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
»Verlassen Sie mein Haus!«, zischte Faucogney. »Und kommen Sie erst wieder, wenn Sie den Mörder meines Sohnes gefunden haben!«
Als Vioric und Murier kurz darauf im eisigen Regen standen, der wie messerscharfe Nadelspitzen auf sie einstach, platzte es aus Murier heraus. »Er hatte was mit dieser Gouvernante.«
»Natürlich. Das sähe eine Blindschleiche mit verbundenen Augen.«
»Wissen wir denn, welchen Weg der junge Faucogney und diese Isabelle genommen haben?«
Vioric wandte den Kopf. Er konnte hinter den Dunstschwaden die Kuppeln des Grand Palais nur noch erahnen und meinte, das Trommeln des Regens auf den gigantischen Glashauben hören zu können. Er zog eine Straßenkarte aus seiner Manteltasche hervor.
»Ich habe vor fünf Tagen die Mutter dazu befragt. Sie hat ihn mir hier eingezeichnet. Hier, die Rue Jean Goujon in Richtung Seine, und dann am Ufer entlang Richtung Trocadéro. In der Rue Vineuse, westlich des Parks, liegt der Salon des Fechtlehrers. Aber auf dieser Strecke gibt es natürlich tausend Möglichkeiten für Umwege.«
Murier nickte. Regentropfen sprangen von seinen Augenbrauen ab, und Vioric wunderte sich, dass der Junge nicht vorschlug, sich irgendwo unterzustellen. Er war selbst versucht, in einem Café Schutz vor dem Regen zu suchen. Viorics letzte Mahlzeit lag mehr als sechzehn Stunden zurück, und es fühlte sich an, als würde auch in seinem Magen ein harter, kalter Regen fallen.
»Murier, stellen Sie eine kleine Truppe zusammen, und kämmen Sie diese Gegend nach Zeugen durch. In einem Radius von, sagen wir, fünfhundert Metern. Wenn Clément und Isabelle ein Liebespaar waren, dann wollten sie Zeit für sich, und sei es nur auf einem Spaziergang. Vielleicht haben sie sich auch in einem Bistro aufgehalten oder hinter einer Hecke im Trocadéro. Finden Sie Leute, die die beiden gesehen haben. Ein teuer gekleideter Junge und eine schöne Frau im strengen schwarzen Kleid. Und überprüfen Sie, ob der Fechtlehrer wieder genesen ist.«
»Wird gemacht, Lieutenant Vioric.« Murier salutierte.
»Lassen Sie das!«, blaffte Julien und fügte etwas sanfter hinzu: »Seien Sie froh, wenn Sie in Ihrem Leben nie die Finger an die Stirn heben müssen, es sei denn, Sie müssen sich da kratzen.« Er schlug den Weg in Richtung Préfecture ein. Murier schien ihn gar nicht zu hören. Er war stehen geblieben und hing seinen Gedanken nach. Aber nach ein paar Metern hörte Vioric, wie der junge Gardien ihn bereits wieder einholte.
»Lieutenant, ich verstehe das Ganze nicht. Hier scheint es um eine Liebesgeschichte zu gehen, vielleicht im Dreieck zwischen Vater, Sohn und Gouvernante. Wenn die Gouvernante verschwindet, dann ist sie womöglich durchgebrannt oder der Vater wollte sie loswerden.«
»Sie meinen, wir werden demnächst ihre Leiche aus der Seine fischen, den gepackten Koffer noch in der Hand?«
Vioric wich im nächsten Moment einer Frau aus, die mit einem riesigen Zwillingskinderwagen durch die Passanten auf dem Trottoir pflügte und dabei den kreischenden Insassen des Wagens lauthals ein Lied vorsang.
»Vielleicht«, sagte Murier. »Aber wie passt das mit dem jungen Faucogney zusammen? Warum endet ein junger Adeliger auf derart schreckliche Weise und wird nicht einfach nur ausgeraubt und erstochen?«
»Vielleicht gehören die beiden Fälle nicht zusammen«, überlegte Vioric. »Aber um das herauszufinden, Murier, müssen wir das sehen, was nicht gesehen werden will.«
*
Der kurze Wintertag verstrich beinahe unbemerkt während all der Zeugenbefragungen, einer Besprechung mit Doktor Durand, etlichen Tassen Kaffee und einem raschen Imbiss bei einer Kartoffelbraterei auf der Straße. Als Vioric von seinen Akten aufsah und es vor den Fenstern bereits dunkel war, erschrak er.
Bei der abendlichen Besprechung ließ der Polizeipräfekt es sich nicht nehmen, persönlich anwesend zu sein. Julien Viorics Büro war mit Stühlen vollgestellt, und an der Tür lehnte wie eine ironische Note Paul Tusson. Wahrscheinlich war er nur hier, dachte Vioric, um ihn im Anschluss zu einer seiner abendlichen Vergnügungen zu überreden.
»Doktor Durand hat bestätigt, dass der Junge gegen den Eisenzaun vor dem Panthéon geschleudert wurde, bis der Tod eintrat«, begann der Lieutenant.
Die anwesenden Polizisten verzogen die Gesichter. Der Polizeipräfekt schloss die Augen. Offensichtlich legte sich sein Bruder bereits die Worte zurecht, mit denen er als Überbringer der unglückseligen Botschaft seinen Gönner milde stimmen wollte.
»Die Muster der Brüche an Rippen und Schienbeinen, Hüfte und Armen stimmen mit dem Muster der Eisenstäbe überein. Zudem haben die Kollegen an dem Sack, in dem der Tote steckte, einige abgeblätterte Rostpartikel des Zauns gefunden. Der Junge starb an der massiven Gewalteinwirkung gegen Kopf und Brust. Welche der vielen Verletzungen es nun genau war, die seinen Tod verursacht hat, lässt sich nicht mehr sagen.«
»Konnte unser guter Doktor herausfinden, ob es mehrere Täter waren, oder gab es nur einen?«, rief Tusson in den Raum hinein.
Vioric nickte. »Es gibt eindeutige Griffspuren an den Fußknöcheln des Toten, wo der Täter den Jungen aller Wahrscheinlichkeit nach festgehalten und ihn mit der Vorderseite des Körpers gegen den Zaun geschlagen hat. Derzeit deutet nichts auf eine zweite, unmittelbar an der Tat beteiligte Person hin.«
»Was haben Sie über diesen Krebs herausgefunden, Lieutenant Vioric?«, warf der Präfekt ein. Vioric zog unwillkürlich die Augenbrauen in die Höhe. Er würde sich wohl nie daran gewöhnen, dass sein eigener Bruder ihn in der Préfecture zu siezen pflegte.
»Der Krebs wurde von Doktor Durand ebenfalls untersucht. Das Fleisch war noch frisch …« Vioric richtete sich an den Gardien vor sich. »Sie und Ihre beiden Kollegen haben untersucht, woher der Krebs stammen könnte.«
»Ja, Lieutenant. Der Krebs ist ein Taschenkrebs, Cancer pagurus. Er wird vor allem auf dem Fischmarkt angeboten, allerdings auch in zahlreichen kleineren Fischläden überall im Rest der Stadt.«
»Und? Irgendetwas Auffälliges?«
Die Gardiens schüttelten den Kopf. »Der Händler im Marché Saint-Quentin sagte, dass von den Viechern jeden Tag viertausend Stück in Paris verkauft und verspeist werden.«
»Das ist keine tragfähige Spur!« Edouard Vioric erhob sich. »Verzetteln wir uns bitte nicht, meine Herren.«
Der Satz war an alle Anwesenden gerichtet, aber sein Bruder erfasste mit seinem Blick nur Julien, als läge es allein in seiner Verantwortung, ob die Ermittlung erfolgreich werden würde oder nicht. So war es immer gewesen, zumindest, seit Benoît Vioric, der vormalige Polizeipräfekt, beschlossen hatte, dass Edouard als sein Nachfolger besser geeignet war als sein älterer Sohn Julien. Oder vielleicht auch seit dem Tag im Jahr 1919, als die ganze Familie nach Kriegsende wieder zusammen an einem Tisch gesessen hatte und klar wurde, dass Julien irgendwie verbogen aus den Schützengräben zurückgekehrt war, während es Edouard gelungen war, seine Kriegserlebnisse in eine aufgeräumte, fast gläserne Entschlusskraft umzuwandeln.
»Wer recherchiert hier die Vergleichsfälle?«, wandte Edouard sich an die Polizisten. »Wann, wo, wie hat es so etwas schon mal gegeben?«
»Wir arbeiten daran, Monsieur le Préfet«, sagte Tusson zu Juliens Überraschung. »Gallimard und Gautier wühlen sich bereits durch das Archiv der Präfektur.«
»Gut. Weiter so, die Herren.« Edouard nickte knapp und verließ das Büro.
Kaum war sein Bruder verschwunden, spürte Julien, wie sich sein Brustkasten weitete und seine Lungen sich mit Luft füllten. Verstohlen sah er sich um, ob die anderen ihm die Erleichterung ansehen konnten, aber seine Leute wirkten ernst und konzentriert. Allein Tusson zwinkerte ihm zu, bevor er sich mit einem lauten Seufzer der Zufriedenheit auf den Platz setzte, den der Präfekt gerade frei gemacht hatte.
Vioric hörte sich die wenig erhellenden Erkenntnisse von Muriers kleiner Truppe an, die die Umgebung von Cléments Weg zur Fechtschule überprüft hatten. Murier berichtete gerade, dass der Fechtlehrer wegen seines schweren Darmkatarrhs mittlerweile im Krankenhaus lag und es wohl nicht gut für ihn aussah, als ein weiterer Gardien an der Tür erschien. Er hielt ein paar Schriftstücke in die Höhe. »Lieutenant? Das hat mir der diensthabende Beamte von der Abteilung für Vermisstenfälle gerade übergeben. Hoffe, das kommt jetzt nicht zu spät. Dem Kollegen ist es gerade eben erst aufgefallen.«
Vioric richtete sich stirnrunzelnd auf und beobachtete, wie die Papiere durch einige Hände hindurch den Weg zu ihm fanden.
»Vor einer Woche hat eine junge Frau namens Lysanne Magloire einen Suchantrag für ihre Schwester Isabelle Magloire gestellt.« Ein Raunen ging durch den gesamten Raum. »Sie gehört wohl zu jenen Verzweifelten, die jahrelang nichts von ihren nach Paris verzogenen Verwandten gehört haben und schließlich bei uns landen, um zu erfahren, ob ihre Angehörigen zufälligerweise im Zusammenhang mit irgendeinem polizeilichen Fall in unseren Registern vermerkt sind.«
»Tja, wird höchste Zeit, dass wir hier eine Meldepflicht bekommen«, fand Tusson. Vioric nahm die Papiere entgegen und betrachtete die wenigen Angaben, die zu der Antragstellerin vermerkt waren.
»Lysanne Magloire, Jahrgang 1902, aus Ribérac, einem kleinen Dorf nahe Bordeaux. Die junge Frau hält sich angeblich seit dem 29. November dieses Jahres in Paris auf und sucht seither erfolglos nach ihrer Schwester. Von der sie allerdings schon seit vier Jahren nichts mehr gehört hat.«
Tusson runzelte die Brauen. »Wenn das mal nicht eine schöne harte Nuss so kurz vor Weihnachten ist.«
Vioric unterdrückte seinen Ärger über den Kollegen der Suchanzeigen-Abteilung, dem das Memo zu der verschwundenen Gouvernante wohl entgangen war. »Hier steht, dass sie ein Zimmer bei einer Madame Roux in der Passage de l’Opéra bewohnt.«
Tusson grinste und setzte sich den Hut auf. »Dann begibst du dich heute Abend ja doch noch in weibliche Gesellschaft, Julien.«
Die Aussicht, jetzt nach der Besprechung noch eine junge Frau aufsuchen zu müssen, die ihre Schwester in der großen weiten Welt verloren hatte, klang für Vioric alles andere als verheißungsvoll.
Er versenkte die Hände in seinen Lederhandschuhen. Das Gefühl, in den engen, festen Raum zu schlüpfen, gab ihm jedes Mal aufs Neue einen Halt, den er sich nicht recht erklären konnte. Einen Halt, den er bis in den warmen Frühling hinein auszudehnen pflegte und der auch dafür sorgte, dass er im Spätherbst schon dicke Handschuhe trug, wenn ansonsten ganz Paris die Wintersachen noch nicht einmal hervorgeholt hatte.
Vioric nahm wie üblich keinen Wagen, um in die Passage de l’Opéra zu gelangen, obwohl die Temperaturen mit dem Gefrierpunkt liebäugelten.
Er wechselte die Seine-Seite und lief am Ufer entlang bis zur Pont Neuf. Trotz der Kälte schlängelte er sich durch geschäftige Menschenströme hindurch, tauchte ein in die flüchtigen Duftwolken müder Pariser auf ihrem Heimweg. Das Knattern der Automobilmotoren mischte sich mit dem Quengeln übermüdeter Kinder und dem harten, sich immer wieder überschneidenden Rhythmus eiliger Schritte. Die Menschen hatten die Hände in Muffs und Manteltaschen verborgen, bis auf einen Zeitungsjungen, der die Abendausgabe des Figaro mit rot gefrorenen Fingern in die Höhe hielt. In den Schatten zwischen den Treppen knisterte neuer Frost. Hinter dem Louvre bog Vioric in die Rue de Rivoli ein und folgte ihr bis zur Einmündung der Rue de Rohan. Als er von dort aus die große, schnurgerade Avenue de l’Opéra betrat, hatte er den Eindruck, in eine Allee aus Licht einzubiegen. Hier wurden die Mäntel nobler und die Menschenmenge wurde dünner. Auf dem Boulevard des Capucines wandte er sich nach rechts und tauchte in eine der engeren Gassen ein. Vor Julien Vioric tat sich nun eine ganz andere Welt auf. Über der Dunkelheit schwebten hier Glasdächer, und unter seinen Füßen fühlte er die filigranen Kacheln alter Mosaikböden, die an winzigen Geschäften vorüberführten. Das Reich der Passagen. Aber die Passage de l’Opéra war, so lebendig es hier noch zugehen mochte, dem Untergang geweiht. Erst vor Kurzem hatte die Stadt ihre Abrisspläne verkündet. Boulevard Haussmann rückte seit Jahren Stück um Stück näher an die Passage heran.
Vioric übergab sich dem Rhythmus der Masse. Hinter den Fenstern der Cafés schwebten Gesichter über Gläsern. Er kam an einem Mann vorbei, der ein verätztes Gesicht hatte und einer Flöte ein paar schiefe Töne entlockte. Vioric kaufte einem Maronenverkäufer eine Tüte ab und aß mit Hunger zwei der Kastanien. Dann fing er den sehnsüchtigen Blick einer jungen Frau auf, die auf einem Stück Pappe stand und ihr schlafendes Baby der vorübereilenden Menge entgegenhielt. Er schenkte ihr die restlichen Maronen.
Die Stühle der Cafés waren alle besetzt, und ein vielstimmiges Summen stieg in die Glasgewölbe auf. Männer und Frauen saßen beisammen, Taftrock an Hosenbein, Spitzenhandschuh an Manschettenknopf. Eine Frau pflückte ihrem Begleiter die Zigarette aus dem Mundwinkel und rauchte sie selbst. An einem anderen Tisch hatte sich eine ihrer Handschuhe entledigt und zerlegte mit bloßen Händen eine Forelle. Es duftete nach frischem Brot und gegarten Muscheln, und der Rauch unzähliger Zigaretten lag als zäher Nebel über allem. Vioric schluckte seinen Hunger herunter und suchte nach dem Treppenaufgang der Pension von Madame Roux. Es war komplizierter als gedacht, denn an den meisten Türen standen nur einzelne Buchstaben, aber keine Namen. Vor einem Treppenzugang plärrte ein Grammofon einen dieser schwungvollen Tänze, die man gerade in jedem Café zu hören bekam. Ein hoch aufgeschossenes Mädchen mit Bubenfrisur brachte zwei weiteren Mädchen die gewagten Schritte und Drehungen dazu bei. Vioric lächelte. Paul Tusson hätte, wäre er hier gewesen, sie alle drei zum Erproben dieser Tanzschritte in einen seiner Lieblingsläden eingeladen. Aber sosehr Vioric sich bemühte, Grazie und Anmut in den Bewegungen der Mädchen zu entdecken – für ihn sahen die drei aus wie Reiher, die in einem ausgetrockneten Flussbett nach Würmern scharrten.
Er bog um eine Ecke und betrat eine Galerie, in der es ruhiger war, als würde der grell leuchtende Teppich des Lebens hier ein wenig ausfransen. Hier saßen vor einem schäbigen Café nur noch vereinzelte Gäste. Plötzlich hörte Vioric seine eigenen Schritte überdeutlich. Ihm fiel ein junger Mann auf, der etwas abseits saß und wie ein Jäger das ihm gegenüberliegende Schaufenster eines Stockladens belauerte. Der Mann bearbeitete mit einem Bleistift ein aufgeschlagenes Notizbuch und schrieb, ohne dabei aufs Papier zu sehen. Vioric beachtete ihn nicht weiter. In letzter Zeit sah man immer mehr solcher Gestalten in den Passagen und vor den einschlägigen Cafés. Seltsame, aus jedem Zusammenhang gefallene Figuren eines Spiels, das die Welt zu verhöhnen schien. Direkt neben diesem Sonderling entdeckte Vioric einen schmalen Treppenaufgang hinter einer Glastür. Ein rostiges Emailleschild prangte an der Mauer: Madame Roux. Er streckte die Hand nach dem Türknauf aus, als jemand laut aufschrie. Vioric schnellte herum. »Ah! Eine neue Gattung im Menschenaquarium!«, rief der Mann neben ihm und sah ihn mit begeistert aufgerissenen Augen an, während sein Füllfederhalter über das Papier raste. Vioric reagierte nicht und probierte die Glastür. Sie war nicht abgeschlossen. Dahinter dämmerte ein enges Treppenhaus vor sich hin. Er drehte den Lichtschalter, aber die Lampe über den Stufen reagierte nicht. Er tastete sich im spärlichen Licht, das aus der Passage ins Treppenhaus fiel, in den ersten Stock und suchte eine Tür mit der Nummer zwei. Vioric hatte keine Streichhölzer dabei. Wie ein Blinder tastete er die aufgeschraubten Metallziffern an den Türen ab. Als er fündig geworden war, klopfte er und lauschte und hörte nur seinen eigenen Herzschlag und das Murmeln einer Vorahnung.
2
15. Dezember 1924, morgens
Für Lysanne war die Passage de l’Opéra ein Gewächshaus wundersamer Alltäglichkeiten. Dichter und Maler verkehrten hier, Huren und Friseure; Blumenmädchen und Händler für Gebrauchtes und Abgelegtes hatten hier genauso wie kleine Boutiquen und Schatzkästchen menschlicher Bedürfnisse ihre Heimat gefunden. Seit der Ankündigung der Abrisspläne lag ein kaum wahrnehmbarer Totenhauch unter den Glasdächern und ließ Lysanne die Stimmung dieses Ortes nur noch intensiver erleben.
In ihrem Leben verschwanden in letzter Zeit beständig vermeintliche Selbstverständlichkeiten. Gaspard war zuerst verschwunden, und kurz darauf Isabelle. Ihr Vater hatte sich in seiner Krankheit förmlich aufgelöst, bevor er schließlich ebenfalls verschwunden war und ihr außer seinen kargen Ersparnissen nichts hinterlassen hatte. Am Ende war nur noch Lysanne da gewesen und die blühenden Walnussplantagen von Ribérac, die Milchkälber und die staubigen Kirchenbänke der Dorfkapelle. Diese hatte Lysanne nun gegen Litfaßsäulen, Omnibusse und den stampfenden Rhythmus der Großstadt eingetauscht. Ein Rhythmus, der ihre Hoffnung auf Arbeit und darauf, Isabelle zu finden und sie endlich zur Rechenschaft zu ziehen, allmählich zu zermalmen drohte.
Lysanne hatte die Adresse ihrer jetzigen Vermieterin von einer Bekannten aus Bordeaux erhalten, mit der sie sich während ihrer Ausbildung an dem dortigen Lehrkrankenhaus angefreundet hatte.
Sie hatte sich mit derselben Entschlossenheit auf Paris gestürzt, mit der sie, Isabelle und Gaspard, an den heißen Sommertagen kopfüber in den Fluss gesprungen waren. Sie hatte keinen Gedanken daran verschwendet, dass ihr Geld nicht reichen könnte, dass sie womöglich keine Arbeit finden und auch sonst auf ganzer Linie scheitern würde.
Als aber an diesem 15. Dezember der Morgen gegen ihr schmales Bett schwappte und durch das halb blinde Fenster der Tag in das Zimmer mit den schuppigen Tapeten kroch, war Lysannes Zuversicht so aufgebraucht wie die begrenzten Vorräte eines Schiffbrüchigen nach Tagen auf dem offenen Meer. Seit zwei Wochen war sie nun hier, und kein einziger der Wünsche, die sie an Paris gehabt hatte, schickte sich an, in Erfüllung zu gehen.
Die Metropole, vor Kurzem noch verheißungsvoll und wunderbar, kam ihr nun wie ein Brett vor, auf dem ein Spiel stattfand, dessen Regeln sie nicht verstand. Mit jedem Morgen pendelte sich ihre Energie auf einem etwas tieferen Niveau als zuvor ein, und an jedem Nachmittag kehrte sie etwas früher und ein wenig erschöpfter zurück in die Passage.
Lysanne nahm einen tiefen Atemzug, ehe sie sich erneut in die Stadt hinauswagte.
Sie schlüpfte in ihr einziges Kleid, trug ein wenig Puder auf und steckte sich das Haar mit zwei Kämmen hinter den Ohren fest. In der Gobelinhandtasche aus dem Nachlass ihrer Mutter befanden sich ihre viel zu dünne Geldbörse, ein Döschen mit Veilchenbonbons, ein Bleistift, ein kleines Messer zum Spitzen und eines der Notizbücher vom Dachboden des Dorfschulhauses, in dem sie aufgewachsen war. Es war das zweite von zehn Büchern, die Lysanne nach Paris mitgenommen hatte. Eines hatte sie bereits mit den wenig erbaulichen Ereignissen der letzten Jahre vollgeschrieben, beim zweiten war die Hälfte der Seiten noch leer. Gefüllt mit ihrer braven Handschrift, für die sie ihr Vater als Kind immer gelobt hatte. Es sollte das Einzige bleiben, für das sie Anerkennung von ihm erhalten hatte.
Lysanne schlüpfte in ihren Mantel, schloss das Zimmer ab, setzte sich in das Café direkt unterhalb ihres Fensters und bestellte ihren allmorgendlichen Milchkaffee. Kaum berührten ihre Finger die stumpf gewordene Fläche des runden Marmortischchens und spürte sie in ihrem Rücken die harten Bögen des Bistrostuhls verflüchtigte sich ihr Trübsinn. Mit einem Mal schien es unter dem Glasgewölbe heller und wärmer zu werden, und Lysanne wurde bewusst, dass dieser Traum von Paris, den sie seit den Tagen vor ihrer Abreise hegte, immer noch sehr lebendig war.
Sie würde mit einer Tasse Milchkaffee ein neues Kapitel ihres Lebens beginnen und dieses Kapitel, noch während es entstand, aufschreiben und dabei die Vergangenheit endgültig hinter sich lassen. Die Eindrücke dieser vibrierenden Stadt festhalten, während ihre linke Hand die heiße Tasse auf dem Marmortischchen streifte. Sie würde ihre biedere Handschrift etwas verzerren, ein wenig wackeln lassen.
Nach den Rückschlägen der letzten Zeit kam Lysanne die Idee, dass das Paris ihrer Vorstellungen bislang nicht wahr geworden war, weil sie sich der Pariser Lebensart schlicht verweigert hatte. Viele hier hatten weder Arbeit noch rosige Zukunftsaussichten.
An diesem Morgen war in der Passage noch nicht viel los, und nur ein paar vereinzelte Leute saßen in den Cafés. Die Ladenbesitzer ordneten ihre Auslagen und putzten die Fenster.
Sie nahm das Notizbuch aus der Tasche. Es fühlte sich gut an, den Falz glatt zu streichen, den Stift auf das Papier zu drücken.
Sie begann damit, den diffus in ihrem Bewusstsein hängenden Traum der vergangenen Nacht aufzuschreiben. Als Lysanne aufschaute, fiel ihr ein junger Mann an einem der Nebentische auf, der interessiert zu ihr herübersah. Er trug eine zerdrückte Melone über einem ebenso zerdrückten Anzug und eine rote Krawatte. In einem jungenhaften Gesicht standen zwei helle, entschlossene Augen, die sie fest im Blick hatten. Ohne zu fragen, stand der Mann auf und setzte sich mit seiner Tasse an ihren Tisch. Lysanne war so überrumpelt, dass sie nicht reagierte, als er mit einem höflichen »Erlauben Sie?« an ihrer Tasse vorbei nach dem Buch schnappte und es zu sich zog. »Sie schreiben, Mademoiselle?«, fragte er und blätterte schamlos und als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, darin herum.
»Geben Sie es zurück!« Lysanne wollte es ihm entreißen, aber auf einmal überkam sie der Verdacht, dass sie hier in Paris, der Stadt der Künstler und Dichter, vielleicht gar nicht das Recht dazu hatte.
»Gleich.« Der Mann zwinkerte ihr zu. »Lassen Sie mal sehen … Ah!«
Er heftete den Blick auf ihre Schrift. Ihr Magen zog sich zusammen.
»Jetzt gleitet der Zug über die Ebene, das Licht wird gläsern. Ich fühle mich schläfrig. Wenn ich aufwache, wird dann alles Paris sein?« Der junge Mann stieß einen leisen Pfiff aus.
Lysanne schoss die Schamesröte in die Wangen, als das, was sie auf der Zugfahrt nach Paris geschrieben hatte, nun plötzlich aus einem fremden Mund erklang.
»Geben Sie mir das Buch zurück!«
Der Fremde griff nach ihrer ausgestreckten Hand, mit der Rechten hielt er das Buch außerhalb ihrer Reichweite. »Lassen Sie mich raten. Sie sind neu in der Stadt und haben gedacht, Sie müssten dem großen Paris in diesem kleinen Büchlein huldigen.« Er legte den Kopf schief und sah Lysanne fragend an. »Was werden Sie jetzt schreiben? Hat sich Ihre Meinung über die Stadt bereits verändert?«
Lysanne trank nervös einen Schluck Milchkaffee und verbrannte sich die Zunge. Er fing ihren Blick auf und gab ihr das Buch mit einer respektvollen Geste zurück. »Louis Aragon. Zu Ihren Diensten, Mademoiselle.«
»Ich bin Lysanne Magloire.« Sie legte das Notizbuch außerhalb von Aragons Reichweite zurück auf den Tisch. »Und ich bin Ihnen viel zu böse, als dass Sie mir dienen könnten. Mit was denn überhaupt?«
Er beugte sich vor und sah sie verschwörerisch an. »Nun, ich könnte Ihnen eine ganz erstaunliche Geschichte über diesen Stockladen dort drüben erzählen, Mademoiselle Magloire.«
Er wies nach links, wo auf der anderen Seite der Passage ein Laden mit zwei Schaufenstern Stöcke und Hüte verkaufte. »Gestern Abend saß ich hier, und plötzlich begann dieses Schaufenster zu leuchten, als wäre es das nächtliche Meer, ein grünes, submarines Licht. Die Stöcke wogten wie Seegras. Ich schwöre Ihnen, Mademoiselle, das ganze Gewölbe hat sich angehört wie ein riesiges Tritonshorn, es rauschte und dröhnte, und dann!« Er kam noch näher und funkelte sie an. »Dann schwamm mit einem Mal eine Meerjungfrau zwischen den Stöcken hindurch und sah mich durch die Scheibe an. Als ich an die Scheibe trat und meine Hand dorthin legte, wo die ihre lag, verschwand die Fisch-Dame, und ich ging enttäuscht zu Bett. Jetzt sitze ich hier und versuche, diesen Moment erneut heraufzubeschwören. Gerade, als ich Sie vorhin zum ersten Mal sah, dachte ich: Das ist vielleicht die Nixe von gestern Abend!«
Lysanne blinzelte. Ein Bild stieg vor ihren Augen auf. Gaspard, der Isabelle und ihr die Augen verbunden hatte und sie in dem Wäldchen hinter Ribérac zu einer verborgenen Lichtung geführt hatte. Auf dem Weg hatte er ihnen die absonderlichsten Dinge beschrieben. Als würden sie durch einen Märchenwald schreiten. Und abends, als sie sich gegenseitig die Zecken von den nackten Beinen gepickt hatten, hatte er behauptet, es wären verzauberte Käfer mit magischen Kräften.
Lysanne schluckte. Gaspard Lazalle war tot. Aber dieser Louis Aragon erinnerte sie auf eine verwirrende Weise an ihn. Sie hatte nicht erwartet, jemals wieder einem Mann zu begegnen, der sich dieser Art von Sprache bediente und aus dessen Blick so viel zauberhafter Schalk sprang. Aber Lysanne hätte niemals zugegeben, dass dieser Fremde ihr auf Anhieb sympathisch war. »Sie sind amüsant«, sagte sie stattdessen reserviert.
»Oh, es sollte Sie nicht amüsieren, sondern alarmieren«, widersprach Louis Aragon. »Wer weiß, vielleicht verwandelt sich die Passage de l’Opéra heute Nacht in den Ozean, und Sie werden aus Ihrem kleinen Zimmerchen da oben herausgespült.«
»Woher wissen Sie, dass ich dort wohne?«
Er antwortete nicht und sah sie mit einem eigenartig rätselnden Blick an. Es fühlte sich an, als würde dieser Blick sie sanft sezieren, und sie wich ein Stück vor ihm zurück.
»Warum starren Sie mich so an?«
Louis Aragon blinzelte, als müsste er ein inneres Bild vertreiben. »Sie erinnern mich an jemanden. Wenn mir doch nur einfiele, wer es war … Nun, irgendetwas an Ihnen ist mir vertraut, auf eine flüchtige Weise. Vielleicht ist es der zarte Blätterregen, durch den ich vergangenen Herbst spaziert bin.«
Lysanne musterte ihn verwirrt. »Ich sehe einfach nur gewöhnlich aus, das wird es sein.«
»Au contraire, Mademoiselle. Ich bin ein Mensch auf der Suche nach den besonderen Flügelschlägen des Lebens, und ich habe all meine Sinne geschärft, um keine noch so kleine Abweichung von der Normalität zu verpassen. Sie wissen es nicht, aber ich habe Sie schon ein paarmal hier gesehen. Immer in Eile. Immer ein wenig traurig. Ich bin ein Sammler von Zufällen und Abweichungen, und ich sehe in Ihnen eine Phiole mit einem besonderen Duft, der die Zerstreuungen meiner geliebten Passage mit einem neuen Aroma bereichert. Und die in mir die Frage aufkommen lässt, ob wir uns nicht früher schon einmal begegnet sind.«
Er lehnte sich zurück, um sich eine Zigarette anzuzünden. »Darf ich fragen, was Sie in Paris machen?«
»Ich suche jemanden.«
»Das ist ein guter Anfang. Aber nur, wenn Sie sich selbst suchen. Alles andere ist meistens zum Scheitern verurteilt.«