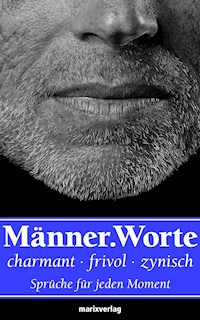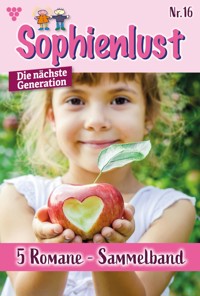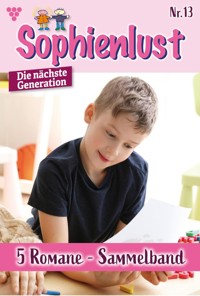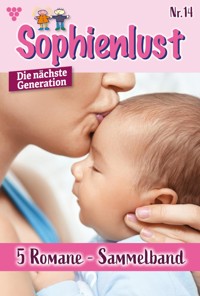25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gaslicht
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In dieser neuartigen Romanausgabe beweisen die Autoren erfolgreicher Serien ihr großes Talent. Geschichten von wirklicher Buch-Romanlänge lassen die illustren Welten ihrer Serienhelden zum Leben erwachen. Es sind die Stories, die diese erfahrenen Schriftsteller schon immer erzählen wollten, denn in der längeren Form kommen noch mehr Gefühl und Leidenschaft zur Geltung. Spannung garantiert! Keine Leseprobe vorhanden. E-Book 1: Die Geistergaleere E-Book 2: E-Book 3: Das Haus, das nicht sterben wollte E-Book 4: E-Book 5: Der Fluch des Pharao E-Book 6: E-Book 7: Du musst sterben, weil du jung bist E-Book 8: E-Book 9: Gefangene des Grauens E-Book 10: E-Book 11: Das geheimnisvolle Palazzo E-Book 12: E-Book 13: Das Mord-Komplott E-Book 14: E-Book 15: Reise an den Abgrund E-Book 16: E-Book 17: Lebendig begraben E-Book 18: E-Book 19: Friedhof des Grauens E-Book 20:
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1281
Ähnliche
Inhalt
Die Geistergaleere
Das Haus, das nicht sterben wollte
Der Fluch des Pharao
Du musst sterben, weil du jung bist
Gefangene des Grauens
Das geheimnisvolle Palazzo
Das Mord-Komplott
Reise an den Abgrund
Lebendig begraben
Friedhof des Grauens
Gaslicht – 1 –
Staffel
Diverse Autoren
Die Geistergaleere
Roman von Viola Larsen
Gezeichnet von den wüsten Spuren einer blutigen Meuterei ankerte Anno 1798 die Galeere »Gelatea« vor der Küste Louisianas. Käptn Francis, ein großer, schwerer Mann mit eisgrauem Haar und Bart, über dessen Stirn kreuzförmig eine kaum verheilte Narbe verlief, bot auf dem Sklavenmarkt seine Ware feil. Der Bursche, der ihn so übel zugerichtet hatte, war mit einer glimpflichen Strafe davon gekommen, weil er, jung und stark, teuer zu verkaufen war. Verzweifelt streckte seine schwangere Frau die Arme nach ihm aus, als er dem Käufer übergeben wurde. »Vergiß ihn«, herrschte Käptn Francis sie an. »Dich habe ich für mich gekauft. Du gehörst jetzt mir!« Just an der gleichen Stelle sollte über zweihundert Jahre später etwas Seltsames geschehen…
Es geschah an einem schwülen Sommermorgen am Golf von Mexiko. Der durchdringende Duft der Hickoryblätter war wie eine Glocke über das kleine Fischerdorf gestülpt, das auf einer Landzunge lag, welche die Form eines Fisches hatte, weshalb das Dorf auch den Namen des Meeresfisches »Mojarra« trug.
Auf dem etwas außerhalb des Ortes in einem Wald von Hickorybäumen gelegenen Seemannsfriedhof, der »Letzter Ankerplatz« genannt wurde, herrschte erhabene Stille, bis der kleine Noel Hannath mit seinem Schubkarren angetrabt kam.
»Passe bitte auf, Noel!« mahnte seine Mutter Leslie, als der Karren über zwei Steine holperte und die Schaufel, die Gießkanne und der Eimer, mit denen der Karren beladen war, gegeneinander schepperten. »Du weißt doch, daß die Männer ihre Ruhe haben wollen!«
Noel, ein Pfiffikus von sieben Jahren, schnitt eine Grimasse. »Wenn nie was los ist, das ist doch ätzend, Mummy?«
»Nicht für die Männer!«
›Die Männer‹, das waren die Seeleute, die auf dem Kirchhof ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. Allzu viele der Gräber trugen namenlose Kreuze, andere waren mit prächtigen Monumenten geschmückt, auf denen ganze Familiengeschichten dargestellt waren, weshalb man sie im Volksmund auch ›Denkmäler‹ nannte. Die kleine, recht wohlhabende Gemeinde legte großen Wert darauf, daß alle Grabstätten gepflegt waren, denn der Seemannsfriedhof »Letzter Ankerplatz« war eine Touristenattraktion.
Mit der Gräberpflege verdiente Leslie Hannath sich ein bescheidenes Zubrot, denn es lebte sich nicht üppig von Robins Heuer. Er war Bootsmann auf einem Frachter, der unter panamesischer Flagge fuhr, und sein letzter Kartengruß war aus Schanghai gekommen.
Alle hatten Leslie davor gewarnt, Robin Hannath zu heiraten, weil er das unruhige Blut seiner frühen Vorfahren geerbt hatte und nicht seßhaft werden wollte, um sich sein Brot als Garnelenfischer oder Austernpflücker zu verdienen. Doch alle gut gemeinten Ratschläge hatten nichts gefruchtet.
Leslie und Robin waren als Nachbarskinder aufgewachsen. Robin stammte aus einer Fischerfamilie, Leslies Eltern waren Lehrer an der Dorfschule gewesen. Die Kinder waren zusammen groß geworden und ihre Liebe war mit ihnen gewachsen. Sie hatten beide ihre Eltern früh verloren und sehr jung geheiratet. Robin war von Anfang ihrer Ehe an zur See gefahren, Leslie war allein in dem alten Haus der Hannaths zurückgeblieben.
Sogar in ihrer schweren Stunde war Leslie allein gewesen. Der Junge war in einer Christnacht zur Welt gekommen, und deshalb hatte sie ihn ›Noel‹ genannt, das hieß ›der an Weihnachten Geborene‹ Seitdem wartete sie mit dem kleinen Noel zusammen, bis Robin wieder einmal heimkam, freilich nie, um lange zu bleiben.
Leslie hatte es sich bedeutend leichter vorgestellt, eine Seemannsfrau zu sein. Sie war jung und sehnte sich nach Robins Nähe, doch er war weit fort von ihr. Zuweilen ertrug sie den Trennungsschmerz, die ständige Angst um den Liebsten und das trostlose Warten auf ihn fast nicht mehr. In solchen dunklen Stunden rebellierte sie gegen ihr Schicksal, hätte am liebsten ihren Jungen genommen und wäre mit ihm auch weit fortgegangen. Nur – wohin?
»Wenn wir fertig sind, darf ich dann Pecans sammeln gehen, Mummy?« fragte Noel, während er den Schubkarren vorsichtig, um keinen Lärm zu machen, über die nächste Steinhürde balancierte. Obwohl, er wußte ja, daß die Männer schon froh darüber waren, wenn mal eine Nuß herunterfiel und ein bißchen Krach machte, hatten sie doch alle eine Menge Abenteuer erlebt und die Nasen voll von der Stille. »Also, darf ich?«
»Ja, aber nur Nüsse, die heruntergefallen sind!« erlaubte Leslie.
Das war nicht so gut. Herunter fielen natürlich die reifen Nüsse, aber die Unreifen brachten mehr Bares. Noel besserte sein mageres Taschengeld damit auf. Apako, der indianische Kneipier, zahlte einen guten Preis für die unreifen Pecans, aus denen er nach einem alten indianischen Rezept einen Likör braute, auf den die Leute ganz verrückt waren, was Noel absolut nicht verstehen konnte. Er hatte nämlich einmal heimlich von dem Likör probiert, und es war ihm speiübel geworden.
»Ich habe gesagt, nur die Pecans, die heruntergefallen sind!« wiederholte Leslie mahnend. Sie hielt die Zügel der Erziehung ziemlich straff, denn ein Junge, der vaterlos aufwuchs, brauchte wenigstens eine starke mütterliche Hand. »Ist das versprochen?«
»Ja, Mummy«, versicherte Noel treuherzig, doch insgeheim war er entschlossen, es mit diesem Versprechen nicht allzu genau zu nehmen.
Er war ein drahtiger blonder Bursche mit strahlend blauen Augen. Leslie war stolz auf ihn. Noel sah seinem Vater sehr ähnlich, auch besaß er Robins verwegenen Charme und dessen fröhliche Unbekümmertheit.
Noel hingegen bedauerte es insgeheim, daß er nicht seiner Mutter ähnlich sah, denn sie war, wie er fand, sehr schön, und das stimmte auch. Eine glatte, oberflächliche Schönheit war Leslie Hannath freilich nicht. Es war vor allem ihre Ausstrahlung, die sie so reizvoll und liebenswert machte. Sie hatte braunes Haar und hellbraune Augen. Ihre Stimme klang warm, und ihr freundliches Wesen gewann ihr die Sympathien der Menschen. Nur die wenigsten wußten, daß Leslie Hannath auch eine Rebellin sein konnte!
»Gehen wir erst zu uns, Mummy?« fragte Noel. Damit meinte er die Grabstätte der Hannaths.
»Heute, ja.«
Noel hatte es ja geahnt, weil die Schmierseife und die Bürste in dem Karren lagen, und das bedeutete, daß er Ur-Ur-Ur-Oma Talabi wieder mal die Zehen schrubben mußte, damit kein Moos darüber wucherte. Er fing fröhlich zu pfeifen an, und Leslie wehrte ihm nicht. Vielleicht hatte Noel ja recht, und die Männer langweilten sich wirklich in der eintönigen Stille zwischen den namenlosen Kreuzen und stolzen Monumenten des Kirchhofs?
Die Grabstätte der Hannaths war das prächtigste und wohl auch das ungewöhnlichste Denkmal. Es war das einzige Monument aus schwarzem Marmor und dies, so tuschelten die Leute, wohl aus gutem Grund. Die Namen der Hannaths, ihre Geburts- und Todesdaten standen in schlichter Reihenfolge nebeneinander, behütet von der Statue einer aus dem schwarzen Marmor gemeißelten, anmutigen Frauengestalt. Noel kam sie wie ein schwarzer Schmetterling vor, der davonfliegen wollte.
Eine unreife, spitze Pecannuß fiel von dem Hickorybaum herunter.
Bestürzt beobachtete Leslie, daß die Statue erschrocken zusammenzuckte, als die Nuß auf das Kindergrab zu ihren Füßen polterte. Natürlich war das eine Täuschung! Eine Marmorstatue bewegte sich nicht. Es mußte ein Schatten gewesen sein, der Leslie genarrt hatte.
Noel hob die Nuß auf und schob sie schnell in seine Tasche. »Sonst futtert Ajamun sie noch auf!« Er hatte es wichtig mit dem Kindergrab, schon weil der Name ihm riesig imponierte. Es war nur ein Vorname, der in die Grabplatte gemeißelt war: ›Ajamun‹, und das bedeutete ›der, der kämpft, um zu bekommen‹. Na ja, die grüne Nuß wäre Ajamun schlecht bekommen, dachte er, denn wer unreife Pecans futterte, bekam Bauchgrimmen, das wußte Noel aus schmerzlicher Erfahrung.
Leslie blickte wie gebannt auf die Statue, war es ihr doch, als habe sich diese verändert. Das beunruhigte sie. Ihr Herz klopfte schneller. Ein unheimliches Bangen beschlich sie.
Stimmte es, was die Leute sich über Talabi Hannath erzählten? Leslie war eher geneigt, die Geschichte für eine Legende zu halten.
Gewiß, Käptn Francis, dem Urahn der Hannaths, wurden sehr schlimme Dinge nachgesagt, und vielleicht war er ja wirklich ein böser Mensch gewesen. Allerdings hieß es auch, daß er ein starker und furchtloser Mann gewesen sei, doch das eine schloß das andere ja nicht aus.
Seiner bösen Taten wegen, flüsterte man sich zu, müsse er noch immer mit einer Geistergaleere über die sieben Meere kreuzen und gelegentlich sollte er sich eine junge, schöne Frau als Opfer seiner Lüste holen.
Leslies Blick suchte das Todesdatum von Käptn Francis erster Frau, die sehr jung gestorben war, nachdem sie dem Käptn drei Söhne geboren hatte. Krank sollte sie nicht gewesen sein, doch den Namen von Käptn Francis wagte in diesem Zusammenhang niemand auszusprechen. Man erzählte sich noch Schlimmeres, ohne den Namen des Käptn zu nennen. Leslie sah auf das Kindergrab und ein eisiger Hauch streifte sie, der sie erschauern ließ.
Erschrocken zuckte sie zusammen, als in diesem Augenblick deutlich ein leises Kichern zu vernehmen war.
»Hörst du es auch, Mummy?« fragte der emsig schrubbende Noel vergnügt. »Uroma Talabi kichert!«
»Rede keinen Unfug«, fuhr Leslie auf. »Eine Steinfigur kichert nicht!«
»Warum denn nicht? Es kitzelt, wenn ich Talabi die Zehen schrubbe. Dann muß sie kichern. Das hat sie schon öfter gemacht.«
»Was sagst du da?« Ein kalter Schauder überrann Leslie. »Sie hat schon öfter gekichert?«
»Ja, da bist du nur nicht dabei gewesen.«
»Warum hast du mir nichts davon gesagt?«
»Weiß nicht.« Ganz so war das eigentlich nicht. Noel hatte es seiner Mummy nicht gesagt, weil Talabi ihn darum gebeten hatte, es für sich zu behalten. Seine Mummy würde sich nur furchtbar aufregen und es doch nicht verstehen, hatte Talabi zu ihm gesagt. »War doch nicht wichtig, Mummy, oder?«
Leslie kannte ihren Sohn! Wenn er so treu blickte, war garantiert etwas im Busch. »Heraus damit, Noel!«
»Womit denn, Mummy?« Aber es half nichts, den Unschuldigen zu mimen, denn Leslie hatte so einen gewissen Blick, der bis in Noels Herz drang. »Na ja«, räumte er ein, »manchmal reden wir eben miteinander.«
Leslie stockte der Atem. »Mit wem redest du?«
»Mit Talabi«, antwortete Noel trotzig.
Da war der eisige Hauch wieder, der Leslie streifte. »Moment mal, mein Sohn!« Warum fror sie nur so entsetzlich? »Du behauptest allen Ernstes, daß du mit Talabi redest?«
»Nicht richtig«, beeilte Noel sich zu versichern.
»Was soll das nun wieder heißen?«
Wie sollte er ihr das erklären? Talabi hatte recht gehabt. Seine Mummy verstand es nicht. Noel versuchte, sich verständlich zu machen. »Also, das ist so, Mummy. Ich höre, was Talabi sagt, und sie hört, was ich sage. Aber wir bewegen die Lippen nicht. Ich meine, wir reden nicht laut miteinander.«
»Nicht so, wie wir zusammen reden, meinst du das?«
Genau das meinte Noel, und er war erleichtert darüber, daß seine Mummy ihn doch zu begreifen schien.
Aber sie fing nicht an, sich aufzuregen, sondern blieb ruhig. Nur sehr blaß wurde sie, richtig weiß im Gesicht.
Leslie nahm sich zusammen. Sollte sie dieses irrwitzige Gespräch vertiefen, oder war es nicht besser, wenn sie zur Tagesordnung überging? Kinder hatten manchmal merkwürdige Fantasien.
»Ich habe noch bei den Namenlosen zu tun«, sagte sie. »Wenn du hier fertig bist, Noel, kannst du mir dort helfen.«
»Mache ich, Mummy!«
Die Schwüle brach wieder über Leslie herein. Langsam ging sie davon. Nach ein paar Schritten blieb sie stehen. Mit beiden Händen fuhr sie sich zum Hals, weil sie keine Luft mehr bekam. Es mußten, sagte sie sich, die feuchte Schwüle und der durchdringende Duft der Hickoryblätter sein, die ihr den Atem raubten!
Was auch sonst hätte es sein sollen?
*
Der gleiche intensive Duft lastete auch über der Hickory-Plantage der Mannerings, drang durch Ritzen und Fugen in das herrschaftliche, alte Pflanzerhaus und verursachte Sheila Mannering quälende Kopfschmerzen.
An solchen Tagen fragte Sheila sich, warum ihre Vorfahren nicht etwas anderes angepflanzt hatten? Baumwolle, vielleicht, oder Mais oder Zuckerrohr oder was auch immer, jedenfalls irgend etwas, das nicht einen so durchdringenden Duft verströmte wie die Blätter der Hickorybäume.
Das war ungerecht, denn die Grundlage ihres Reichtums verdankten die Mannerings diesen Walnußbaumgewächsen, deren spitze Nüsse, die Pecans, vielfach verwendbar waren und deren Holz sich gut verkaufen ließ. Später waren noch andere Quellen des Reichtums wie das Erdöl und die Raffenerien dazu gekommen, und inzwischen war Mannering führend in der Petrochemie.
Darüber dachte Sheila freilich nicht nach. Sie war eine goldene Tochter, die es nie nötig gehabt hatte, über irgend etwas nachzudenken. Mit ihrer auffallend schmalen Figur, ihrem naturkrausen, rotblonden Lockenschopf und ihren grünen Augen war sie ein bezaubernder, jungenhafter Typ. Sie hatte Charme und Witz und eine erstaunlich tiefe, ein bißchen rauhe Stimme. Eine ›Schiffsjungenstimme‹, wie John Mannering, ihr Vater, gescherzt hatte.
Ihre Mutter hatte sie früh verloren und nach dem plötzlichen Herztod ihres Vaters war sie die Herrscherin über die Plantage, das Erdöl und die Petrochemie. Ein Erbe war in ihren Besitz übergegangen, dessen überwältigende Größe ihr gar nicht bewußt war. Die Geschäfte interessierten sie auch nicht, die Leitung des Mannering-Trusts überließ sie dem schon zu Lebzeiten ihres Vaters unentbehrlichen James Bennett.
Über ihn mußte Sheila an diesem Morgen allerdings nachdenken, denn in drei Tagen sollte sie ihn heiraten.
Hatte John Mannering seiner Tochter nicht hundertmal gesagt, sie müsse, wenn er einmal nicht mehr da sein würde, James Bennett unbedingt halten, weil sonst der gesamte Mannering-Trust verloren sei?
Genau damit hatte James Bennett sie unter Druck gesetzt! Oh, Sheila glaubte ihm ja, daß er sie liebte und es tat ihr leid, daß sie seine Gefühle nicht in dem gleichen Maße zu erwidern vermochte.
Aber was war überhaupt Liebe? Sheila wußte es nicht. Sie hatte auch hierüber nie nachgedacht, sondern ihren Spaß an amüsanten Flirts und flüchtigen Begegnungen gehabt. Eine ernsthafte Beziehung hatte sie nie gewollt und auf keinen Fall wollte sie sich mit dreiundzwanzig Jahren schon fest binden!
Dabei war James Bennett ihr absolut nicht zuwider. Sie fand ihn durchaus sympathisch und als Freund hätte sie ihn gerne ihr Leben lang behalten. Aber als Ehemann? Er war nun einmal nicht der Typ, der zärtliche Gefühle in ihr auslöste und ihr Herz schneller schlagen ließ.
James hatte sie fatal in die Enge getrieben, indem er ihr das Angebot eines europäischen Pharmakonzerns präsentiert hatte, der seinen Sitz in London hatte und ihn als Generalmanager anheuern wollte. Klipp und klar hatte er Sheila erklärt, daß er den Mannering-Trust verließ, falls Sheila sich nicht dazu entschloß, seine Frau zu werden!
Warum, grübelte sie, hatte er es mit der Heirat auf einmal so eilig? Warum drängte er derart auf eine schnelle Hochzeit? Nur aus Liebe – oder gab es noch einen anderen Grund dafür?
Sie hatte ›Ja‹ gesagt, aber sie hatten sich nicht einmal einen Verlobungskuß geschenkt.
Mit Zärtlichkeiten bedrängte James sie nicht. Er versicherte ihr, daß er ihr in dieser Hinsicht Zeit lassen wolle. Das war ja wahnsinnig nett von ihm, fand Sheila, befürchtete jedoch, daß sich an ihrer Einstellung ihm gegenüber in dieser Hinsicht bis zu ihrer goldenen Hochzeit nichts ändern würde!
Ihre Kopfschmerzen wurden unerträglich.
Vielleicht war der Duft der Hickoryblätter gar nicht Schuld daran, sondern ihr Kopf schmerzte, weil sie über James und ihre Hochzeit nachdenken mußte. Auch machte es sie rasend, daß in dem ganzen Haus ein heilloses Durcheinander herrschte, weil schon die Vorbereitungen für das Hochzeitsfest getroffen wurden.
Es sollte eine riesige Überraschungsparty für die Freunde des Paares und auch für die Braut werden. Um den Presserummel zu vermeiden, hatte James zu Sheila gesagt, sei es ratsam, den Hochzeitstermin streng geheim zu halten. Er hatte es auch übernommen, die Fete zu arrangieren, und Sheila war das gerade recht, denn sie hatte nicht die geringste Lust dazu, ein Fest für die erzwungene Hochzeit auszurichten.
Dabei war das alte Pflanzerhaus mit seinen schlanken weißen Säulen und umweht von dem nostalgischen Charme der Vergangenheit wie genau dazu geschaffen, glanzvolle Feste darin zu feiern.
Die Räume waren hell und lichtdurchflutet, mit zahlreichen antiken Kostbarkeiten ausgestattet, und man konnte sich lebhaft vorstellen, wie das einmal gewesen war, damals, vor dem Sezessionskrieg 1863, als die Damen des Hauses in ihren Roben aus schmeichelhaftem Samt und knisternder Seide durch die Räume geschwebt waren.
Nein, Sheila hielt das hektische Durcheinander der Festvorbereitungen und den aufdringlichen Duft der Hickoryblätter nicht mehr aus! Spontan, wie es ihrem Naturell entsprach, ergriff sie die Flucht. Dabei hatte John Mannering seiner Tochter, schon als sie noch ein Kind gewesen war, eingeschärft, daß Flucht nie eine Lösung war. ›Die Probleme, vor denen du davonläufst‹, hatte er zu ihr gesagt, ›haben schnelle Beine und kommen dir überallhin nach!‹
Sheila lief trotzdem davon.
Sie sagte der schwarzen Wirtschafterin kurz Bescheid, daß sie zu ihrer Yacht fahren wolle und nicht sagen könne, wann genau sie zurückkomme. Kurz entschlossen setzte sie sich in ihr schickes Cabrio, schaltete eine Radiostation mit hämmernden Rockrhythmen auf höchste Lautstärke und fuhr los. Es war nicht weit von dem Pflanzerhaus bis zu dem Platz an der Küste, an der die Yacht vor Anker lag.
Doch hier geriet Sheila vom Regen in die Traufe. Auf der Yacht herrschte der gleiche hektische Tumult, das gleiche Durcheinander wie in dem Pflanzerhaus.
Auf der Yacht wollte James die Hochzeitsgäste ja versammeln, wenn um Mitternacht auf einer Tribüne im Wasser als Höhepunkt des Festes ein Brillantfeuerwerk abgebrannt werden sollte. Das hatte Sheila ganz vergessen.
Sie ging gar nicht erst an Bord, sondern fuhr einfach weiter, die Küste entlang, hielt bei Henrys Bootsverleih an, charterte einen schnellen Motorflitzer und brauste los.
Draußen auf dem Wasser fühlte sie sich wohl. Sie genoß das herrliche Gefühl der Freiheit! Ihre Kopfschmerzen waren auf einmal wie fortgeblasen. Erst als sie Hunger bekam, steuerte sie den kleinen Fischerhafen von Mojarra an.
Die Ankerplätze waren besetzt von Fischerbooten, die träge in dem trüben Wasser schaukelten. Sheila manövrierte das kleine Motorboot geschickt in die schmale Lücke neben einem Schiff, das hier eigentlich auch nichts verloren hatte, denn es war kein Fischkutter, sondern ein Raddampfer, ein uraltes, marodes Ding.
Zwei schwarze Schornsteine stachen wie erhobene Zeigefinger in den blauen Himmel, von den riesigen Antriebsrädern war der rote Putz abgeblättert, die Wände waren schmutzig-grau und einige Staketen der Reling waren abgebrochen, wodurch das Deck aussah wie das aufgerissene Maul eines Riesenfisches, der Zahnlücken hatte.
Sheila wurde es kalt und heiß. Ein Schauer überlief sie, wobei sie nicht wußte, ob es ein Schauer der Angst oder ein Wonneschauer war? Der häßliche alte Raddampfer strahlte etwas aus, das sie in einen dunklen, geheimnisvollen Bann zog.
An Deck brutzelte ein Mann Fische in einer Pfanne.
Himmel, was für ein Bursche war das! Lang, breitschultrig, drahtig, muskulös. Dunkles Haar, das lockig unter einem Stirnband hervorquoll, dunkler Wangenbart, ein kantiges, von Wasser, Wind und Sonne gegerbtes Gesicht. In Jeans und mit nacktem Oberkörper stand er breitbeinig an Deck und träufelte Öl über die in der Pfanne brutzelnden Fische.
Sheilas Magen knurrte, und das Wasser lief ihr im Mund zusammen.
»Hey!« rief sie hinüber. »Gibt’s da drüben was zu futtern?«
»Warum?«
»Weil ich hungrig bin.«
»Sie können ja herüber kommen.«
»Bin schon unterwegs!«
Als sie an Bord des Raddampfers kam, drehte der Bursche sich nicht einmal um. »Gabeln sind in der Kombüse.«
Gastfreundlich schien er nicht zu sein, oder er hatte schlicht und einfach keine Manieren. Sheila amüsierte das.
Die Kombüse stellte sie fest, war aufgeräumt und peinlich sauber. Sie fand Pappteller und Plastikbesteck, und als sie damit wieder an Deck kam, stellte sie sich vor: »Ich heiße Sheila.«
Er hieß Fran.
»Dann sagen wir doch einfach Sheila und Fran zueinander«, schlug sie vor.
Er warf ihr einen kurzen Blick aus dunklen Feueraugen zu. »›Mam‹ und ›Käptn Fran‹, Mam«, setzte er dagegen.
Sheilas Brauen zuckten belustigt in die Höhe als sie stramm salutierte. »Aye, aye, Käptn Fran.«
Er reagierte nicht auf den Scherz, schien ein ziemlich humorloser Geselle zu sein.
Sheila setzte sich auf die Bank an den Tisch, der neben der Kochplatte stand. »Und jetzt her mit dem Fisch!«
Er lud ihren Pappteller voll. »Fangfrisch!« Guten Appetit wünschte er ihr nicht, aber den hatte Sheila ja sowieso.
»Kann ich auch ein Stück Brot haben?«
Er schob ihr das Brot, ein Messer und eine Coladose hin.
Selbstbedienung an Bord, das war neu für Sheila, und es machte Spaß, war doch mal was anderes! Sie schnitt eine dicke Scheibe Brot ab, tunkte sie in das heiße Öl, auf dem sich noch Bläschen kräuselten und kostete von dem Fisch. Es schmeckte himmlisch! Kochen konnte Käptn Fran!
Er aß von seinem Pappteller im Stehen. Dabei schob er das Stirnband zurück.
Da sah Sheila die kreuzförmige Narbe auf seiner Stirn, die aussah, als sei sie kaum verheilt. Sagte man dem berühmt-berüchtigten Käptn Francis, der angeblich noch immer auf den Meeren spuken mußte, nicht nach, daß er genau solch eine Narbe auf der Stirn gehabt haben sollte, schoß es ihr durch den Kopf?
Wieder überrann sie ein Schauer, beängstigend und wohlig zugleich. War es doch Angst – oder was sonst?
Ihr Handy klingelte.
Aber sie konnte das nicht hören, denn sie hatte es in ihrem Cabrio liegen lassen, das auf dem Parkplatz der Bootsvermietung stand.
*
Im Grunde war es dem Anrufer ganz recht, daß Sheila nicht abnahm, denn es war ihm lieber, wenn er die heikle Geschichte, die vor ihm lag, erst hinter sich hatte, bevor er mit ihr telefonierte.
Andererseits hatte er Sheila versprochen gehabt, sie im Laufe des Vormittags anzurufen, und James Bennett hielt gegebene Versprechen, nur war er wieder mal noch nicht dazu gekommen, sein Versprechen einzulösen. Manager eines Weltkonzerns zu sein, war ein gnadenloser Job, der für ein Privatleben keinen Raum ließ.
›Die Petrochemie‹, behauptete Alix, ›ist deine wahre Geliebte, und sie ist schlimmer als zehn eifersüchtige Weiberleute!‹
James Bennett war auf dem Weg zu Alexandra Battista, die von ihren Freunden kurz ›Alix‹ genannt wurde.
Die Strecke von der Mannering-Petrochemie zu dem idyllischen Vorort von New Orleans, in dem Alix wohnte, legte er sonst in einem höllischen Tempo zurück.
Diesmal tat er dies nicht. Es ging gegen Mittag und auf den Straßen herrschte hektischer Verkehr. Doch nicht deshalb fuhr James Bennett so manierlich. Wer sauste auch schon mit einem Affenzahn seiner Hinrichtung entgegen? So ungefähr etwas Ähnliches, befürchtete er, erwartete ihn nämlich.
Dabei war James Bennett kein furchtsamer Typ und durch seinen Job darin geschult, brisante, auch hochdramatische Auseinandersetzungen zu meistern. Ein Haudrauf war er freilich nicht, sondern ein Kämpfer von der ruhig bleibenden, beharrlichen Sorte. Aber auf seine Weise setzte er seinen Willen durch!
Er war auf Sieg programmiert, das verrieten allein schon sein energisches Kinn und die etwas gewölbte Stirn.
Er war schlank und hochgewachsen, hatte helles, kurz gestyltes Haar und kühle graue Augen. Seine sonore Stimme und seine sichere Haltung strahlten jene Verläßlichkeit und Seriösität aus, die ein Manager brauchte, um Geschäftspartner, Banker und andere Leute von der Unfehlbarkeit seiner Argumente zu überzeugen.
Von Hause aus hatte er das beste Rüstzeug für eine Steilkarriere mitbekommen. Er stammte aus einer angesehenen Bostoner Anwaltsfamilie, hatte eine erstklassige Universität besucht und einige Praktika in Europa absolviert, bevor er bei Mannering zunächst als Assitent John Mannerings eingetreten war. Der Chef hatte ihn bald systematisch zu seinem Kronprinzen aufgebaut, wobei er insgeheim gehofft hatte, daß aus James, dem er wie einem Sohn zugetan gewesen war, und seiner Tochter Sheila einmal ein Paar werden würde.
Wie nur sollte James es Alix beibringen?
Natürlich hatte er sich schon einige Formulierungen zurechtgelegt, aber er machte sich nichts vor, egal, was er sagen würde, Alix würde explodieren. Sie war keine Frau, die sich einfach abservieren ließ.
Doch es gab kein Entrinnen!
Schon bog er mit seinem Wagen in die schicke Vorortstraße, in der anonyme Hochburgen standen, bei der nicht einmal die Briefkästen Namen sondern nur die Nummern der Wohnungen trugen und es durchaus passieren konnte, daß manche Leute jahrelang im gleichen Haus lebten, ohne sich je zu begegnen oder gar ein paar Worte miteinander zu wechseln.
In einer dieser komfortablen Residenzen hatte James Bennett ein Appartement für Alix gekauft und eingerichtet.
Zuerst war sie keineswegs begeistert davon gewesen, denn sie stand mehr auf der alternativen Masche, doch dann hatte sie sich schnell in die Annehmlichkeiten des exklusiven Umfeldes eingelebt. Es paßte ja auch zu ihr.
Alix war jung, schön und sexy. Sie war eine hochbegabte Journalistin und hätte absolut das Zeug dazu gehabt, ernsthafte Probleme journalistisch aufzuarbeiten. Zu James Mißfallen entwickelte sie jedoch eine fatale Neigung zum Sensationsjournalismus, womit sie enorm erfolgreich war. Ihm gefiel das trotzdem nicht.
Kennengelernt hatten sie sich, als Sheila einem Korruptionsskandal in der Mannering Petrochemie auf der Spur gewesen war und in dieser Sache ein Interview mit James geführt hatte. Der Skandal, den James dank ihrer Informationen schleunigst aufgedeckt und aus der Welt geschafft hatte, war daraufhin nicht publik geworden, denn zwischen Alix und James hatte es gefunkt. Zuerst war es nur eine schnelle, heiße Sexaffäre gewesen und das hätte es eigentlich auch bleiben sollen, doch sie dauerte inzwischen einige Jahre!
James hatte einen Schlüssel zu Alix’ Appartement und jederzeit Zutritt. Er wußte, das sie um diese Zeit zu Hause war, denn sie war ein Nachtmensch und schlief in den Tag hinein.
Aber als er die Tür zu dem Appartement aufmachte, marschierte Alix schon ausgehfertig mit ihrem schnurlosen Telefon durch das mit Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, Infomappen und Pressenotizen vollgestopfte Studio und ihre langen schwarzen Haare flatterten wie Rabenfedern um ihr auffallend kleines, apartes Gesicht. Vielleicht wirkte ihr Gesicht aber auch nur so klein, weil die Pracht ihrer Schneewittchenhaare es schier erdrückte.
Ihre gescheiten schwarzen Augen funkelten, ihre lebhaften Gesten zeugten von ihrer inneren Anspannung und die langen Schritte, die sie machte, verrieten, daß sie mal wieder total im Streß war.
Ungeduldig machte sie James ein Zeichen, sie ja nicht zu unterbrechen, beendete das Gespräch dann aber doch abrupt.
»Tut mir wahnsinnig leid, James!« Sie hatte eine helle Stimme, die wie immer, wenn Alix innerlich angespannt war, etwas metallisch klang. »Ist ja irre nett von dir, daß du vorbeischaust. Nur habe ich keine Zeit.«
Das hatte er schon gemerkt. Er mußte es ihr trotzdem sagen, mußte ihr sagen, daß seine Heirat mit Sheila Mannering eine beschlossene Sache war und in drei Tagen stattfand.
»Stell dir vor«, überfiel Alix ihn, bevor er den Mund auftun konnte, »ich habe einen ganz tollen Tip bekommen! Ein Geisterschiff ist in der Nähe der Küste von mehreren glaubhaften Augenzeugen gesichtet worden.« Ihre Augen glitzerten vor Neugier und Unternehmungslust. »Ob es wieder Käptn Francis auf der Suche nach einem Opfer ist?«
James wollte sie unterbrechen, doch Alix redete schon weiter. »Leider widersprechen sich die Aussagen in einem entscheidenden Punkt. Einige haben ihn auf einem alten, maroden Raddampfer gesehen –«
»Dann ist es nicht Käptn Francis«, schaltete James sich ungeduldig ein, »Raddampfer gab es zu seiner Zeit doch noch gar nicht. Käptn Francis’ berüchtigtes Sklavenschiff war eine Galeere, ein Segler mit Ruderantrieb.«
»Ein Segler mit Ruderantrieb!« hauchte Alix hingerissen. »Dort haben die anderen Augenzeugen ihn gesehen! Dann ist er es! Oh, er ist es! Wie findest du das, James?«
»Komisch.« Er glaubte nicht an Geisterschiffe, ob es sich nun um einen Raddampfer oder eine Galeere handelte und schon gar nicht glaubte er daran, daß Käptn Francis, der seit zweihundert Jahren tot war, im Golf von Mexiko herumspukte. »Mach dich nicht lächerlich, Alix!«
»Lächerlich?« fauchte sie. »Du hast eben keine Ahnung von meinem Job! Diese Story wird die Sensation des Jahres…«
»Ich muß mit dir reden, Alix«, unterbrach er sie entschlossen. »Jetzt und sofort!«
»Jetzt und sofort muß ich fort!«
»Am hellichten Tag wirst du den Käptn kaum begegnen!«
»Nein, aber bis ich meine Recherchen gemacht und meine Vorbereitungen getroffen habe, ist sowieso Nacht und stockfinster. Oh, ich muß noch einen Film für Nachtaufnahmen besorgen…«
»Worüber ich mit dir zu reden habe«, schnitt James ihr sehr energisch das Wort ab, »es ist wichtig! Ich muß es dir sagen!«
»Dann sage es mir. Aber schnell!«
»Ich heirate Sheila Mannering.«
Alix hatte schon wieder eine Nummer gewählt und redete in das Telefon. »Was machst du,
James?« fragte sie nebenbei. Aber dann begriff sie und legte auf und starrte ihn an. »Du heiratest Sheila?«
»So ist es.«
»Wann?«
»In drei Tagen. Ich habe den Termin geheimgehalten, um dem Presserummel zu entgehen.« Seine sonore Stimme erhob sich etwas. »Falls du es wagen solltest…«
»Ich bin hinter Sensationen her, James!« Alix schnippte spöttisch mit den Fingern. »Deine Heirat mit Sheila Mannering ist keine Sensation. Nicht mal eine Überraschung. Damit rechnet doch jeder. In Insiderkreisen werden schon Wetten abgeschlossen, wann du den Coup endlich landen wirst!«
Alix explodierte nicht.
Das verunsicherte James Bennett ungeheuer.
Sie fing an, ihr Handwerkszeug zu richten. »Ich verstehe, daß dir die Hochzeit wichtig ist, sie ist ja auch ein bedeutender Geschäftsabschluß für dich.« Alix blieb total cool. »Aber für mich ist Käptn Francis auf seiner Geistergaleere wichtiger!«
»Falls es nicht doch ein Raddampfer und gar nicht Käptn Francis ist!« höhnte James, dessen männliche Eitelkeit durch Alix’ gleichgültiges Verhalten zutiefst getroffen war.
Alix pfiff den Hochzeitsmarsch, während sie ihr Mikrophon, das Aufnahmegerät, einen Schreibblock, ein Nachtfernglas und den Fotoapparat einpackte. »Wenn du Sheila lieben würdest«, sagte sie schon auf dem Weg zur Tür, »dann würde ich platzen vor Eifersucht! Aber du heiratest sie doch nur aus schierem Machterhalt und der Petrodollars wegen. Und jetzt entschuldige mich. Ciao, James!«
Die Tür knallte hinter ihr heftig zu.
Das war die blamabelste Niederlage, die James Bennett sich jemals in seinem Leben eingehandelt hatte. Noch nie zuvor auch hatte jemand ihm derart offen einen Spiegel vorgehalten!
Er wartete, verließ das Appartement erst, als er sicher sein konnte, daß Alix mit dem Lift unterwegs in die Tiefgarage war. Dann kehrte er mit langen Schritten zu seinem Wagen zurück, den er auf dem Gästeparkplatz des Hauses abgestellt hatte.
Unverzüglich machte er sich auf den Rückweg nach New Orleans und versuchte während der Fahrt Sheila über das Autotelefon zu erreichen. Vergebens. Eine bohrende Unruhe beschlich ihn.
Warum meldete Sheila sich nicht?
Wenigstens hatte Alix ihm den Abschied leicht gemacht. Aber die Kränkung, die seinem männlichen Selbstwertgefühl dadurch widerfahren war, rumorte in ihm. Er hatte nicht gedacht, daß er Alix so wenig bedeutete! Für ihn war die Trennung von ihr, wie ihm erst jetzt bewußt wurde, schmerzlich. Andererseits war er erleichtert darüber, daß ihm durch Alix’ eiskalte Reaktion eine Szene erspart geblieben war.
Außerdem war er wütend auf sie! Wie hatte sie es wagen können, ihm ins Gesicht zu schleudern, daß diese Heirat nur ein Geschäftsabschluß für ihn bedeutete, weil es ihm nicht um Liebe, sondern um den Machterhalt und die Petrodollars ging, wobei es ihn rasend machte, daß Alix recht hatte.
Dabei war doch auch für sie nur ihr Job wichtig. Diese lächerliche Geistergaleere war ihr wichtiger gewesen, als die Trennung von ihm. Alix hatte ihn, davon war er überzeugt, ohne Gefühlsregung aus ihrem Leben entlassen.
Doch dies war ein Irrtum!
*
Alix war außer sich.
Während sie zu dem Touristik-Center von New Orleans fuhr, um sich Informationen für ihre Recherchen zu besorgen, liefen Tränen über ihr Gesicht.
Sogar in dem Info-Center rollten ihre Tränen weiter, und der mitleidige Blick der freundlichen Hostess veranlaßte sie, eilig zu betonen, daß sie sich einen scheußlichen Schnupfen eingehandelt hatte. »Kein Wunder bei dieser Schwüle, nicht wahr? Ein bißchen Zugluft, und schon ist es passiert!«
Man kannte sich. Alix hatte durch ihren Job öfter hier zu tun.
»Sie wollen Infos über den ›letzten Ankerplatz‹?« vermutete die Hostess, die schon gehört hatte, daß Käptn Francis an der Küste gesichtet worden sein sollte. »Sie sind doch sicher hinter ihm her, Miß Battista! Aber seien Sie vorsichtig«, warnte sie schaudernd. »Der Käptn ist schon zweimal hier an der Küste aufgetaucht und jedesmal war danach eine junge Frau verschwunden.«
»Er soll auf einem Raddampfer aber auch auf einer Galeere gesehen worden sein?«
»Ja, das ist merkwürdig.« Die Hostess richtete eifrig das Material heraus. »Andererseits, können Geister denn nicht an mehreren Orten zur gleichen Zeit sein?«
Das hatte Alix noch gar nicht bedacht.
»Haben Sie sonst noch etwas gehört?«
»Nur, daß er sogar am hellen Tag gesehen wurde. Dabei ist er doch immer nur in Sturmnächten aufgetaucht!«
»Öfter mal was Neues!« Alix kämpfte immer noch mit ihren Tränen, und sie nieste ein paarmal kräftig, um den Schnupfen, den sie angeblich hatte, glaubhaft zu machen. »Dann werde ich mich mal auf die Strümpfe machen. Vielen Dank für Ihre Bemühungen!«
»Gute Besserung für Ihren Schnupfen«, wünschte die nette Hostess. »Und geben Sie acht auf sich, Miß Battista!«
»Mache ich«, versprach Alix.
Ihre Tränen versiegten, als sie in ihrem Wagen einen Blick in die Unterlagen warf. Das war echt eine heiße Story! Angst hatte sie nicht, denn mit heißen Stories waren immer Risiken verbunden. Alex war schon mit einem Mafiapaten, einer ausgerasteten Hollywood-Diva, die mit einem Kampfhund auf sie losgegangen war und einem Heiratsschwindler fertig geworden, der erst abkassiert und die armen Frauen danach kalt gemacht hatte. Käptn Francis schreckte sie nicht!
Energisch putzte sie sich die Nase.
War James Bennett, fragte sie sich überhaupt, die Tränen wert, die sie um ihn weinte?
Alix hatte es in ihrem Leben nicht leicht gehabt. Sie stammte aus kleinen Verhältnissen, ihre Eltern, die sie früh verloren hatte, waren einfache Leute gewesen. Ihren Weg nach oben hatte sie sich hart erkämpft. So selbstsicher und kühl sie sich auch gab, war sie in Wahrheit doch sehr verletzlich.
Aber nun gewann sie ihre Selbstsicherheit zurück, und sie handelte.
Über ihr Autotelefon rief sie Nell an.
Nell, eine freundliche, gutmütige Farbige, war ihre treue Begleiterin, die ihr alle lästigen Dinge wie Putzen, Waschen, Bügeln, abnahm. Nell wohnte in der gleichen engen Gasse im vieux carré, in der auch Alix gelebt hatte, bevor sie in die Nobelburg umgezogen war. Ihre kleine Wohnung dort hatte sie nie aufgegeben.
»Packe meinen ganzen persönlichen Kram in der Nobelburg sofort zusammen, Nell, und schaffe das Zeug in meine alte Bleibe«, bat sie. »Wir sehen uns dann dort. Ich bin jetzt hinter Käptn Francis her.«
»Gib acht auf dich, Alix!« mahnte Nell besorgt.
»Wie immer. Bis dann, Nell.«
Als das erledigt war, fühlte Alix sich frei. Jetzt konnte sie sich auf Käptn Francis konzentrieren! Nur war der belebte Parkplatz vor dem Infocenter just nicht der rechte Ort, um sich in die Unterlagen zu vertiefen. Außerdem mußte sie sich, um für ihre nächtliche Aktion gerüstet zu sein, ein Boot besorgen.
Sie fuhr zu Henrys Bootsverleih. Dort hatte sie schon einige Male für Verfolgungsjagden zu Wasser schnelle Flitzer gechartert. Mister Henry, ein weißhaariger Senior, war ein ehemaliger Marinesoldat, er trug immer noch eine Art Uniform und sah darin aus wie ein Admiral im Ruhestand.
»Muß ja wohl nicht fragen, hinter wem sie heute her sind, Miß Battista?« Er zwinkerte ihr zu. »Käptn Francis soll sich mit seiner Geistergaleere wieder mal in der Gegend herumtreiben!«
»Und was haben Sie darüber gehört?«
»Nur, daß der Bursche, den man gesichtet hat, die gleiche Narbe auf der Stirn hat wie Käptn Francis sie gehabt haben soll!«
»Was halten Sie davon?«
»Nichts. Ich glaube nicht an Gespenster, Miß Battista. Das sind doch alles Mären und Legenden. Aber wenn es den Leuten Spaß macht, sich zu gruseln, sollen sie doch! Ja, dann muß es wohl was Stabiles sein für heute Nacht! Seien Sie vorsichtig!«
»Ich denke, Sie glauben nicht an Gespenster!«
»Aber ich habe einen höllischen Respekt vor Stürmen. Es braut sich was zusammen, ich sage es Ihnen. Habe eine Nase dafür.« Er werde alles zu ihrer Zufriedenheit veranlassen, versprach er. »Sie können das Boot jederzeit abholen, es ist immer jemand für Sie da, Miß Battista.«
Alix bedankte sich und ging zu ihrem Wagen zurück, um die Infos einzusehen. Sie hatte neben einem Cabrio eingeparkt, aus dem ein Radio plärrte und ein Handy piepte. Nach einer Weile störte sie das. Es war rücksichtslos! »He!« rief sie hinüber. »Lauter geht’s wohl nicht?«
Als keine Reaktion erfolgte, stieg sie aus, um sich Ruhe zu verschaffen. Das Verdeck des Cabrio war offen, mochte der Kuckuck wissen, wo der Besitzer sich herumtrieb. Kurz entschlossen schaltete Alix das plärrende Radio aus und fauchte in das piepende Handy: »Es ist niemand zu Hause!«
»Alix!?« fragte eine vertraute Stimme entgeistert.
»James?« rief Alix genau so verblüfft.
»Oh, entschuldige«, stammelte Bennett. »Ich muß mich verwählt haben. Eigentlich wollte ich Sheila anrufen…«
Alix ließ das Handy fallen wie eine heiße Kartoffel, es fiel kopfüber auf die Fußmatte, jaulte kurz und gab dann den Geist auf. Das Cabrio gehörte Sheila Mannering!
Das hatte Alix gerade noch gefehlt. Der richtige Parkplatz war das wohl nicht.
Sie fuhr weiter, die Küstenstraße entlang. Wenn sie nur
James’ Stimme nicht gehört hätte! Sie biß tapfer die Zähne zusammen, um nicht ganz unkontrolliert wieder loszuheulen. Er war wirklich keine Träne wert! Auch mit Sheila spielte er ja ein falsches Spiel. Alix kam durch ihren Job viel herum, da hörte man dies und das, und sie hatte einiges über Pläne mit der Petrochemie gehört. Hatte James es deshalb so eilig mit der Hochzeit?
Die Hitze war grausam. An einem schattigen Platz hielt sie an und nahm sich die Infos vor. Viel Neues erfuhr sie daraus nicht, denn die Gerüchte und Legenden über Käptn Francis waren ihr bekannt.
Aber daß die Gemeinde das Gelände, auf dem ursprünglich die Sklavenmärkte stattgefunden hatten, vor über zweihundert Jahren von Käptn Francis erworben hatte, um hier einen Seemannsfriedhof anzulegen, das hatte sie nicht gewußt, und es stimmte sie nachdenklich.
Bestand zwischen dem Gelände, auf dem die Sklavenmärkte stattgefunden hatten und das in Käptn Francis Besitz gewesen war und dem Friedhof ›Letzter Ankerplatz‹ ein Zusammenhang?
Allerdings war Käptn Francis, wie in der Broschüre über den Seemannsfriedhof stand, hier gar nicht bestattet worden. Er war in einer Sturmnacht irgendwo auf hoher See mit seiner Galeere havariert, und sein Leichnam war nie gefunden worden.
Über Käptn Francis’ Geistergaleere stand nichts darin. Beinahe hatte Alix den Eindruck, daß Furcht dem Chronisten zu schweigen gebot. Sie entschied, sich vor Ort umzusehen und fuhr weiter nach Mojarra.
Der Weg durch die Ortschaft zu dem Seemannsfriedhof war gut ausgeschildert, offensichtlich, um Touristenbussen die Anfahrt zu erleichtern.
Bei den Infos lag eine Karte des Friedhofs, die wie ein Stadtplan aufgefächert war. Der Mittelpunkt dieser Totenstadt war demnach die Grabstätte der Hannath.
Alix stellte ihren Wagen vor dem Friefhof im Schatten eines Baumes ab, nahm ihre Spezialkamera mit und machte sich auf den Weg. Sie fühlte sich etwas benommen vom durchdringenden Duft der Baumblätter. Die Sonne stach giftig, und die Hitze war grausam. Kein Windhauch wehte.
Es fiel ihr auf, wie liebevoll gepflegt die Gräber waren. Der Mittelpunkt der Anlage war die Grabstätte der Hannaths. Der schwarze Marmor irritierte Alix. Warum schwarzer Marmor? Das mutete seltsam an zwischen den hellen Steinen und hölzernen Kreuzen. Sie suchte auf der Namenstafel Daten, die mit Käptn Francis zusammenhingen.
Es war merkwürdig. Lucie, die erste Frau des Käptn, war wirklich sehr jung verstorben, nur zwanzig Jahre war sie geworden und hatte schon drei Söhne geboren! Nun, man sagte ja, der Käptn habe sie umgebracht. Aber auch seine zweite Frau Talabi war nicht alt geworden. Und wer war das Kind mit dem seltsamen Namen ›Ajamun‹, das in einem kleinen Grab zu Füßen der Statue bestattet worden war?
Das Todesdatum von Käptn Francis enthielt die Tafel nicht, denn keiner hatte ja gewußt, wann genau er den Tod gefunden hatte. War dies möglicherweise der Auslöser für die Gerüchte, daß er gar nicht richtig tot sei, sondern noch immer als Geist auf den Meeren spuken müsse?
Alix betrachtete die Statue. Sie war ein Kunstwerk, das, wie sie schätzte, von einem italienischen Meister geschaffen worden war. Die Frau, die es darstellte, war wunderschön, nur war ihr Gesicht unendlich traurig. Alix zückte ihre Spezialkamera. »Bitte lächeln, Mam!« bat sie.
Die Statue tat es.
Sie lächelte!
Das war doch völlig unmöglich? Ausgeschlossen war das!
Alix wurde nervös. Es war ihr noch nie passiert, daß sie Halluzinationen gehabt hatte. Irgend ein Schattenspiel des Blattwerks der Bäume mußte sie getäuscht haben. Obwohl, es war doch vollkommen windstill?
Sie machte noch einige Aufnahmen von der Grabstätte, als ein Rascheln in dem Gezweig über der Grabstätte sie hochblicken ließ. Zwischen den Blättern war ein Gesicht! Das Gesicht eines Jungen. War es das Gesicht des kleinen Ajamun, der zu Füßen der Statue bestattet war? Sie mußte verrückt geworden sein! Es war doch irre, so etwas zu denken! Trotzdem drückte Alix auf den Auslöser ihrer Kamera.
Aber dann rannte sie davon, weil eine unerklärliche Angst sie befiel. Sie flüchtete in ihren Wagen, saß dort lange wie betäubt. Schließlich fuhr sie langsam die Dorfstraße hinunter, die öde und verlassen war. Durst plagte sie, und so hielt sie an einer kleinen Kneipe an. ›Apakos Wigwam‹ stand auf dem Schild und darunter ›Zimmer zu vermieten‹. Sie nahm ihre Kamera und ihre Tasche und ging hinein.
Angenehm kühl war es drinnen. Der Mann am Tresen hatte unverkennbar einen indianischen Einschlag. »Wie wäre es mit einem Eistee, Mam?« fragte er freundlich. Alix nickte dankbar. Eine unbeschreibliche Müdigkeit machte ihr sogar das Sprechen schwer. Dankbar trank sie den Tee, fragte: »Kann ich ein Zimmer haben, um mich auszuschlafen? Ich muß weiter, wenn es dunkel wird.«
Apako führte sie in eine saubere Kammer, in der ein frisch bezogenes Bett stand und versprach, sie zu wecken, sobald es dunkel wurde. Alix legte ihre Tasche und die Kamera ab. Die Fotos waren fertig. Sie ging damit zum Fenster, um sie im Licht zu betrachten.
Es war Wahnsinn! Die Statue lächelte tatsächlich. Aber das Gesicht des Jungen zwischen dem Blattwerk des Baumes war verschwunden.
Es wurde ihr schwarz vor den Augen, als sie durch das Fenster einen Jungen sah, der die verlassene Straße hinunter lief.
*
Der Junge, der sich wie ein geölter Blitz davon machte, war Noel Hannath, und er hatte guten Grund, die Beine unter die Arme zu nehmen.
War er doch durch die Fremde mit ihrem dämlichen Eistee und auch noch einem Zimmer, in dem sie sich ausschlafen wollte, bei Apako in der Küche aufgehalten worden, bevor sie abgerechnet hatten. Apako hatte gerade das Geld aus der Kasse am Tresen im Wigwam holen wollen, als die Fremde gekommen war, und das hatte dann gedauert.
Aus der Schule hätte Noel längst zu Hause sein müssen! Seine Mummy wartete bestimmt schon mit dem Essen auf ihn. Die letzte Stunde war ausgefallen, weil der Lehrer Zahnschmerzen gehabt hatte, und die Chance hatte Noel genutzt, um auf dem ›Letzten Ankerplatz‹ grüne Pecans von dem Baum bei der Hannath-Grabstätte zu pflücken.
Was sollte er nur seiner Mummy sagen? Es hatte keinen Zweck, sie anzuschwindeln, weil sie dann ihren durchdringenden Blick bekam, den, mit dem sie ihm ins Herz schauen konnte, so daß er ihr schließlich doch die Wahrheit sagte.
Er hatte ganz schön die Muffe, als er mit argloser Miene und treuem Blick in die Küche des kleinen Fischerhauses trabte, in dem schon seine Großeltern gelebt hatten. Er mochte das Haus mit den Fischernetzen an den Wänden, den alten Möbeln, den Tontöpfen und Kupferkrügen und dem Emailgeschirr, das in der Wohnstube in einem Wandbord stand. In der Küche, fand Noel, war es besonders gemütlich.
Das Essen war gerichtet, daneben lag ein Zettel.
Seine Mummy war nicht da!
Auf dem Zettel stand: Bin im ›Alten Haus‹. Wenn Du mit Deinen Schularbeiten fertig bist, kannst Du kommen und mir helfen. Das Essen steht auf dem Tisch. Grießpudding mit Himbeersoße, das magst Du doch. Läßt Du mir ein bißchen was übrig? Guten Appetit. Mummy.
Noel pfiff erleichtert durch die Zähne. Da hatte er ja noch mal Glück gehabt! Und Grießpudding mit Himbeersoße war seine Lieblingsspeise. Vergnügt machte er sich darüber her, bis ihm einfiel, daß er sich vor dem Essen ja die Hände waschen mußte. Mit vollem Mund ging das auch, und als er, weil seine Hände durch das Herumklettern ziemlich schmutzig waren, die Sandseife aus der Putzkammer holte, merkte er, daß seine Mummy das Putzzeug gar nicht mitgenommen hatte.
Aber das brauchte sie doch, wenn sie in dem ›Alten Haus‹ mal wieder klar Schiff machte, wie sie es nannte! Das machte sie von Zeit zu Zeit, aber sonst sagte sie es Noel immer vorher. Er runzelte die Stirn. War irgendwie komisch, daß sie ihm nichts gesagt hatte und ohne das Putzzeug fortgegangen war, auch noch um die Mittagszeit bei dieser Affenhitze!
Er grübelte freilich nicht lange darüber nach. Mit der fröhlichen Unbekümmertheit, die er von seinem Vater geerbt hatte, setzte er sich wieder an den Tisch, futterte weiter und nahm sich vor, mit den Schularbeiten schnell voran zu machen, damit er seiner Mummy nur ja noch helfen konnte, denn hatte er ihr nicht versprochen, nur Nüsse einzusammeln, die heruntergefallen waren?
Reuig beschloß er, ihr von dem herrlichen Pudding und der Himbeersoße tüchtig etwas übrig zu lassen!
Noel futterte wie ein Weltmeister und hatte dabei ein verflixt schlechtes Gewissen!
*
Leslie hatte auch ein schlechtes Gewissen, weil sie einfach fortgelaufen war und Noel nur das Essen gerichtet und einen Zettel hingelegt hatte.
Aber sie hatte es wieder mal nicht ausgehalten, daheim herum zu sitzen. Sie war rebellisch, voll Sehnsucht, war wütend und unglücklich und das alles zusammen zur gleichen Zeit. Sie hatte Heimweh nach Robin. Nie hätte sie gedacht, daß Liebe soviel Kummer brachte und daß es so schwer war, eine Seemannsfrau zu sein.
Jedesmal, wenn ihr derart jammervoll zumute war, flüchtete sie zu dem ›Alten Haus‹, um ihren Frust durch eine Putzorgie abzureagieren oder sich ungestört auszuweinen.
Das ›Alte Haus‹ hatte in längst vergangenen Zeiten einmal Käptn Francis gehört. Damals war es das stolze Haus eines reichen Mannes gewesen, der seinen Reichtum zwar mit Menschenhandel erworben, aber dadurch soviel Geld besessen hatte, daß er trotzdem ein einflußreicher Mann gewesen war, vor dem man zwar den Hut gezogen, hinter dessen Rücken man aber die Nase gerümpft hatte.
Nun war dies einst so stolze Anwesen nur noch die Hülle eines Hauses. Die schlanken Pfeiler, die einmal das Dach getragen hatten, standen noch, auch einige der Räume, die italienischen Mosaikfliesen der Fußböden und die Veranda waren erhalten geblieben.
Der Garten um das Haus war verwildert. Die malerischen Teiche waren ausgetrocknet, und über die Reste der einstigen Austernbänke war längst Gras gewachsen. Hier sollte Käptn Francis, wie es hieß, mit einer Austernzucht einmal recht erfolgreich gewesen sein.
Leslie ging zu den Austernbänken hinaus, denn hier war es schattig unter alten Bäumen. Die Hitze machte ihr zu schaffen, sie fühlte sich wie ausgebrannt. Erschöpft setzte sie sich ins Gras, lehnte den Kopf an einen Baumstamm.
Dieser Käptn Francis! Sie schüttelte den Kopf. Hatte mit Menschen gehandelt und seine erste Frau umgebracht und seine zweite Frau wahrscheinlich auch und eines der Kinder noch dazu und wer konnte wissen, was er sonst für Untaten verübt haben mochte und hatte immer Glück gehabt. Sogar mit den Austern, die er gezüchtet hatte!
›Aber doch nicht Käptn Francis!‹ widersprach eine leise, heitere Stimme, und da war ein Kichern, das Leslie schon gehört hatte, einmal auf dem Seemannsfriedhof und schon oft in ihren Träumen. ›Der Käptn hat Austern geschlürft, aber doch nicht gezüchtet! Dazu hatte er weder die Zeit noch die Geduld. War ein sehr Ruheloser. Einer, den es nirgendwo lange hielt, der immer weiter mußte. Nein, nein, die Austern habe ich gezüchtet!‹
»Du?« Leslie schrak zusammen. »Wer – du?« Es war doch niemand da außer ihr. »Wo bist du? Wer bist du?«
»Ich bin überall, und ich bin Talabi.«
»Ach, Talabi ist schon lange, lange tot. Käptn Francis, heißt es, hat sie umgebracht.«
»Unsinn! Der Husten hat mich umgebracht, den wurde ich Jahre nicht mehr los, seit ich Ajamun aus der eisigen Strömung retten wollte…«
»In der Käptn Francis ihn ertränken wollte, heißt es, weil Ajamun deine Hautfarbe hatte und jeder sehen konnte, daß er schwarz und nicht sein Kind war!«
»Ajamun war der Sohn meines ersten Mannes, das ist wahr.« Das klang stolz und sehr traurig. Aber dann wurde die Stimme richtig zornig. »Mache mich nicht böse, Leslie Hannath. Ich habe dich für gescheiter gehalten und nicht gedacht, daß du alles glaubst, was die Leute reden. Käptn Francis ist gut gewesen zu Ajamun. Ich bin ja auch gut gewesen zu seinen Kindern! Drei fremde, kleine Kinder, weißt du, was das bedeutet und wieviel Arbeit das macht, wenn man noch dazu einen eigenen kleinen Burschen hat?«
Und ob Leslie sich das vorstellen konnte. »Also, ich habe schon mit Noel genug zu tun!« gestand sie. »Aber warum ist Ajamun denn in die Strömung gefallen?«
»Weil er ein Kätzchen retten wollte.« Talabi seufzte. »Das hatte freilich der Käptn hineingeworfen. Es wimmelte von Katzen hier und man hat das damals eben so gemacht, wenn man sie los sein wollte. Der Käptn hat uns dann alle drei herausgeholt, Ajamun, das Kätzchen und mich, weil ich doch gar nicht schwimmen konnte, weißt du. Das Kätzchen hat überlebt, Ajamun nicht, er hatte zuviel Wasser geschluckt. Und mich hat Jahre später der Husten umgebracht.« Die Stimme erstickte in einem Schluchzen.
»Weine nicht!« bat Leslie sanft. »Es ist doch schon so lange her.«
»Aber es schmerzt wie am ersten Tag.«
»Ja, das kann ich verstehen.«
Eine Weile war es still.
Dann sagte die Stimme, und sie klang wieder recht ungehalten: »Und wenn jemand behauptet, der Käptn hätte seine erste Frau umgebracht, dann sage ihm, daß er ein Dummkopf und ein Lügner ist. Weißt du, wie jung die arme Lucie gewesen ist, als sie sterben mußte?«
»Zwanzig, glaube ich.«
»Wie alt bist du?«
»Fünfundzwanzig.«
»Und du hast erst ein Kind geboren! Lucie war neunzehn als sie schon drei strammen Buben das Leben geschenkt hatte. Krank ist sie nicht gewesen, das ist wahr. Aber nach der Geburt des dritten Jungen war ihre Kraft erschöpft, ihr Herz hat versagt, ihr Leben ist verlöscht wie ein Kerzenlicht. Ich weiß es. Der Käptn war in seinen Geschäften unterwegs, ich habe Lucie in meinen Armen gehalten, als sie starb.«
»Du… du bist damals schon im Hause gewesen?«
»Ja.«
»Und du warst… ich meine, man sagt…«
»… daß ich die Konkubine des Käptn gewesen bin. Das stimmt. Zu Leuten, die das behaupten, brauchst du nicht zu sagen, daß sie Lügner sind. Ja, ich war seine Konkubine.«
»Obwohl du ihn doch hassen mußtest, wenn es denn stimmt, daß er deinen Mann verkauft hat?«
»Auch das stimmt, ja. Aber ob Haß oder Liebe, danach wurde eine Sklavin damals nicht gefragt, sie hatte zu gehorchen, und bis Ajamun geboren war, hat der Käptn mich ja in Ruhe gelassen.«
»Hat Lucie gewußt, das mit dir und Käptn Francis?«
»Gewiß. Geredet haben wir darüber nie. Aber es war ja üblich. Fast alle Männer, die Sklavinnen hielten, hatten eine Sklavin als Konkubine.«
»Und wie haben die Ehefrauen das ertragen?«
»Die wurden auch nicht gefragt.«
Wieder war es eine Weile still.
Dann fragte Leslie zögernd: »Weißt du, was aus deinem ersten Mann, aus Anamuns Vater, geworden ist?«
»Er ist, bald nachdem wir auseinandergerissen worden waren, in den Baumwollfeldern umgekommen.« Sie setzte rasch hinzu: »Es war ein Unfall!«
»Wie schrecklich«, flüsterte Leslie. »Und du mußtest bei Käptn Francis bleiben! Du hast ihn gehaßt?«
»Nicht gehaßt, nicht geliebt. Wir haben zusammen gelebt. Er fuhr zur See, ging seinen Geschäften nach, war meistens fort. Ich habe derweilen seine Söhne zu rechten Männern erzogen, habe sein Haus geführt und war mit meiner Austernzucht recht erfolgreich.«
»Aber hätte nicht alles so bleiben können, wie es war? Warum hat Käptn Francis dich zu seiner Frau gemacht?«
»Das müßtest du Käptn Francis fragen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß für einen reichen, angesehenen Mann wie den Käptn, Mut dazu gehört hat, eine schwarze Sklavin zu seiner Frau zu machen!« Wieder dieses leise Kichern. »Und ihr dann nach ihrem Tod auch noch ein Denkmal aus schwarzem Marmor errichten zu lassen…«
Sie unterbrach sich. »Ach herrje, ich hätte dir noch viel zu erzählen. Wollte eigentlich mit dir über dich und Robin reden und dich fragen, Leslie Hannath, warum du dich damit zufrieden gibst, auf deinen Robin zu warten und zu rebellieren, statt etwas zu tun…«
»Was sollte ich denn tun?« fragte Leslie ratlos und ziemlich unglücklich.
»Kämpfen! Warum machst du es nicht wie ich und versuchst es mal mit der Austernzucht? Und jetzt muß ich dich verlassen. Weil Noel mit seinem Schubkarren kommt, er bringt dir das Putzzeug. Adieu, Leslie Hannath, vielleicht besuche ich dich mal wieder in deinen Träumen…«
Die Stimme verwehte wie ein Hauch.
»Mummy!« trompetete dafür Noels Stimme von dem ›Alten Haus‹ herüber. »Mummy, wo steckst du denn?« Aber Leslie hörte es nicht.
›Sie ist bei den Austernbänken, deine Mummy‹, sagte eine vertraute Stimme zu Noel.
»He!« rief er verblüfft. »Was machst du denn hier, Talabi?«
»Oh, ich bin eben mal ein bißchen spazieren gegangen!« Sie lachte leise und dann war sie fort. Noel wußte immer ganz genau, wann Talabi fort war, und dann hatte es auch gar keinen Zweck zu versuchen, sie wieder herbei zu holen.
Er lief zu den Austernbänken. Da saß seine Mummy, hatte den Kopf an einen Baumstamm gelehnt und schlief. Er rüttelte sie ein bißchen an den Schultern. »Wache auf, Mummy! Der Himmel sieht so komisch aus. Es wird ein Sturm kommen, sagen die Leute.«
»Noel?« Leslie schrak auf, und es dauerte ein paar Herzschläge, bis sie zu sich kam. »Ich muß eingeschlafen sein. Die Hitze hat mir zugesetzt. Ich war schon den ganzen Tag verdreht.«
»Du hast ja auch das Putzzeug vergessen. Ich habe es mitgebracht. Aber ich glaube, wir können gar nicht mehr putzen. Wir müssen nach Hause, ehe der Sturm kommt.«
Manche Stürme kamen von einer Sekunde auf die andere gleichsam aus dem Nichts, andere wiederum brauchten länger, bis sie sich auf den Weg machten.
Der Himmel sah wirklich eigenartig aus. Es waren gar keine Wolken aufgezogen, die Farbe hatte sich nur verändert, das grelle Blau war in sich gedunkelt und darüber lag ein Hauch von Violett, das war der Widerschein der Sonne, die ihren Glanz verlor.
»Wenn der Himmel sein Kleid wechselt«, meinte Leslie, »dann zieht der Sturm erst seine Stiefel an, und es dauert noch eine Weile, bis er da ist.«
Aber sie nahm Noel doch bei der Hand, und gemeinsam zogen sie den Schubkarren und machten sich auf den Heimweg.
Wenn Leslie nur gewußt hätte, was sie geträumt hatte? Sie war sicher, daß es ein seltsamer und auch wunderbarer Traum gewesen war, aber sie sagte zu Noel nichts darüber.
»Hat der Grießpudding geschmeckt?« fragte sie.
»Der war Spitze, Mummy!« Zerknirscht gestand Noel, daß er die Schüssel leer gefuttert hatte. »Dabei hätte ich dir doch was übrig lassen sollen! Ich wollte das auch, ehrlich! Aber auf einmal war alles weg!«
Leslie lachte. »Weißt du, was ich da mache?«
»Du machst noch einmal einen Grießpudding!«
»Erraten, mein Schatz!«
Sie lachten zusammen und liefen schneller, denn die Luft flimmerte auf einmal eigenartig, und in der Ferne war ein dumpfes Brausen.
*
Dieses dumpfe Brausen störte in der Mannering-Petrochemie die Telefonleitungen.
Vergebens versuchte James Bennett, Verbindung mit dem Pflanzerhaus zu bekommen, da war nur dieses Brausen in der Leitung und sonst nichts.
Das machte ihn reizbar und ungeduldig. Die Sitzung, durch die er den ganzen Tag festgehalten wurde, strapazierte seine Nerven. Es ging um einen Milliarden-Deal. Und Sheila war weder in dem Pflanzerhaus noch auf der Yacht, und ihr Handy funktionierte nicht mehr. Wo war Sheila?
Wie immer, wenn Sitzungen stattfanden, die sich erfahrungsgemäß bis in die Nacht hinein hinzogen, wurden am späten Nachmittag in der Lobby der Chefetage exzellente Buffets mit warmen und kalten Speisen aufgebaut, die sich großer Beliebtheit erfreuten.
James versuchte in seinem eleganten Büro wieder, eine Telefonverbindung zu bekommen, während die Herren vor Eröffnung der Buffets auf der Dachterrasse frische Luft schöpften. Frisch war die Luft an diesem Spätnachmittag allerdings nicht, sie war dumpf, klebrig und schmeckte penetrant nach Schwefel.
Die Herren tauschten besorgte Blicke.
Das imposante Verwaltungsgebäude der Mannering-Petrochemie befand sich in einiger Entfernung von den Raffenerien, doch in unmittelbarer Nähe der Herstellungshallen. Von der Dachterrasse aus war das gesamte Mannering-Imperium, umrahmt von gigantischen Bohrtürmen, zu überblicken. Es war ein grandioser Anblick, der in möglichen Gefahrensituationen freilich auch bedenklich stimmen konnte.
Es war besorgniserregend, daß die Farbe des wolkenlosen Himmels sich merkwürdig veränderte und das durch Nebel gefesselte Sonnenlicht in dem Abgrund einer seltsamen Schwärze ertrank.
»Sieht verdammt nach einem bösen Wetter aus«, murmelte einer der Herren, und ein anderer meinte: »Da braut sich etwas Wüstes zusammen!«
Das fanden alle, nur war man sich nicht einig, ob die bedrohlichen Anzeichen nun auf einen Sturm oder eher auf ein Erdbeben hindeuteten?
Die Erde bebte öfter in der Region, doch es waren leichte Beben, die kaum wahrgenommen wurden. Schlimmer war es, wenn die See bebte, und verheerend waren die berüchtigten Stürme, die meterhohe Flutwellen auslösten.
»Es kann auch nur ein ganz gewöhnliches Gewitter sein, das heraufzieht«, tröstete der smarte, dynamiche Typ aus London, den sie nur den ›Youngster‹ nannten und der als Bevollmächtigter der europäischen Konkurrenz an der Sitzung teilnahm. Er war eben jung und nahm die Dinge leichter als die älteren Herren.
Nur ein Gewitter, ja, das sei natürlich möglich, räumten die Silberlöwen ein, fühlten sich jedoch sichtlich recht unbehaglich auf der Dachterrasse, und nicht einmal die erfrischenden Drinks mundeten ihnen mehr. Wo eigentlich Bennett steckte, hätten sie gerne gewußt.
Der Youngster aus London übernahm es, in Bennetts Büro nachzufragen, und er kam mit der Mitteilung zurück, daß Mister Bennett in seinem Büro aufgehalten werde und die Herren um etwas Geduld bitten lasse.
Aufgehalten wurde James durch seine vergeblichen Bemühungen, wieder eine Telefonverbindung zu dem Pflanzerhaus herzustellen. Sheila mußte doch inzwischen endlich nach Hause gekommen sein! Aber es klappte nicht, er kam nicht durch, aus dem Hörer tönte nur dieses dumpfe Brausen, und auch der Apparat seiner Sekretärin im Vorzimmer funktionierte nicht.
James wurde immer nervöser.
Vielleicht hatten die Gespräche und Verhandlungen in dem Milliardengeschäft auch deshalb zu keinem Ergebnis geführt, weil James sich nicht hatte konzentrieren können. Man hatte ihm das nicht angemerkt, dafür war er viel zu routiniert, aber Tatsache war, daß er mit seinen Gedanken nicht bei der Sache gewesen war. So etwas war ihm noch nie passiert! Aber er brauchte doch Sheilas Zustimmung zu der Verhandlung. Wo steckte sie nur?
Er machte sich auch persönlich Sorgen um sie. Nicht, weil sie vorübergehend abhanden gekommen war, denn das hatte er schon öfter erlebt. Sheila war ein kapriziöses Mädchen, das plötzlich irgend einen Einfall hatte und den auch unverzüglich ohne Rücksicht auf Verluste in die Tat umsetzte. So konnte er sich durchaus vorstellen, daß sie, kurz vor der Hochzeit, in einem jähen Freiheitsdrang noch irgend einen Trip nach irgendwohin gestartet hatte, ohne lange zu überlegen, daß er sich Sorgen um sie machen könnte.
Nein, das war es nicht.
Was ihn nicht losließ, war die Frage, wieso Alix sich gemeldet hatte, als er Sheila über ihr Handy angerufen hatte?
Er war absolut sicher, daß er die richtige Nummer gewählt und sich auch nicht verwählt hatte. Aber wieso war das Handy danach verstummt und hatte auf Anrufe nicht mehr reagiert?
Alix, da machte er sich nichts vor, war zu allem fähig!
Das hätte natürlich bedeutet, daß ihre Trennung ihr doch nahe gegangen war und daß sie ihm nur die kühle, überlegene Frau vorgespielt hatte. Er traute ihr das zu, und es hätte ihm sogar geschmeichelt, wenn er nicht in so großer Sorge gewesen wäre. Alle diese Überlegungen erklärten nämlich nicht, wie Alix an das Handy von Sheila gekommen war?
Der melodische Gong ertönte, der anzeigte, daß die Buffets serviert waren.
James mußte sich um seine Verhandlungspartner kümmern!
Er rief seiner Sekretärin zu, daß sie weiter versuchen solle, das Pflanzerhaus zu erreichen und eilte hinaus, um als Gastgeber traditionsgemäß die Buffets zu eröffnen. Aber seinen Verhandlungspartnern schien der Appetit vergangen zu sein, denn die Herren erwarteten ihn abmarschbereit.
Sie bedauerten, daß sie auf das Vergnügen der vorzüglichen Buffets verzichten mußten, wollten jedoch so schnell wie möglich nach Hause. Die Handys der Herren funktionierten nicht mehr, und das, so meinten alle, deute auf atmosphärische Störungen hin, die Böses ahnen ließen.
Einige der Herren waren mit Firmenhelikoptern eingeflogen und hofften nervös, daß die Funkgeräte noch funktionierten, so daß sie überhaupt abheben konnten. Diejenigen, die mit Limousinen angereist waren, befürchteten einen Ausfall der Ampelanlagen, was ein perfektes Chaos und den totalen Stau auf allen Straßen bedeutet hätte.
Der Aufbruch vollzog sich dementsprechend hektisch und überstürzt. Die Herren drängten zu den Lifts.
Das Milliardenspiel, um das es bei den Verhandlungen gegangen war, es war auf einmal nicht mehr wichtig, alle waren nur noch bestrebt, mit heiler Haut davonzukommen.
Als letzten der Herren verabschiedete James den smarten Youngster aus London, der keine Angst vor einem Unwetter und sich deshalb auch nicht in die Lifts gedrängelt hatte.
»Schade, daß wir nicht zum Zug gekommen sind, Mister Bennett«, bedauerte er. »Mein Boß wird nicht erfreut darüber sein. Die Gesellschafter der Mannering-Petrochemie sind ziemlich harte Burschen, wie?«
»Miß Mannering ist die Hauptgesellschafterin, sie besitzt die Hauptanteile, wie Sie wissen«, betonte James.
»Ja, aber wenn die übrigen Gesellschafter nicht zustimmen, nützt uns das herzlich wenig!«
»Wenn die Zustimmung der Gesellschafter zu der Fusion auf dem Verhandlungsweg nicht zu erreichen sein sollte, gibt es ja noch andere Mittel und Wege…«