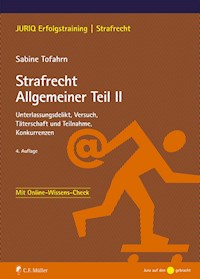19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: JURIQ Erfolgstraining
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Der Inhalt: Das Skript behandelt die prüfungsrelevanten Bereiche der Straftaten gegen Gemeinschaftswerte aus dem Besonderen Teil des StGB, insbesondere Straßenverkehrs-, Brandstiftungs-, Rechtspflege- und Urkundendelikte. Die Konzeption: Die Skripten der Reihe "JURIQ Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet, begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps. In den Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten die Kontrolle des eigenen Lernerfolgs. Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess. Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils, ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Strafrecht Besonderer Teil III
Straftaten gegen Gemeinschaftswerte
von
Sabine Tofahrn
4., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-9447-3
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.dewww.cfmueller-campus.de
© 2019 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre strafrechtlichen Kenntnisse!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Dieses Skript behandelt die Straftaten gegen Gemeinschaftswerte, der Band Strafrecht Besonderer Teil I die Straftaten gegen die Persönlichkeitswerte und im Strafrecht Besonderer Teil II setzen wir fort mit denjenigen gegen Vermögenswerte.
Auf geht's – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an die C.F. Müller GmbH, Waldhofer Str. 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen. Oder Sie wenden sich direkt an den Verfasser unter [email protected].
Köln, im Juli 2019
Sabine Tofahrn
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müllermit Online-Wissens-Check
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
zurück zu Rn. 147, 233, 332, 448
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. TeilEinführung
2. TeilStraßenverkehrsdelikte
A.Überblick
B.Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, § 315b
I.Überblick
II.Objektiver Tatbestand
1.Eingriff in den Straßenverkehr, § 315b Abs. 1 Nr. 1–3
a)§ 315b Abs. 1 Nr. 1
b)§ 315b Abs. 1 Nr. 2
c)§ 315b Abs. 1 Nr. 3
d)Eingriff durch Unterlassen
e)Verkehrsfeindliche Einwirkungen aus dem Straßenverkehr heraus
2.Beeinträchtigung der Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs
3.Konkrete Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen oder eine fremde Sache von bedeutendem Wert
III.Subjektiver Tatbestand
1.Subjektiver Tatbestand des § 315b Abs. 1
2.Qualifikation gemäß § 315b Abs. 3 i.V.m. § 315 Abs. 3 Nr. 1a und b
IV.Rechtswidrigkeit
V.Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination gem. § 315b Abs. 1 i.V.m. Abs. 4
VI.Fahrlässigkeits-Fahrlässigkeits-Kombination gemäß § 315b Abs. 1 i.V.m. Abs. 5
VII.Erfolgsqualifikation gemäß § 315b Abs. 3 i.V.m. § 315 Abs. 3 Nr. 2
C.Gefährdung des Straßenverkehrs, § 315c
I.Überblick
II.Objektiver Tatbestand
1.§ 315c Abs. 1 Nr. 1
2.§ 315c Abs. 1 Nr. 2a–g
3.Konkrete Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen oder eine fremde Sache von bedeutendem Wert
III.Subjektiver Tatbestand
IV.Rechtswidrigkeit
V.Schuld
VI.Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination und Fahrlässigkeits-Fahrlässigkeits-Kombination
VII.Täterschaft und Teilnahme
VIII.Konkurrenzen
D.Trunkenheit im Verkehr, § 316
E.Exkurs: Vollrausch, § 323a
I.Überblick
II.Tatbestand
1.Sichversetzen in einen Rausch
2.Vorsatz oder Fahrlässigkeit
III.Objektive Strafbarkeitsbedingung: die Rauschtat
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld
V.Täterschaft und Teilnahme
VI.Konkurrenzen
F.Verbotene Kraftfahrzeugrennen, § 315d
I.Überblick
II.Grundtatbestand, § 315d Abs. 1
1.Das nicht erlaubte Kraftfahrzeugrennen im öffentlichen Straßenverkehr
2.Tathandlungen und Täter
3.Subjektiver Tatbestand
III.Qualifikation, § 315d Abs. 2
IV.Erfolgsqualifikation, § 315d Abs. 5
V.Konkurrenzen
G.Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, § 142
I.Überblick
II.Objektiver Tatbestand
1.Gemeinsame Voraussetzungen der Abs. 1 und 2
2.Tathandlung gem. § 142 Abs. 1 Nr. 1
3.Tathandlung gem. § 142 Abs. 1 Nr. 2
4.Tathandlung gem. § 142 Abs. 2
III.Subjektiver Tatbestand
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld
V.Tätige Reue gem. § 142 Abs. 4 StGB
VI.Täterschaft und Teilnahme
VII.Konkurrenzen
H.Übungsfall Nr. 1
3. TeilBrandstiftungsdelikte
A.Überblick
B.Brandstiftung, § 306
I.Überblick
II.Objektiver Tatbestand
1.Tatobjekt
a)§ 306 Abs. 1 Nr. 1–6
b)Teleologische Restriktion
c)Fremd
2.Tathandlung/Taterfolg
a)Inbrandsetzen
b)Durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstören
3.Kausalität und objektive Zurechnung
III.Subjektiver Tatbestand
IV.Rechtswidrigkeit
V.Konkurrenzen
C.Schwere Brandstiftung, § 306a
I.Überblick
II.Schwere Brandstiftung, § 306a Abs. 1
1.Objektiver Tatbestand
a)Tatobjekte gem. § 306a Abs. 1 Nr. 1
b)§ 306a Abs. 1 Nr. 3
c)Teleologische Restriktion
2.Subjektiver Tatbestand
3.Rechtswidrigkeit
4.Schuld
5.Konkurrenzen
III.Schwere Brandstiftung, § 306a Abs. 2
1.Objektiver Tatbestand
a)Inbrandsetzen oder Zerstören der genannten Tatobjekte
b)Konkrete Gefahr einer Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen
2.Subjektiver Tatbestand
3.Rechtswidrigkeit und Schuld
4.Konkurrenzen
D.Besonders schwere Brandstiftung, § 306b
I.Überblick
II.Besonders schwere Brandstiftung, § 306b Abs. 1
1.Schwere Gesundheitsschädigung
2.Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen
3.Kausalität
4.Unmittelbarkeitszusammenhang
III.Besonders schwere Brandstiftung, § 306b Abs. 2
1.Gefahr des Todes
2.Verhindern oder Erschweren des Löschens des Brandes
3.Absicht, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld
V.Konkurrenzen
E.Brandstiftung mit Todesfolge, § 306c
F.Fahrlässige Brandstiftung, § 306d
G.Tätige Reue, § 306e
H.Übungsfall Nr. 2
4. TeilRechtspflegedelikte
A.Überblick
B.Die Aussagedelikte, §§ 153 ff.
I.Überblick
II.Falsche uneidliche Aussage, § 153
1.Objektiver Tatbestand
a)Täter
b) Tatort
c)Tathandlung
2.Subjektiver Tatbestand
3.Rechtswidrigkeit und Schuld
4.Anstiftung und Beihilfe
III.Meineid, § 154
1.Überblick
2.Objektiver Tatbestand
3.Subjektiver Tatbestand
4.Rechtswidrigkeit und Schuld
5.Strafmilderung, § 157
6.Strafmilderungsgrund, § 158
7.Konkurrenzen
IV.Versuchte Anstiftung zur Falschaussage, § 159
V.Verleitung zur Falschaussage, § 160
1.Überblick
2.Objektiver Tatbestand
3.Subjektiver Tatbestand
4.Rechtswidrigkeit und Schuld
VI.Fahrlässiger Falscheid, § 161
C.Falsche Verdächtigung, § 164
I.Überblick
II.Objektiver Tatbestand
1.Tatobjekt
2.Tatort
3.Tathandlung
III.Subjektiver Tatbestand
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld
V.Konkurrenzen
D.Strafvereitelung, § 258
I.Überblick
II.Objektiver Tatbestand der Verfolgungsvereitelung gem. § 258 Abs. 1
III.Objektiver Tatbestand der Vollstreckungsvereitelung gem. § 258 Abs. 2
IV.Subjektiver Tatbestand
V.Rechtswidrigkeit und Schuld
VI.Persönliche Strafausschließungsgründe
VII.Konkurrenzen
E.Strafvereitelung im Amt, § 258a
I.Überblick
II.Tatbestand
III.Rechtswidrigkeit und Schuld
F.Vortäuschen einer Straftat, § 145d
I.Überblick
II.Objektiver Tatbestand
III.Subjektiver Tatbestand
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld
V.Konkurrenzen
G.Übungsfall Nr. 3
5. TeilUrkundendelikte
A.Einführung
B.Urkundenfälschung, § 267
I.Überblick
II.Objektiver Tatbestand
1.Tatobjekt: Urkunde
a)Die „normale“ Urkunde
aa)Verkörperte Gedankenerklärung
bb)Zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmt und geeignet
cc)Erkennbarkeit des Ausstellers
b)Reproduktionen als Urkunde
c)Zusammengesetzte Urkunde
d)Gesamturkunde
2.Tathandlung
a)Herstellen einer unechten Urkunde
b)Verfälschen einer echten Urkunde
c)Gebrauchen einer unechten oder verfälschten Urkunde
III.Subjektiver Tatbestand
IV.Rechtswidrigkeit und Schuld
V.Besonders schwerer Fall gemäß § 267 Abs. 3
VI.Qualifikation gemäß § 267 Abs. 4
VII.Konkurrenzen
C.Fälschung technischer Aufzeichnungen, § 268
I.Überblick
II.Objektiver Tatbestand
1.Technische Aufzeichnung
2.Tathandlungen
III.Subjektiver Tatbestand
IV.Strafzumessungsregeln und Qualifikation
D.Fälschung beweiserheblicher Daten, § 269
I.Überblick
II.Objektiver Tatbestand
III.Subjektiver Tatbestand
IV.Strafzumessungsregeln und Qualifikation
E.Urkundenunterdrückung, § 274
I.Überblick
II.Objektiver Tatbestand des § 274 Abs. 1 Nr. 1
III.Objektiver Tatbestand des § 274 Abs. 1 Nr. 2
IV.Subjektiver Tatbestand
V.Konkurrenzen
F.Mittelbare Falschbeurkundung, § 271
I.Überblick
II.Objektiver Tatbestand
III.Subjektiver Tatbestand
IV.Qualifikationstatbestände nach § 271 Abs. 3
V.Konkurrenzen
G.Übungsfall Nr. 4
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Dencker/Struensee/Nelles/Stein
Einführung in das 6. StrRG, 1998
Fischer
Strafgesetzbuch, 66. Aufl. 2018
Jäger
Examens-Repetitorium Strafrecht Besonderer Teil,7. Aufl. 2017
Joecks/Jäger
Studienkommentar Strafgesetzbuch, 12. Aufl. 2018
Küper/Zopfs
Strafrecht Besonderer Teil, 10. Aufl. 2018
Lackner/Kühl
Strafgesetzbuch, 29. Aufl. 2018
Leipziger Kommentar
Strafgesetzbuch, 12. Aufl. ab 2006
Maurach/Schroeder/Maiwald
Strafrecht Besonderer Teil I, 10. Aufl. 2013
Münchener Kommentar
Strafgesetzbuch, 2006 ff. (5. Aufl.)
Nomos Kommentar
Strafgesetzbuch, 1995 ff. (3. Aufl. 2010)
Otto
Grundkurs Strafrecht Die einzelnen Delikte, 8. Aufl. 2014
Rengier
Strafrecht Besonderer Teil II, 19. Aufl. 2018
Schmidhäuser
Strafrecht Besonderer Teil II, 2. Aufl. 1983
Systematischer Kommentar
Strafgesetzbuch, Band II, 5–7. Aufl. (Stand 2011)
Schönke/Schröder
Strafgesetzbuch, 30. Aufl. 2019
Wessels/Hettinger/Engländer
Strafrecht Besonderer Teil I, 42. Aufl. 2018
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 5Mentale Techniken und Entspannung
Im Folgenden finden Sie konkrete Anwendungs- und Übungsvorschläge, um Ihre Aufmerksamkeit so zu lenken, dass es Ihnen leichter fällt, sich zu entspannen oder sich nach Arbeitsphasen zu regenerieren. Jeder Mensch besitzt die Fähigkeit, das natürliche Phänomen der Alltagshypnose oder Trance gezielt zu nutzen. Sie haben es selbst schon erlebt, z.B. bei Tagträumen mit offenen Augen, wenn Ihre Aufmerksamkeit „wegdriftet“! Sie können auch absichtlich Ihre Gedanken und Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen lenken, so dass Sie sich entspannter, leichter, motivierter oder auch kompetenter fühlen. Ihre Aufmerksamkeitslenkung bestimmt also auch Ihr Erleben und die damit verbundenen Gefühle. Diese Trancefähigkeit von Menschen macht man sich bei Hypnoseverfahren in der Psychotherapie und Medizin zu Nutze (Ängste, Schlafstörungen, Depressionen oder starke Schmerzen). Im Führungskräftecoaching nutzt man mentale Techniken, die den Umgang mit Stress und Konflikten erleichtern. Warum sollten wir diese nicht auch zur Entspannung beim Prüfungslernen nutzen?!
Lerntipps
Nutzen Sie Ihre mentalen Möglichkeiten stärker als bisher aus!
Damit Sie sich in Trance „hypnotisieren“, müssen Sie aktiv mitarbeiten und üben. Nur wenn Sie wollen, können Sie sich aktiv auf bestimmte für Sie vielleicht neue Vorgehensweisen, Gedanken und Innenbilder einlassen. Mit mentalen Techniken kann man durch relativ einfache Übungen schnell eine tiefe Entspannung erreichen. Entspannung dient der Erholung, dem Stressabbau und der Wiederherstellung körperlicher und seelischer Ausgeglichenheit. Mit viel Übung z.B. auch in einem „Selbsthypnosetraining“ bei einem Coach können Sie innerhalb weniger Minuten, häufig manchmal sogar Sekunden sich tiefenentspannen oder akute Blockaden lösen. Weil wir in Trance für Anweisungen (Suggestionen) empfänglicher sind, können Sie geeignete Autosuggestionen sogar nutzen, um Ihr Lernverhalten positiv zu beeinflussen.
Es geht los mit einem Bild – wählen Sie Ihr Ruhebild aus!
In allen „Hypnosesitzungen“ ist das „Ruhebild“ zum Einstieg zentral. Es dient dazu, die Entspannung zu verbessern und so das innere Gleichgewicht leichter herzustellen. Das Bild sollte angenehm und mit Ruhe verbunden sein. Häufig werden als angenehm erlebte Szenen aus dem Urlaub gewählt, wie z.B. der Blick von einer Alpenwiese auf die Berge, oder man betrachtet die Hügel der Toskana, man liegt auf einer Wiese oder am Strand, schaut auf das Meer oder geht im Wald spazieren. In diesen Bildern sollten Sie ausreichend Zeit haben und länger dort verweilen können. Das Interessante ist, dass unser Gehirn in der Wirkung plastische Innenbilder nicht von äußeren Gegebenheiten unterscheidet. Eine kleine Anmerkung: Das ist bei Problemen und Ängsten übrigens genauso. Wir sind es letztendlich selbst, die diese erzeugen und das können wir auch in förderlicher Weise nutzen.
Lassen Sie die Sinneseindrücke auf sich wirken!
Wenn Sie Ihre Augen schließen, können Sie die Sinneseindrücke noch besser auf sich wirken lassen. Die Eindrücke werden mit der Zeit plastischer und reichhaltiger. Auch wenn jeder von Ihnen ein anderes Bild und Erleben haben wird, lassen Sie sich von dieser Beschreibung animieren.
Sie sitzen am Meer und sehen die Wellen, den Horizont . . . Sie spüren dabei die angenehme Wärme, die über Ihre Stirn und die Wangen streicht. Sie merken mitunter, dass ein angenehm frischer Luftzug Ihre Stirn kühlt. Sie hören dann die typischen Geräusche der Szenerie, das Kommen und Gehen der Wellen, vielleicht auch den Ruf der Möwen . . . Sie fühlen die unterschiedlichen Berührungen an den Händen, den feinen Sand, den Sie vielleicht in die Hand nehmen und durch die Finger rieseln lassen. Sie nehmen auch die typischen Gerüche wahr, die würzig-salzige Meeresluft und spüren sogar etwas Salz auf den Lippen . . . Vielleicht legen Sie sich jetzt hin und schließen die Augen . . .
Lesen Sie die Zeilen noch einmal und achten darauf, in Richtung welcher Wahrnehmungsqualitäten Sie Ihre Aufmerksamkeit gerichtet haben (Sehen, Fühlen, Hören, Riechen, Schmecken).
Positive Innenbilder fördern!
Begünstigen Sie Ihre Innenbilder, indem Sie stets mehreren Sinneskanälen Beachtung schenken. Je komplexer und plastischer das Bild, umso stärker werden die an die Wahrnehmung gekoppelten Erlebenskomponenten aktiviert, also die Gefühle. Die Innenrealität wirkt am besten, wenn Sie sich von der Außenrealität und Außenreizen abschirmen. Halten Sie die Augen geschlossen – Sie können auch eine Augenbinde oder Augenmaske zu Hilfe nehmen (siehe auch unten den Lerntipp zur Augenfixierung).
Da unsere Innenbilder vielfältige innere Verarbeitungsprozesse hervorrufen und damit verbunden sind, können auch unangenehme Gefühle auftreten, die uns nicht erklärbar sind. Damit sollten Sie ganz gelassen umgehen, weil das normal ist und die Gelassenheit schon ein Abklingen bewirken kann.
Falls Bilder erscheinen, die unangenehm sind und sich „verfestigen“, so brechen Sie abrupt ab und schalten bewusst auf ein schönes Bild, eine schöne Erinnerung um. Sie brauchen lernförderliche Bilder.
Finden Sie einen geeigneten Rahmen!
Schalten Sie vor der Entspannung mögliche Störgeräusche aus (Telefon, geöffnetes Fenster). Achten Sie darauf, dass Sie nicht gestört werden (Schild an die Tür . . .). Benutzen Sie einen bequemen Sessel, Stuhl oder ein Sofa, auf dem Sie abschalten können. Achten Sie darauf, dass die Übungen räumlich in Ihrem Freizeitbereich, also nicht im Arbeitsbereich durchgeführt werden, wenn es Ihnen möglich ist. Legen Sie zu Beginn jeder Übung fest, wie lange sie dauern soll (Ruhebild in der Trainingsphase z.B. nach 15 Minuten die Augen öffnen). Verlassen Sie sich darauf, dass Sie nach Ihrer Zeitvorgabe, die Augen wieder öffnen, stellen sie sich eventuell einen leise summenden Wecker, den Sie bald aber entbehren können. Entspannung erreichen Sie natürlich nach viel Kaffee- oder Colakonsum nur schlecht. Bei Übermüdung oder nach Alkoholgenuss wird man wahrscheinlich nur durch eine Portion Schlaf frischer.
Leiten Sie Ihre „Selbsthypnose“ durch eine Augenfixierung ein!
Die Einleitung verschiedener mentaler Techniken besteht darin, die Aufmerksamkeit von äußeren Geschehnissen weg immer mehr zu innerem Erleben zu lenken. Das können Sie folgendermaßen leichter erreichen:
•
Setzen Sie sich bequem hin und rücken Sie sich gemütlich zurecht.
•
Suchen Sie sich einen kleinen Punkt im Raum in Augenhöhe vor möglichst ruhigem Hintergrund, damit Sie sich gut konzentrieren können.
•
Sie können auch einen Papierschnipsel aus einem Aktenlocher nehmen und ihn an eine bestimmte Stelle kleben.
•
Verwenden Sie in der Übungsphase möglichst den gleichen Stuhl und den gleichen Fixationspunkt.
•
Sie beobachten den Punkt intensiv und werden feststellen, dass der Hintergrund und die Ränder verschwimmen, milchig werden, mal ist der Punkt scharf, dann wieder unscharf zu sehen.
•
Betrachten Sie den Punkt mit Geduld, die Augen werden automatisch müder. Sie können die Augen dann schließen, wieder leicht öffnen, schließen . . .
•
Beobachten Sie dann Ihre Atmung und bemerken, wie Sie ruhig ein- und ausatmen. Mit jedem Atemzug werden Sie und Ihr Körper lockerer und entspannter.
•
Wenn Sie Umweltgeräusche zu Beginn lauter hören, arbeiten Sie nicht dagegen an.
•
Richten Sie die Aufmerksamkeit dann verstärkt auf Ihren Körper, z.B. die Bauchdecke, die sich hebt und senkt, die Füße, Beine, das Gesäß . . . die Hände, die Arme . . . die Geräusche werden Ihnen gleichgültiger.
•
Stellen Sie sich nun Ihr Ruhebild vor – so lange Sie wollen.
•
Wenn Sie sich entspannt fühlen und die Augen öffnen möchten, zählen Sie rückwärts von 3 bis 0.
•
Stehen Sie dann auf und Sie werden sich frischer fühlen.
Jeden Tag das gleiche Ritual, nach einer Woche können Sie das!
Wahrscheinlich werden Sie feststellen, dass Sie die erlebten Prozesse auch aus dem Alltag kennen (Dösen, Tagträume, mit offenen Augen andere Inhalte sehen, während die Realität in den Hintergrund tritt . . .). Diese andere Welt des Alltags ist der menschliche Trancezustand und wird hier methodisch nutzbar gemacht. Folgende methodische Hinweise dazu:
•
Üben Sie das Vorgehen der Augenfixierung und des Ruhebildes täglich möglichst zweimal.
•
Planen Sie die Übungszeiten fest als Erholungszeit in größeren Zwischenpausen für ca. 15 Minuten ein, vielleicht nach einer Arbeitseinheit von 90 Minuten am späten Vormittag oder am Nachmittag (wenn das Lerntief naht).
•
Manche setzen die Übung auch direkt nach dem Wachwerden, also vor Lernbeginn ein, manche werden dann müder.
•
Auch wenn die Übung anfangs noch als unangenehme Pflicht erlebt wird, werden Sie schnellen Erfolg haben.
•
Nach ca. 1 Woche täglichen Übens werden Sie die Übung als hilfreich erleben und sich darauf freuen.
•
Nach ca. 2 Wochen und täglich zweimal üben können Sie schon die Kurzform der Autohypnose ausprobieren, es wird auf jeden Fall schneller gehen, sich zu entspannen
Falls Ruhebilder – selbst die schönsten – nicht mehr wirken, so ersetzen Sie diese durch andere.
Nutzen Sie die Entspannung auch für gezielte Autosuggestionen!
Nach ca. 1 bis 2 Wochen täglicher Übung werden Sie die Einleitung der Autohypnose zielgerichtet kombiniert mit „Selbstbeauftragungen“ und „Autosuggestionen“ einsetzen können, z.B. zu Beginn einer Lernphase. Nach einer Pause können Sie sich z.B. das wieder „Warmlaufen“ erleichtern.
Verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick über die gestellte Aufgabe, indem Sie sich orientieren, z.B.
•
Definition einmal durchlesen, in einem Kapitel eines Buches Überschriften, Stichworte ansehen, ohne sie sich merken zu wollen.
•
Aufbauschemata durchlesen.
•
Bei schriftlichen Ausarbeitungen die Gliederung ansehen, Stichworte lesen.
Das dauert nur wenige Minuten. Durch diese Übersicht ist Ihr Arbeitsspeicher auf die zukünftige Arbeit vorbereitet. Das Gehirn hat Grobinformationen für den kommenden Auftrag und stellt seine Mittel bereit.
Nun legen Sie eine Pause von einer knappen Minute mit einer Kurzentspannung mit geschlossenen Augen ohne Ruhebild ein und betrachten die anstehenden Aufgaben. Jetzt ist der Auftrag (Suggestion) erteilt und Sie können zügig mit der Weiterarbeit beginnen.
Überlegen Sie sich Ihre Autosuggestionen oder „Selbstbeauftragungen“ vor der Entspannung. Es kann z.B. auch motivationsförderliches Selbstlob sein („Ich habe schon etwas länger arbeiten können, Pausen besser eingehalten, folgende Dinge erledigt . . .“) oder andere lernförderliche Übungen und Selbstverbalisierungen.
Diese Lerntipps helfen und haben ihre Grenzen!
Autohypnose hilft nur, wenn sie regelmäßig und konsequent, also in der Übungsphase auch mehrmals täglich angewendet wird. Wenn Sie sehr viele Tagträume haben, die eher in Richtung Angstphantasien, Schwarzmalereien oder Realitätsflucht gehen, sollten Sie vorsichtiger mit der Anwendung sein. Sie können natürlich auch einen Experten wie einen Coach zu Rate ziehen. Bei sehr starken Lern- und Leistungsstörungen oder Depressionen, Ängsten, Lebenskrisen sollten Sie einen Psychotherapeuten oder eine Beratungsstelle konsultieren. Unsere Übungen können kein Ersatz dafür sein, sind aber eine hervorragende Grundlage zur direkten Entspannung, aber auch um seine mentalen Techniken an anderer Stelle weiterzuentwickeln (durch Bücher, in Übungsgruppen).
1. TeilEinführung
1
Im Strafrecht wird nach den geschützten Rechtsgütern unterschieden zwischen Straftaten gegen Persönlichkeitswerte und Straftaten gegen Gemeinschaftswerte.
Zu den Persönlichkeitswerten, auch Individualrechstgüter genannt, gehören u.a. Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen. Straftaten, die diese Rechtsgüter verletzen, sind Gegenstand der Skripte „Strafrecht BT I“ (Straftaten gegen Persönlichkeitswerte) und „Strafrecht BT II“ (Straftaten gegen das Vermögen).
2
In diesem Skript werden wir uns mit den Straftaten gegen Gemeinschaftswerte, auch Universalrechtsgüter genannt, beschäftigen, die für Sie im Examen relevant sind. Dazu gehören die Sicherheit des Straßenverkehrs, die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, das Vertrauen des Rechtsverkehrs in die Echtheit, inhaltliche Richtigkeit und den Bestand von Urkunden sowie die Sicherheit der Allgemeinheit bei gemeingefährdenden Brandlegungen.
[Bild vergrößern]
3
Die Sicherheit des Straßenverkehrs wird geschützt in den §§ 315b–316. Seit dem 13.10.2017 ist in § 315d auch die medial immer wieder Aufsehen erregende Teilnahme an einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen unter Strafe gestellt. Zu den sog. „Straßenverkehrsdelikten“ gehört zudem das unerlaubte Entfernen vom Unfallort gem. § 142, auch wenn das geschützte Rechtsgut nicht die allgemeine Sicherheit des Straßenverkehrs, sondern das private Feststellungsinteresse eines Unfallbeteiligten ist. Da in der Klausur die Straßenverkehrsdelikte häufig in Zusammenhang mit § 20 und damit auch der actio libera in causa geprüft werden, wird der dann relevante § 323a (Rauschtat) als „Exkurs“ zu den Straßenverkehrsdelikten dargestellt.
4
Die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege wird in den Aussagedelikten gem. §§ 153 ff. sowie der falschen Verdächtigung gem. § 164, dem Vortäuschen einer Straftat sowie der Strafvereitelung gem. §§ 258, 258a geschützt.
5
Das Vertrauen des Rechtsverkehrs in die Echtheit, inhaltliche Richtigkeit sowie den Bestand von Urkunden ist das geschützte Rechtsgut der §§ 267 ff. Der Schutz wird in § 268 auf technische Aufzeichnungen und in § 269 auf beweiserhebliche Daten erweitert.
Der Schutz der Allgemeinheit vor gemeingefährdenden Brandlegungen erfolgt mit den §§ 306 ff.
Die weniger klausurrelevanten Umweltstraftaten sowie die Straftaten im Amt sind nicht Gegenstand dieses Skripts.[1]
Anmerkungen
Sie können dazu nachlesen bei Wessels/Hettinger/Engländer Strafrecht BT 1 Rn. 1168 ff.
2. TeilStraßenverkehrsdelikte
A.Überblick
B.Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, § 315b
C.Gefährdung des Straßenverkehrs, § 315c
D.Trunkenheit im Verkehr, § 316
E.Exkurs: Vollrausch, § 323a
F.Verbotene Kraftfahrzeugrennen, § 315d
G.Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, § 142
H.Übungsfall Nr. 1
2. Teil Straßenverkehrsdelikte › A. Überblick
A.Überblick
6
Straßenverkehrsdelikte spielen in Klausuren häufig eine nicht unerhebliche Rolle.
Sofern in Ihrem Klausursachverhalt also ein Kraftfahrzeug involviert ist, sollten Sie stets auch an die nachgenannten Vorschriften sowie an § 21 StVG, der hier nicht erörtert wird, denken.
Prüfungsrelevant sind die Normen § 315b (Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr), § 315c (Gefährdung des Straßenverkehrs) und als Auffangtatbestand § 316 (Trunkenheit im Straßenverkehr) sowie § 315d, mit welcher der Gesetzgeber in 2017 das Ausrichten und Durchführen von sowie die Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen unter Strafe gestellt hat.
Geschütztes Rechtsgut dieser Normen ist zum einen die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs zum anderen bei den §§ 315b, c und d (Abs. 2 und 5) darüber hinaus auch das Leben, die körperliche Unversehrtheit und fremdes Eigentum.
7
Lesen Sie die §§ 315b bis 315e und finden Sie die Unterschiede heraus, bevor Sie die nachfolgenden Ausführungen durcharbeiten.
§§ 315b und c sowie § 315d Abs. 2 sind konkrete Gefährdungsdelikte, bei welchen der Täter durch die Tathandlung entweder Leib und Leben eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert konkret gefährdet haben muss. Bei §§ 315d Abs. 1 und 316 hingegen ist eine solche konkrete Gefahr nicht erforderlich. Strafgrund ist hier die abstrakte Gefahr, die in der Vornahme der jeweiligen Tathandlungen unter den genannten Voraussetzungen liegt. § 315d Abs. 5ist eine Erfolgsqualifikation, bei der es durch die Tat nach § 315d Abs. 2 nicht nur zu einer Gefahr, sondern zum Eintritt einer besonderen Folge gekommen ist.
8
Wie sich dem Wortlaut der Normen entnehmen lässt, erfasst § 315b gefährliche Eingriffe, die von außen in den Straßenverkehr hineinwirken. Im Gegensatz dazu wird der Straßenverkehr bei §§ 315c und d dadurch gefährdet, dass Verkehrsteilnehmer aus dem Straßenverkehr heraus oder im Vorfeld mit Wirkung für den Straßenverkehr Fehlleistungen erbringen.
[Bild vergrößern]
9
§ 316a (Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer) ist zwar bei den Straßenverkehrsdelikten normiert, wird aber allgemein wegen der Absicht des Täters, einen Raub, räuberischen Diebstahl oder eine räuberische Erpressung zu begehen, als raubähnliches Delikt begriffen. Die geschützten Rechtsgüter sind dementsprechend das Eigentum und das Vermögen sowie darüber hinaus die Sicherheit des Straßenverkehrs. Aufgrund seines Bezuges zu den Vermögensdelikten haben wir diesen Straftatbestand in dem Skript „Strafrecht BT II“ ausführlich erörtert.
10
§ 142 (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) schützt das private Feststellungsinteresse eines Unfallbeteiligten zur Durchsetzung bzw. Abwehr zivilrechtlicher Ansprüche. Da dieses Interesse aus den Gefahren des Straßenverkehrs resultiert, wird § 142 thematisch zu den Straßenverkehrsdelikten gezählt.
11
Die §§ 315, 315a beschäftigen sich mit der Sicherheit des Bahn-, Schiffs- und Luftverkehrs und sind mit Ausnahme des § 315 Abs. 3 nicht sonderlich klausurrelevant. Auf § 315 Abs. 3 wird in § 315b Abs. 3 verwiesen, so dass dieser bei den Straßenverkehrsdelikten Anwendung findet.
2. Teil Straßenverkehrsdelikte › B. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, § 315b
B.Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, § 315b
2. Teil Straßenverkehrsdelikte › B. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, § 315b › I. Überblick
I.Überblick
12
Wie bereits ausgeführt, erfasst § 315b grundsätzlich nur Eingriffe, die von außen in den Straßenverkehr hinein wirken. Dies ergibt sich insbesondere aus einem Vergleich des § 315b mit § 315c, welcher insbesondere in Abs. 1 Nr. 2 verkehrstypische Verhaltensweisen erfasst, welche die Sicherheit des Straßenverkehrs gefährden können. Da der Katalog des § 315c Abs. 1 Nr. 2 (die sog. „sieben Todsünden des Straßenverkehrs“) abschließend ist (ergänzt wird er allerdings in § 315d um die Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen), können Strafbarkeitslücken entstehen bei Verhaltensweisen, die von der Vorwerfbarkeit her jenen des § 315c Abs. 1 Nr. 2 entsprechen, dort aber nicht aufgelistet sind. Um diese Strafbarkeitslücken zu schließen, durchbrechen der BGH und weitestgehend auch die Literatur den Grundsatz des § 315b und subsumieren auch solche Tathandlungen unter § 315b, die aus dem fließenden oder ruhenden Straßenverkehr, also von innen heraus begangen werden. Voraussetzung ist jedoch, dass diese Tathandlungen einen verkehrsfeindlichen Charakter besitzen und somit ihrer Natur nach wieder solchen Einwirkungen gleichstehen, die von außen in den Straßenverkehr hineinwirken. Mit den vom BGH entwickelten Anforderungen werden wir uns ausführlich im objektiven Tatbestand unter Rn. 23 beschäftigen.
13
Die Tathandlung, die der Täter bei § 315b vornimmt, muss zum einen zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs und zum anderen zu einer konkreten Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen oder eine fremde Sache von bedeutendem Wert führen.
[Bild vergrößern]
14
Aufgrund des Verweises in § 315b Abs. 3 auf § 315 Abs. 3 gibt es zu § 315b Abs. 1 sowohl Qualifikationen als auch eine Erfolgsqualifikation. Die Qualifikationen sind in § 315 Abs. 3 Nr. 1a und b geregelt und zeichnen sich durch eine besondere Absicht aus. Eine Erfolgsqualifikation gem. § 315 Abs. 3 Nr. 2 liegt vor, wenn der Täter durch den gefährlichen Eingriff eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verursacht hat.
Die Unterscheidung zwischen Qualifikation und Erfolgsqualifikation ist wichtig für den Aufbau und die Prüfungsvoraussetzungen.
Die Qualifikation des § 315 Abs. 3 Nr. 1a und b zeichnet sich dadurch aus, dass der Täter den Eingriff in einer besonderen Absicht vorgenommen hat. Für die Klausur bedeutet dies, dass Sie den Grundtatbestand des § 315b Abs. 1 und die Qualifikation gem. § 315b Abs. 3 i.V.m. § 315 Abs. 3 Nr. 1a oder b zusammen prüfen. Im objektiven Tatbestand werden die Voraussetzungen des § 315b Abs. 1 geprüft. Im subjektiven Tatbestand muss zunächst der Vorsatz hinsichtlich der objektiven Voraussetzungen des § 315b und alsdann die besondere Absicht gem. § 315 Abs. 3 Nr. 1a oder b geprüft werden.
Auch die Erfolgsqualifikation können Sie zusammen mit dem Grunddelikt prüfen. In diesem Fall prüfen Sie zunächst den objektiven und subjektiven Tatbestand des § 315b Abs. 1. Nach dem subjektiven Tatbestand und vor der Rechtswidrigkeit prüfen Sie die Voraussetzungen der Erfolgsqualifikation. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass hinsichtlich des Eintritts der Folge gem. § 18 lediglich Fahrlässigkeit erforderlich ist. Zu den weiteren Voraussetzungen vgl. Rn. 42.
15
Beachten Sie, dass § 315b sowohl vorsätzlich, als auch vorsätzlich/fahrlässig und fahrlässig/fahrlässig begangen werden kann. Mit diesen verschiedenen Begehungsformen beschäftigen sich die Abs. 4 und 5.
Gem. § 315b Abs. 4 macht sich der Täter strafbar, wenn er die Tathandlung vorsätzlich vornimmt, dabei die Gefahr aber nur fahrlässig verursacht. § 315b enthält damit – ebenso wie § 315c – eine Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination. Gem. § 11 Abs. 2 handelt es sich auch in diesen Fällen noch um eine Vorsatztat, so dass eine Teilnahme möglich bleibt.
§ 315b Abs. 5 ist anwendbar, wenn der Täter die Handlung fahrlässig begeht und dabei zugleich fahrlässig die Gefahr herbeiführt. In diesem Fall handelt es sich um ein vollständiges Fahrlässigkeitsdelikt, so dass eine Teilnahme gem. §§ 26, 27 nicht möglich ist.
Die Abs. 4 und 5 des § 315b sind immer in Verbindung mit Abs. 1 anwendbar. Sofern sie in der Klausur in Betracht kommen sollten, sollten Sie sie im Obersatz bereits erwähnen, indem Sie z.B. ausführen: „A könnte sich wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gem. § 315b Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 strafbar gemacht haben, indem er …“.
16
Die Abs. 4 und 5 haben Auswirkungen auf den Prüfungsaufbau in der Klausur. Diese werden wir unter Rn. 41 ff. ausführlich erörtern. DerAufbau des vorsätzlichen § 315b Abs. 1 sieht wie folgt aus:
I.Objektiver Tatbestand
1.Tathandlung: Eingriff in den Straßenverkehr durch
a)Nr. 1: Zerstören, Beschädigen oder Beseitigen von Anlagen oder Fahrzeugen
b)Nr. 2: Bereiten eines Hindernisses
c)Nr. 3: Vornahme eines ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriffs
Eingriffe aus dem Straßenverkehr als verkehrsfeindliche EinwirkungRn. 23
Verhalten des BeifahrersRn. 29
2.Taterfolg
a)dadurch Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs
b)dadurch konkrete Gefahr für
aa)Leib oder Leben eines anderen Menschen
TatbeteiligteRn. 32
bb)fremde Sache von bedeutendem Wert
II.Subjektiver Tatbestand
1.Vorsatz, wobei dolus eventualis reicht
2.Evtl. gem. § 315b Abs. 3 i.V.m. § 315 Abs. 3 Nr. 1: Absicht
a)einen Unglücksfall herbeizuführen
b)eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken
III.Rechtswidrigkeit
IV.Schuld
2. Teil Straßenverkehrsdelikte › B. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, § 315b › II. Objektiver Tatbestand
II.Objektiver Tatbestand
17
Der objektive Tatbestand ist verwirklicht, wenn der Täter durch einen in Abs. 1 Nr. 1–3 genannten Eingriff zunächst abstrakt die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt und dadurch konkret Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet hat.
[Bild vergrößern]
1.Eingriff in den Straßenverkehr, § 315b Abs. 1 Nr. 1–3
a)§ 315b Abs. 1 Nr. 1
18
Der Eingriff in den Straßenverkehr kann in dem Zerstören, Beschädigen oder Beseitigen von Anlagen oder Fahrzeugen bestehen.
Die Begriffe des Beschädigens und Zerstörens sollten Ihnen aus § 303 bekannt sein. Die dort verwendeten Definitionen sind entsprechend bei § 315b anwendbar.
Beschädigen ist eine nicht ganz unerhebliche Verletzung der Substanz sowie darüber hinaus eine nicht ganz unerhebliche Beeinträchtigung der bestimmungsgemäßen Brauchbarkeit der Sache.[1]
Das Zerstören ist eine so weitgehende Beschädigung der Sache, dass ihre Gebrauchsfähigkeit vollständig aufgehoben ist.[2]
Das Durchtrennen von Bremsschläuchen stellt ebenso eine Beschädigung dar wie die Zersplitterung einer Glasscheibe durch Auftreffen eines schweren Gegenstandes, der von einer Brücke auf das Fahrzeug geworfen wird.[3] Wirft der Täter bei Nacht einen 58 kg schweren Granitstein auf die mittlere Fahrspur der Autobahn und fährt anschließend ein Fahrzeug dort auf, so kommt das Bereiten eines Hindernisses gem. Nr. 2 in Betracht. Denken Sie in diesen Fällen auch immer an die §§ 212, 211 (heimtückische Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln) und die §§ 223 ff.[4]
Ein Beseitigen liegt vor, wenn der bestimmungsgemäße Gebrauch durch örtliche Veränderung erheblich beeinträchtigt ist.[5]
Entfernen eines Stoppschildes, Wegwerfen eines Gullydeckels.[6]
19
Die von diesen Tathandlungen betroffenen Tatobjekte sind gem. § 315b Abs. 1 Nr. 1 Anlagen oder Fahrzeuge.
Unter Anlagen sind sämtliche dauerhaften Einrichtungen zu verstehen, die dem Straßenverkehr dienen.[7]
Dazu zählen Verkehrszeichen, Ampeln, Schranken an Bahnübergängen sowie sonstige Einrichtungen, die in § 43 StVO beispielhaft aufgezählt sind. Darüber hinaus zählen zu den Anlagen aber auch die Straße selbst samt dem Zubehör, wie z.B. Gullydeckel oder Leitplanken.
Unter Fahrzeugen sind sämtliche im Straßenverkehr vorkommenden Beförderungsmittel ohne Rücksicht auf ihre Antriebsart zu verstehen.[8]
Zu den Fahrzeugen gehören mithin sowohl Kraftfahrzeuge als auch Straßenbahnen, Fahrräder und Motorräder sowie motorisierte Rollstühle. Nicht erfasst sind Inlineskates oder Skateboards.
b)§ 315b Abs. 1 Nr. 2
20
Der Eingriff in den Straßenverkehr kann auch durch das Bereiten eines Hindernisses erfolgen.
Ein Hindernis bereitet, wer eine Einwirkung auf den Straßenkörper vornimmt, die geeignet ist, den reibungslosen Verkehrsablauf zu hemmen oder zu gefährden.[9]
Das Errichten einer Straßensperre[10], das Spannen eines Drahtseils quer über die Fahrbahn[11] stellt ebenso ein Hindernis dar wie das Zu-Boden-Werfen eines Menschen auf die Fahrspur einer Autobahn, wobei sich der Täter zum Fixieren des Opfers auf das Opfer setzt, damit dieses nicht von der Straße fliehen kann.[12]
c)§ 315b Abs. 1 Nr. 3
21
Schließlich kann ein Eingriff in den Straßenverkehr durch Vornahme eines ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriffs erfolgen. Diese Tathandlungsalternative hat einen Auffangcharakter und ist aus diesem Grund vom Wortlaut her weit gefasst. Damit das in Art. 103 Abs. 2 GG verankerte Bestimmtheitsgebot nicht verletzt wird, ist ein Täterverhalten zu fordern, welches in seiner Gefährlichkeit den in § 315b Abs. 1 Nr. 1 und 2 genannten Tathandlungsalternativen gleichsteht.[13]
Als ähnliche, ebenso gefährliche Eingriffe wurden angesehen das Herabgießen von Farbe von einer Autobahnbrücke auf fahrende Autos[14], das Deponieren von benzingefüllten Plastikbeuteln im Motorraum zur Herbeiführung einer Explosion[15]
d)Eingriff durch Unterlassen
22
Die Tathandlungen gem. § 315b Abs. 1 Nr. 1–3 können auch durch ein Unterlassen begangen werden, sofern die Voraussetzungen des § 13 gegeben sind. Dies kommt insbesondere dann in Betracht, wenn ein Kraftfahrer ein Hindernis nicht beseitigt, das er durch einen eigenen Unfall oder ein eigenes Fahrverhalten auf der Fahrbahn errichtet hat.[16]
An dem Anhänger des von A geführten Lkw platzt im Verlauf der Fahrt einer der mittleren Reifen, so dass das Fahrzeug kurzfristig ins Schleudern gerät. Dabei löst sich eine nur unsachgemäß befestigte Holzpaneele, die auf der rechten Fahrbahn liegen bleibt. A bringt sein Fahrzeug einige hundert Meter weiter zum Stehen, bemerkt zwar die Holzpaneele, glaubt aber, zunächst wichtigere Dinge erledigen zu müssen. Der nachfolgende Lkw-Fahrer L sieht diese Holzpaneele zu spät und kann einen Unfall mit dem überholenden Porschefahrer P nur noch dadurch vermeiden, dass er sein Fahrzeug nach rechts in die Leitplanke fährt.
Eine Strafbarkeit nach § 315b Abs. 1 Nr. 2 scheidet zunächst aus, weil A nicht durch einen verkehrsfremden Eingriff in den Straßenverkehr ein Hindernis bereitet hat. Die Holzpaneele hat sich infolge eines verkehrstypischen Vorganges gelöst, welcher auch nicht unter Berücksichtigung der BGH-Rechtsprechung zu einem verkehrsfeindlichen Eingriff umgedeutet werden kann.
In Betracht kommen kann jedoch eine Strafbarkeit gem. §§ 315b Abs. 1 Nr. 2, 13. Der BGH hat in Fällen vergleichbarer Art das Bereiten eines Hindernisses durch Unterlassen der Entfernung desselben bejaht.[17] Die Garantenstellung ergibt sich im vorliegenden Beispiel aus Ingerenz, da die nicht ordnungsgemäße Befestigung der Ladung ein pflichtwidriges Vorverhalten darstellt. Teilweise wird in der Literatur die Entsprechungsklausel verneint. Demnach muss das Unterlassen von seiner Vorwerfbarkeit her einem aktiven Tun entsprechen (§ 13). Ein Täter, der aber lediglich ein Hindernis nicht beseitige, weise weniger kriminelle Energie auf als ein solcher, der aktiv ein solches Hindernis schaffe.[18]
e)Verkehrsfeindliche Einwirkungen aus dem Straßenverkehr heraus
23
Wie bereits eingangs erwähnt, soll § 315b grundsätzlich nur Eingriffe erfassen, die von außen in den Straßenverkehr einwirken. Um Strafbarkeitslücken zu vermeiden, sollen nach Auffassung des BGH, der sich die Literatur weitestgehend angeschlossen hat[19], allerdings auch solche Tathandlungen von § 315b erfasst werden, die aus dem fließenden oder ruhenden Straßenverkehr heraus begangen wurden.
Sollten Sie in der Klausur § 315b prüfen müssen, dann wird Ihnen in den meisten Fällen die nachfolgend dargestellte Problematik begegnen. Bei genauer Kenntnis der BGH-Rechtsprechung dürfte Ihnen die Abgrenzung zwischen einem strafbaren Eingriff gem. § 315b und einem weder von dieser Norm noch ggfs. von § 315c erfassten und damit straflosen Eingriff jedoch leicht fallen.
24
Diese Eingriffe können entweder das Bereiten eines Hindernisses gem. § 315b Abs. 1 Nr. 2 oder aber die Vornahme eines ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriffs gem. § 315b Abs. 1 Nr. 3 darstellen. Voraussetzung ist jedoch, dass Sie sich nicht in einer Verletzung von Verkehrsregeln und in einer fehlerhaften Verkehrsteilnahme erschöpfen, da insoweit § 315c Abs. 1 Nr. 2 abschließend ist. Die Verkehrsbehinderung, die durch den zweckentfremdeten Einsatz des Kraftfahrzeuges erreicht wird, muss von einigem Gewicht sein.
Erforderlich ist mithin, dass
•
die Eingriffe aufgrund einer Zweckentfremdung des Fahrzeuges und der damit verbundenen Gefahrverursachung den Charakter von verkehrsfeindlichen Einwirkungen annehmen, und
•
der Täter in der Absicht handelt, den Verkehrsvorgang zu einem Eingriff in den Straßenverkehr zu pervertieren und dadurch die Sicherheit des Straßenverkehrs zu beeinträchtigen. Diese „Pervertierungsabsicht“ setzt dolus directus 1. Grades voraus.
25
Zusätzlich verlangt der BGH beim Einsatz eines Fahrzeuges als Waffe oder Schadenswerkzeug einen Schädigungsvorsatz, wobei dolus eventualis genügt. Der Täter muss also zumindest billigend in Kauf nehmen, dass entweder ein anderer Mensch oder eine fremde Sache von bedeutendem Wert durch sein Verhalten geschädigt wird. Insofern sind die Anforderungen an den Vorsatz bei Eingriffen dieser Art höher, da es bei § 315b grundsätzlich ausreicht, dass der Täter nur die Gefährdung eines anderen Menschen bzw. einer fremden Sache von bedeutendem Wert billigend in Kauf nimmt.[20]
Damit kann § 315b in diesen Fällen nur als Vorsatz-Vorsatz-Kombination gem. Abs. 1 verwirklicht werden.
Das Falschfahren auf der Autobahn (sog. „Geisterfahrer“)[21], das gezielte Zufahren auf einen anderen Menschen[22], das vorsätzliche Rammen eines anderen Fahrzeugs bei hoher Geschwindigkeit sind als verkehrsfeindliche Eingriffe angesehen worden[23]. Auch das Abschütteln eines Polizisten, der sich zum Zwecke der Festnahme auf die Motorhaube gelegt hat, ist ein verkehrsfeindlicher Eingriff.[24]
26
Nach Auffassung des BGH kann eine bewusste Zweckentfremdung sogar dann vorliegen, wenn sich der Täter objektiv verkehrsgerecht verhält, dabei aber die Absicht hat, einen Verkehrsunfall herbeizuführen.[25]
A positioniert sich mit seinem Fahrzeug an einer unfallträchtigen und schwer einsehbaren Straßeneinmündung, bei welcher die Verkehrsteilnehmer die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ gewohnheitsmäßig übersehen. Nachdem er von seinem Freund F über Handy darüber informiert wurde, dass Verkehrsteilnehmer V sich mit überhöhter Geschwindigkeit der Einmündung nähert, biegt er mit seinem Fahrzeug von rechts kommend in die Straßeneinmündung ein und verursacht auf diese Art und Weise einen Verkehrsunfall, bei dem ein nicht unerheblicher Fahrzeugschaden sowohl an seinem als auch an dem gegnerischen Fahrzeug entsteht.
Da A hier das Fahrzeug verwendet hat, um Ansprüche gegenüber der gegnerischen Versicherung zu begründen, hat er es nicht in erster Linie als Fortbewegungsmittel eingesetzt, sondern bewusst als Unfallfahrzeug zweckentfremdet. Auf diese Zweckentfremdung kam es ihm auch an. Darüber hinaus kann ihm der entsprechende Schädigungsvorsatz unterstellt werden, da der zivilrechtliche Schadensersatzanspruch nur bei Realisierung eines Verkehrsunfalls ausgelöst wird.
27
Eine Strafbarkeit gem. § 315b in Fällen der soeben genannten Art wird in der Literatur teilweise abgelehnt. Es wird darauf hingewiesen, dass ein verkehrsgerechtes Verhalten des Täters, welches nur aufgrund eines Fehlverhaltens eines Dritten zu einer Schädigung führen kann, nicht von § 315b erfasst werden könne.[26] Die andere in der Literatur vertretene Ansicht verweist allerdings darauf, dass ein Unfall provozierendes Verhalten gegen § 1 Abs. 2 StVO verstoße und deswegen gerade nicht verkehrsgerecht sei, womit der Anwendungsbereich der §§ 315b ff wieder eröffnet sei.[27]
Da der BGH zur Bestimmung der Tatbestandsmäßigkeit des verkehrsfeindlichen Eingriffs maßgeblich auf subjektive Komponenten wie die Pervertierungsabsicht und den Schädigungsvorsatz abstellt, stellt sich für Sie in der Klausur die Frage, wo und wie diese BGH-Rechtsprechung dargestellt werden muss. Eine Aufteilung dergestalt, dass im objektiven Tatbestand zunächst danach gefragt wird, ob eine Einwirkung von einigem Gewicht vorliegt und erst im subjektiven Tatbestand der Schädigungsvorsatz und die Absicht diskutiert werden, empfiehlt sich nicht, da die Einwirkung nur dann tatbestandsmäßig ist, wenn die subjektiven Anforderungen erfüllt sind. Dementsprechend kann bei diesen Problemfällen die BGH-Rechtsprechung mit ihren subjektiven Anforderungen nur im objektiven Tatbestand dargestellt werden. Um kritische Anmerkungen des Korrektors zu vermeiden, sollten Sie in Fällen dieser Art nicht zwischen objektivem und subjektivem Tatbestand unterscheiden, sondern Ihre Ausführungen mit „I. Tatbestand“ übertiteln und unter dieser Überschrift dann einheitlich die objektiven und subjektiven Voraussetzungen des § 315b prüfen.
[Bild vergrößern]
28
Klausurrelevant sind in diesem Zusammenhang auch die Fälle der sog. „Polizeiflucht“. Die frühere BGH-Rechtsprechung hat § 315b Abs. 1 Nr. 3 bejaht, wenn der Täter gezielt auf einen ihn anhaltenden Polizisten zufährt, um ihn zu zwingen, den Weg freizugeben und dabei vorhat, dem Polizisten im letzten Augenblick auszuweichen. Voraussetzung war jedoch, dass der Täter das Fahrzeug nicht nur lediglich als Fluchtmittel nutzen wollte (dann kein verkehrsfeindlicher Eingriff), sondern zugleich als Werkzeug zur Nötigung „pervertieren“ wollte, um sich einen Fluchtweg zu eröffnen.[28] Nach jetziger BGH-Rechtsprechung wäre nunmehr in Fällen dieser Art zusätzlich erforderlich, dass der Täter mit der Möglichkeit der Verletzung des Polizeibeamten gerechnet und diese billigend in Kauf genommen hat. Gleiches gilt für die Fälle, in denen der Täter verfolgende Polizeifahrzeuge durch verkehrswidriges Verhalten abdrängen möchte. Nimmt er nur eine Behinderung und Gefährdung der Polizisten als Folge seines Verhaltens billigend in Kauf, so ist eine Strafbarkeit gem. § 315b Abs. 1 Nr. 2 zu verneinen, da der Täter in diesen Fällen das Fahrzeug überwiegend als Fluchtmittel benutzt, so dass ein Eingriff vorliegt, der überwiegend aus dem Straßenverkehr heraus erfolgt und nicht verkehrsfeindlich ist. Nimmt der Täter hingegen auch hier z.B. eine Körperverletzung der verfolgenden Polizeibeamten billigend in Kauf, setzt er das Fahrzeug nicht nur als Fluchtmittel, sondern verkehrswidrig als Werkzeug zur Nötigung und Körperverletzung ein, so dass das Bereiten eines Hindernisses gem. § 315b Abs. 1 Nr. 2 bejaht werden kann.[29]
Im letztgenannten Beispiel kommt natürlich auch eine Strafbarkeit gem. § 315c Abs. 1 Nr. 2 in Betracht. Zu bedenken ist aber, dass nur § 315b über Abs. 3 die Möglichkeit der (Erfolgs-) Qualifikation eröffnet ist, weswegen beide Normen in Tateinheit gem. § 52 stehen können und in der Klausur zu prüfen sind.
29
Bei Eingriffen des Beifahrers in den Verkehrsvorgang ist streitig, ob diese von § 315b I Nr. 3 erfasst sein sollen.
Das Abziehen des Zündschlüssels durch den Beifahrer während der Fahrt, so dass die Lenkradsperre ausgelöst wird[30] oder aber das Ziehen der Handbremse bei 140 km/h, um den Fahrer zu einem langsameren Fahren zu veranlassen.
In Rechtsprechung und Teilen der Literatur wird die Auffassung vertreten, dass die Handlungen des Beifahrers nur dann erfasst sein sollen, wenn dieser das Fahrzeug pervertiert.[31] Insofern gelten für den Beifahrer die gleichen Anforderungen wie für den Fahrer. Der Beifahrer wird damit als normaler Verkehrsteilnehmer angesehen. Liegt eine Pervertierung nicht vor, handelt es sich um einen aus dem Straßenverkehr stammenden Eingriff, der nicht von § 315b erfasst sein soll. Da § 315c in derartigen Fällen nicht verwirklicht sein kann, ist das Verhalten jedenfalls nicht nach den Straßenverkehrsdelikten strafbar.
Eine starke Gegenmeinung[32]widerspricht einer dadurch eintretenden Privilegierung des Beifahrers und stuft Eingriffe des Beifahrers als verkehrsfremde Eingriffe von außen in den Straßenverkehr ein, die regelmäßig von § 315b erfasst werden. Damit ist jedenfalls eine Bestrafung nach den Straßenverkehrsdelikten möglich.
2.Beeinträchtigung der Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs
30
Wie bereits ausgeführt, müssen die Tathandlungen der Nr. 1–3 zunächst einmal eine abstrakte verkehrsspezifische Gefahr für die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs schaffen, was regelmäßig der Fall sein dürfte.
Die abstrakte Gefahr kann bejaht werden, wenn der Eingriff störend auf Verkehrsvorgänge wirkt und so zu einer Steigerung der allgemeinen Betriebsgefahr führt.[33]
In der Fallbearbeitung ist daher normalerweise keine ausführliche Erörterung dieses Tatbestandsmerkmals erforderlich. Es reicht aus, dass Sie feststellend erwähnen, dass die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs durch die Vornahme der Tathandlung beeinträchtigt ist. Die tatbestandlichen Voraussetzungen können nur dann in der Klausur interessant werden, wenn der Eingriff außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs stattgefunden hat oder aber zum Zeitpunkt des Eingriffs Straßenverkehr z.B. wegen der nächtlichen Uhrzeit, nicht stattfand.
Auch wenn im Tatbestand des § 315b Abs. 1 nicht von „öffentlichem“ Straßenverkehr gesprochen wird, so ergibt sich die Öffentlichkeit doch aus dem Schutzzweck der Norm.
Zum öffentlichen Straßenverkehr gehören neben den allgemeinen, dem Straßenverkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen auch solche Verkehrsflächen, die jedermann oder nach allgemeinen Merkmalen bestimmte größere Gruppen von Verkehrsteilnehmern dauernd oder vorübergehend zur Benutzung offen stehen.[34]
Hierzu zählen u.a. Tankstellen, Parkplätze und Parkhäuser sowie das Firmengelände. Kein öffentlicher Verkehrsraum sind jedoch Parkhäuser außerhalb der normalen Betriebszeit sowie Kasernengelände, sofern nicht der Zugang vorübergehend für jedermann freigegeben ist.[35]
3.Konkrete Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen oder eine fremde Sache von bedeutendem Wert
31
Als Taterfolg muss durch die Tathandlung gem. § 315b Abs. 1 Nr. 1–3 Leib oder Leben eines anderen Menschen oder einer fremden Sache von bedeutendem Wert gefährdet worden sein. Im Gegensatz zu der abstrakten Gefahr für die Sicherheit des Straßenverkehrs handelt es sich bei dieser Gefahr um eine konkrete Gefahr. Eine konkrete Gefahr kann regelmäßig bejaht werden, wenn es sogar zu einer Verletzung der genannten Rechtsgüter gekommen ist. Ansonsten gilt folgende Definition:
Eine konkrete Gefahr liegt vor, wenn die Sicherheit des Rechtsguts derart beeinträchtigt ist, dass sich das Ausbleiben eines Schadens nach objektiv nachträglicher Prognose als Zufall darstellt.[36]
Eine konkrete Gefahr liegt vor, wenn jemand einen schweren Betonstein von einer Brücke auf eine dicht befahrene Autobahn wirft, da es hier lediglich vom Zufall abhängt, ob der Täter damit einen schweren Unfall mit Personen- und Sachschaden herbeiführt oder nicht.
Nimmt hingegen jemand eine Manipulation an den Bremsen eines Fahrzeuges vor, die zu einer verminderten Bremsleistung führt, so kann eine konkrete Gefahr nur dann angenommen werden, wenn es infolge dieser verminderten Bremsleistung zu einem „Beinahe-Unfall“ gekommen ist. Konnte hingegen der Fahrer des Fahrzeuges mit einem beherzten Durchtreten der Bremsen das Fahrzeug noch vor einer Ampel zum Stehen bringen, muss eine konkrete Gefahr abgelehnt werden.[37]
Beachten Sie, dass es sich bei der konkreten Gefahr und eine verkehrsspezifische Gefahr handeln muss. Eine solche liegt dann vor, wenn sie auf die Wirkungsweise der für Verkehrsvorgänge typischen Fortbewegungskräfte zurückzuführen ist, also das Fahrverhalten oder die Fahrsicherheit beeinträchtigt.[38]
A wirft von einer Brücke große Steine auf fahrende Fahrzeuge, was zu Schäden an der Motorhaube führt. Hier hat der BGH[39] die verkehrsspezifische Gefahr bejaht, da der Schaden mit den Bewegungskräften zusammenhänge. Anders: A gibt auf ein fahrendes Fahrzeug einen Schuss ab, der aber nur zur Beschädigung des Kotflügels führt und vom Fahrer nicht bemerkt wird. Hier macht es keinen Unterschied, ob A auf ein fahrendes oder ein parkendes Fahrzeug schießt. Der Schaden steht nicht mit den Bewegungskräften in Zusammenhang.[40]
32
Diese Gefahr kann zunächst für Leib und Leben eines anderen Menschen bestehen. Fraglich und umstritten ist, ob Tatbeteiligte als „andere Menschen“ angesehen werden können. Die herrschende Meinung verneint die Einbeziehung eines Teilnehmers in den Schutzbereich des § 315b. § 315b enthalte einen gemeingefährlichen Straftatbestand, der die Interessen der Allgemeinheit schütze. Es könne mithin nicht Zweck dieser Norm sein, Personen zu schützen, welche zugleich wegen derselben Handlung aus dieser Norm zu bestrafen seien.[41] Eine in der Literatur vertretene Gegenauffassung verweist jedoch darauf, dass es durch das Erfordernis einer konkreten Gefährdung einer anderen Person zu einer Individualisierung des geschützten Objekts durch das Gesetz gekommen sei. Da § 315b insoweit auch den Schutz des Einzelnen verfolge, müssten auch Teilnehmer in den Schutzbereich einbezogen werden.[42]
In diesen Fällen wird die Strafbarkeit des Täters häufig aufgrund einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung des Teilnehmers zu verneinen sein, so dass eine Streitentscheidung in der Klausur nicht erforderlich sein wird. Sie müssen jedoch gleichwohl die unterschiedlichen Meinungen darstellen.
33
Sofern der Täter nicht Leib oder Leben eines anderen Menschen, sondern eine Sache gefährdet, muss diese fremd sein und von bedeutendem Wert.
Der Wert der Sache hängt dabei weniger vom Verkehrswert ab, sondern v.a. von dem drohenden Schaden, der anhand der Reparaturkosten ermittelt werden kann. Nach Auffassung des BGH[43] liegt dieser Wert noch immer bei 750,00 €. Nach der Gegenauffassung ist die Grenze bei ca. 1300 € anzusetzen.[44]
Fremd sind die Tatobjekte, wenn sie weder im Allein- oder Miteigentum des Täters stehen noch herrenlos sind.[45]
34
Damit scheidet das eigene Fahrzeug des Täters aus.
Sofern der Täter mittels des Fahrzeugs einen ausnahmsweise von § 315b erfassten Eingriff vornimmt und dabei zugleich nur dieses Fahrzeug gefährdet, scheidet nach überwiegender Auffassung auch dieses Fahrzeug als Tatobjekt aus, da das notwendige Tatmittel nicht zugleich das geschützte Tatobjekt sein kann.[46]
Dieses Problem wird eher bei § 315c relevant, da hier der Eingriff immer durch das Führen eines Fahrzeugs bewirkt wird. „Durch“ dieses Führen muss dann eine Gefahr für andere Rechtsgüter u.a. auch für fremde Sachen entstehen. Hier ergibt sich schon aus dem Wortlaut, dass eine Gefahr, die „durch“ ein Fahrzeug verursacht werden muss, nicht zugleich auch eine Gefahr „für“ das Fahrzeug sein kann.
35
Die konkrete Gefährdung muss „durch“ eine der Tathandlungen der Nr. 1 bis 3 eingetreten sein. Dies ist der Fall, wenn
•
die Tathandlung i.S.d. conditio-sine-qua-non-Formel kausal für die eingetretene Gefahr war und
•
die konkrete Gefahr unmittelbar (objektiv zurechenbar) auf der Tathandlung beruht.[47] Dies bedeutet, dass sich die spezifische Gefährlichkeit der Tathandlung in typischer Weise in der konkreten Gefahr realisiert haben muss.
In diesem Zusammenhang können sämtliche Fallgruppen relevant werden, die Ihnen von der objektiven Zurechnung bekannt sind, insbesondere die eigenverantwortliche Selbstgefährdung des Opfers.
Sofern Sie Zeit haben, können Sie an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und Sie sich erneut mit diesen Fallgruppen auseinandersetzen, die im Skript „Strafrecht AT I“ dargestellt werden.
Aktivist A hat die Nase voll vom Feinstaub. Er möchte aus Protest die durch den Wald führende Landstraße blockieren und nimmt dabei auch Gefahren für die Autofahrer in Kauf. Als er den ersten Baum fällt, der eine Fahrspur blockieren soll, stellt er sich so dilettantisch an, dass der Baum auf einen zufällig anwesenden Spaziergänger fällt und diesen tötet.
Hier könnte A zwar mit dem Fällen des Baumes ein Hindernis bereitet haben. Die Gefahr für den Spaziergänger ist aber keine verkehrsspezifische, so dass eine Strafbarkeit gem. § 315b ausscheidet, sofern keine weitere Gefahr eingetreten ist.
2. Teil Straßenverkehrsdelikte › B. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, § 315b › III. Subjektiver Tatbestand
III.Subjektiver Tatbestand
1.Subjektiver Tatbestand des § 315b Abs. 1
36
Der Täter muss mit Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung handeln, wobei dolus eventualis ausreicht. Beachten Sie, dass der Vorsatz des Täters sich lediglich auf die konkrete Gefährdung von Leib oder Leben bzw. der Beschädigung einer fremden Sache von bedeutendem Wert beziehen muss. Es ist nicht erforderlich, dass der Täter auch mit der Verletzung des Tatobjektes rechnet, es sei denn, der Täter hat sein Kraftfahrzeug in verkehrsfeindlicher Absicht pervertiert, da in diesen Fällen ausnahmsweise ein Schädigungsvorsatz vorliegen muss.
2.Qualifikation gemäß § 315b Abs. 3 i.V.m. § 315 Abs. 3 Nr. 1a und b
37
§ 315 Abs. 3 Nr. 1 ist aufgrund der Verweisung des Abs. 3 in § 315b eine Qualifikation zu § 315b Abs. 1. Diese Qualifikation zeichnet sich dadurch aus, dass der Täter zusätzlich zu dem normalen Tatbestandsvorsatz eine Absicht hat.
Gem. § 315 Abs. 3 Nr. 1a hat er die Absicht, durch die Tat einen Unglücksfall herbeizuführen.
Ein Unglücksfall liegt vor bei einem plötzlichen Eintritt eines erheblichen Personen- oder Sachschadens.[48]
38
Gem. § 315 Abs. 3 Nr. 1b ist die Tat qualifiziert, wenn der Täter in der Absicht handelt, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Dabei muss die Handlung gem. § 315b Abs. 1 Nr. 1 bis 3 das Mittel zur Verdeckung oder Ermöglichung der Tat sein, sie darf nicht die Tat selbst sein. Wie bei § 211 auch ist es nicht erforderlich, dass tatsächlich eine Straftat begangen wurde. Beachten Sie, dass es nur auf die subjektive Vorstellung des Täters ankommt.
Unter Absicht ist in beiden Fällen dolus directus 1. Grades zu verstehen.
2. Teil Straßenverkehrsdelikte › B. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, § 315b › IV. Rechtswidrigkeit
IV.Rechtswidrigkeit
39
Bei der Rechtswidrigkeit kann diskutiert werden, ob eine Einwilligung des gefährdeten Rechtsgutsträgers eine Strafbarkeit des Täters nach § 315b ausschließt. Umstritten ist, ob ein disponibles Rechtsgut vorliegt, in dessen Verletzung der Gefährdete einwilligen kann. In der Klausur werden solche Fälle überwiegend in Zusammenhang mit § 315c diskutiert, wenn ein Beifahrer in Kenntnis der Alkoholisierung des Fahrers zu diesem ins Fahrzeug steigt und es zu einem Beinahe-Unfall kommt, bei welchem lediglich der Beifahrer konkret gefährdet wurde. Wir werden uns daher mit dieser Problematik ausführlich bei § 315c, dort unter Rn. 65 auseinandersetzen. Die dortigen Ausführungen können entsprechend auf § 315b übertragen werden.
Im Übrigen gelten die allgemeinen Grundsätze.
2. Teil Straßenverkehrsdelikte › B. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, § 315b › V. Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination gem. § 315b Abs. 1 i.V.m. Abs. 4
V.Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination gem. § 315b Abs. 1 i.V.m. Abs. 4
40
Gem. § 315b Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 kann der Täter zwar vorsätzlich eine der Tathandlungen vornehmen und dadurch die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs gefährden, aber nur fahrlässig hinsichtlich der Gefahr handeln. Von Relevanz wird diese Kombination vor allem wieder bei § 315c. An dieser Stelle sollten Sie sich aber schon einmal folgenden, für beide Normen relevanten Aufbau einprägen:
I.Objektiver Tatbestand
II.Vorsatz im Hinblick auf die Vornahme der Tathandlung gem. Nr. 1 bis 3 und die dadurch eingetretene Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs
III.Fahrlässigkeit gem. § 315b Abs. 4 im Hinblick auf die Gefahr
objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit der Gefahr
IV.Rechtswidrigkeit
V.Schuld
Subjektiver Fahrlässigkeitsvorwurf
2. Teil Straßenverkehrsdelikte › B. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, § 315b › VI. Fahrlässigkeits-Fahrlässigkeits-Kombination gemäß § 315b Abs. 1 i.V.m. Abs. 5
VI.Fahrlässigkeits-Fahrlässigkeits-Kombination gemäß § 315b Abs. 1 i.V.m. Abs. 5
41
Möglich ist auch, dass der Täter sowohl hinsichtlich der Einwirkung auf den Straßenverkehr als auch hinsichtlich der Gefahrverursachung fahrlässig handelt. In diesem Fall stellt § 315b ein ganz normales Fahrlässigkeitsdelikt dar, das wie folgt geprüft werden sollte:
I.Tatbestand
1.Tathandlung gem. § 315b Abs. 1 Nr. 1–3
2.Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs
3.Eintritt der konkreten Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen oder einer fremden Sache von bedeutendem Wert
4.Kausalität
5.Objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit der Gefahr (Fahrlässigkeit)
6.Objektive Zurechnung
II.Rechtswidrigkeit
III.Schuld
Subjektiver Fahrlässigkeitsvorwurf
2. Teil Straßenverkehrsdelikte › B. Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, § 315b › VII. Erfolgsqualifikation gemäß § 315b Abs. 3 i.V.m. § 315 Abs. 3 Nr. 2
VII.Erfolgsqualifikation gemäß § 315b Abs. 3 i.V.m. § 315 Abs. 3 Nr. 2
42
Verursacht der Täter durch die Tat eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen, so verwirklicht er die Erfolgsqualifikation des § 315 Abs. 3 Nr. 2, welcher aufgrund der Verweisung in § 315b Abs. 3 auf diese Norm anwendbar ist. Erfolgsqualifikationen werden Ihnen schon an anderer Stelle begegnet sein, so vor allem bei § 227, der Körperverletzung mit Todesfolge. Dort wie auch hier sieht der Aufbau einer Erfolgsqualifikation wie folgt aus:
I.Voraussetzungen des Grunddeliktes
1.Objektiver Tatbestand des § 315b
2.Subjektiver Tatbestand des § 315b Abs. 1
(Bei Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination bzw. bei Fahrlässigkeits-Fahrlässigkeits-Kombination wählen Sie den oben dargestellten Aufbau.)
II.Voraussetzungen des § 315 Abs. 3 Nr. 2
1.Eintritt der Folge
a)Schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen
b)Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen
2.Kausalität zwischen Grunddelikt und schwerer Folge
3.Unmittelbarkeitszusammenhang zwischen Grunddelikt und schwerer Folge
4.Fahrlässigkeit gem. § 18
III.Rechtswidrigkeit
IV.Schuld
43
Selbstverständlich müssen Sie in der Klausur die Voraussetzungen der Erfolgsqualifikation nicht zusammen mit jenen des Grunddelikts prüfen. Sollten Sie sich für einen getrennten Aufbau entscheiden, dann prüfen Sie zunächst komplett die Voraussetzungen des § 315b. Alsdann beginnen Sie mit einem neuen Prüfungspunkt, unter welchem Sie die Voraussetzungen des § 315 Abs. 3 Nr. 2 entsprechend den o.g. Aufbauschemata prüfen, anschließend Rechtswidrigkeit und Schuld.
44
Die Folge des § 315 Abs. 3 besteht zum einen in einer schweren Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen.
Unter schweren Gesundheitsschädigungen sind solche zu verstehen, die zum einen vergleichbar oder identisch sind mit den schweren Körperverletzungen des § 226, daneben aber auch sonstige langwierige und ernsthafte Erkrankungen, die einen längeren Krankenhausaufenthalt und evtl. auch eine Minderung der Erwerbstätigkeit nach sich ziehen.[49]