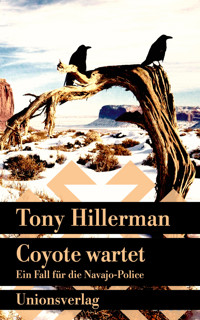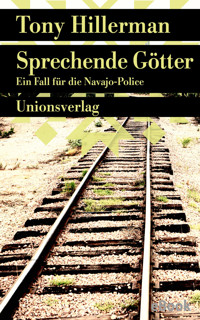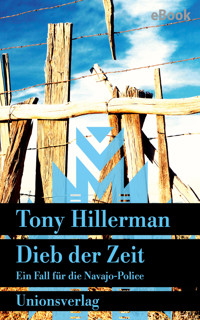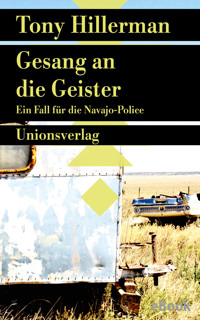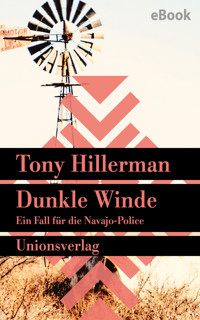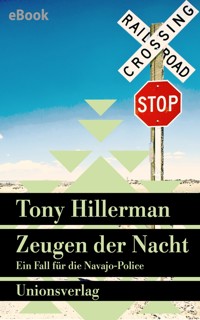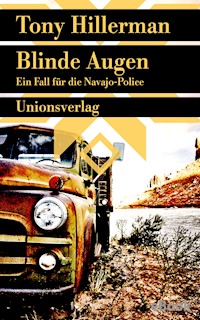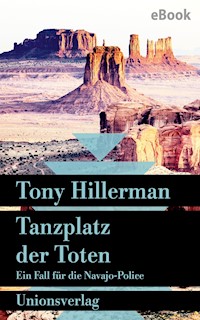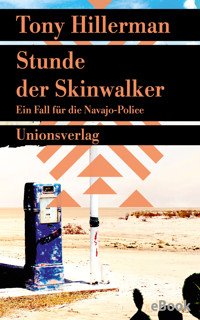
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Officer Jim Chee erkennt draußen im Dunkeln gerade noch die Umrisse einer Gestalt, als drei Schüsse die Wand seines Wohnwagens durchschlagen und ihn nur knapp verfehlen. Am nächsten Morgen landet der Fall auf dem Schreibtisch von Lieutenant Joe Leaphorn, der seit Wochen über seiner Landkarte brütet: Zwischen Arizona und dem menschenleeren Gebiet des Big Mountain stecken drei Nadeln für drei ungelöste Mordfälle, alle scheinbar ohne Motiv. Sollte Jim Chee das vierte Opfer werden? Auf der Suche nach einer Verbindung zwischen den Fällen beginnen Leaphorn und Chee zusammenzuarbeiten. Und Chee stößt bald auf eine beunruhigende Spur: Ist der Täter ein Skinwalker - eine dunkle Macht in Menschengestalt? Verfilmt als Serie »Dark Winds – Der Wind des Bösen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Ähnliche
Über dieses Buch
In Lieutenant Leaphorns Karte stecken drei Nadeln für drei ungelöste Mordfälle, alle scheinbar ohne Motiv. Als Leaphorns jüngerer Kollege Officer Jim Chee nur knapp einem ähnlichen Anschlag entgeht, beginnen die beiden gemeinsam zu ermitteln. Eine beunruhigende Spur führt zur Legende der Skinwalker – einer dunklen Macht in Menschengestalt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925–2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Klaus Fröba (*1934) ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Übersetzer, er veröffentlichte Jugendbücher und Kriminalromane. Er übersetzte aus dem Englischen, u. a. Werke von Jeffrey Deaver, Ira Levin, Tony Hillerman und Douglas Preston. Fröba lebt in der Nähe von Bonn.
Zur Webseite von Klaus Fröba.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Stunde der Skinwalker. Verfilmt als Serie »Dark Winds – Der Wind des Bösen«
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Klaus Fröba
Ein Fall für die Navajo-Police (6)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Andreas Heckmann nach dem Original durchgesehen und grundlegend überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 1986 bei Harper & Row, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1988 unter dem Titel Die Nacht der Skinwalkers im Rowohlt Verlag, Reinbek.
Originaltitel: Skinwalkers
© by Anthony G. Hillerman 1986
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Klaus Fröba beim Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund - Charles Harker (Alamy Stock Foto); Symbol – Valerii Egorov (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31164-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 11:48h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
STUNDE DER SKINWALKER. VERFILMT ALS SERIE »DARK WINDS – DER WIND DES BÖSEN«
Vorbemerkung des Autors1 – Klack-klack machte es, als die Katze durch die …2 – Lieutenant Joe Leaphorn war früh ins Büro gekommen …3 – Roosevelt Bistie sei nicht zu Hause, sagte ihnen …4 – Jähes Hochschrecken aus dem Schlaf. Gegen die Nacht …5 – Lieutenant Joe Leaphorn lenkte seinen Streifenwagen in den …6 – Der heiße, trockene Südwestwind trieb Sand über die …7 – Dr. Randall Jenks hielt ein Blatt Papier in …8 – Es war fast dunkel, als Chee auf den …9 – Ich schätze, Sie kommen zu spät«, sagte der …10 – Der Gewittersturm fegte durch das Tal heran …11 – Jim Chee hatte sich eine Weile den Kopf …12 – Joe Leaphorns Telefon läutete. »Wer ist dran?« …13 – Sanostee war ein guter Ausgangspunkt für die Fahrt …14 – Officer down«, dieser Alarm führt bei der Polizei …15 – Das Krankenhaus in Gallup ist der ganze Stolz …16 – Als Chee aufwachte, war die Katze da …17 – Endlich hatte McGinnis das Schild frisch gemalt …18 – Chee hatte einen freien Tag, es blieb ihm …19 – Kaum hatte Leaphorn sein Büro betreten, läutete das …20 – Howard Morgan war gerade dabei, im KOAT-TV-Studio in …21 – Officer Leonard Skeet aus dem Ears Sticking Up …22 – Die Nacht vertrieb den Sturm, so ist das …23 – Für Chee war alles wie von Nebel verhangen …24 – Dass es ein Behindertenparkplatz war, kümmerte Leaphorn in …Mehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Über Klaus Fröba
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema USA
Ich widme dieses Buch Katy Goodwin, Ursula Wilson, Faye Bia Knoki, Bill Gloyd, Annie Kahn, Robert Bergman, George Bock und allen Medizinmännern der Navajo und den Ärzten der belacani, die sich um die Diné kümmern und sorgen. Danken möchte ich Dr. Albert Rizzoli für seine freundliche Hilfe. Und ich möchte dem Indian Health Service meinen Respekt ausdrücken, dessen gute Arbeit viel zu selten Anerkennung findet.
Vorbemerkung des Autors
Wer diesen Navajo-Krimi mit einer Landkarte der Big Reservation neben sich liest, sei gewarnt: Der Ort Badwater Wash, sein Krankenhaus und seine Handelsstation sind ebenso fiktiv wie die Menschen, die dort leben. Gleiches gilt für Short Mountain. Ich verwende auch eine ungebräuchliche Schreibung des Navajo-Begriffs für den Schamanen, Medizinmann oder Singer, der normalerweise »hataalii« buchstabiert wird. Außerdem hat mich mein guter Freund Ernie Bulow mit Recht darauf hingewiesen, dass traditionell orientierte Schamanen die Art und Weise missbilligen würden, in der Jim Chee aufgefordert wird, den Blessing Way zu singen – so eine Einladung sollte mündlich, nicht brieflich erfolgen. Ablehnen würden sie auch, dass Chee unter freiem Himmel in den Sand malt. Ein so heiliges und machtvolles Ritual sollte nur in einem Hogan vollzogen werden.
Wir Navajo wissen, dass der Kojote immer dort draußen lauert, knapp außer Sichtweite. Und dass er immer hungrig ist.
ALEX ETCITTY,mütterlicherseits aus dem Water Is Close Clan
1
Klack-klack machte es, als die Katze durch die kleine Klappe unten in der Fliegengittertür schlüpfte. Das leise Geräusch genügte, um Jim Chee aufzuwecken. Er hatte sich auf der schmalen Pritsche im Halbschlaf unruhig hin und her gewälzt und war immer wieder unsanft gegen die Metallstreben gestoßen, die die Aluminiumhaut seines Wohnwagens stabilisierten. Als er nun hochschreckte, merkte er, dass das Laken zerknüllt um seine Brust lag.
Noch halb betäubt von seinem Albtraum, in dem er sich in einem Lasso verfangen hatte, mit dem er die Schafe seiner Mutter davon abhalten wollte, in etwas Vages, Gefährliches zu stürzen, zog er das Laken glatt. Möglich, dass sein wilder Traum ihm nun auch ein paar sorgenvolle Gedanken eingab, was seine Katze betraf. Was hatte sie nach drinnen verjagt? Etwas, das einer Katze Angst macht, jedenfalls dieser Katze. Etwas, das auch für ihn bedrohlich war? Doch das bedrückende Gefühl dauerte nur einen Augenblick, dann wich es dem glücklichen Gedanken, dass Mary Landon bald kommen würde. Die faszinierende, schlanke Mary Landon mit ihren schönen blauen Augen würde aus Wisconsin zurückkehren. Nur noch ein paar Wochen, dann hatte das Warten ein Ende.
Jim Chee, verwurzelt in den Traditionen der Navajo, schob den Gedanken aber wieder beiseite. Alles hatte seine Zeit. An Mary Landon konnte er später denken. Jetzt galt es, an morgen zu denken, eigentlich an heute, denn sicher war es weit nach Mitternacht. Er und Jay Kennedy mussten losfahren und Roosevelt Bistie festnehmen. Bistie sollte wegen eines Tötungsdelikts angeklagt werden, vielleicht war es sogar Mord. Nichts, was besonders schwierig gewesen wäre, aber doch so unerfreulich, dass Jim Chee sich mit seinen Überlegungen rasch wieder woanders festhakte. Wieder dachte er an die Katze. Was hatte sie bloß in den Wohnwagen getrieben? Ein Kojote? Oder was sonst könnte es gewesen sein?
Letzten Winter war sie hier aufgetaucht und hatte sich ein Stück östlich von Chees Wohnwagen, wo der niedrige Ast eines Wacholders, ein Felsbrocken und ein verrostetes Fass einen Unterschlupf bildeten, ein Lager eingerichtet. Sie war ihm eine vertraute, wenngleich misstrauische Nachbarin geworden. Chee hatte sich angewöhnt, ihr Essensreste hinzustellen, um sie durchzufüttern, solange alles verschneit war. Nach der Schneeschmelze, als schon die Trockenheit einsetzte, stellte er eine mit Wasser befüllte Kaffeedose dazu. Aber das lockte auch andere Tiere an, Vögel vor allem, die das Gefäß manchmal umkippten.
Darum hatte Chee eines Nachmittags, als es gerade nichts Besseres zu tun gab, die Tür ausgehängt, unten aus dem Rahmen ein Viereck in Katzengröße ausgesägt und dann eine Sperrholzklappe mit Lederscharnieren und Wunderkleber befestigt. Das war aus einer Laune heraus geschehen, auch weil er sehen wollte, ob die misstrauische Katze sich überhaupt darauf einließ. Falls sie sich daran gewöhnte, die Klappe zu benutzen, war nicht nur das Problem mit der Tränke gelöst, sondern sie konnte sich auch mit dem Rudel Feldmäuse beschäftigen, das sich, wie Chee vermutete, in seinem Wohnwagen eingenistet hatte. Chee machte sich ein bisschen Vorwürfe, ihr überhaupt Wasser hingestellt zu haben. Ohne seine Einmischung hätte alles seinen natürlichen Lauf genommen. Die Katze hätte sich einen anderen Unterschlupf gesucht, weiter den Hügel hinunter, näher am San Juan River, der immer Wasser führte. Aber nun hatte er die Katze von sich abhängig gemacht, war für sie verantwortlich.
Mit bloßer Neugier hatte es angefangen. Die Katze musste jemandem gehört haben, das Halsband verriet es, und obwohl sie abgemagert war, am rechten Hinterbein ein Stück Fell verloren und eine lange Narbe über den Rippen hatte, sah man ihr an, dass sie reinrassig war. Er hatte sie der Frau vom Zoogeschäft in Farmington beschrieben: gelbbraunes Fell, kräftige Hinterbeine, runder Kopf mit spitzen Ohren, ein bisschen wie ein Rotluchs, auch nur mit einem Stummelschwanz. Die Frau hatte gemeint, das müsse eine Manx-Katze sein.
»Ein Haustier«, hatte sie missbilligend gesagt. »Die Leute nehmen ihre Tiere in die Ferien mit, dann passen sie nicht auf, lassen sie aus dem Wagen springen, und schon ist es passiert.« Sie hatte Chee vorgeschlagen, die Katze einzufangen und bei ihr vorbeizubringen. »Dann findet sich sicher jemand, der sich um das Tier kümmert.«
Chee war allerdings nicht sicher, ob ihm das gelungen wäre, er hatte es gar nicht erst versucht. Er war zu sehr Navajo, um ohne zwingenden Grund auf ein Tier loszugehen. Aber er war neugierig, ob so ein Geschöpf, das offensichtlich aus einer Zucht stammte und bei Weißen aufgewachsen war, noch genug natürlichen Jagdinstinkt besaß, um in der Welt der Navajo zu überleben. Und allmählich wandelte sich seine Neugier in gelegentliche Bewunderung. Schon im Frühsommer hatte die Katze aus ihren Blessuren und Narben so viel gelernt, dass sie nicht mehr Präriehunden nachjagte, sondern sich auf kleine Nagetiere und Vögel beschränkte. Sie hatte gelernt, wann sie sich verstecken und wann sie Reißaus nehmen musste. Sie hatte gelernt zu überleben.
Und sie war darauf gekommen, dass der Weg zur Wasserbüchse in Chees Wohnwagen weniger mühevoll war als der hinunter zum Fluss. Nach einer Woche ging sie schon durch die Klappe ein und aus, wenn Chee weg war. Und im Sommer kam sie dann auch, wenn er da war. Zuerst hatte sie angespannt am Trittbrett gewartet, bis er sich nicht mehr in der Nähe der Tür aufhielt, hatte ihn beim Trinken nervös beobachtet und war, sobald er auch nur die geringste Bewegung machte, davongesaust. Aber jetzt, im August, nahm sie ihn einfach nicht mehr zur Kenntnis. Nachts war sie allerdings erst einmal hereingekommen, als ein Rudel Hunde sie von ihrem Lager unter dem Wacholderbusch verjagt hatte.
Chee sah sich im Wohnwagen um. Es war viel zu dunkel, um die Katze zu entdecken. Er schob das Laken weg und schwang die Beine aus dem Bett. Durch das Moskitogitter vor dem Fenster sah er den tief stehenden Mond. Ein klarer Sternenhimmel, nur weit im Nordwesten ballten sich dunkle Gewitterwolken. Chee gähnte, reckte sich, ging zum Spülbecken und trank einen Schluck Wasser aus der hohlen Hand, es schmeckte schal. Feiner Staub lag in der Luft, wie seit Wochen schon. Am späten Nachmittag war ein Gewitter über den Chuskas aufgezogen, aber nach Norden gewandert, hoch nach Utah und Colorado, und hier um Shiprock war alles beim Alten geblieben. Chee ließ das Wasser weiter laufen, spritzte sich eine Handvoll ins Gesicht. Die Katze war dicht bei seinen Füßen, vermutete er, hinter dem Abfalleimer. Er gähnte noch einmal. Was hatte sie nur hineingetrieben? Vor ein paar Tagen hatte er die Spur eines Kojoten gesehen, unten am Fluss. Aber ein Kojote jagt nicht so nahe an menschlichen Behausungen, es sei denn, er wäre entsetzlich hungrig. Und Hunde hätte er im Gegensatz zu einem Kojoten gehört. Vielleicht doch ein Kojote. Was sonst?
Chee stand vor dem Spülbecken, halb aufgestützt, gähnte wieder. Zurück ins Bett. Der Tag morgen würde ungemütlich werden. Kennedy hatte gesagt, er wolle um acht beim Wohnwagen sein, und der FBI-Mann war immer pünktlich. Dann kam die lange Fahrt in die Lukachukais, um Roosevelt Bistie zu finden und ihn zu fragen, warum er einen alten Mann namens Dugai Endocheeney mit einem Schlachtermesser getötet hatte. Seit sieben Jahren war Chee nun schon bei der Navajo-Police, seit seinem Abschluss an der University of New Mexico, und er wusste inzwischen, dass er sich mit diesem Teil seiner Arbeit nie anfreunden würde. Das staatliche Gesetz würde Bistie heilen wollen, indem man ihn vor ein staatliches Gericht schleppte, wegen eines Tötungsdelikts im Reservat anklagte und wegsperrte. Diese Art des Umgangs mit Verwirrten würde sie nie zur Harmonie zurückfinden lassen.
Allerdings gefiel Chee das meiste an seinem Job. Das, was morgen kam, musste er eben durchstehen. Er dachte an die schöne Zeit, als er in Crownpoint stationiert war, wo Mary Landon an der Grundschule unterrichtete. Mary Landon war immer da gewesen, hatte ihm immer zugehört. Chee fühlte sich entspannt. Einen Augenblick noch, dann würde er wieder ins Bett kriechen. Durch den Vorhang sah er nur den blendenden Glanz der Sterne über dem nachtschwarzen Land.
Was lauerte dort draußen? Ein Kojote? Oder Shy Girl Beno? Von Shy Girl kam er auf deren Gegenpart, auf Welfare Woman. Und auf den Fall mit dem falschen Begay. Bei diesem Gedanken spielte ein amüsiertes Lächeln um seine Lippen. Eigentlich hieß die Frau von der Wohlfahrt Irma Onesalt und war Sozialarbeiterin in einem Stammesbüro, hart wie Sattelleder und fies wie eine Schlange. Nie würde er ihr Gesicht vergessen, als sie erfuhr, dass der falsche Begay aus der Badwater-Klinik geholt und durch das halbe Reservat gekarrt worden war. Inzwischen war sie tot, jemand hatte sie erschossen. Aber das war unten im Süden passiert, weit weg vom Shiprock-Distrikt, außerhalb von Chees Zuständigkeit. Seltsam nur, dass ihr Tod ihn nicht daran hinderte, immer noch mit dem gleichen Vergnügen an den Fall mit dem falschen Begay zu denken. Es hieß, es werde sich wohl nie herausfinden lassen, wer Welfare Woman erschossen hatte, weil praktisch jeder, der mit ihr zu tun gehabt hatte, verdächtig war und ein einleuchtendes Motiv besaß. Chee konnte sich nicht erinnern, je einer so unausstehlichen Frau begegnet zu sein.
Er streckte sich. Zurück ins Bett. Unversehens fiel ihm eine Alternative zu seiner Kojote-jagt-Katze-Theorie ein. Shy Girl im Camp von Theresa Beno. Sie hatte sich, während er mit Theresa, ihrem Mann und ihrer älteren Tochter sprach, draußen herumgetrieben, immer auf Abstand bedacht, aber sicher deshalb, weil sie mit ihm reden wollte. Die Schüchterne hatte das schmale Gesicht, den zierlichen Körperbau und die Schönheit der Beno-Frauen. Er hatte Shy Girl, als er das Camp verließ, in einen grauen Chevy Pick-up steigen sehen, und als er dann in Roundtop an der Tankstelle hielt, um eine Cola zu trinken, war auch sie dort eingebogen. Sie hatte abseits der Tanksäulen im Wagen gesessen und ihn beobachtet. Deshalb hatte er gewartet. Aber dann war sie davongefahren.
Chee ging vom Spülbecken zur Tür, starrte durch das Moskitogitter in die Dunkelheit und roch die trockene Augustluft. Shy Girl weiß etwas über die Schafe, dachte er, und sie hat es mir sagen wollen. Aber sie wollte nur dort mit mir reden, wo niemand sie beobachten kann. Es ist ihr Schwager, der die Schafe stiehlt. Sie weiß es. Sie will, dass man ihn erwischt. Sie ist hinter mir hergefahren und hat gewartet. Und gleich kommt sie zur Tür und wird mir, sobald ihr Mut groß genug ist, alles erzählen. Sie ist es, die sich da draußen herumtreibt und die Katze aufgescheucht hat.
Natürlich war das eine alberne Idee, einer dieser Einfälle in halb wachem Zustand. Chee konnte draußen nichts entdecken, nur die dunklen Umrisse der Wacholderbüsche; und eine Meile flussaufwärts hatte jemand an der Straßenmeisterei die Lichter brennen lassen. Dahinter ein ferner Schimmer: der Lichtschein der Zivilisation über Shiprock. Er roch die staubhaltige Luft und den eigentümlich süßen Duft von welkem Laub, den Chee wie alle Navajo nur zu gut kannte und der bedrückende Kindheitserinnerungen weckte. An abgemagerte Pferde, verendende Schafe, bekümmerte Erwachsene. An Tage, da sie nicht satt geworden waren und jeder darauf geachtet hatte, mit dem ausgehöhlten Kürbis nicht mehr vom lauwarmen Wasser zu schöpfen, als er wirklich zum Trinken brauchte. Wie lange hatte es schon nicht mehr geregnet? Ein Schauer über Shiprock Ende April, das war alles gewesen.
Nein, Theresa Benos schüchterne Tochter war nicht dort draußen. Vielleicht doch ein Kojote. Wie dem auch sei, er würde sich wieder schlafen legen. Er ließ noch ein bisschen Wasser in die hohle Hand fließen, schlürfte es und merkte am Geschmack, dass der Tank auf dem Wohnwagendach fast leer sein musste. Höchste Zeit, ihn auszuspülen und frisches Wasser nachzufüllen. Wieder dachte er an Kennedy. Chee hatte dieselben Vorurteile gegen das FBI wie die meisten Polizisten, aber Kennedy schien besser zu sein als die meisten. Und schlauer. Was nicht schlecht war, denn er blieb wohl für längere Zeit in Farmington, Chee würde mit ihm zusammenarbeiten und …
In diesem Augenblick bemerkte er die Gestalt in der Dunkelheit. Sie hatte sich wohl durch eine kleine Bewegung verraten. Oder Chees Augen hatten sich jetzt an das nächtliche Licht gewöhnt. Eine Gestalt, nur ein schwarzer Schatten in der Nacht, kaum weiter als drei Meter von dem Fenster entfernt, unter dem Chee schlief. Eine menschliche Gestalt. Zierlich? Vielleicht doch das Mädchen aus Theresa Benos Camp. Aber warum blieb sie so stumm da draußen stehen, wenn sie doch gekommen war, um mit ihm zu reden?
Das gleißende Licht und der Knall waren eins. Ein weißgelber Blitz, der sich tief in Chees Netzhaut brannte. Und ein Knall, der ihm ins Trommelfell fuhr. Und wieder. Und wieder. Chee hatte sich instinktiv auf den Boden geworfen und die Krallen der Katze gespürt, als sie in panischem Schrecken über seinen Rücken zur Türklappe flüchtete.
Dann war es still. Chee richtete den Oberkörper auf. Wo war seine Pistole? Am Gürtel im Wandschrank. Auf allen vieren kroch er hin. Noch immer sah er nur das Weißgelb der Blitze, hörte nur das Klingen in seinen Ohren. Er riss die Tür des Wandschranks auf und tastete blind nach oben, bis seine Finger das Holster fanden, die Pistole herauszogen und sie spannten. Dann saß er mit dem Rücken zum Wandschrank da, wagte kaum zu atmen und wartete darauf, dass die Blendung nachließ. Allmählich begann er, seine Umgebung wieder zu erkennen. Noch war die offene Tür nicht mehr als der Umriss eines dunkelgrauen Vierecks in einer Fläche aus zerfließender Finsternis. Nachtschwärze drang durch das Fenster über dem Bett. Und darunter schienen sich einige kreisrunde Flecke aneinanderzureihen – Flecke, die dort nicht hingehörten, kaum auszumachen, nur eine Spur heller als die Dunkelheit ringsum.
Erst jetzt merkte er, dass das Laken auf dem Boden lag und seine Knie gegen die Schaumstoffmatratze drückten. Aber er hatte sie nicht von der Pritsche gerissen. Die Katze? Ausgeschlossen. Das Dröhnen in seinen Ohren verklang, in der Ferne hörte Chee einen Hund bellen; die Schüsse mussten ihn aufgeschreckt haben. Denn Schüsse waren es gewesen. Drei Schüsse. Oder vier?
Wer immer geschossen hatte, lauerte wohl noch draußen und wartete darauf, dass Chee herauskäme. Oder dachte darüber nach, ob drei Schüsse durch die Aluminiumwand auf Chees Bett genug gewesen waren. Das Flimmern vor Chees Augen hatte aufgehört, er starrte auf die Löcher in der Wand. Es waren riesige Löcher, so groß, dass eine Faust hineingepasst hätte. Eine Schrotflinte. Das erklärte den höllischen Lärm und das gleißende Licht. Es wäre ein Fehler, jetzt durch die Tür nach draußen zu gehen. Also blieb Chee sitzen, den Rücken am Wandschrank, die Pistole umklammert, und wartete. Das Gebell eines zweiten Hundes, auch weit entfernt. Ein Luftzug wehte durch den Wohnwagen, es roch nach verbranntem Schießpulver, welkem Laub und dem Schlamm, den der Fluss ans Ufer gespült hatte. Die Feuerkreise vor Chees Augen waren erloschen, er konnte wieder sehen. Und er sah jetzt, dass die Matratze zerfetzt war, die Wucht der Geschosse hatte sie von der Pritsche geschleudert. Und durch die Löcher in der dünnen Aluminiumwand sah er den bleichen Schein der Blitze am Horizont, wo sich weit im Nordwesten das Gewitter austobte. In der Mythologie der Navajo galten Blitze als Zeichen für den Zorn des yei. Sie symbolisierten den Groll, den die Holy People die Erde spüren ließen.
2
Lieutenant Joe Leaphorn war früh ins Büro gekommen. Kurz vor der Morgendämmerung war er aufgewacht, hatte eine Weile reglos dagelegen, warm Emmas Hüfte neben sich gespürt, ihren Atemzügen gelauscht und ein betäubendes Gefühl der Verlorenheit empfunden. Schließlich war ihm klar geworden, dass er sie zwingen musste, zum Arzt zu gehen. Er selbst würde sie hinbringen, keine Ausreden gelten und sich keinen Aufschub mehr abhandeln lassen. Er gestand sich ein, dass er Emmas Widerstreben, zu einem Arzt der belacani zu gehen, nur wegen seiner eigenen Ängste hingenommen hatte. Denn er wusste, was der Arzt sagen würde. Und dass dann auch sein letzter Funke Hoffnung erlöschen musste. »Ihre Frau hat Alzheimer«, würde er sagen, und Leaphorn würde Mitgefühl in seiner Miene lesen, bevor er erklärte, was Leaphorn ohnehin schon wusste: dass die Krankheit unheilbar war. Der Teil des Gehirns, in dem die Erinnerung eines Menschen gespeichert ist und der sein Verhalten bestimmt, erfüllte allmählich seine Funktionen nicht mehr. Bis der Kranke, so jedenfalls erschien es Leaphorn, schließlich vergaß, weiterzuleben. Wie er es sah, tötete die Krankheit ihre Opfer schrittweise, und Emmas Sterben hatte schon begonnen. So hatte er dagelegen, sie neben sich atmen gehört und um sie getrauert. Dann war er aufgestanden, hatte Kaffeewasser aufgesetzt, am Küchentisch gesessen und gewartet, bis hinter der hoch aufragenden Felswand, nach der die kleine Stadt Window Rock benannt war, der Himmel hell wurde. Agnes hatte ihn gehört oder den Kaffee gerochen. Er hatte im Bad Wasser laufen hören, dann war sie zu ihm in die Küche gekommen, schon gewaschen und gekämmt, in einem mit roten Rosen bedruckten Morgenmantel.
Leaphorn mochte Agnes, er war, als Emmas Kopfschmerzen und ihre Vergesslichkeit schlimmer wurden, froh und erleichtert gewesen, als sie zu ihnen zog und, wie Emma sagte, bleiben wollte, bis sie wieder gesund wäre. Aber Agnes war Emmas Schwester, und beide waren – wie alle in der Yazzie-Familie – tief in der Tradition der Navajo verhaftet. Seiner Einschätzung nach waren sie jedoch aufgeklärt genug, um nicht zu erwarten, dass er, wenn Emma starb, eine andere Frau aus der Familie heiratete. Gelegentlich mochte der Gedanke aber vielleicht doch aufkommen. Und das bereitete ihm Unbehagen, wenn er mit Agnes allein war.
Also hatte er seinen Kaffee ausgetrunken und war durch das Dämmerlicht des frühen Morgens zum Dienstgebäude der Navajo-Police gegangen, um Distanz zu gewinnen zur fruchtlosen Sorge um seine Frau und sich einem Problem zuzuwenden, das er zu lösen hoffte. In dieser ruhigen Stunde am Morgen, in der noch kein Telefon läutete, wollte er sich endlich darüber klar werden, ob es zwischen den drei Tötungsdelikten, mit denen er zu tun hatte, einen Zusammenhang gab. Anscheinend waren diese Verbrechen nur dadurch verbunden, dass sie Leaphorn gleichermaßen ratlos machten. Sein ganzes Denken und Fühlen als Navajo lehnte sich dagegen auf, einen Zusammenhang zu konstruieren. Aber der Gedanke, dass es ihn eben doch gab, ließ ihn seit Tagen nicht los. Der Fall war so widersprüchlich und verwickelt, dass Leaphorn darin Zuflucht vor der Sorge um Emma finden konnte. An diesem Morgen wollte er der Lösung des Rätsels einen ersten Schritt näherkommen. Er würde den Hörer neben die Gabel legen, sich vor die Karte des Navajo-Reservats stellen, auf die Nadeln starren, mit denen er Tatorte zu markieren pflegte, und sich zu nüchternem Nachdenken zwingen. Sofern es ringsum still war und Leaphorn ein wenig Zeit hatte, war er sehr gut darin, hinter scheinbar zufälligen Ereignissen logische Zusammenhänge zu erkennen.
Im Eingangskorb lag eine Notiz.
Von: Captain Largo, Shiprock.
An: Lieutenant Leaphorn, Window Rock.
Heute Morgen um etwa 2.15 wurden drei Schüsse in den Wohnwagen von Officer Jim Chee gefeuert, begann die Notiz. Leaphorn las sie rasch. Keine Beschreibung eines Täters oder Fluchtfahrzeugs. Chee war unverletzt. Am Schluss hieß es: Chee sagt aus, er könne keine Angaben zu einem möglichen Motiv machen.
Leaphorn las den letzten Satz noch einmal. Von wegen, dachte er. Als ob Chee keine Vermutungen hätte! Natürlich schießt niemand grundlos auf einen Cop. Und natürlich kennt der Cop, auf den geschossen wurde, den Grund genau, und natürlich wirft dieser Grund ein so schlechtes Licht auf das Verhalten des Polizisten, dass er sich lieber nicht daran erinnert. Leaphorn schob den Zettel beiseite. Sobald die Bürozeit begann, würde er Largo anrufen und nachfragen, ob er dem etwas hinzuzufügen habe. Aber nun wollte er über die drei Tötungsdelikte nachdenken.
Er schwang den Stuhl herum und betrachtete die Karte des Reservats, die fast die ganze Breite der Wand hinter ihm bedeckte. Drei Nadeln markierten die Fälle, um die es ging: eine nicht weit von Window Rock, eine weiter oben, an der Grenze zwischen Arizona und Utah, eine im Nordwesten, im menschenleeren Gebiet am Big Mountain. Die Nadeln bildeten ein ungefähr gleichseitiges Dreieck, dessen Eckpunkte etwa hundertzwanzig Meilen voneinander entfernt lagen. Leaphorn fiel auf, dass aus dem Dreieck ein seltsam geformtes Viereck geworden wäre, wenn der Mann mit der Schrotflinte Chee umgebracht hätte. Dann hätte er es mit vier ungeklärten Tötungsdelikten zu tun gehabt. Er wischte den Gedanken weg. Die Sache mit Chee würde nicht ungeklärt bleiben. Die Dinge lagen viel einfacher. Sie mussten nur herausfinden, wo er ein Dienstvergehen begangen hatte, und den Mann finden, mit dem er bei dessen Festnahme unsanft umgesprungen war. Anders als bei den drei Fällen, für die die Stecknadeln standen, handelte es sich hier nicht um ein Verbrechen, dem das Motiv fehlte.
Das Telefon läutete, der Diensthabende unten meldete sich. »Tut mir leid, Sir, aber die Vertreterin des Stammesrats von Cañoncito ist hier.«
»Haben Sie ihr nicht gesagt, dass ich erst ab acht im Büro bin?«
»Sie hat Sie kommen sehen und ist schon unterwegs zu Ihnen.«
Nein, sie schob bereits Leaphorns Tür auf. Und nun saß ihm die Vertreterin des Stammesrats im hölzernen Lehnstuhl am Schreibtisch gegenüber, füllig, mit starkem Busen, wie Leaphorn mittelgroß und in mittlerem Alter. Sie trug eine altmodische, purpurfarbene Bluse und eine schwere Halskette aus silbernen Kürbisblüten. Die Nacht habe sie im Window Rock Motel verbracht, unten am Highway, ließ sie Leaphorn wissen. Gestern Nachmittag, gleich nach einer Versammlung ihrer Leute im Gemeindehaus in Cañoncito, sei sie losgefahren, den ganzen Weg bis hierher. Die Leute in Cañoncito seien nämlich unzufrieden mit der Navajo-Police. Die Art, wie man ihnen Polizeischutz gewähre, gefalle ihnen nicht, denn es gebe einfach keinen. Deshalb sei sie heute Morgen gekommen, um mit Lieutenant Leaphorn darüber zu reden, aber das Gebäude sei verschlossen gewesen, und nur zwei Leute hätten überhaupt Dienst geschoben. Eine halbe Stunde habe sie draußen im Wagen warten müssen, bis man endlich aufgeschlossen habe.
Ungefähr fünf Minuten brauchte sie, um ihm das zu erläutern. Währenddessen konnte Leaphorn darüber nachdenken, dass sie in Wirklichkeit hergefahren war, um an der heute beginnenden Versammlung des Tribal Council teilzunehmen; dass der Stammeszweig in Cañoncito schon seit 1868 mit der Stammesverwaltung unzufrieden war, seit der Rückkehr des Stamms aus der Internierung in Fort Stanton also; dass die Vertreterin des Stammesrats garantiert wusste, wie unfair ihre Erwartung war, in aller Frühe mehr als den Mann am Funkgerät und den Diensthabenden im Polizeibüro vorzufinden; dass sie ihm diese Beschwerden schon mindestens zweimal vorgetragen hatte; und dass sie ihr Auftauchen im Morgengrauen sicher nur betonte, um Leaphorn klarzumachen, dass Navajo in amtlicher Funktion wie alle guten Navajo im Morgengrauen schon auf den Beinen sein sollten, um die aufgehende Sonne mit Gebeten und einer Handvoll Pollenstaub zu preisen.
Endlich schwieg sie. Leaphorn wartete nach Navajo-Sitte auf ein Zeichen, ob sie fertig war oder nur eine Denkpause eingelegt hatte. Sie schüttelte seufzend den Kopf.
»Kein Navajo-Polizist, nicht einer«, sagte sie. »Im ganzen Cañoncito-Reservat nicht. Nur einer von der Laguna Police lässt sich manchmal blicken. Manchmal!« Wieder eine Pause. Leaphorn wartete.
»Dann sitzt er in dem Häuschen an der Straße und rührt keinen Finger. Wenn er überhaupt da ist.« Die Vertreterin des Stammesrats wusste genau, dass sie ihm das alles schon gesagt hatte. Darum machte sie sich nicht mehr die Mühe, ihm während ihres Lamentos in die Augen zu blicken, sondern studierte die Landkarte hinter ihm.
»Man ruft an, und niemand hebt ab. Man geht hin, und niemand ist da.« Sie löste den Blick von der Karte und sah Leaphorn an. Jetzt also war sie fertig.
»Euer Polizist in Cañoncito ist Officer des Bureau of Indian Affairs«, sagte Leaphorn. »Er ist Laguna, steht aber in Diensten des BIA. Er arbeitet nicht für die Laguna, sondern für euch.« Leaphorn setzte ihr auseinander, was er ihr schon zweimal erklärt hatte: dass der Rechtsausschuss im Tribal Council beschlossen hatte, keinen eigenen Navajo-Polizeiposten in Cañoncito einzurichten, sondern sich auf Amtshilfe durch das BIA zu stützen, weil ihr Stammeszweig in einem Reservat bei Albuquerque lebte, weit von der Big Reservation entfernt, und es dort unten nur zwölfhundert Navajo gab. Dass die Vertreterin des Stammesrats selbst zum Rechtsausschuss des Tribal Council gehörte, erwähnte Leaphorn so wenig wie sie. Sie hörte ihm geduldig zu, wie es die Höflichkeit der Navajo verlangte, aber ihre Augen wanderten dabei wieder über die Karte.
»Nur zwei Sorten von Nadeln«, stellte sie fest, als Leaphorn fertig war, »das ist alles, im ganzen Cañoncito-Gebiet.«
»Die stammen noch aus der Zeit, ehe der Tribal Council die Zuständigkeit an das Bureau of Indian Affairs abgegeben hat«, sagte Leaphorn und hoffte, ihm bliebe die nächste Frage erspart, die nach der Bedeutung der Nadeln. Es waren, soweit es um das Cañoncito-Gebiet ging, lauter Nadeln in Rottönen, mit denen Leaphorn Festnahmen markierte, bei denen Alkohol eine Rolle gespielt hatte, oder in Schwarz, nach seinem Code Beschwerden wegen Hexerei. Andere Vorkommnisse hatte es im Cañoncito-Gebiet praktisch nicht gegeben. Leaphorn glaubte nicht an Hexer oder Hexen, aber in der Big Reservation gab es Leute, die behaupteten, unten in Cañoncito seien alle Skinwalker.
»Und weil der Stammesrat nun mal so entschieden hat«, fügte Leaphorn hinzu, »kümmert sich das BIA um das Cañoncito-Gebiet.«
»Nein«, widersprach sie, »das tut das BIA eben nicht.«
Der ganze Vormittag war ähnlich verlaufen. Kaum hatte die Vertreterin des Stammesrats endlich das Büro verlassen, erschien ein schmächtiger, sommersprossiger Weißer, stellte sich als Eigentümer der Firma vor, die alles Vieh für das Navajo-Rodeo lieferte, und verlangte die Zusicherung, dass alle seine nicht eingerittenen Pferde, Rodeo-Bullen und zum Kälberfangen gedachten Rinder während der Nacht angemessen bewacht würden. Und schon steckte Leaphorn in jenem Wust administrativer Entscheidungen, Aktennotizen und amtlicher Vermerke, wie sie für das Rodeo typisch waren, eine Veranstaltung, die alle Polizisten in Window Rock fürchteten. Er musste einen Haufen Anordnungen treffen, um die Flut, die drei Tage lang über die Stadt hereinbrechen würde, einigermaßen zu lenken – eine Flut von weißen und indianischen Cowboys, alle gleichermaßen Machos, von Cowboy-Groupies, Betrunkenen, Dieben, Trickbetrügern, Texanern, Schwindlern, Fotografen und einfachen Touristen, und bevor er damit fertig war, läutete das Telefon.
Der Direktor der Internatsschule von Kinlichee berichtete, Emerson Tso habe wieder mit dem Schwarzbrennen begonnen. Tso verkaufte seinen Schnaps nicht nur den Schülern, die sich die Mühe machten, den kurzen Weg zu ihm zu kommen; er brachte ihnen das Zeug auch bereitwillig nachts in die Schlafsäle. Der Direktor verlangte, dass Tso für immer hinter Schloss und Riegel verschwinde. Leaphorn, der Whiskey so abgrundtief hasste wie Hexerei, versprach, sich Tso noch am selben Tag vorführen zu lassen. Er sagte es derart grimmig, dass der Direktor sich nur kurz bedankte und auflegte.
Und so fand Leaphorn erst kurz vor Mittag Zeit, über die drei ungeklärten Tötungsdelikte und die Frage eines Zusammenhangs nachzudenken. Aber vorher legte er den Hörer neben die Gabel. Er ging zum Fenster und schaute über das schmale Asphaltband der Navajo Route 27 hinweg auf die verstreuten Backsteingebäude, in denen die Verwaltung seines Stamms untergebracht war, auf die hinter dem Ort aufragenden Sandsteinfelsen und auf die dunklen Gewitterwolken, die sich am Augusthimmel zu ballen begannen, in diesem trockenen Sommer aber vermutlich nicht hoch genug steigen würden, um ihnen den ersehnten Regen zu bescheren. Auf diese Weise bekam er die Vertreterin des Stammesrats, das Rodeo und die Schwarzbrennerei aus dem Kopf. Dann setzte er sich wieder, schwang den Stuhl herum und studierte die Karte.
Alle bei der Navajo-Police kannten Leaphorns Karte als Ausdruck seiner Verschrobenheit. Sie prangte auf einer Korkplatte hinter seinem Schreibtisch. Es war die Indian-Country-Karte des Auto Club of Southern California, die wegen ihrer Detailtreue und ihres großen Maßstabs allgemein beliebt war. Das Besondere an Leaphorns Karte war die Art, wie er sie benutzte.
Sie war mit Hunderten bunter Nadeln gespickt, wobei jede Farbe für ein bestimmtes Verbrechen stand. Und es gab Hunderte handschriftlicher Vermerke, alle von Leaphorn, in Kürzeln, die Außenstehenden rätselhaft bleiben mussten. Für ihn aber bedeutete jedes Kürzel ein Stück von dem Wissen, das er während seines Lebens im Reservat und während der vielen Jahre im Polizeidienst zusammengetragen hatte. Das winzige t zum Beispiel, westlich von Three Turkey Ruins, markierte Treibsand im Tse Des Zygee Wash. Das e neben der Straße nach Ojleto an der Grenze zu Utah (und neben Dutzenden anderer kleiner Straßen) kennzeichnete Stellen, an denen man mit Erdrutschen als Folge von Unwettern rechnen musste. Das häufige r neben den Initialen von Familien bezeichnete Berghänge, an denen während des Sommers die Camps für die Schafherden zu finden waren. Unzählige solcher Merkzeichen waren über die Karte verstreut. H stand für Orte, an denen man Fälle von Hexerei gemeldet hatte, und S war das Zeichen für Schwarzbrennerei.
Die handschriftlichen Vermerke blieben an Ort und Stelle, die Nadeln dagegen wanderten mit den Gezeiten menschlichen Fehlverhaltens. Blau zeigte an, wo Vieh gestohlen worden war; sobald der Dieb auf einer abgelegenen Straße mit einer Ladung Färsen erwischt worden war, verschwand die blaue Nadel indes wieder von Leaphorns Karte. Wie grelle Leuchtpünktchen nahmen sich die roten und pinken Nadeln aus, mit denen Leaphorn Straftaten im Zusammenhang mit Alkohol markierte. Zog er einige von ihnen heraus, war zugleich das Schicksal eines Schwarzbrenners besiegelt. Rot in allen Schattierungen leuchtete rund um die Ortschaften am Rand des Reservats und entlang der Einfallstraßen. Oft steckte neben dem Rot eine Nadel für Vergewaltigung, Körperverletzung, häusliche Gewalt oder andere rabiate, aber weniger verheerende Kontrollverluste. Zu den Verbrechen, die eher im Leben der Weißen eine Rolle spielten, zu Einbrüchen, Vandalismus und Banküberfällen, kam es nur selten und meist, wie Leaphorns Nadeln auswiesen, an den Rändern des Reservats. Aber im Augenblick interessierten ihn nur die Nadeln mit braunem Kopf und weißem Punkt, die die drei ungeklärten Tötungsdelikte markierten.
Solche Verbrechen waren im Reservat nicht üblich. Wenn jemand gewaltsam zu Tode kam, dann meist durch einen Unfall: Betrunkene liefen frontal in ein Auto, schlugen sich in der Kneipe den Schädel ein oder gingen im Alkoholrausch zu Hause auf Familienmitglieder los. Es handelte sich da weniger um vorsätzliche Gewalt, eher um Kurzschlusshandlungen. Braune Nadeln mit einem weißen Kopf verschwanden meist nach ein, zwei Tagen wieder von Leaphorns Karte.
Aber die drei Nadeln, um die es hier ging, steckten seit Wochen und hatten sich nicht nur in die Korkplatte gebohrt, sondern auch in Leaphorns Denken. Eine der Nadeln steckte schon fast zwei Monate.
Irma Onesalt war der Name des Opfers. Leaphorn hatte ihre Nadel vor vierundfünfzig Tagen neben die Straße zwischen Upper Greasewood und Lukachukai gesteckt. Ein Geschoss vom Kaliber 30-06. Waffen dieses Kalibers hingen bei jedem dritten Pick-up im Reservat in der Halterung vor der Heckscheibe. Anscheinend hatte praktisch jeder eine 30-06, wenn er nicht eine 30-30 bevorzugte. Manche hatten auch von beiden Kalibern eine. Irma Onesalt, mütterlicherseits aus dem Bitter Water Clan, väterlicherseits von den Towering House People, Tochter von Alice und Homer Onesalt, einunddreißig Jahre alt, ledig, Angestellte im Navajo Office of Social Services, wurde tot auf dem Fahrersitz ihres Wagens gefunden, einem zweitürigen Datsun, der sich überschlagen hatte und auf dem Dach liegen geblieben war. Der Schuss war durch das Seitenfenster gedrungen, hatte Kinn und Kehle durchbohrt und war auf der Beifahrerseite im Türrahmen stecken geblieben. Es gab auch eine Zeugin, allerdings wusste sie nicht viel und konnte nur vage Aussagen machen, eine Schülerin aus dem Toadlena-Internat, die auf dem Heimweg zu ihren Eltern gewesen war. Sie hatte einen Mann gesehen, einen alten Mann, sagte sie, der mit einem Pick-up etwa dort geparkt hatte, wo der Schütze sich aufgehalten haben musste. Demzufolge hätte Irma Onesalt nach dem tödlichen Schuss die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Leaphorn, der die Tote gesehen hatte, hielt das für eine naheliegende Schlussfolgerung.
Die zweite Nadel, zwei Wochen später, stand für Dugai Endocheeney. Seine Mutter hatte zum Mud People, sein Vater zum Streams Come Together Clan gehört. Er war fünfundsiebzig oder siebenundsiebzig Jahre alt, je nachdem, wem man traute. Er war im Schafspferch hinter seinem Hogan am Nokaito Bench erstochen worden, nicht weit von dort, wo der Chinle Creek in den San Juan River mündet. Das Schlachtermesser hatte noch in der Leiche gesteckt. Dilly Streib, der für den Fall zuständige FBI-Agent, hatte gemeint, es gebe einen klaren Zusammenhang zwischen beiden Fällen. »Onesalt hatte keine Freunde und Endocheeney keine Feinde. Also ist jemand dabei, das Ganze von beiden Enden aufzurollen, und nimmt sich die Guten wie die Schlechten vor, bis nur die Mitte übrig ist.«
»Wir Durchschnittsmenschen«, hatte Leaphorn gesagt.
Streib hatte gelacht. »Kann nicht lange dauern, bis er hinter Ihnen her ist – wenn er mit denen aufräumt, die unausstehlich sind.«
Delbert L. Streib war kein typischer FBI-Mann. Leaphorn, der an einem Kurs der FBI Academy teilgenommen und sein halbes Leben den Laufburschen für die Bundespolizei gespielt hatte, hielt ihn für schlauer als die meisten. Ein Mann von rascher, zupackender Intelligenz, was ihn in den Jahren von J. Edgar Hoover gehörig in Misskredit gebracht und zu seiner Versetzung ins Indianergebiet geführt hatte. Aber bei aller Intelligenz: Die Tötungsdelikte an Onesalt und Endocheeney, die ja in seine Zuständigkeit fielen, stellten ihn genauso vor ein Rätsel wie Leaphorn.
Nach einem Blick auf die Karte hatte er gemeint, was Leaphorn als »Nadel zwei« bezeichne, sei eigentlich die dritte Nadel. Und vielleicht hatte er recht. Leaphorn hatte »Nadel drei« zum Fall Wilson Sam gesteckt, der mütterlicherseits zum One Walks Around Clan, väterlicherseits zum Turning Mountain People gehörte, ein Schafhirte von siebenundfünfzig Jahren, der gelegentlich Jobs bei Straßenarbeiten am Arizona Highway annahm. Ein Schaufelblatt hatte ihn im Genick getroffen, so heftig, dass der Tod auf der Stelle eingetreten sein musste. Doch hinsichtlich des Todeszeitpunkts tappte man im Dunkeln. Sams Neffe hatte seinen Hütehund gefunden, der sich am Klippenrand über dem Chilchinbito Canyon heiser geheult hatte und zu Tode erschöpft war vor Durst. Wilson Sams Leiche hatte man unten in der Schlucht entdeckt, offensichtlich hatte der Täter sie zu den Klippen geschleift und hinuntergestoßen. Laut Autopsie war die Tatzeit etwa die gleiche wie bei Endocheeney. Wer zuerst gestorben war, ließ sich also nur vermuten. Wieder gab es keine Zeugen, keine Anhaltspunkte, kein offenkundiges Motiv. Es gab eigentlich überhaupt nichts, abgesehen von der Annahme des Coroners hinsichtlich der Tatzeit, da es schwer vorstellbar war, dass ein und derselbe Mann zur gleichen Zeit Endocheeney und Sam getötet hatte.
»Es sei denn, er war ein Skinwalker«, hatte Streib düster gemurmelt. »Vielleicht habt ihr Indianer ja recht, und Skinwalker können wirklich fliegen, schneller als Pick-ups mit Turboantrieb.«
Streibs Frotzeleien störten Leaphorn nicht, Witze über Hexerei dagegen schon. Deshalb hatte er nicht gelacht.
Wenn er jetzt daran dachte, konnte er immer noch nicht lachen. Er seufzte, kratzte sich am Ohr und setzte sich anders hin. Auf die Karte zu starren, hatte ihn auch heute nicht weiter gebracht als in all den Wochen zuvor. Die erste Nadel gehörte sozusagen nach Window Rock, die beiden anderen führten in die Wildnis.
Das erste Opfer war eine jüngere Frau aus der Verwaltung, ziemlich gebildet, Distanzschuss. Die beiden anderen waren traditionsverhaftete Männer, die sich um ihre Herden kümmerten, wahrscheinlich kaum Englisch konnten und aus nächster Nähe getötet worden waren. Hatte Leaphorn es mit zwei getrennten Fällen zu tun? Manches sprach dafür. Im Window-Rock-Fall ging es um Vorsatz, so selten er auch im Reservat vorkommen mochte. Natürlich konnte das auch in der Wildnis der Fall gewesen sein, aber es sah nicht danach aus. Wer einen Mord plant, greift nicht zur Schaufel. Und auch das Schlachtermesser war nicht gerade eine typische Mordwaffe für einen Navajo.