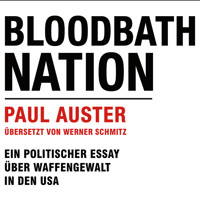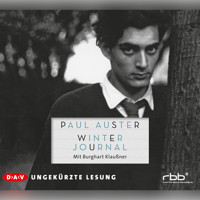9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
«Sunset Park» beschreibt die Hoffnungen und Sorgen einer unvergesslichen Schar von Menschen, die in den dunkelsten Zeiten der jüngsten amerikanischen Wirtschaftskrise zusammenkommen: ein rätselhafter junger Mann, der wie besessen Trümmer fotografiert; eine kühle Cineastin mit Hang zum Androgynen; ein politischer Aktivist, der in seiner Klinik für kaputte Dinge Artefakte einer verschwundenen Welt repariert; eine Malerin erotischer Themen; eine einst gefeierte Schauspielerin, die sich auf ihr Comeback am Broadway vorbereitet; ein Kleinverleger, der versucht, seinen Verlag und seine Ehe zu retten. Die dramatischen Ereignisse, die das Schicksal von Austers Helden verbinden, kulminieren in einem besetzten Haus im heruntergekommenen Stadtteil Sunset Park, Brooklyn, und sie zeichnen ein bewegendes Bild des heutigen Amerika und seiner inneren Dämonen. Dieser Roman ist eine emotionale und politische Tour de Force – am Puls der Zeit und dunkel glänzend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Ähnliche
Paul Auster
Sunset Park
Roman
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
MILES HELLER
1
Seit fast einem Jahr macht er Fotos von aufgegebenen Dingen. Täglich kommen mindestens zwei Aufträge, manchmal sechs oder sieben, und jedes Mal, wenn er und seine Leute ein Haus betreten, stehen sie wieder vor den Dingen, den unzähligen ausrangierten Dingen, die von den Familien beim Auszug zurückgelassen wurden. Die Abwesenden sind alle in Eile geflohen, verschämt und kopflos, und es steht fest, dass, wo immer sie jetzt leben (falls sie ein Haus zum Leben gefunden haben und nicht im Freien kampieren müssen), ihre neuen Behausungen kleiner sind als die, die sie verloren haben. Jedes Haus eine Geschichte des Scheiterns– Bankrott und Zahlungsverzug, Schulden und Zwangsvollstreckung–, und er nimmt es auf sich, die verbliebenen Reste dieser versprengten Leben zu dokumentieren, zum Beweis dafür, dass die verschwundenen Familien einst hier gelebt haben, dass die Geister von Leuten, die er niemals sehen und niemals kennenlernen wird, in den weggeworfenen und überall in ihren leeren Häusern herumliegenden Dingen noch gegenwärtig sind.
Die Arbeit nennt sich Entrümpeln, und er gehört zu einem Vier-Mann-Trupp der Immobiliengesellschaft Dunbar, die den Banken, denen die bewussten Liegenschaften jetzt gehören, ihre «Hauspflege»-Dienste anbieten. Die weiten Ebenen Südfloridas sind übersät mit diesen verwaisten Bauten, und da es im Interesse der Banken liegt, sie so schnell wie möglich wieder zu verkaufen, müssen die verlassenen Häuser gereinigt, renoviert und so hergerichtet werden, dass sie potenziellen Käufern gezeigt werden können. In einer zusammenbrechenden Welt, in der wirtschaftlicher Ruin und privates Elend erbarmungslos um sich greifen, ist die Entrümpelungsbranche eine der wenigen, die in dieser Gegend noch florieren. Zweifellos ist es ein Glück für ihn, dass er diesen Job gefunden hat. Er weiß nicht, wie lange er das noch ertragen kann, aber die Bezahlung ist anständig, und in einem Land, das immer weniger Arbeit anzubieten hat, ist das ein ausgesprochen guter Job.
Am Anfang entsetzten ihn die Unordnung, der Schmutz, die Verwahrlosung. Selten kommt er in ein Haus, das von den früheren Besitzern in einwandfreiem Zustand zurückgelassen wurde. Häufiger wird es einen Ausbruch von Gewalt und Raserei gegeben haben, eine Abschiedsorgie unmäßiger Zerstörungswut – die Wasserhähne voll aufgedreht, Waschbecken und Badewannen übergelaufen, die Wände mit Vorschlaghämmern bearbeitet und eingestürzt, mit obszönen Graffiti beschmiert oder von Kugeln zersiebt, zu schweigen von herausgerissenen Kupferrohren, verdreckten Teppichen und Kothaufen mitten im Wohnzimmer. Das mögen Extremfälle sein, spontane Aktionen, ausgelöst vom Zorn der Enteigneten, ein widerwärtiger, aber verständlicher Ausdruck von Verzweiflung, aber auch wenn ihn dann nicht in jedem Haus der Ekel packt, graust es ihn vor jeder Tür, die er zu öffnen hat. Als Erstes gilt es immer, mit dem Gestank fertigzuwerden, mit der Attacke verpesteter Luft auf seine Geruchsnerven, mit den allgegenwärtigen, komplexen Gerüchen von Schimmel, ranziger Milch, Katzenstreu, zugeschissenen Toiletten und verwesenden Essensresten auf dem Küchentisch. Nicht einmal durch offene Fenster einströmende frische Luft kann diese Gerüche vertreiben; nicht einmal die penibelste, umsichtigste Reinigungsaktion kann den Gestank der Niederlage beseitigen.
Und dann sind da immer die Gegenstände, die vergessenen Habseligkeiten, die aufgegebenen Dinge. Inzwischen gehen seine Fotos in die Tausende, in seinem wuchernden Archiv finden sich Bilder von Büchern, Schuhen und Ölgemälden, Klavieren und Toastern, Puppen, Teegeschirr und schmutzigen Socken, Fernsehern und Brettspielen, Partykleidern und Tennisschlägern, Sofas, Seidendessous, Fugenspritzen, Reißzwecken, Plastikmonstern, Lippenstiften, Gewehren, ausgebleichten Matratzen, Messern und Gabeln, Pokerchips, einer Briefmarkensammlung und einem toten Kanarienvogel am Boden seines Käfigs. Er hat keine Ahnung, was ihn dazu treibt, diese Bilder zu machen. Er sieht durchaus das Nichtige dieses Tuns, von dem kein Mensch etwas haben kann, und doch spürt er jedes Mal, wenn er ein Haus betritt, wie die Dinge nach ihm rufen, ihn mit den Stimmen der Leute, die dort nicht mehr wohnen, ansprechen und ihn bitten, sie noch ein letztes Mal anzusehen, bevor sie weggekarrt werden. Die anderen im Team machen sich über seine obsessive Knipserei lustig, aber das kümmert ihn nicht. Er verachtet diese Männer samt und sonders, sie zählen für ihn nicht. Der hirntote Victor, Boss des Teams; der stotternde Schwätzer Paco; und der keuchende Fettsack Freddy – die drei Musketiere des Verderbens. Laut Vorschrift sind alle brauchbaren Gegenstände ab einem bestimmten Verkaufswert bei der Bank abzuliefern, die wiederum verpflichtet ist, sie den Eigentümern zurückzugeben, aber seine Kollegen reißen sich hemmungslos alles unter den Nagel, was sie kriegen können. Für sie ist er ein Trottel, weil diese Beutestücke ihn nicht interessieren – die Whiskeyflaschen, Radios und CD-Player, die Bogenschieß-Ausrüstung, die Sexmagazine–, er will nichts anderes als seine Fotos – nicht Dinge, sondern Bilder von Dingen. Seit einiger Zeit hält er sich an seinen Vorsatz, während der Arbeit so wenig wie möglich zu sprechen. Paco und Freddy nennen ihn nur noch El Mudo.
Er ist achtundzwanzig Jahre alt, und nach bestem Wissen treibt ihn keinerlei Ehrgeiz. Jedenfalls kein glühender Ehrgeiz, keine klare Vorstellung davon, wohin es mit ihm in Zukunft gehen könnte. Er weiß, lange wird er nicht mehr in Florida bleiben, bald wird er das Bedürfnis haben, wieder weiterzuziehen, doch bis aus diesem Bedürfnis die Notwendigkeit zum Handeln erwächst, gibt er sich damit zufrieden, in der Gegenwart zu verweilen und nicht nach vorn zu schauen. Vor siebeneinhalb Jahren hat er das College verlassen, um seiner eigenen Wege zu gehen, und wenn er in dieser Zeit eins gelernt hat, dann dies: in der Gegenwart zu leben, sich auf das Hier und Jetzt zu beschränken. Und mag dies auch nicht die löblichste Fähigkeit sein, die man sich denken kann, so hat es ihm doch beträchtliche Disziplin und Selbstbeherrschung abverlangt, sie zu erwerben. Keine Pläne haben, soll heißen, nichts ersehnen und nichts erhoffen, mit seinem Los zufrieden sein, hinnehmen, was die Welt einem von einem Sonnenaufgang zum nächsten zuteilt – wer so leben will, darf nur sehr wenig begehren, so wenig wie menschenmöglich.
Nach und nach hat er seine Bedürfnisse auf ein absolutes Minimum reduziert. Er hat das Rauchen und Trinken aufgegeben, er speist nicht mehr in Restaurants, er besitzt weder Fernseher noch Radio noch Computer. Gern würde er sein Auto gegen ein Fahrrad eintauschen, aber auf den Wagen kann er nicht verzichten, dafür sind die Strecken, die er zur Arbeit zurücklegen muss, viel zu groß. Ähnliches gilt für das Handy in seiner Tasche, das er mit Vergnügen auf den Müll werfen würde, wenn nicht auch dies für seine Arbeit unerlässlich wäre. Die Digitalkamera mochte eine Schwäche sein, doch in Anbetracht der Eintönigkeit und Plackerei des endlosen Entrümpelungstrotts kommt ihm der Apparat wie sein Lebensretter vor. Miete zahlt er nur wenig, da seine kleine Wohnung in einer armen Gegend liegt, und abgesehen von seinen Ausgaben für die dringendsten Grundbedürfnisse leistet er sich nur einen einzigen Luxus: Er kauft Bücher, Taschenbücher, hauptsächlich Romane, amerikanische Romane, britische Romane, fremdsprachige Romane in Übersetzungen, doch am Ende sind Bücher kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit, und Lesen ist eine Sucht, von der er keinesfalls geheilt werden möchte.
Wäre das Mädchen nicht, würde er wahrscheinlich noch vor Ende des Monats aussteigen. Er hat genug Geld gespart, um hinzugehen, wo er will, und mehr als gedeckt ist sein Bedarf an der Sonne Floridas – die, wie er nach vielen Beobachtungen inzwischen glaubt, der Seele mehr schadet als Gutes tut. Für ihn ist das eine machiavellistische Sonne, eine heuchlerische Sonne, und das von ihr erzeugte Licht beleuchtet die Dinge nicht, sondern verdunkelt sie – es blendet mit seinem unaufhörlichen, allzu hellen Glanz, schlägt mit dampfenden Kissen aus feuchter Luft auf einen ein, bringt einen mit seinen Fata Morganas und wabernden Wogen aus Nichts aus dem Gleichgewicht. Nur Glitzern und Gleißen, bietet es keine Substanz, keine Ruhe, keine Atempause. Und doch sah er unter dieser Sonne das Mädchen zum ersten Mal, und da er sich nicht dazu überreden kann, es aufzugeben, lebt er weiter mit der Sonne und versucht, seinen Frieden mit ihr zu machen.
Sie heißt Pilar Sanchez, und kennengelernt hat er sie rein zufällig eines Samstagnachmittags Mitte Mai vor sechs Monaten in einem Park, die unwahrscheinlichste aller unwahrscheinlichen Begegnungen. Sie saß auf dem Rasen und las ein Buch, und keine drei Meter von ihr saß auch er auf dem Rasen und las ein Buch, das zufällig das gleiche war wie ihres, das gleiche Buch in derselben Taschenbuchausgabe, Der große Gatsby, das er gerade zum dritten Mal las, seit sein Vater es ihm zum sechzehnten Geburtstag geschenkt hatte. Er hatte schon zwanzig, dreißig Minuten dort gesessen, vertieft in das Buch, abgeschottet von seiner Umgebung, als er jemanden lachen hörte. Er drehte sich um, und in diesem fatalen Augenblick, da er sie zum ersten Mal sah, wie sie ihn anlächelte und auf den Titel ihres Buchs zeigte, schien sie ihm gar noch jünger als sechzehn zu sein, noch ein richtiges Mädchen, ein kleines Mädchen, eine junge Heranwachsende in engen, abgeschnittenen Shorts, Sandalen und einem winzigen schulterfreien Top, jener Kleidung, wie sie von allen halbwegs attraktiven Mädchen im heißen sonnigen Süden Floridas getragen wurde. Eigentlich noch ein Baby, sagte er sich, und doch, da war sie mit ihren glatten, unbedeckten Gliedmaßen und ihrem munteren Lächeln, und er, der selten irgendjemanden oder irgendetwas anlächelt, schaute in ihre dunklen lebhaften Augen und lächelte zurück.
Sechs Monate später ist sie immer noch minderjährig. Laut ihrem Führerschein ist sie siebzehn und wird achtzehn erst im Mai, und daher muss er in der Öffentlichkeit vorsichtig mit ihr sein und um jeden Preis alles vermeiden, was den Argwohn der lüsternen Mitwelt erregen könnte, denn ein einziger Anruf irgendeines aufgebrachten Wichtigtuers bei der Polizei könnte ihn ins Gefängnis bringen. Jeden Morgen, außer an Wochenenden und Feiertagen, fährt er sie zur John F.Kennedy Highschool; sie ist im letzten Schuljahr und hofft, dank guter Leistungen anschließend aufs College gehen zu können, um später als Krankenschwester zu arbeiten. Er fährt sie hin, setzt sie aber nicht vor dem Eingang ab. Das wäre zu riskant. Irgendein Lehrer oder sonst jemand von der Schule könnte die beiden zusammen im Auto erblicken und Alarm schlagen, und so hält er drei oder vier Blocks vor der Schule an und lässt sie dort aussteigen. Zum Abschied gibt er ihr keinen Kuss. Er rührt sie nicht an. Seine Zurückhaltung betrübt sie, denn in ihren eigenen Augen ist sie bereits eine ausgewachsene Frau, und sie akzeptiert seine vorgetäuschte Gleichgültigkeit nur, weil er ihr gesagt hat, die müsse sie akzeptieren.
Pilars Eltern kamen vor zwei Jahren bei einem Autounfall ums Leben, und bis sie nach dem Ende des Schuljahrs im Juni in seine Wohnung zog, lebte sie bei ihren drei Schwestern im Haus der Familie. Maria, zwanzig Jahre alt, Teresa, dreiundzwanzig, und Angela, fünfundzwanzig. Maria bereitet sich an der Volkshochschule auf ihren Beruf als Kosmetikerin vor. Teresa arbeitet als Kassiererin in einer Bank. Angela, die hübscheste der Schwesternschar, ist Tischdame in einer Cocktailbar. Mit manchen Gästen schläft sie für Geld, behauptet Pilar, fügt jedoch gleich hinzu, sie habe Angela sehr gern, sie habe alle ihre Schwestern sehr gern, sei aber trotzdem froh, dass sie bei ihnen ausgezogen sei, das Haus berge ihr zu viele Erinnerungen an Mutter und Vater, und außerdem, sie könne auch nichts dafür, aber sie nehme Angela übel, was sie tue, es sei doch eine Sünde, wenn eine Frau ihren Körper verkaufe, und dass sie sich deswegen nicht mehr mit ihr zu streiten brauche, empfinde sie als Erleichterung. Ja, sagt sie zu ihm, seine Wohnung sei ein schäbiges kleines Loch, das Haus viel größer und komfortabler, aber in der Wohnung gebe es immerhin keinen achtzehn Monate alten Carlos junior, und auch dies empfinde sie als ungeheure Erleichterung. Zwar sei Teresas Sohn kein schlechtes Kind, soweit man so etwas von Kindern überhaupt sagen könne, und was solle Teresa auch machen, wo ihr Mann im Irak stationiert sei und sie selbst den ganzen Tag in der Bank arbeiten müsse, aber das gebe ihr noch lange nicht das Recht, die Aufsicht über den Jungen alle zwei Tage ihrer kleinen Schwester aufzuhalsen. Pilar wolle ja kein Spielverderber sein, aber das nehme sie ihr einfach übel. Sie brauche Zeit für sich allein und zum Lernen, sie wolle etwas aus sich machen, und wie solle ihr das gelingen, wenn sie andauernd Windeln wechseln müsse? Andere Leute mochten sich an Babys erfreuen, sie aber wolle damit nichts zu tun haben. Danke, sagt sie, vielen Dank.
Er bewundert ihr Temperament, ihre Intelligenz. Schon am ersten Tag, als sie im Park über den Großen Gatsby sprachen, imponierte ihm, dass sie das Buch für sich selbst las und nicht, weil ein Lehrer in der Schule ihr das aufgegeben hatte, und noch mehr imponierte es ihm, als sie im weiteren Verlauf der Unterhaltung den Standpunkt vertrat, die wichtigste Figur in dem Buch sei nicht Daisy oder Tom oder gar Gatsby selbst, sondern Nick Carraway. Er bat sie, das zu erklären. Weil er derjenige sei, der die Geschichte erzähle, sagte sie. Er sei der Einzige, der mit beiden Füßen auf dem Boden stehe, der Einzige, der sich selbst von außen betrachten könne. Alle anderen seien Verlorene, seichte Gestalten, und ohne Nicks Anteilnahme und Verständnis würden wir nichts für sie empfinden können. Alles hänge von Nick ab. Das Buch würde nicht halb so gut funktionieren, wenn es von einem allwissenden Erzähler erzählt würde.
Allwissender Erzähler. Sie weiß, was der Ausdruck bedeutet, so wie ihr klar ist, was es heißt, von der Aussetzung der Ungläubigkeit, Biogenese, Antilogarithmen oder Brown v. Board of Education und dem Ende der Rassentrennung zu reden. Wie ist es möglich, fragt er sich, dass eine junge Frau wie Pilar Sanchez, deren kubanischer Vater sein Leben lang als Briefträger gearbeitet hat, deren drei ältere Schwestern es zufrieden sind, ihr Leben im eintönigen Sumpf alltäglicher Verrichtungen zu verbringen, sich so ganz anders als der Rest ihrer Familie entwickelt hat? Pilar hungert nach Wissen, sie hat Pläne, sie arbeitet fleißig, und ihm liegt alles daran, sie zu ermutigen, ihr auf dem Weg ihrer Ausbildung zu helfen. Seit dem Tag, da sie von zu Hause aus- und bei ihm einzog, hat er mit ihr für die Aufnahmeprüfung fürs College gepaukt, hat alle ihre Hausaufgaben durchgearbeitet, hat ihr die Grundlagen der Infinitesimalrechnung beigebracht (die auf der Highschool kein Thema sind) und ihr Dutzende von Romanen, Kurzgeschichten und Gedichten vorgelesen. Er, der junge Mann ohne Ziele, der College-Aussteiger, der den Plunder der Privilegien seines früheren Lebens abgeworfen hatte, fühlt sich dazu berufen, in ihrem Namen ehrgeizig zu werden und sie so weit nach vorn zu treiben, wie sie mitzugehen bereit ist. Oberste Priorität hat das College, ein gutes College und ein ausreichendes Stipendium, und hat sie das erst einmal geschafft, wird alles andere sich schon ergeben, denkt er. Zurzeit träumt sie davon, Krankenschwester zu werden, aber das wird sich noch ändern, dessen ist er sich gewiss, ja, er weiß, sie hat das Zeug dazu, eines Tages Medizin zu studieren und Ärztin zu werden.
Der Vorschlag, bei ihm einzuziehen, kam von ihr. Ihm selbst wäre es nie in den Sinn gekommen, etwas derart Kühnes aufs Tapet zu bringen, doch Pilar war entschlossen, nicht nur getrieben von dem Wunsch, ihrer Umgebung zu entfliehen, sondern auch begeistert von der Aussicht, jede Nacht mit ihm schlafen zu können, und nachdem sie ihn gebeten hatte, mit Angela zu reden, die als Haupternährerin des Clans in allen Familienangelegenheiten das letzte Wort hatte, traf er sich mit der ältesten Sanchez-Schwester und schaffte es tatsächlich, ihre Zustimmung zu erhalten. Anfangs war sie zögerlich und argumentierte, Pilar sei zu jung und unerfahren für einen Schritt von solcher Tragweite. Natürlich wisse sie, dass ihre Schwester ihn liebe, aber sie könne diese Liebe nicht gutheißen, der Altersunterschied sei zu groß, früher oder später werde er von seinem halbwüchsigen Spielzeug genug haben, sich gelangweilt von Pilar abwenden und ihr das Herz brechen. Er entgegnete, wahrscheinlich werde es genau umgekehrt ausgehen, er werde es sein, der mit gebrochenem Herzen zurückbleiben würde. Dann schob er jede weitere Diskussion über Herzen und Gefühle beiseite und verlegte sich auf rein praktische Erwägungen. Pilar habe keine Arbeit, sagte er, sie liege ihren Schwestern auf der Tasche, und er sei in der Lage, sie zu ernähren und ihnen diese Last abzunehmen. Schließlich wolle er sie ja nicht nach China entführen. Ihr Haus sei fünfzehn Minuten zu Fuß von seiner Wohnung entfernt, und sie könnten sie so oft besuchen, wie sie wollten. Um den Handel abzuschließen, bot er ihnen Geschenke an, alle möglichen Sachen, die sie gerne gehabt hätten, sich aber aus Geldmangel nicht leisten konnten. Zur Bestürzung und feixenden Belustigung der drei Clowns, mit denen er zusammenarbeitete, stellte er vorübergehend die von ihm selbst propagierten Anstandsregeln der Entrümpelei auf den Kopf und klaute im Lauf der nächsten Woche seelenruhig einen fast noch fabrikneuen Flachbildfernseher, eine hochwertige Kaffeemaschine, ein rotes Dreirad, sechsunddreißig Filme (darunter eine Sammleredition der Pate-Trilogie), einen Schminkspiegel in Profiqualität und ein Set Weingläser aus Kristall, die er Angela und ihren Schwestern als Ausdruck seiner Dankbarkeit überreichte. Mit anderen Worten: Pilar wohnt jetzt bei ihm, weil er die Familie bestochen hat. Er hat sie gekauft.
Ja, sie liebt ihn, und, ja, trotz seiner Bedenken und inneren Zweifel liebt er sie ebenfalls, so unwahrscheinlich es ihm vorkommen mag. Um das hier festzuhalten: Er ist nicht speziell auf junge Mädchen fixiert. Bis jetzt waren alle Frauen in seinem Leben mehr oder weniger in seinem Alter. Pilar stellt für ihn demnach nicht die Verkörperung eines idealen Frauentyps dar – sie ist nichts anderes als sie selbst, ein kleines Glück, auf das er zufällig eines Nachmittags im Park gestoßen ist, eine Ausnahme von sämtlichen Regeln. Auch kann er sich selbst nicht erklären, was sie für ihn so attraktiv macht. Gewiss, er bewundert ihre Intelligenz, aber was hat das letztlich schon zu bedeuten, denn er hat auch schon früher Frauen für ihre Intelligenz bewundert, ohne sich im Geringsten zu ihnen hingezogen zu fühlen. Er findet sie hübsch, aber nicht außerordentlich hübsch, nicht schön in irgendeiner objektiven Hinsicht (freilich könnte man ebenso gut sagen, jede Siebzehnjährige ist schön, aus dem schlichten Grund, dass alles Junge schön ist). Aber egal. Er hat sich nicht wegen ihres Körpers oder ihrer Klugheit in sie verknallt. Nur, was ist es dann? Was hält ihn hier, wenn alles ihm sagt, er sollte gehen? Vielleicht ist es die Art, wie sie ihn ansieht, die Wildheit ihres Blicks, das verzückte Strahlen ihrer Augen, wenn sie ihm zuhört, das Gefühl, dass sie vollständig anwesend ist, wenn sie zusammen sind, dass er der einzige Mensch ist, der auf der ganzen weiten Welt für sie existiert.
Manchmal, wenn er seine Kamera auspackt und ihr seine Aufnahmen von den aufgegebenen Dingen zeigt, füllen ihre Augen sich mit Tränen. Diese ihre weiche, sentimentale Seite hat für ihn etwas Komisches, und doch bewegt sie ihn, diese Empfänglichkeit für den Schmerz anderer, aber da sie auch sehr hart sein kann, gesprächig und überschäumend lustig, vermag er nie vorauszusagen, welche ihrer Seiten in irgendeinem Augenblick zum Vorschein kommen wird. Das könnte auf kurze Sicht anstrengend sein, doch auf Dauer, so meint er, kann es sich nur positiv auswirken. Er, der sich so viele Jahre lang so vieles versagt hat, der so hartnäckig Verzicht geleistet hat, der sich dazu erzogen hat, sein Temperament zu zügeln und sich von allem kühl distanziert durch die Welt treiben zu lassen, ist nach und nach ins Leben zurückgekehrt – dank ihrer Gefühlsexzesse, ihrer Entflammbarkeit, ihrer rührseligen Tränen, wenn er ihr Bilder von verlassenen Teddybären, kaputten Fahrrädern oder Vasen mit verwelkten Blumen zeigt.
Als sie das erste Mal miteinander ins Bett gingen, versicherte sie ihm, sie sei längst keine Jungfrau mehr. Er nahm sie beim Wort, doch als es dann so weit war und er in sie eindringen wollte, stieß sie ihn fort und sagte, das dürfe er nicht tun. Das Mamaloch sei tabu, sagte sie, absolutes Sperrgebiet für männliche Glieder. Zungen und Finger seien zugelassen, nicht aber Glieder, unter keiner Bedingung, ausgeschlossen, niemals. Er kapierte gar nicht, wovon sie redete. Er hatte doch ein Kondom übergestreift? Sie waren geschützt, es gab keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Ja, sagte sie, und genau da sei er im Irrtum. Teresa und ihr Mann hätten sich auch immer auf Kondome verlassen, und er solle sich ansehen, was daraus geworden sei. Nichts Erschreckenderes für Pilar als die Vorstellung, schwanger zu werden, niemals werde sie das Schicksal herausfordern und diesen unberechenbaren Gummis trauen. Eher würde sie sich die Pulsadern aufschneiden oder von einer Brücke springen, als sich schwängern zu lassen. Ob er das verstehe? Ja, er verstand das, aber was war die Alternative? Das lustige Loch, sagte sie. Angela habe ihr davon erzählt, und er müsse zugeben, vom streng biologischen und medizinischen Standpunkt aus sei dies die einzige wirklich sichere Form der Geburtenkontrolle.
Seit sechs Monaten fügt er sich nun ihren Wünschen, beschränkt jegliche Aktivität seines Glieds auf ihr lustiges Loch und sucht ihr Mamaloch allenfalls mit Zunge oder Fingern auf. So sehen sie also aus, die Abnormitäten und Besonderheiten ihres Liebeslebens, das dennoch ein erfülltes Liebesleben ist, eine wunderbare erotische Partnerschaft, und nichts weist darauf hin, dass es so bald damit zu Ende gehen könnte. Letztlich ist es diese sexuelle Komplizenschaft, die ihn so fest an sie bindet und ihn nicht aus dem heißen Niemandsland voller zerstörter und leerer Häuser fortziehen lässt. Er ist verzaubert von ihrer Haut. Er ist ein Gefangener ihrer feurigen jungen Lippen. Er ist zu Hause in ihrem Körper, und sollte er je den Mut aufbringen und sie verlassen, wird er es, das weiß er, bis ans Ende seines Lebens bereuen.
2
Er hat ihr so gut wie nichts von sich erzählt. Schon an jenem ersten Tag im Park, als sie ihn sprechen hörte und begriff, dass er von anderswo kam, hatte er ihr verschwiegen, dass dieses Anderswo New York City war, das West Village in Manhattan, um genau zu sein, und nur vage angedeutet, sein Leben habe weiter oben im Norden begonnen. Als er etwas später mit ihr für die Aufnahmeprüfung übte und sie in die Infinitesimalrechnung einführte, kam Pilar schnell dahinter, dass er mehr als bloß ein Wanderarbeiter war, der Häuser entrümpelte, nämlich ein hochgebildeter Mensch mit rascher Auffassungsgabe und einer so gewaltigen und fundierten Liebe zur Literatur, dass ihre Englischlehrer an der John F.Kennedy Highschool sich dagegen wie Hochstapler ausnahmen. Wo er zur Schule gegangen sei, fragte sie ihn eines Tages. Er zuckte die Achseln, wollte nichts von Stuyvesant und den drei Jahren sagen, die er an der Brown University verbracht hatte. Als sie ihn weiter bedrängte, starrte er zu Boden und murmelte etwas von einem kleinen College in New England. Als er ihr in der Woche darauf einen Roman von Renzo Michaelson gab, der zufällig sein Pate war, bemerkte sie, dass das Buch bei einem Verlag namens Heller Books erschienen war, und fragte ihn, ob es da irgendeine Verbindung gebe. Nein, sagte er, das ist reiner Zufall, Heller ist doch ein ziemlich verbreiteter Name. Das brachte sie auf die einfache, vollkommen logische nächste Frage, zu welcher der vielen Familien mit Namen Heller er denn gehöre. Wer seine Eltern seien und wo sie lebten? Die sind beide nicht mehr da, antwortete er. Nicht mehr da? Ob sie gestorben seien? Ja, leider. Genau wie bei mir, sagte sie und hatte plötzlich Tränen in den Augen. Ja, sagte er, genau wie bei dir. Irgendwelche Brüder oder Schwestern? Nein. Ich bin ein Einzelkind.
Mit solchen Lügen hat er sich die Unannehmlichkeit erspart, von Dingen zu reden, denen er seit Jahren mühsam aus dem Weg gegangen ist. Sie soll nicht erfahren, dass seine Mutter sechs Monate nach seiner Geburt seinen Vater verlassen hat, um einen anderen Mann zu heiraten. Sie soll nicht erfahren, dass er seinen Vater, Morris Heller, Gründer und Inhaber von Heller Books, seit dem Sommer nach seinem dritten Jahr an der Brown nicht mehr gesehen hat. Am allerwenigsten soll sie irgendetwas von seiner Stiefmutter erfahren, Willa Parks, die seinen Vater zwanzig Monate nach der Scheidung geheiratet hatte, und nichts, nichts, gar nichts von seinem toten Stiefbruder Bobby. Das alles geht Pilar nichts an. Das ist seine Privatsache, und bis er einen Ausgang aus der Vorhölle findet, in der er seit sieben Jahren feststeckt, wird er niemandem ein Wort davon erzählen.
Bis heute kann er nicht sagen, ob er es vorsätzlich getan hat oder nicht. Zweifellos hat er Bobby geschubst, sie haben sich gestritten, und er hat Bobby wütend weggestoßen, aber er weiß nicht, ob der Stoß kam, bevor oder nachdem er das herannahende Auto gehört hatte, was heißen soll, dass er nicht weiß, ob Bobbys Tod ein Unfall war oder ob er insgeheim versucht hatte, ihn zu töten. Die ganze Geschichte seines Lebens kreist um die Ereignisse an jenem Tag in den Berkshires, und er kennt die Wahrheit immer noch nicht, hat noch immer keine Gewissheit, ob er sich eines Verbrechens schuldig gemacht hat oder nicht.
Es war der Sommer 1996, ungefähr einen Monat nachdem sein Vater ihm zum sechzehnten Geburtstag Der große Gatsby und fünf andere Bücher geschenkt hatte. Bobby war achtzehneinhalb und hatte gerade die Highschool abgeschlossen, allerdings nur mit Hängen und Würgen und dank der Bemühungen seines Stiefbruders, der zum Schnäppchenpreis von zwei Dollar pro Seite, insgesamt sechsundsiebzig Dollar, drei Examensarbeiten für ihn geschrieben hatte. Ihre Eltern hatten für den August ein Haus in der Nähe von Great Barrington gemietet, und die zwei Jungen waren auf dem Weg, sie übers Wochenende zu besuchen. Er war zum Fahren noch zu jung, Bobby hatte schon den Führerschein, und daher war Bobby dafür verantwortlich, den Ölstand zu prüfen und den Tank zu füllen, bevor sie aufbrachen – was er natürlich verabsäumte. Nach fünfzehn Meilen ging ihnen auf einer gewundenen, hügeligen Landstraße das Benzin aus. Vielleicht wäre er nicht so wütend geworden, wenn Bobby so etwas wie Zerknirschung bekundet, wenn der dämliche Nichtsnutz es über sich gebracht hätte, für seinen Fehler um Verzeihung zu bitten, aber Bobby, typisch, fand die Situation nur komisch und fing erst einmal an zu lachen.
Handys gab es damals schon, aber sie hatten keins, und so mussten sie aussteigen und zu Fuß weitergehen. Es war ein drückend heißer, schwüler Tag, Wolken von Mücken und Moskitos umschwirrten sie, und er war auf hundertachtzig, ihm stank alles, Bobbys idiotische Unbekümmertheit, die Hitze und die Insekten, diese verfluchte, mickrige Landstraße, und binnen kurzem fing er an, seinen Bruder zu beschimpfen. Am liebsten hätte er sich mit ihm geschlagen. Bobby aber ging auf seine Beleidigungen nicht ein und ließ das alles von sich abprallen. Reg dich nicht wegen solcher Lappalien auf, sagte er, das Leben ist voller unerwarteter Wendungen; vielleicht würden sie auf dieser Straße etwas Interessantes erleben, vielleicht, nur vielleicht würden sie hinter der nächsten Kurve zwei schöne Mädchen entdecken, zwei völlig nackte schöne Mädchen, die mit ihnen ins Gebüsch gehen und es sechzehn Stunden am Stück mit ihnen treiben würden. Unter normalen Umständen hätte er über solche Reden gelacht und sich von den Albernheiten seines Stiefbruders mitreißen lassen, aber an ihrer Situation war nun einmal nichts normal, und Lachen war das Letzte, wonach ihm zumute war. Das alles war so schwachsinnig, er hätte Bobby ins Gesicht schlagen können.
Wann immer er heute an diesen Tag zurückdenkt, stellt er sich vor, alles wäre ganz anders gekommen, wenn er nicht links, sondern rechts von Bobby gegangen wäre. Dann hätte der Stoß ihn von der Straße weg und nicht mitten auf sie befördert, und damit wäre die Geschichte auch schon vorbei gewesen, falls man dann überhaupt noch von einer Geschichte hätte reden können, die ganze Angelegenheit wäre im Sande verlaufen, ein kurzer Ausbruch, im nächsten Augenblick vergessen. Aber sie gingen nun einmal so nebeneinander und nicht anders, er innen, Bobby außen, immer am Straßenrand entlang auf den Gegenverkehr zu, von dem zehn Minuten lang nichts zu sehen war, kein Auto, kein Lastwagen, kein Motorrad, und nachdem er diese zehn Minuten lang ununterbrochen auf Bobby eingeschimpft hatte, verlor sein Stiefbruder allmählich den heiteren Gleichmut, mit dem er ihre unangenehme Lage hinnahm, und reagierte zunehmend gereizter und aggressiver, und nach wenigen Meilen brüllten die beiden sich aus vollem Halse an.
Wie oft hatten sie sich in der Vergangenheit geprügelt? Unzählige Male, öfter, als er sich erinnern kann, aber daran war nichts Ungewöhnliches, findet er, Brüder kabbeln sich ständig, und mochte Bobby auch nicht sein richtiger Bruder sein, war er doch immer da gewesen, solange er denken konnte. Da er zwei Jahre alt gewesen war, als sein Vater Bobbys Mutter heiratete und sie zu viert unter einem Dach zu leben begannen, kann er sich natürlich nicht an diese erste Zeit erinnern, sie ist vollständig ausgelöscht, sodass man mit Recht sagen könnte, Bobby sei immer sein Bruder gewesen, auch wenn das streng genommen nicht der Fall war. Es hatte die üblichen Reibereien und Konflikte gegeben, und da er zweieinhalb Jahre jünger als Bobby war, hatte er die meisten Schläge einstecken müssen. Undeutlich erinnerte er sich an einen verregneten Tag irgendwo auf dem Lande, als sein Vater einmal einschritt und einen kreischenden Bobby von ihm wegzerrte, an seine Stiefmutter, wie sie Bobby ausschimpfte, weil er zu grob sei, an Bobby, den er ans Schienbein trat, als der ihm ein Spielzeug aus den Händen reißen wollte. Aber es war nicht nur Krieg und Kampf gewesen, es hatte auch Pausen, Waffenstillstände und gute Zeiten gegeben, und von der Zeit an, als er sieben oder acht Jahre alt war, Bobby also neun, zehn oder elf, kann er sich erinnern, dass er seinen Bruder wirklich gerngehabt, vielleicht sogar geliebt hatte und dass auch umgekehrt er von ihm gerngehabt und vielleicht sogar geliebt worden war. Aber richtig vertraut miteinander waren sie nie, nicht so, wie manche Brüder es sind, auch feindliche Brüder, die sich ewig streiten; das hatte zweifellos damit zu tun, dass sie in einer künstlichen Familie lebten, einer konstruierten Familie, und dass jeder der beiden Jungen sich jeweils seinem eigenen Elternteil am meisten verbunden fühlte. Nicht dass Willa ihm eine schlechte Mutter oder sein Vater Bobby ein schlechter Vater gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Die zwei Erwachsenen waren treue Verbündete, ihre Ehe stabil und bemerkenswert frei von Problemen, und beide mühten sich nach Kräften, dem Kind des jeweils anderen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Dennoch gab es unsichtbare Verwerfungslinien, mikroskopische Risse, die sie daran erinnerten, dass sie eine zusammengeflickte Einheit und kein fugenloses Ganzes waren. Zum Beispiel die Sache mit Bobbys Nachnamen. Willa hieß Willa Parks, aber ihr erster Mann, der mit sechsunddreißig an Krebs gestorben war, hieß Nordstrom, und Bobby hieß ebenfalls Nordstrom, und da er in den ersten viereinhalb Jahren seines Lebens Nordstrom geheißen hatte, sträubte Willa sich dagegen, ihn in Heller umzubenennen. Sie meinte, das könne Bobby verwirren, und überhaupt brachte sie es nicht fertig, die letzten Spuren ihres ersten Mannes auszulöschen, der sie geliebt hatte und ohne eigenes Verschulden gestorben war; und seinem Sohn seinen Namen wegzunehmen kam ihr so vor, als sollte er zum zweiten Mal getötet werden. Also blieb die Vergangenheit ein Teil der Gegenwart, und der Geist von Karl Nordstrom lebte als fünftes Mitglied im Haushalt mit, ein abwesender Geist, der an Bobby seine Spuren hinterlassen hatte – Bobby, der gleichzeitig Bruder und kein Bruder war, Sohn und nicht Sohn, Freund und Feind.
Sie lebten unter einem Dach, doch abgesehen davon, dass ihre Eltern miteinander verheiratet waren, hatten sie wenig gemeinsam. Nach Temperament und Ansichten, nach Neigungen und Verhalten, nach allen Maßstäben, anhand deren man beurteilt, wer und was ein Mensch ist, waren sie verschieden, zutiefst und unabänderlich verschieden. Im Lauf der Jahre trieben sie immer weiter auseinander, und als sie durch die Frühzeit der Pubertät zu stolpern begannen, trafen sie sich praktisch nur noch am Küchentisch und bei Familienausflügen. Bobby war klug, fix und witzig, aber ein miserabler Schüler, der die Schule hasste, und da er obendrein ein rücksichtsloser und frecher Unruhestifter war, wurde er als Problemfall eingestuft. Im Gegensatz dazu bekam sein jüngerer Stiefbruder immer die besten Noten. Heller war still und verschlossen, Nordstrom extrovertiert und ungestüm, und jeder meinte vom anderen, er packe das Leben nicht richtig an. Zu allem Übel war Bobbys Mutter Anglistikprofessorin an der NYU, eine Frau, deren Leidenschaft Büchern und Ideen galt, und wie schwer muss es ihrem Sohn zugesetzt haben, wenn sie Hellers schulische Leistungen lobte, über seine Aufnahme in der Stuyvesant Highschool frohlockte und beim Abendessen mit ihm über den gottverdammten Existenzialismus debattierte. Mit fünfzehn hatte sich Bobby zu einem starken Kiffer entwickelt, einem dieser Schüler mit glasigem Blick, die sich auf Wochenendpartys die Seele aus dem Leib kotzen und Kleinhandel mit Drogen treiben, um bei Kasse zu bleiben. Der mufflige Heller, der unartige Nordstrom, und nie konnten die beiden zueinanderfinden. Gelegentlich kam es von der einen oder anderen Seite zu verbalen Attacken, aber die Schlägereien zwischen ihnen hatten aufgehört – was im Wesentlichen den Mysterien der Genetik zu verdanken war. Vor zwölf Jahren auf jener Straße in den Berkshires war der sechzehnjährige Heller knapp eins achtzig groß und wog siebenundsiebzig Kilogramm. Nordstrom, schmaler gebaut, war eins zweiundsiebzig und wog fünfundsechzig. Das Missverhältnis ließ keine Kämpfe mehr zu. Seit einiger Zeit schon traten sie in verschiedenen Ligen an.
Worüber stritten sie an jenem Tag? Welches Wort, welcher Satz, welche Folge von Wörtern oder Sätzen hatte ihn so erzürnt, dass er die Beherrschung verlor und Bobby zu Boden stieß? Er kann sich nicht mehr deutlich erinnern. So vieles wurde bei diesem Streit gesagt, so viele Anschuldigungen flogen zwischen ihnen hin und her, so viele verschüttete Animositäten bahnten sich, von Rachsucht getrieben, einen Weg ins Freie, dass er den einen Satz, der ihn durchdrehen ließ, nicht genau zu bestimmen vermag. Anfangs war es noch ziemlich kindisch. Auf seiner Seite Verärgerung über Bobbys Schluderei, immer musste er alles vermasseln, wie konnte er nur so dumm und nachlässig sein, sieh dir an, was du uns jetzt schon wieder eingebrockt hast. Auf Bobbys Seite Verärgerung über die spießige Reaktion seines Bruders auf eine kleine Unannehmlichkeit, seine scheinheilige Rechtschaffenheit, die besserwisserische Arroganz, mit der er ihm seit Jahren auf den Sack ging. Kindergezänk, hitzköpfig und pubertär, nichts sonderlich Beunruhigendes. Dann aber, als sie sich weiter beharkten, als auch Bobby allmählich in Wallung geriet und der Disput immer lauter und erbitterter wurde, zündete die erste Stufe echter Feindseligkeit. Jetzt ging es um die Familie, nicht mehr nur um sie beide. Er habe es satt, der Paria der heiligen Vier zu sein, schäumte Bobby, er könne es nicht mehr ertragen, dass seine Mutter ihn, Miles, ständig bevorzuge, es stehe ihm bis hier, von gefühllosen, rachsüchtigen Erwachsenen andauernd irgendwelche Strafen und Hausarrest aufgebrummt zu bekommen, er halte das nicht mehr aus, er wolle nie mehr ein Wort von wissenschaftlichen Tagungen und Verlagsverträgen hören oder warum dieses Buch besser sei als jenes – er habe die Schnauze voll von diesem ganzen Mist, von Miles, von seiner Mutter, von seinem Stiefvater, von allen in dieser grässlichen Familie, er könne es kaum noch erwarten, das alles hinter sich zu lassen, wenn er nächsten Monat aufs College gehe, und selbst wenn er vom College fliegen würde, er sei fertig mit ihnen allen und werde nie mehr zurückkommen. Adios, Arschlöcher. Scheiß auf Morris Heller und seinen gottverdammten Sohn. Scheiß auf die ganze beschissene Welt.
Er weiß nicht mehr, bei welchem Wort oder welchen Worten ihm die Sicherung durchbrannte. Vielleicht ist das auch gar nicht wichtig, vielleicht wird er sich nie daran erinnern können, welche der vielen Beleidigungen in dieser giftigen Schimpfkanonade den Stoß ausgelöst hat; wichtig ist nur eins, wichtiger als alles andere: zu wissen, ob er das Auto kommen gehört hat oder nicht, das Auto, das plötzlich mit fünfzig Meilen pro Stunde um eine scharfe Kurve bog und erst sichtbar wurde, als es schon zu spät war, seinen Bruder von der Straße zu ziehen. Fest steht, dass Bobby ihn anschrie und er zurückschrie, er solle endlich aufhören und den Mund halten, und dass sie während dieser ganzen wahnsinnigen Brüllerei einfach immer weitergingen und nichts von ihrer Umgebung wahrnahmen, weder den Wald zu ihrer Linken noch die Wiese zu ihrer Rechten, weder den diesigen Himmel über ihnen noch die Vögel, die überall um sie herum sangen, Finken, Drosseln, Grasmücken, das alles war längst verschwunden, und übrig geblieben war einzig und allein die Raserei ihrer Stimmen. Es scheint sicher, dass Bobby das nahende Auto nicht hörte – oder er achtete nicht darauf, weil er auf dem Seitenstreifen ging und sich nicht in Gefahr sah. Aber wie war das bei dir?, fragt sich Miles. Hast du es gewusst oder nicht?
Es war ein fester, entschlossener Stoß, der Bobby aus dem Gleichgewicht brachte und auf die Fahrbahn taumeln ließ, wo er lang hinstürzte und mit dem Kopf auf den Asphalt schlug. Er setzte sich auf, rieb sich fluchend die Schläfe und wollte sich gerade hochrappeln, als das Auto ihn niedermähte, ihm das Leben ausquetschte und das der ganzen Familie für immer veränderte.
Das ist das Erste, was er Pilar verschweigt. Das Zweite ist der Brief, den er fünf Jahre nach Bobbys Tod an seine Eltern schrieb. Er hatte gerade sein vorletztes Jahr an der Brown University absolviert und wollte den Sommer in Providence verbringen; dort hatte er nicht nur eine Teilzeitstelle als Assistent eines seiner Geschichtsprofessoren (abends und an Wochenenden in der Bibliothek), sondern auch eine Vollzeitstelle als Ausfahrer für ein Haushaltsgerätegeschäft (Klimaanlagen installieren, Fernseher und Kühlschränke über enge Treppen hochschleppen). Seit kurzem hatte er eine Freundin, und da sie in Brooklyn wohnte, nahm er an einem Wochenende im Juni eine Auszeit bei seinem Teilzeitjob und fuhr nach New York, um sie zu besuchen. Er besaß noch die Schlüssel zur Wohnung seiner Eltern in der Downing Street, sein altes Schlafzimmer war noch da, und seit er aufs College ging, bestand die Abmachung, dass er dort kommen und gehen konnte, wie er wollte, ohne seine Besuche vorher anzukündigen. Nachdem er am Freitagabend den Lieferwagen abgestellt hatte, brach er auf und traf einige Zeit nach Mitternacht in der Wohnung ein. Seine Eltern schliefen schon. Früh am nächsten Morgen wurde er von ihren Stimmen geweckt, die aus der Küche zu ihm drangen. Er stieg aus dem Bett, öffnete die Tür seines Zimmers und blieb zögernd stehen. Sie redeten lauter und eindringlicher als sonst, Willas Stimme klang bedrückt, und wenn sie auch nicht direkt miteinander stritten (das taten sie selten), ging es offenbar um etwas Wichtiges, um irgendeine brisante Angelegenheit, die sie zu regeln, zu besprechen oder zu überdenken hatten, und er wollte sie nicht stören.
Die angemessene Reaktion wäre gewesen, in sein Zimmer zurückzugehen und die Tür zu schließen. Er stand da im Flur und lauschte, ihm war klar, er hatte kein Recht dazu, er musste und sollte sich zurückziehen, aber er konnte nicht anders, er war zu neugierig, er wollte unbedingt wissen, was da vor sich ging, und so rührte er sich nicht von der Stelle und belauschte zum ersten Mal in seinem Leben ein privates Gespräch seiner Eltern, und da es in dem Gespräch hauptsächlich um ihn ging, war es auch das erste Mal, dass er sie oder irgendjemand anderen jemals hinter seinem Rücken über sich reden hörte.
Er hat sich verändert, sagte Willa gerade. Ich spüre bei ihm einen Zorn und eine Kälte, die mir Angst machen, und ich hasse ihn für das, was er dir angetan hat.
Er hat mir überhaupt nichts angetan, antwortete sein Vater. Wir reden vielleicht nicht mehr so viel miteinander wie früher, aber das ist normal. Er wird bald einundzwanzig. Er hat jetzt sein eigenes Leben.
Ihr hattet so ein gutes Verhältnis. Das ist einer der Gründe, warum ich mich in dich verliebt habe – weil du den Kleinen so geliebt hast. Weißt du noch, Baseball, Morris, wie viele Stunden du mit ihm im Park geübt hast, um ihm eine gute Wurftechnik beizubringen?
Die guten alten Zeiten.
Und er war ja auch gut, oder? Ich meine, wirklich gut. Schon im zweiten Jahr erster Pitcher der Collegemannschaft. Er schien so glücklich damit. Und ein halbes Jahr später wirft er alles hin und steigt da aus.
Vergiss nicht, das war der Frühling, nachdem Bobby gestorben war. Er war damals ganz schön durcheinander. Wie wir alle. Daraus kannst du ihm keinen Vorwurf machen. Wenn er nicht mehr Baseball spielen wollte, war das seine Sache. Aus deinem Mund hört sich das so an, als habe er mich bestrafen wollen. Das habe ich nie so empfunden.
Da hat er auch mit dem Trinken angefangen, richtig? Wir sind erst später dahintergekommen, aber ich denke, da hat es angefangen. Trinken und Rauchen und diese Verrückten, mit denen er sich rumgetrieben hat.
Er hat versucht, Bobby nachzumachen. Die beiden mögen nicht sehr gut miteinander ausgekommen sein, aber ich glaube, Miles hat ihn geliebt. Er hat den Tod seines Bruders erlebt, und danach hat er unbewusst so werden wollen wie er.
Bobby war ein leichtsinniger Kindskopf. Miles war der wandelnde Tod.
Ich gebe zu, sein Gebaren hatte etwas theatralisch Düsteres. Aber in der Schule war er immer gut. Egal, was war, am Ende hat er immer gute Noten bekommen.
Er ist ein kluger Bursche, das will ich nicht bestreiten. Aber kalt, Morris. Innerlich abgestorben, verzweifelt. Mich graust, wenn ich an die Zukunft denke…
Wie oft hatten wir das Thema schon? Hundertmal? Tausendmal? Du kennst seine Geschichte so gut wie ich. Der Junge hat keine Mutter. Mary-Lee ist gegangen, als Miles sechs Monate alt war. Bis du an Bord kamst, wurde er von Edna Smythe erzogen, der legendären Lichtgestalt Edna Smythe, aber sie war doch nur ein Kindermädchen, für sie war das nur ein Job, und das heißt, dass er nach diesen sechs Monaten nie mehr eine richtige Mutter hatte. Und als du in sein Leben kamst, war es vermutlich zu spät.
Du verstehst also, wovon ich rede?
Aber natürlich. Ich habe das immer verstanden.
Unerträglich, ihnen weiter zuzuhören. Sie hackten ihn in kleine Stücke, zergliederten ihn mit ruhigen und effizienten Schnitten wie Pathologen eine Leiche, sprachen von ihm, als wäre er bereits tot. Er schlich in sein Zimmer zurück und schloss leise die Tür. Sie ahnten nicht, wie sehr er sie liebte. Seit fünf Jahren trug er sich mit der Erinnerung an das, was er seinem Bruder auf jener Straße in Massachusetts angetan hatte, und da er seinen Eltern nie von dem Stoß erzählt und ihnen nie gesagt hatte, wie sehr ihn dieses Ereignis quälte, missdeuteten sie die Schuldgefühle, die seinen ganzen Organismus durchdrangen, als eine Art Krankheit. Vielleicht war er wirklich krank, vielleicht stellte er sich wirklich als abgestorbener, absolut unliebenswürdiger Mensch dar, aber das hieß noch lange nicht, dass er sich gegen sie gewandt hatte. Die komplizierte, übernervöse, unendlich großzügige Willa; sein offenherziger, immer freundlicher Vater – er hasste sich dafür, dass er ihnen so viel Kummer, so viel unnötige Sorgen machte. Für sie war er ein wandelnder Toter, jemand, der keine Zukunft hatte, und als er auf dem Bett saß und an die zukunftslose Zukunft dachte, die undeutlich vor ihm im Nebel schwebte, erkannte er, dass er nicht den Mut besaß, ihnen noch einmal gegenüberzutreten. Vielleicht war es für alle Beteiligten am besten, wenn er für immer aus ihrem Leben verschwand.
Liebe Eltern, schrieb er am nächsten Tag, verzeiht bitte die Abruptheit meiner Entscheidung, aber nachdem ich nun noch ein Jahr am College hinter mich gebracht habe, fühle ich mich von der Schule ein wenig ausgebrannt und finde, eine Pause könnte mir ganz guttun. Ich habe dem Dean bereits mitgeteilt, dass ich mich für das Herbstsemester beurlauben lassen möchte, und falls das nicht reichen sollte, nehme ich auch noch das Frühjahrssemester dazu. Tut mir leid, wenn ich euch enttäusche. Das einzig Erfreuliche ist, dass ihr eine Zeitlang kein Schulgeld für mich zu zahlen braucht. Selbstverständlich erwarte ich kein Geld von euch. Ich habe Arbeit und werde für mich selbst sorgen können. Morgen fahre ich für ein paar Wochen zu meiner Mutter nach L.A.Danach werde ich mich melden, sobald ich mich wo auch immer eingerichtet habe. Ich drücke und küsse euch beide, Miles.
Es stimmt, er ist am nächsten Morgen abgereist, aber nicht nach Kalifornien zu seiner Mutter. Und irgendwo eingerichtet hat er sich auch. In den vergangenen gut sieben Jahren hatte er eine ganze Reihe stets wechselnder Adressen, aber gemeldet hat er sich nie.
3
Wir haben 2008, den zweiten Sonntag im November, und er liegt mit Pilar im Bett und blättert auf der Suche nach kuriosen und komischen Namen in der Baseball Encyclopedia herum. Das haben sie nun schon ein paarmal getan, und für ihn ist es von enormer Bedeutung, dass sie den Humor in diesem absurden Tun erblickt, dass sie den Dickensischen Geist versteht, der in den zweitausendsiebenhundert Seiten dieser revidierten, aktualisierten und erweiterten Ausgabe von 1985 steckt, die er vorigen Monat für zwei Dollar in einem Antiquariat erstanden hat. An diesem Morgen stöbert er bei den Pitchern herum, denn zu denen fühlt er sich immer als Erstes hingezogen, und bald ist er auf den ersten verheißungsvollen Fund des Tages gestoßen. Boots Poffenberger. Pili zerknautscht ihr Gesicht, um nicht zu lachen, kneift die Augen zu, hält die Luft an, aber schon nach wenigen Sekunden kann sie nicht mehr, und die Luft platzt in einem Tornado aus Jaulen, Kreischen und keckerndem Gelächter aus ihr heraus. Als der Sturm sich legt, reißt sie ihm das Buch aus den Händen und behauptet, den Namen habe er sich ausgedacht. Er sagt: Das würde ich niemals tun. Solche Spiele machen nur Spaß, wenn man sie ernst nimmt.
Und da steht’s, mitten auf Seite 1977: Cletus Elwood «Boots» Poffenberger, geboren am 1.Juli 1915 in Williamsport, Maryland, Größe 1,77, Rechtshänder, spielte zwei Jahre bei den Tigers (1937 und 1938) und ein Jahr bei den Dodgers (1939), Gesamtbilanz seiner Karriere: sechzehn Wins und zwölf Losses.
Er findet noch mehr: Whammy Douglas, Cy Slapnicka, Noodles Hahn, Wickey McAvoy, Windy McCall, Billy McCool. Bei diesem Letzten schnurrt Pili vor Vergnügen. Sie ist hingerissen. Von nun an ist er den ganzen Vormittag lang nicht mehr Miles, sondern Billy McCool, ihr süßer geliebter Billy McCool, ihr Ass am Wurfmal, ihr Ass im Ärmel, ihr Herzass.
Am Elften erfährt er aus der Zeitung, dass Herb Score gestorben ist. Er ist zu jung, er hat ihn nie pitchen sehen, aber er erinnert sich an die Geschichte, die sein Vater ihm über den Abend des 7.Mai 1957 erzählt hat, als ein von Yankee-Infielder Gil McDougald schnurgerade geschlagener Ball Score ins Gesicht traf und einer der verheißungsvollsten Karrieren der Baseball-Geschichte ein Ende setzte. Seinem Vater zufolge, zu der Zeit zehn Jahre alt, war Score der beste Linkshänder jener Tage gewesen, wahrscheinlich sogar besser als Koufax, der damals auch schon Pitcher war, aber erst einige Jahre später richtig rauskam. Der Unfall geschah exakt einen Monat vor Scores vierundzwanzigstem Geburtstag. Es war seine dritte Saison bei den Cleveland Indians, 1955 war er Rookie des Jahres geworden (16–10, Earned Run Average 2.85, 245Strike-Outs), im Jahr darauf hatte er sich gar noch gesteigert (20–9, Earned Run Average 2.53, 264Strike-Outs). Dann, an jenem frostigen Frühlingsabend im Municipal Stadium, kam der Wurf zu McDougald. Der Ball schlug Score nieder, als sei er von einer Kugel getroffen worden (die Worte seines Vaters); reglos blieb er