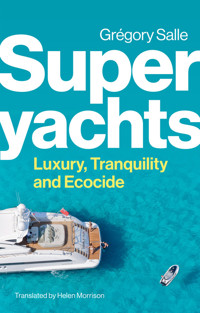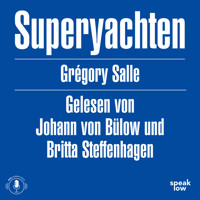15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Abramowitsch hat eine, der Emir von Abu Dhabi auch, Jeff Bezos sowieso: Superyachten sind Ausweis der Zugehörigkeit zum Club der lucky few. Sie ermöglichen grenzenlose Mobilität und exklusiven Geltungskonsum. Zugleich sind sie schwimmende Umweltsünden. Sie verbrennen Unmengen Treibstoff, ihre Anker zerstören kostbare Flora. Und sie sind Spielfelder obszöner Ungleichheit: Während ihre Besitzer zu den einflussreichsten Menschen der Welt gehören, ist das Bordpersonal oft Willkür und Rechtlosigkeit ausgeliefert.
Grégory Salle sieht in den riesigen Luxusschiffen den Schlüssel zum Verständnis des gegenwärtigen Kapitalismus. In seinem fulminanten Essay zeigt er, dass Superyachten nicht einfach Symbole des Exzesses sind. Vielmehr sind sie Symbole dafür, dass der Exzess zum Kennzeichen unseres Zeitalters geworden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 161
Ähnliche
Cover
Titel
3Grégory Salle
Superyachten
Luxus und Stille im Kapitalozän
Aus dem Französischen von Ulrike Bischoff
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die französische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Superyachts. Luxe, calme et écocide bei Éditions Amsterdam, Paris.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 2. Auflage der Ausgabe der edition suhrkamp 2790.
edition suhrkamp 2790Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022© Éditions Amsterdam, 2021Alle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Textund Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-77507-3
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
5Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Koloss vor Anker
Maß versus Maßlosigkeit
Schwimmende Paläste
Einzelexemplare
UHNWI
Yachting-Lifestyle
Die verborgene Stätte der Produktion
Amsterdams Red Party
Vermögenssteuer und Co.
Im (Finanz-)Sturm oben schwimmen
Demonstrative Abgeschiedenheit
Politische Geografie der Luxusyacht
Die grüne Karte (Greenwashing)
Posidonia
Das Meeresobservatorium
Auf See/Bei einer Versammlung
Auf frischer Tat
Kapitalozän und Ökosozialismus sitzen in einem Boot …
Danksagung
Quellen und Literaturhinweise
Wissenschaftliche Arbeiten
Graue Literatur und Fachquellen
Allgemeine Medien
Videos
Vorwort
Koloss vor Anker
Schwimmende Paläste
Einzelexemplare
UHNWI
Yachting-Lifestyle
Die verborgene Stätte der Produktion
Amsterdams Red Party
Vermögenssteuer und Co.
Im (Finanz-)Sturm oben schwimmen
Demonstrative Abgeschiedenheit
Politische Geografie der Luxusyacht
Die grüne Karte (Greenwashing)
Posidonia
Das Meeresobservatorium
Auf See/Bei einer Versammlung
Auf frischer Tat
Kapitalozän und Ökosozialismus sitzen in einem Boot …
Bildnachweise
Informationen zum Buch
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
7
8Vorwort zur deutschen Ausgabe
»Um den Raum zu erkennen, in dem man sich befindet, tut es not, seine Grenzen zu erfahren«, erklärte Max Horkheimer in einem Fragment aus den zwanziger Jahren. Diese Feststellung ist ebenso simpel wie quälend. Umso mehr, als sie weniger selbstverständlich scheint, wenn man sie nicht auf einen physischen Raum, sondern auf den als solchen nicht greifbaren sozialen Raum bezieht. Das vorliegende Buch knüpft auf seine Art an diesen Gedanken an. Es war von der folgenden Idee geleitet: So belanglos »Superyachten« (eine schmeichelhafte Bezeichnung, die an sich schon ein symbolischer Gewaltstreich ist, gleich den sogenannten »Smartphones«, die nicht so »intelligent« sind, wie der Name nahelegt) auch erscheinen mögen, offenbaren sie doch eine bezeichnende Facette der Welt, in der wir leben, und das liegt nicht nur an ihrem exzessiven Charakter. Etwas mehr als ein Jahr nachdem dieses Buch im April 2021 in Frankreich erschien, haben diverse Ereignisse und Phänomene diese Idee bestätigt.
Während ich dies schreibe, hat das Szenario, das ich am Ende des Buches halb scherzhaft ausgemalt habe, eine ernsthaftere Entwicklung genommen. Im Rahmen der westlichen Sanktionen, die nach der militärischen Invasion der Ukraine gegen russische Vermögens9werte verhängt wurden, hat man in mehreren Häfen Superyachten festgesetzt, die (mutmaßlich) dem Kreml nahestehenden Persönlichkeiten gehören. In der Regel ließ sich dabei der Umstand ausnutzen, dass sie gerade renoviert wurden. Auch eine Yacht, die wahrscheinlich – über eine Strohfirma – Wladimir Putin gehört und ironischerweise den Namen Graceful trägt, lag monatelang wegen Umbauten im Hamburger Hafen. Aber kurz vor dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine wurden die Arbeiten abgebrochen, und das Boot verließ plötzlich, aber diskret den Hafen. Dem russischen Diktator wird auch der indirekte Besitz der Scheherazade zugeschrieben, deren Wert auf 600 bis 700 Millionen Euro geschätzt wird. Nachdem das Schiff in einem toskanischen Hafen hektisch für die Abfahrt bereit gemacht worden war, beschlagnahmten es die italienischen Behörden Anfang Mai 2022. Tatsächlich entspann sich ein Versteckspiel zwischen russischen Oligarchen und Behörden, an dem sich auch eine informelle Gemeinschaft beteiligte, indem sie die Yachten über Webseiten für Geolokalisation und die sozialen Netzwerke verfolgte – selbst das Wirtschaftsmagazin Forbes fand Gefallen daran! Zahlreiche Superyachten, die erwiesenermaßen oder mutmaßlich russischen Milliardären gehören, suchten Zuflucht in den Gewässern der Malediven, Montenegros oder der Seychellen und schalteten zuweilen (illegalerweise) ihr automatisches Identifikationssystem aus, um einer Ortung zu ent10gehen. Der unendliche Reiz der Offshore-Ökonomie …
Es ist leicht nachvollziehbar, welche Bedeutung die Beschlagnahmung einer solchen Yacht in einer Zeit hat, in der sich der Charakter großer Vermögen infolge der Finanzialisierung des Kapitals entmaterialisiert hat, und das umso mehr, je höher man auf der Leiter des Reichtums steigt. Ein solcher »Fang« ist sichtbar, greifbar, konkret. Paradoxerweise verleiht gerade die imposante Materialität des anvisierten Ziels ihm eine starke symbolische Dimension. Dennoch handelt es sich um einen nur scheinbar beeindruckenden Fang, unter anderem, weil die anschließenden Verfahren juristisch heikel sind. Im Übrigen ist diese Maßnahme unzureichend. Wie der Ökonom Gabriel Zucman vorschlägt, ist dringend die Einführung eines internationalen Finanzkatasters notwendig, um die großenteils im Ausland angelegten beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerte der Kleptokraten zu besteuern, wenn nicht gar einzufrieren. Gegen diese Maßnahmen sperren sich jedoch die Plutokraten im Westen, die, man kommt nicht umhin es zu sagen, einiges mit den geschmähten Oligarchen gemeinsam haben. Trotzdem: Der Beweis ist erbracht, dass etwas, das als Hirngespinst oder zumindest als unrealistisch gelten könnte, durchaus nicht unmöglich ist: die Beschlagnahmung.
Bereits Anfang Februar 2022 gab ein isoliertes und fälschlich als anekdotisch eingestuftes Ereignis Anlass 11zu Gerede. Offenbar plante die Stadtverwaltung von Rotterdam, eine denkmalgeschützte Brücke von 1927 (wenn man einen Vorgängerbau ein halbes Jahrhundert zuvor nicht mitrechnet) teilweise abzubauen, um Jeff Bezos' neue Superyacht mit ihren imposanten drei Masten passieren zu lassen. Auch wenn es von offizieller Seite keine Bestätigung gab, lassen die verfügbaren Indizien doch vermuten, dass diese absurde Forderung akzeptiert worden wäre, und das von einem sozialdemokratischen Bürgermeister. Nach einer Renovierung im Jahre 2017 war noch verkündet worden, die Brücke müsse unantastbar bleiben. Um das Ganze aufzuhalten, bedurfte es einer digitalen gesellschaftlichen Mobilisierung. In den sozialen Medien hatten zahlreiche Bürger der Stadt angekündigt, die Yacht mit Eiern zu bewerfen. Der Streit wurde im Sommer 2022 endgültig beigelegt: Zuerst zog das Schiffsbauunternehmen seinen Antrag auf einen Abbau der Brücke zurück. In den frühen Morgenstunden des 2. August wurde die Yacht schließlich heimlich und ohne Segelmasten durch die Kanäle Rotterdams zu einer Werft auf der anderen Seite der Stadt geschleppt. Dennoch sagt diese Episode viel über die Macht aus, die unsere Gesellschaften dem materiellen Reichtum unberechtigterweise (in einer Mischung aus symbolischer Anerkennung und Einflussmöglichkeiten) einräumen.
Vereinzelte Affären wie diese und mehr oder weniger spektakuläre Ereignisse dürfen allerdings tiefgrei12fende und äußerst aufschlussreiche wirtschaftliche Tendenzen nicht kaschieren. Der Luxusyachtsektor hat die globale Finanzkrise 2007/08 ohne bleibende Schwierigkeiten überstanden, besonders in seinem Spitzensegment. Noch besser kam die Branche durch die Covid-19-Pandemie – vielmehr die Syndemie, um den Begriff von Richard Horton aufzugreifen, auf den wir in diesem Buch unvermutet stoßen werden. Der Superyacht-Markt hat in dieser Zeit nicht nur nicht gelitten, sondern erlebte wie die Vermögen der Milliardäre insgesamt einen Aufschwung. Im Jahr 2021 florierte der Sektor. Das gilt für Neubauten ebenso wie für den Gebrauchtmarkt, für den Kauf ebenso wie für die Vermietung, für den Bau ebenso wie für Renovierungen. Die Auftragsbücher sind voll. Ende 2021 konnte man verkünden, dass über 1000 Superyachten in Auftrag gegeben worden waren, obwohl im selben Jahr fast 900 verkauft worden waren, also fast doppelt so viele wie 2020. Und die Auftragswerte steigen weiter. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, spiegelt der Aufschwung dieses Sektors seit den achtziger Jahren zuverlässig das wider, was der Ökonom Branko Milanović als »die Entstehung einer globalen Plutokratie« bezeichnet, mit allem, was das für einen sozialen Separatismus »von oben« bedeutet. Die Hersteller liegen keineswegs falsch, wenn sie gern die Karte des sicheren Wertes im Fall einer Quarantäne ausspielen: Gibt es eine angenehmere Art, Social Distancing zu be13treiben? Die Anthropologin Giulia Mensitieri hat in einer Rezension dieses Buches für das französische Onlineportal »La vie des idées« zu Recht daran erinnert, dass Michel Foucault in seinem Essay »Von anderen Räumen« das Schiff als »die Heterotopie par exellence« bezeichnet hat. Man wäre geradezu versucht, die Superyacht zur maximalen Inkarnation der »Freiheit-Befreiung« zu machen, die der Philosoph Aurélien Berlan analysiert hat, hätte der Raumwahn mancher Milliardäre den Exit-Wunsch nicht noch weiter getrieben.
Die Kritik an der Lebensweise der Ultrareichen bekommt nicht immer eine gute Presse, unter anderem bei den Verächtern sozioökonomischer Ungleichheiten. Für Louis Maurin, den Direktor der Beobachtungsstelle für Ungleichheiten in Tours, läuft eine Fokussierung auf die Kritik an den Ultrareichen darauf hinaus, eine weniger augenfällige, aber weitaus umfangreichere Schicht Wohlhabender außer Acht zu lassen. Wenn man sich auf das »eine Prozent« konzentriert, vergisst man die 8 Prozent der »Reichen« (die im Monat jeweils über 3500 Euro netto verdienen) und die 20 Prozent der »Privilegierten«, die an der Spitze der sozialen Stratifikation nach französischer Einteilung stehen. Die Kritik an Ultrareichen sei einfach und unzureichend, weil sie die Gesamtheit der Gesellschaftsstruktur nicht in Betracht ziehe. Eine solche Kritik an der Kritik, die nebenbei die Blindheit, sprich: 14Doppelzüngigkeit eines ökonomisch behüteten linken Bildungsbürgertums anprangert, verdient es, berücksichtigt zu werden, und sei es nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Es stimmt, dass die enge Fokussierung auf einige Milliardäre zu Fehleinschätzungen führen kann, was sowohl die Realität von Klassenstrukturen als auch die Ungleichheit erzeugenden Mechanismen angeht. Dennoch wirft eine solche Kritik einige soziologische und politische Probleme auf. Neben der Tatsache, dass sie sich übermäßig auf Ungleichheiten im Einkommen statt auf solche bei Erbschaften (und erst recht auf Ungleichheiten in den Produktionsverhältnissen) bezieht, vernachlässigt sie die beträchtlichen Unterschiede, die innerhalb der gewählten Kategorien bestehen, und das schwindelerregende Ausmaß, in dem eine sehr kleine Anzahl von Menschen Reichtümer an sich reißt. Ist es vernünftig, Lohnniveaus in Verruf zu bringen, die zwar relativ gesehen hoch, absolut gesehen aber gerechtfertigt sind und sogar eine Vergütung darstellen, auf die jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer ohne Scham Anspruch erheben sollte, während man gleichzeitig die Kluft zwischen ihnen und absolut unvertretbaren Vermögenskonzentrationen herunterspielt?
Der Humanökologe Andreas Malm räumt einen weiteren Zweifel aus, nicht nur auf ökonomischer, sondern auch auf ökologischer Ebene. Er greift die vor 30 Jahren vorgeschlagene Unterscheidung zwischen 15»Luxusemissionen« und »Subsistenzemissionen« (von Kohlendioxid) auf und zeigt, dass sie gegenwärtig nichts von ihrer Relevanz verloren hat, im Gegenteil. Vielmehr liefert Malm Gründe für die Annahme, dass die Luxusemissionen in der aktuellen Lage noch verabscheuungswürdiger sind und daher ein vorrangiges Ziel sein sollten. »Es handelt sich hierbei also um ein als ideales Leben angepriesenes Verbrechen«, erklärt er zusammenfassend in Bezug auf einen Konsum, der, um demonstrativ sein zu können, zugleich zerstörerisch ist. Übrigens finden sich nicht mehr nur in sozialwissenschaftlichen, sondern auch in naturwissenschaftlichen Fachzeitschriften Beiträge, die fordern, die durch die Lebensweise der Reichsten verursachten Schäden und ihre völlig übertriebene CO2-Bilanz vorrangig ins Visier zu nehmen. (Damit man eine ungefähre Vorstellung bekommt: Der durchschnittliche CO2-Ausstoß von Milliardären soll im Jahr 2018 8190 Tonnen pro Kopf betragen haben, weltweit lag er bei fünf Tonnen pro Kopf.) Den Schwerpunkt auf die Superyachten zu legen entschuldigt eindeutig nicht andere Formen ebenso massiver Umweltverschmutzung, angefangen bei der durch Kreuzfahrtschiffe und ihre Tausenden Passagiere verursachten. Vielmehr gibt es eine ganze Bandbreite von Praktiken im Arbeits- und Freizeitbereich, die es zu überdenken gilt.
Abschließend möchte ich noch etwas zu der Reihe sagen, in der dieses Buch auf Französisch erschien, 16weil sie dessen ungewöhnlichen Stil außerhalb der akademischen Regeln erklärt. Die Reihe »L'ordinaire du capital« verfolgte bei ihrer Gründung die Absicht, durch die Veröffentlichung »literarischer Dokumente« zu einer Kritik des Alltagslebens beizutragen, wie es vom Kapitalismus geprägt wird. Seither pendeln die dort erschienenen Bücher zwischen Literatur, Journalismus und Sozialwissenschaften und scheuen sich nicht, Genres zu vermischen oder Grenzen zu verwischen. Das erklärt die Herangehensweise, die ich hier gewählt habe und die sich diverser Stilmittel bedient: der ersten Person, der Prosopopöie, Anflügen von Spott … Tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass dieses Thema eine zugleich ernsthafte und spielerische Behandlung erfordert. Es versteht sich jedoch von selbst, dass der Humor den Ernst nicht ausschließt. Während das Mittelmeer den einen als Spielplatz für ihre prunkvollen Schiffe dient, ist es für die anderen ein Ort des Todes: Tausende sterben jedes Jahr bei dem Versuch, mit zerbrechlichen Booten die europäischen Küsten zu erreichen.
17Koloss vor Anker
Wir fahren auf einer Landstraße, die am Südufer der Bucht von Saint-Tropez entlangführt, in die Stadt hinein. Unseren Wagen stellen wir auf dem Parkplatz des neuen Hafens ab. Die Ecke, in der wir uns anschließend die Beine vertreten, liegt zwischen der Feuerwache und dem VIP Room, einem der angesagten Clubs hier. Ich habe noch ein wenig Zeit, also tue ich etwas, das mir früher nicht in den Sinn gekommen wäre, denn alles, was mit dem offenen Meer zu tun hat, ist mir eigentlich immer todlangweilig erschienen: Ich will mir die Boote am Kai ansehen. Ich hoffe auf einen dicken Fisch – ich meine, von Weitem hätte ich in der Nähe des Leuchtturms ein großes Boot gesehen. Bis vor Kurzem hätte mich der Anblick der vertäuten Yachten oder vielmehr der Anblick der Schar von Gaffern, die diese vertäuten Yachten bestaunten – mich eingeschlossen –, betrüblich gestimmt. Aber man sollte keine Gelegenheit auslassen, nicht man selbst zu sein …
Zugegeben, den Weg zum Yachthafen schlage ich an diesem milden Vormittag (die Côte d'Azur macht ihrem Namen, den sie 1887 von dem Dichter Stéphen Liégeard bekam, alle Ehre: Himmel und Meer präsentieren sich im versprochenen Azurblau) keineswegs lustlos ein. Ich nehme mir die Zeit, ein bisschen zu 18bummeln und einen Blick auf die Charterangebote für Yachten in den Schaukästen zu werfen, an denen ich schon oft vorbeigegangen sein muss, ohne sie bemerkt zu haben. Die Büros sind geschlossen und die Lichter ausgeschaltet, aber die Annoncen sind weiterhin zu sehen. Mit einer Idee für eine Illustration im Kopf versuche ich, ein Foto zu machen, aber die Helligkeit lässt mein Spiegelbild in der Vitrine allzu deutlich erkennen, wie eine Doppelbelichtung. Anscheinend geht es nicht; ein neuer Versuch ist ebenso vergeblich wie der erste. Angesichts des wenig überzeugenden Resultats lasse ich die Sache fallen und verschiebe sie auf später, auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich auf dem Rückweg noch einmal hier vorbeikomme (und tatsächlich war die Chance endgültig vertan).
Ich begegne nicht vielen Leuten. Es geht auf die letzte Februarwoche zu. In dieser Jahreszeit sind die Straßen zwar nicht menschenleer, aber doch wenig frequentiert. Die dörfliche Ruhe steht in krassem Gegensatz zu dem Klischee, das man mit diesem Ort verbindet. Allenfalls kommen einem die Maler in den Sinn, die es vor gut 100 Jahren wegen des berühmten Lichts hierhergelockt hat. Trotz der damals unvorstellbaren Veränderungen ist etwas vom buntscheckigen Charme früherer Zeiten geblieben. Da stehe ich nun an der Rue de l'Annonciade, neben dem gleichnamigen Museum, während sich mein Blick auf den Hafen und die Maler richtet, die diesmal dem Klischee entsprechen. 19Auf der anderen Straßenseite beherrscht eine Luxusboutique in einer alten provenzalischen Villa den Platz wie ein Kondensat historischen Wandels.
Die unmittelbare Hafenumgebung ist deutlich belebter, auch wenn der Betrieb nicht annähernd mit dem irrsinnigen Ansturm im Sommer zu vergleichen ist. Auf dem Kai zögere ich einen Moment und überlege, ob ich einen Abstecher zu dem bekannten Café machen soll, das dank seiner roten Farbe nicht zu übersehen ist – nicht um einen Kaffee zu trinken, sondern um die Daten zu aktualisieren, die im Rahmen einer Langzeitstudie zu den gesellschaftlichen Beziehungen auf einer als soziologische Beobachtungsstelle geltenden Halbinsel gesammelt wurden. Die Erfassung der Preise vor Ort ist Bestandteil der Recherchen, und in diesem Fall möchte ich wissen, ob das kleine und das große Glas Bier einer gängigen Marke die Schwelle von 10 beziehungsweise 20 Euro überschritten haben. Aber ich setze meinen Weg fort, allerdings nicht ohne kurz innezuhalten und einen Blick auf einen Hafen-Stammgast zu werfen: die Sea Gull mit 40 Metern Länge, gebaut 1980, wie der Vintage-Look trotz eines drei Jahre dauernden Liftings erahnen lässt.
Dieser Ort sollte mich eigentlich an Guy de Maupassant und Paul Signac denken lassen, so verlangt es jedenfalls die Konvention. Als Maupassant diese Gegend 1888 an Bord seiner Yacht Bel-Ami erkundete, hielt er seine Eindrücke Tag für Tag fest und veröffent20lichte sie umgehend in einem Reisebericht. Signac, ebenfalls ein hervorragender Segler, las dieses Werk und war einige Jahre später an Bord der Olympia von diesem Ort so bezaubert, dass er ihn in einigen Gemälden unsterblich machte, unter anderem in Die rote Boje und Der Hafen bei Sonnenuntergang. Doch stattdessen denke ich an die amerikanische Anarchistin Emma Goldman, die hier ihre Memoiren schrieb – was die Lokalgeschichte längst vergessen hat. Als sie die Danksagungen in Gelebtes Leben