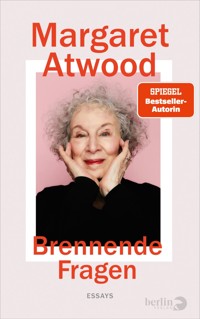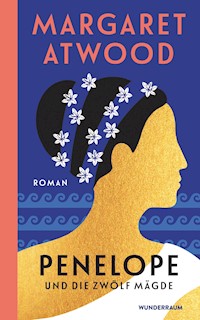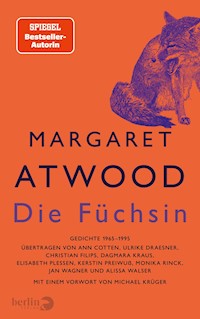17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Erstmals in deutscher Übersetzung - Margaret Atwoods fundierte, hochamüsante Literaturgeschichte Kanadas 1972 erschien »Survival« erstmals und sorgte für Stürme der Begeisterung wie der Empörung. Seitdem wird es gelesen, gelehrt, immer wieder aufgelegt - und nun, fast 50 Jahre danach, endlich auch ins Deutsche übersetzt. Margaret Atwood fragt darin: Womit hat unsere Literatur sich im Wesentlichen beschäftigt? Ihre provokante Antwort erläutert sie in zwölf geistreichen, leidenschaftlichen Kapiteln. Als eine der Ersten betont sie die Bedeutung der Geschichten der First Nations, liest die kanadischen »Klassiker« neu und formte so die Eigenwahrnehmung ihrer Landsleute. Für die Neuausgaben je um ein Vorwort ergänzt, gilt Margaret Atwoods visionärer Wurf nach wie vor als das wohl interessanteste und prägendste Buch über die kanadische Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Übersetzung aus dem kanadischen Englisch von Yvonne Eglinger
Die Originalausgabe erschien 1972 unter dem Titel »Survival« bei House of Anansi Press, Toronto
© 1972 O. W. Toad Ltd
© Introduction 2004 O. W. Toad Ltd
© Introduction 2013 O. W. Toad Ltd
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2021
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München nach einem Entwurf von Brian Morgan
Covermotiv: Mathieu Lavoie
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Zitate
Vorwort
Was, warum und wo ist Hier?
1 Survival – Überleben
Ich begann schon …
2 Die Natur als Ungeheuer
Gedichte, die Schilderungen von …
3 Tiere als Opfer
Man sollte annehmen …
4 Ureinwohner
Bis in jüngste Zeit …
5 Totems unserer Ahnen
Bisher haben wir …
6 Familienporträt
In diesem Kapitel …
7 Vergebliche Opfer
Eines der ersten …
8 Der zufällige Todesfall
In den letzten …
9 Der gelähmte Künstler
Bisher haben wir …
10 Frauen aus Eis gegen Mütter der Erde
Ich weiß noch, …
11 Quebec: Brennende Herrenhäuser
Ich gehe dieses Kapitel …
12 Ausbrüche und Neuschöpfungen
Für mich war es …
Survival: Fast so etwas wie meine Memoiren
Einleitung für die Ausgabe im Jahr 2003
Literaturverzeichnis
Dank
Für Jay Macpherson
Northrop Frye, D. G. Jones,
James Reaney, Eli Mandel
und Dennis Lee
Wir sollen unsere Glieder ausrenken und sie zur
Gliederung in eine Reihe legen
Um zu sehen, was fehlt
Um das Gelenk zu finden, das aus den Fugen ist
Denn es ist unvorstellbar dazusitzen
und still
den Körper dieses Todes zu akzeptieren …
– Saint-Denys Garneau,»Der Körper dieses Todes«
Es in schlichten Worten zu sagen,
lässt mich erkennen, wie ich das Falsche fürchtete.
– Margaret Avison,»Die Agnes Cleves Papers«
Vorwort
Er will nicht über Kanada sprechen … Da hast du das kanadische Dilemma in einem Satz. Über Kanada will niemand sprechen, nicht mal wir Kanadier. Du hast recht, Paddy. Kanada ist stinklangweilig.
– Brian Moore,Ginger Coffey sucht sein Glück
Jene, die nach einer kanadischen Identität suchen, haben nicht begriffen, dass man sich nur mit etwas identifizieren kann, das man auch zu sehen oder zu erkennen vermag. Man braucht zumindest ein Bild im Spiegel. Doch kein anderes Land schert sich genug um uns, um uns ein Bild von uns selbst zurückzuspiegeln, und sei es eines, das wir übel nehmen könnten. Und offenbar schaffen wir selbst es auch nicht, denn bislang glich all unser Bemühen in diese Richtung dem der drei blinden Männer, die einen Elefanten zu beschreiben versuchen. Ein paar der Beschreibungen hatten ihren Wert, aber zusammen ergeben sie etwas Bruchstückhaftes, Unkenntliches. Womit sollen wir uns identifizieren?
– Germaine Warkentin,»Ein Bild in einem Spiegel«
Es ist richtig, dass kein Partikularismus das Gute angemessen verkörpern kann. Doch ist es nicht ebenfalls richtig, dass die Menschen nur durch partikuläre Wurzeln, wie unvollkommen diese auch sein mögen, erstmals begreifen können, was gut ist? Und gerade der Saft solcher Wurzeln nährt für die meisten Menschen ihre Teilhabe an einem umfassenderen Guten.
– George Grant,Technologie und Empire
Mir scheint, dass die kanadische Empfindsamkeit zutiefst gestört wurde, weniger durch unser berühmtes Identitätsproblem, so wichtig es auch sein mag, als vielmehr durch eine Reihe von Paradoxien, denen sich diese Identität gegenübersieht. Die Frage »Wer bin ich?« ist für sie weniger verwirrend als das Rätsel, das in etwa so lautet: »Wo ist Hier?«
– Northrop Frye,Der Buschgarten
Da die Karten verloren, die Reisen
vor Jahren per Gesetz beendet wurden,
ist dies ein namenloses Gebiet geworden.
– Margaret Avison,»Nicht die liebliche Süßdolde aus Gerard’s Herball«
Was, warum und wo ist Hier?
Als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, wollte ich ein kurzes, praktisches Handbuch zur kanadischen Literatur erstellen, im Wesentlichen für Schüler und all die Lehrenden an Highschools, Universitäten und in der beruflichen Bildung, die sich unverhofft der Aufgabe gegenübersahen, ein Fach zu unterrichten, das sie niemals selbst studiert hatten: kanadische Literatur – Canlit. Dank meiner eigenen Auseinandersetzung mit genau diesem Problem wusste ich, dass es schon eine beträchtliche Menge verfügbaren Lehrmaterials gab, dass dieses jedoch vornehmlich aus pauschalen historischen Überblicken, Einzelbiografien oder tiefschürfenden akademischen Studien bestand, die sich häufig mit vergriffenen Werken beschäftigten. In Kanada gibt es viele Autoren und viele Bücher, aber nur wenige offensichtliche Klassiker. Das führt dazu, dass all jene, die Quellen zusammen- oder Informationen bereitstellen, immer wieder auf lange Autoren- und Titellisten zurückgreifen, durch die sich der künftige Leser oder Lehrer wühlen und dabei auswählen muss, so gut er eben kann. Doch früher oder später wird so oder ähnlich die unvermeidliche Frage laut: »Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit ihm (und nicht mit Faulkner)?«, »Warum müssen wir eigentlich das hier lesen (und nicht Hermann Hesse)?«. Oder, als Quintessenz: »Was ist das Kanadische an kanadischer Literatur, und warum interessiert uns das?«
Bevor ich versuche, diese Frage zu beantworten, sollte ich klarstellen, was dieses Buch nicht ist:
Es ist keine ausführliche, umfängliche oder ganzheitliche Abhandlung über kanadische Literatur. Davon gibt es bereits einige, sie sind tatsächlich allumfassend, und daher ziemlich lang. Da dieses Buch kurz ist, muss es viele wichtige und gute Werke außer Acht lassen. Ich verfolge nicht den Anspruch, dass meine Zitate eine »ausgewogene« Übersicht aller je in Kanada geschriebenen Werke ergeben, und das aus ein paar guten Gründen.
Der erste lautet, dass ich eher Schriftstellerin als Wissenschaftlerin oder Fachfrau bin, und ich habe meine Beispiele so gewählt, wie sie mir selbst untergekommen sind; nicht durch Studium oder Recherche, sondern im Verlauf eigener Lektüre. Der zweite Grund lautet, dass dieses Buch Strukturen behandelt, und nicht Autoren oder Einzelwerke. Es geht mir nicht darum, Beispiele von vergleichbarer Länge schön säuberlich nebeneinanderzustellen, sondern Strukturen so klar wie möglich herauszuarbeiten aus Themen, Bildern und Einstellungen, die unsere Literatur zusammenhalten. Falls es diese Strukturen wirklich gibt, wird man Abwandlungen davon auch in Werken anderer Autoren finden, die ich vielleicht übersehen oder nicht miteinbezogen habe, weil eine Struktur anderswo deutlicher zutage tritt, oder weil ich von ihnen überhaupt noch nie etwas gehört habe. Ein Leser, der diesen Ansatz lohnend findet, wird sich mit meinen Beispielen nicht zufriedengeben. Sie dienen lediglich als Anregung.
Es ist keine Darstellung einer historischen Entwicklung. Deshalb beginnt Survival auch nicht mit den ersten Büchern, die je in Kanada geschrieben wurden, und arbeitet sich dann weiter voran bis in die Gegenwart. Es ist nützlicher, zuerst die Situation zu erfassen, in der man sich gerade befindet, wie immer sie aussehen mag, und dann nachzuvollziehen, wie man hineingeraten ist. Daher werden Sie hier wenig über die sogenannten Confederation Poets aus Kanadas Gründungszeit oder über alte Pelzhändlertagebücher lesen. Ich leugne nicht deren Bedeutung, aber ich bezweifle, dass sie der beste Einstieg ins Thema sind. Die meisten meiner Beispiele, wenn auch nicht alle, stammen aus dem zwanzigsten Jahrhundert und viele aus den letzten paar Jahrzehnten.
Es ist nicht wertend. Ich unterlasse es nach Möglichkeit, Verdienstorden auszuteilen, und kein lesender Bewunderer sollte sich euphorisch bestätigt oder zurückgesetzt fühlen, weil sein Lieblingsautor Erwähnung findet oder auch nicht. Ich versuche zwar, Bücher auszusparen, die ich selbst langweilig finde, aber dennoch geht es mir hier nicht um »gute Literatur« oder »guten Stil« oder »literarische Meisterleistungen«. Ich schreibe über das »Hier«.
Es ist nicht biografisch angelegt. Sie werden hier keinerlei Einzelheiten zum fraglos fesselnden Privatleben der jeweiligen Autoren finden. Ich habe die Bücher so behandelt, als hätte Kanada selbst sie geschrieben; eine Fiktion, der Sie hoffentlich zeitweise folgen werden. Diese Fiktion behebt ein gewisses Ungleichgewicht: Wir alle wissen, dass Autoren ein Privatleben haben, aber bis vor Kurzem wurden unsere Autoren so behandelt, als hätten sie nur ein Privatleben. Autoren sind jedoch auch Übermittler ihrer Kultur.
Es ist nicht besonders originell. Viele der hier aufgeführten Gedanken sind schon seit einigen Jahren im Umlauf, tauchen in Fachzeitschriften und privaten Gesprächen auf. Mein Buch verhält sich dazu wie eine Vitaminpille zu einem Gourmetmenü: Es hat den Vorteil, dass es günstiger zu bekommen und schneller zu schlucken ist, doch es verzichtet auf die meisten Nuancen und Finessen. Außerdem übergeht es so manche Kleindebatte, die auch endlich mal geführt werden könnte. Diese Fummelarbeit überlasse ich anderen, die an solcherlei Unternehmungen möglicherweise mehr Freude haben.
Aber, so fragen Sie sich jetzt vielleicht, wenn mein Buch weder begutachtet noch bewertet, keine historischen oder biografischen Informationen bietet und keine originellen und brillanten Erkenntnisse liefert, wozu ist es dann eigentlich gut? Nun, es bemüht sich um eine einzige, einfache Sache. Es skizziert eine Reihe von Grundstrukturen, die – so meine Hoffnung – wie die feldornithologischen Merkmale in Vogelbüchern funktionieren: Sie sollen Ihnen dabei helfen, eine Gattung von allen anderen zu unterscheiden, die kanadische Literatur von all den anderen Literaturen, mit denen sie oft verglichen oder verwechselt wird. Jede dieser Grundstrukturen muss in der kanadischen Literatur insgesamt häufig genug vorkommen, damit sie bedeutsam wird. Zusammengenommen ergeben diese Grundstrukturen die Gestalt der kanadischen Literatur, insofern sie kanadische Literatur ist, und diese Gestalt bildet zudem ein nationales Denkmuster ab.
Als Sammlung von Strukturen kann dieses Buch vielseitig eingesetzt werden. Man kann die Strukturen auf Bücher anwenden, die hier nicht erwähnt werden, um ihre Gültigkeit zu überprüfen. Oder man kann sich durch alle der genannten Strukturen lesen, zum Beispiel anhand eines Buches aus jedem Kapitel. Oder es können ein oder zwei Strukturen eingehender untersucht werden. (Lehrern aus Gegenden, in denen allzu vulgäre Sprache immer noch Unruhe auslöst, empfehle ich das dritte Kapitel; da geht es um Tiere, die glücklicherweise weder Englisch noch Französisch sprechen, ob heilig oder heidnisch.) Und noch ein Hinweis: Lesen Sie die Zitate zu Beginn jedes Kapitels. Sie wurden sorgfältig ausgewählt.
Hier also eine Beschreibung dessen, was ich zu schreiben beabsichtigt habe: etwas, das kanadische Literatur, als Kanadische Literatur – nicht bloß als Literatur, die zufällig in Kanada geschrieben wurde –, auch anderen Personen als Wissenschaftlern und Experten zugänglich machen soll, und zwar auf schlichte und zweckmäßige Weise. Doch ich muss feststellen, dass ich noch ein wenig mehr geschrieben habe: eine Mischung aus einer persönlichen Stellungnahme – was auf die meisten Bücher zutrifft – und einem politischen Manifest – was ebenfalls auf die meisten Bücher zutrifft, wenn auch eher zufällig. Bis vor Kurzem war das Lesen kanadischer Literatur für mich und alle anderen, die es taten, ein Privatvergnügen, denn diese Literatur wurde in der Öffentlichkeit weder gelehrt noch nachgefragt oder auch nur erwähnt (außer mit Spott). Wie bei so vielen, die vor, sagen wir, 1965 mit ihr in Berührung kamen, setzte ich mich vor allem als Schriftstellerin mit ihr auseinander, nicht als Studentin oder Lehrende, und manche, wenn auch längst nicht alle der Strukturen, mit denen ich mich hier beschäftige, wurden mir zuerst durch meine eigene Arbeit bewusst. Und durch mein Erstaunen darüber, dass ich die Belange dieser Arbeit mit Schriftstellern teilte, mit denen ich – so musste ich feststellen – offenbar zu einer kulturellen Gemeinschaft gehörte, die für mich nie fest definiert gewesen war. Ich schreibe in diesem Buch nur wenig über mein eigenes Werk, weil ich der Meinung bin, dass jeder Schriftsteller selbst sein heikelster Kritiker ist. Dennoch nähere ich mich vielen der Strukturen, und den ihnen innewohnenden Problemen, aus dem Blickwinkel der Schreibenden; vielleicht der beste Blickwinkel überhaupt, da auch die Schriftsteller selbst die Strukturen auf diese Weise angehen. Die Antwort auf die Frage »Worüber kann man in diesem Land lesen?« ist tatsächlich auch die Antwort auf die Frage »Worüber kann man in diesem Land schreiben?«.
Das Verfassen kanadischer Literatur ist historisch gesehen immer ein sehr privater Akt gewesen, von dem ein Publikum ausgeschlossen war, denn lange Zeit gab es keines. Die Lehre kanadischer Literatur hingegen ist ein politischer Akt. Wenn man es schlecht anpackt, werden die Leute womöglich noch gelangweilter von ihrem Land, als sie es sowieso schon sind; wenn man es gut macht, zeigt man ihnen vielleicht, warum ihnen vermittelt wurde, von ihrem Land gelangweilt zu sein, und wem diese Langeweile nützt.
Aber zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Der erste Teil – »Was ist das Kanadische an kanadischer Literatur?« – wird, so hoffe ich, im weiteren Verlauf dieses Buches beantwortet. Der zweite Teil – »Was wollen wir eigentlich damit?« – sollte überhaupt keiner Antwort bedürfen, denn keine Nation mit ein wenig Selbstachtung würde sie jemals stellen. Doch das ist eines unserer Probleme: Kanada besitzt keine Selbstachtung, und die Frage wird gestellt. Darum.
Die Antworten, die man aus der Literatur schöpft, hängen von den Fragen ab, die man stellt. Wenn man fragt: »Warum schreiben Schriftsteller?«, wird die Antwort psychologisch oder biografisch ausfallen. Wenn man fragt: »Wie schreiben sie?«, erhält man vielleicht eine Antwort wie »Mit einem Stift« oder »Unter Mühen«, oder man bekommt erklärt, wie Bücher komponiert werden, eine Antwort, die das Buch als in sich geschlossenes Wortgebilde sieht und Stil und Form berücksichtigt. Das sind vollkommen berechtigte Fragen. Ich aber beschäftige mich hier mit der folgenden: »Worüber schreiben Schriftsteller?«
Die Figur Stephen Dedalus aus James Joyces Ein Porträt des Künstlers als junger Mann schaut sich das Vorsatzblatt seines Geografiebuches an und entdeckt eine Liste, die er dort niedergeschrieben hat:
Stephen Dedalus
Elementarklasse
Clongowes Wood College
Sallins
County Kildare
Irland
Europa
Die Welt
Das Universum
Diese Liste umfasst so ziemlich alles, worüber ein Mensch schreiben und wovon er somit lesen kann. Sie beginnt mit dem Persönlichen, fährt fort mit dem Sozialen oder Kulturellen oder Nationalen und endet mit »Das Universum«, dem Universalen. Jedes erzählende oder dichterische Werk kann Elemente aller dieser drei Bereiche enthalten, mag sich ihr Verhältnis auch ändern: Liebeslyrik ist in der Regel eher persönlich oder universal als national, ein Roman kann sich um eine Familie oder das Leben eines Politikers drehen, und so weiter. In Kanada gab es zumindest in Highschools und der universitären Lehre bisher die Tendenz, das Persönliche und das Universale zu betonen, das Nationale und Kulturelle jedoch auszublenden. Das ist ungefähr so, als wollte man jemandem die menschliche Anatomie beibringen, indem man sich nur den Kopf und die Füße vornimmt. Das wäre also ein guter Grund, kanadische Literatur zu lesen: Es vermittelt eine vollständigere Vorstellung davon, wie alle Literatur erschaffen wird. Sie wird von Menschen erschaffen, die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort leben, und das begreift man besser, wenn Zeit und Ort die eigenen sind. Wenn man ausschließlich die Werke toter Ausländer liest, verstärkt man damit sicherlich die Ansicht, dass Literatur nur von toten Ausländern geschrieben sein kann.
Doch es gibt noch einen Grund, der nichts mit dem Leser als Literaturstudenten zu tun hat, sondern mit dem Leser als Bürger. Ein Kunstwerk kann einerseits ein Genussmittel und andererseits (laut Germaine Warkentin) ein Spiegel sein. Der Leser blickt in den Spiegel und sieht nicht den Schriftsteller, sondern sich selbst; und hinter seinem eigenen erkennt er ein Abbild der Welt, in der er lebt. Wenn einem Land oder einer Kultur solche Spiegel fehlen, kann dieses Land niemals feststellen, wie es aussieht; es muss sich blindlings vorantasten. Wenn man, wie es in diesem Land lange der Fall war, dem Betrachter einen Spiegel gibt, der nicht ihn selbst, sondern jemand anderen zeigt, und ihm zugleich erzählt, dass das Spiegelbild ihn selbst darstelle, wird er eine sehr verfälschte Vorstellung seines Aussehens erhalten. Er wird zudem eine verfälschte Vorstellung davon erhalten, wie andere Menschen aussehen, denn man kann nur schwer herausfinden, wie irgendwer ist, wenn man nicht weiß, wie und wer man selbst ist. Selbsterkenntnis kann natürlich unangenehm sein, und das Ausmaß, in dem die kanadische Literatur auf ihrem eigenen Gebiet vernachlässigt wurde, lässt aufseiten der Kanadier unter anderem eine Angst erahnen, sich selbst zu erkennen. Außerdem deutet die große Zahl von Spiegel- und Spiegelungsbildern in unserer Literatur auf eine Gesellschaft hin, die sich auf vergeblicher Suche nach einem Bild, einer Spiegelung als Antwort befindet, wie bei A. M. Kleins verrücktem Dichter, der »den ganzen Tag einen Spiegel anstarrt, als wollte er / sich selbst erkennen«.
Es finden sich natürlich auch Spiegelbilder von uns in anderen Literaturen als der kanadischen. Es gibt den gelassenen, fröhlichen, holzfällenden, Waldmurmeltiere verspeisenden »Kanadier« aus Thoreaus Walden; es gibt Edmund Wilson, der schreibt: »In meiner Jugend zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts stellten wir uns Kanada meist wie ein für Amerikaner praktisch gelegenes riesiges Jagdrevier vor.« (Ganz genau, Edmund.) In Malcolm Lowrys Unter dem Vulkan ist Kanada für den Protagonisten das kühle Land der Träume, der ersehnte Ausweg. Wenn er es nur irgendwie aus dem schwülheißen Mexiko dorthin schaffen kann, wird alles gut. Es gibt Shreve, den rosig-grauen kanadischen Zimmergenossen des Protagonisten Quentin aus Faulkners Absalom, Absalom!, der gesund lebt, Atemübungen macht und als Zuhörer für Quentins endloses Lamento dient. Und spaßeshalber erwähne ich auch den Kanadier, der in Radclyffe Halls Quell der Einsamkeit, dem ersten lesbischen Roman, die Freundin der Protagonistin abschleppt: Er ist muskulös, tüchtig, gesichtslos und heterosexuell. Das bildet mehr oder weniger die Bandbreite Kanadas ab, wie es in der »internationalen« Literatur wahrgenommen wird: ein Ort, an den man aus der »Zivilisation« flieht, ein unberührtes, unverdorbenes Land, das man sich leer vorstellt, oder bevölkert von glücklichen, altmodischen Bauern oder Sportlehrern, wunderlich, stumpf oder beides. Wenn man in Kanada produzierte Bierwerbung oder Reiseliteratur sieht, beschleicht einen oft das ungute Gefühl, dass sich die Leute, die diese Bilder verbrochen haben, auf genau solche Spiegelungen stützen, denn so will alle Welt, drinnen und draußen, Kanada sehen. Doch die kanadische Literatur selbst erzählt eine vollkommen andere Geschichte.
Wenn man fordert, seine eigene Literatur zu lesen, um zu verstehen, wer man ist, und um nicht als eine Art Kulturtrottel dazustehen, ist das nicht gleichbedeutend mit der Forderung, überhaupt nichts anderes als diese Literatur zu lesen, auch wenn die kulturellen »Internationalisten« oder Kanada-zuletzt-Verfechter das manchmal glauben möchten. Ein Leser kann nicht von Canlit allein leben, und man tut der kanadischen Literatur keinen Gefallen, wenn man es versucht. Würde ein Außerirdischer auf einer einsamen Insel abgesetzt und man gäbe ihm nichts als alle vorhandene kanadische Literatur zu lesen, wäre er vollkommen außerstande, sich irgendetwas Aussagekräftiges über kanadische Literatur zu erschließen, denn er könnte sie mit nichts vergleichen; er würde annehmen, es handele sich um die menschliche Literatur an sich. Das Studium kanadischer Literatur sollte jedoch vergleichend sein, so wie das Studium jeder Literatur, denn erst durch Gegensätze treten charakteristische Strukturen klar hervor. Um uns selbst zu kennen, müssen wir unsere Literatur kennen; um uns genau zu kennen, müssen wir sie als Teil der Gesamtliteratur kennen.
Doch in Kanada, so behauptet Northrop Frye, ist die Antwort auf die Frage »Wer bin ich?« zumindest teilweise identisch mit der Antwort auf eine andere Frage: »Wo ist Hier?« »Wer bin ich?« ist eine angemessene Frage in Ländern, in denen die Umwelt, das »Hier«, bereits klar definiert ist, so sehr sogar, dass sie das Individuum möglicherweise zu überwältigen droht. In Gesellschaften, wo alles und jedes seinen festen Platz hat, muss ein Mensch möglicherweise darum kämpfen, sich von seinem gesellschaftlichen Hintergrund abzuheben, um nicht bloß einem übergeordneten Gefüge zu dienen.
»Wo ist Hier?« ist eine andere Art Frage. Der Mensch stellt sie, wenn er sich auf unbekanntem Terrain wiederfindet. Und sie beinhaltet weitere Fragen: Wo befindet sich jener Ort im Verhältnis zu anderen Orten? Wie finde ich mich dort zurecht? Wenn der Mensch sehr verloren ist, fragt er sich vielleicht sogar, wie er »hier« überhaupt gelandet ist, und hofft, dass er den richtigen Weg oder sogar einen Ausweg findet, indem er den gleichen Weg wieder zurückgeht. Wenn das nicht möglich ist, muss er sich darüber klar werden, was »Hier« für die Bedürfnisse menschlichen Lebens zu bieten hat, und sich überlegen, wie er am Leben bleibt. Ob er überlebt oder nicht, hängt zum Teil davon ab, wie »Hier« tatsächlich beschaffen ist – ob es für ihn zu heiß, zu kalt, zu feucht oder zu trocken ist –, und zum Teil von seinen eigenen Wünschen und Fähigkeiten – ob er die verfügbaren Ressourcen nutzen kann, sich an das anpasst, was für ihn nicht zu ändern ist, und dabei möglichst nicht durchdreht. Vielleicht sind schon andere Menschen »hier«; Ureinwohner, die ihm hilfsbereit, gleichgültig oder feindselig gegenüberstehen. Vielleicht gibt es Tiere, die man zähmen kann, töten und verspeisen oder meiden muss. Falls jedoch eine zu große Diskrepanz zwischen den Erwartungen unseres Helden und seiner Umwelt herrscht, erfährt er vermutlich einen Kulturschock oder bringt sich um.
Es gibt eine schöne Szene in Carol Bolts Theaterstück Büffelsprung: In den 1930er-Jahren lässt ein Highschool-Lehrer seine Schüler die Namen aller Ehefrauen Heinrichs VIII. aufzählen, während am Fenster gerade ein Protestmarsch vorbeizieht. Er weist sie darauf hin, sie seien nicht in der Schule, um sich Paraden anzusehen, und das fasst die über etliche Jahrzehnte vorherrschende Haltung gegenüber kanadischer Geschichte und Kultur ziemlich gut zusammen: Geschichte und Kultur finden anderswo statt, und wenn man sie direkt vor dem Fenster erblickt, sollte man nicht hinsehen.
Die Frauen Heinrichs VIII. können dabei für die Flut von Werten und Artefakten stehen, die von außen hereindrängen, von »dort«; aus Amerika, England oder Frankreich. Die Werte und Artefakte – die genauso gut als Comic-Hefte, Porträts der Queen, die Ed Sullivan Show oder Protestmärsche nach Ottawa (!) gegen den Krieg in Vietnam daherkommen können – deuten an, dass »dort« immer wichtiger ist als »hier« oder dass »hier« nur eine andere, minderwertige Variante von »dort« ist. Sie machen die Werte und Artefakte, die von »hier« stammen, unsichtbar, sodass die Leute etwas ansehen, ohne es wirklich wahrzunehmen, oder sie sehen es zwar, halten es aber für etwas anderes. Ein Mensch, der »hier« ist, aber lieber anderswo wäre, ist ein Vertriebener oder Gefangener; ein Mensch, der »hier« ist, aber glaubt, anderswo zu sein, ist geisteskrank.
Doch wenn man hier ist und nicht weiß, wo man sich überhaupt befindet, weil man seine Wegmarken falsch gesetzt oder die Orientierung verloren hat, dann muss man kein Vertriebener oder Wahnsinniger sein: Man hat sich einfach nur verirrt. Das bringt uns zurück zu unserem Bild des Mannes auf unbekanntem Terrain. Kanada ist unbekanntes Terrain für seine Einwohner, und ich meine damit nicht, dass Sie vielleicht noch keine Reise in die Arktis oder nach Neufundland gemacht, noch nicht – wie es in den Reisebroschüren steht – Unser Großes, Weites Land erkundet haben. Ich spreche von Kanada als Gemütszustand, als dem Raum, den man nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit dem Kopf bewohnt. In genau diesem Raum haben wir uns verirrt.
Ein Mensch, der sich verirrt hat, braucht eine Landkarte, mit einer Markierung des eigenen Standorts darauf, sodass er erkennen kann, wo er sich im Verhältnis zu allem anderen befindet. Die Literatur ist nicht nur ein Spiegel, sie ist auch eine Landkarte, eine Geografie des Geistes. Unsere Literatur kann eine solche Landkarte sein, sofern wir lernen, sie als unsere Literatur zu lesen, als das Ergebnis dessen, wer und wo wir schon gewesen sind. Wir brauchen dringend eine solche Karte, wir müssen übers Hier Bescheid wissen, denn hier leben wir. Für die Menschen eines Landes oder einer Kultur ist das gemeinsame Wissen über ihren Platz, ihr Hier, kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Ohne dieses Wissen werden wir nicht überleben.
1 Survival – Überleben
Wenn deine Liebe ein saurer Nachgeschmack
im Mund ist, werde zum Grund
für Entschuldigungen, überlebe.
…
Wenn dein Gesicht im Silberspiegel
flach wird, halte durch;
halte durch, wenn du kannst, und überlebe.
– John Newlove,»Wenn du kannst«
Es ist die Zeit des Todes
und die Angst überhaupt niemals
gelebt zu haben
macht die Jungen irr
wenn Schweine, die der Schlachtung entkamen
Dutzende vergorene
Äpfel fressen und trunken durch
leere Wälder stürmen
und Jäger anderswo
das Handwerk lernen
– Al Purdy,»Herbst«
… Lionel war einsam. Die Monate vergingen. Lionel war einsam. Die Monate vergingen. Sie standen einander zu nahe. Insgeheim wollte Lionel auf einen Baum klettern und bei seiner eigenen Beerdigung zusehen. Er wusste das nicht …
– Russell Marois,Der Telegrafenmast
Sentimental fühle ich mich,
nur wenn ich zu Hause bin
in meinem Slum mit sechzig Dollar Miete,
und kanadisch fühle ich mich,
nur wenn ich wem in den Hintern krieche.
– John Newlove,»Wie ein Kanadier«
Worte zu finden für unser Leiden
zu genießen, was wir leiden müssen –
keine stummen Tiere zu sein …
…
… Wir werden überleben
und wir werden
irgendwie in den Sommer kommen …
– D. G. Jones,»Hinterm Busch halten: Weihnachten 1963«
Ich begann schon in jungen Jahren mit der Lektüre kanadischer Literatur, wusste jedoch nicht, dass es sich um kanadische Literatur handelte. Tatsächlich war mir nicht bewusst, dass ich in einem Land lebte, das so etwas wie eine eigenständige Existenz besaß. In der Schule brachte man uns bei, »Rule, Britannia« zu singen und den Union Jack, die britische Flagge, zu zeichnen. Nach dem Unterricht lasen wir stapelweise Comics über Captain Marvel, Plastic Man und Batman, ein Vergnügen, das durch das Missfallen unserer Eltern noch gesteigert wurde. Irgendjemand hatte uns aber auch Charles G. D. Roberts’ Könige im Exil zu Weihnachten geschenkt, und ich schluchzte mich rasch durch die herzzerreißenden Geschichten über eingesperrte, gefangene und gepeinigte Tiere. Danach war Ernest Thompson Setons Wilde Tiere, die ich kannte dran, womöglich noch erschütternder, weil die Tiere wirklicher erschienen – sie lebten in Wäldern, nicht im Zirkus – und ihr Sterben banaler war: nicht das Sterben von Tigern, sondern von Kaninchen.
Niemand bezeichnete diese Geschichten als kanadische Literatur, und falls doch, hätte es mich kein bisschen interessiert; für mich waren diese Bücher einfach frisches Lesefutter, neben Walter Scott, Edgar Allan Poe und Donald Duck. Ich war bei meiner Lektüre nicht wählerisch und bin es auch heute noch nicht. Ich las damals vor allem zur Unterhaltung, so wie heute. Und ich meine das nicht entschuldigend: Ich finde, wenn man die spontane Gefühlsreaktion beim Lesen ausklammert – die Begeisterung oder Spannung oder einfach die Freude daran, eine Geschichte erzählt zu bekommen – und versucht, sich zuerst auf die Bedeutung oder die Form oder die »Botschaft« zu konzentrieren, kann man es auch sein lassen; Arbeit allein macht nun mal nicht glücklich.
Doch damals wie heute gab es verschiedene Grade der Unterhaltung. Ich las die Rückseite von Cornflakes-Packungen zum Zeitvertreib, Captain Marvel und Walter Scott als Flucht aus dem Alltag – selbst damals war mir klar: Wo ich auch lebte, dort war es nicht, denn ich hatte noch nie ein Schloss gesehen, und auch das auf dem Comic-Umschlag beworbene Eis am Stiel gab es in Kanada nicht zu kaufen, oder wenn, dann teurer – aber Seton und Roberts las ich als etwas, das, ob Sie es glauben oder nicht, dem echten Leben näher war. Tiere hatte ich schon gesehen, sogar eine ganze Menge davon; ein sterbendes Stachelschwein war für mich wirklicher als ein Ritter in Rüstung oder Clark Kents Metropolis. Alte, moosige Verliese und Kryptonit waren in meiner Heimat Mangelware, auch wenn ich gern glauben wollte, dass es sie anderswo gab; aber die Materialien für Setons Objekte aus Stöcken und Steinen und die aus der Natur stammenden Zutaten für Ellsworth Jaegers Rezepte ausWildwood Wisdom gab es überall; wir konnten das alles recht einfach nachmachen und taten es auch. Die meisten dieser Gerichte waren einigermaßen ungenießbar – probieren Sie doch einmal den Eintopf aus Rohrkolbenwurzeln oder die Pollenpfannkuchen –, aber die Grundzutaten findet man rund um jedes kanadische Sommerhäuschen.
Und nicht nur der Inhalt dieser Bücher fühlte sich wirklicher für mich an. Auch ihre Form, ihre Struktur. Die Tiergeschichten handelten vom Überlebenskampf, und Setons praktische Ratgeber waren im Grunde Überlebenshandbücher. Sie wiesen nachdrücklich auf mögliche Gefahren hin: sich verirren, die falsche Wurzel oder Beere essen oder einen Elch in der Brunftzeit reizen. Obwohl sie vor nützlichen Tipps nur so strotzten, bildeten sie eine Welt voller Fallgruben ab, so, wie auch die Tiergeschichten von Fangeisen und Schlingen durchsetzt waren. In dieser Welt stürzte sich kein Superman in letzter Sekunde vom Himmel, um einen vor der Katastrophe zu retten; kein Reiter erschien spornstreichs mit des Königs Begnadigung. Das Wichtigste war, am Leben zu bleiben, und nur durch eine Mischung aus List, Erfahrung und knappem Entrinnen konnte dies dem Tier – oder dem sich selbst überlassenen Menschen – gelingen. Und es gab, zumindest in den Tiergeschichten, keine endgültigen Happy Ends oder perfekten Lösungen. Falls das Tier in der Geschichte durch Glück seiner Notlage entrann, wusste man doch, dass später eine andere folgen würde, der es zum Opfer fallen musste.
Damals analysierte ich die Dinge natürlich nicht so gründlich. Ich lernte einfach, was man zu erwarten hatte: In Comics und Büchern wie Alice im Wunderland oder Conan Doyles Die vergessene Welt wurde man gerettet oder kehrte aus der Welt der Gefahren wieder in sein heimeliges, sicheres Leben zurück; bei Seton und Roberts nicht, denn die Welt der Gefahren war mit der echten Welt identisch. Doch als ich während der Highschool auf etwas stieß, das deutlicher als kanadische Literatur gekennzeichnet war, wieder ein Weihnachtsgeschenk, nämlich die Anthologie Kanadische Kurzgeschichten, von Robert Weaver und Helen James herausgegeben, überraschte mich das nicht. Da waren sie wieder, die flüchtenden Tiere, diesmal größtenteils in Menschengestalt, und diese Menschen mussten sich behaupten. Da gab es den winzigen Fehler, der in die Katastrophe führte, da gab es den verhängnisvollen Unfall. Es war eine Welt erfrorener Leiber, toter Erdhörnchen, voll Schnee, toter Kinder und einem beständigen Gefühl der Bedrohung. Keine Bedrohung durch einen böswilligen Feind, sondern durch die gesamte Umwelt. Die vertraute Gefahr lauerte hinter jedem Busch – und ich kannte die Namen jedes einzelnen Buschs. Noch einmal: Ich las das alles nicht als Canlit, ich las es einfach bloß. Ich weiß noch, wie mich einige dieser Geschichten begeisterten (besonders James Reaneys »Der Bully«), andere mich ziemlich kaltließen. Doch sie alle fühlten sich für mich auf eine Weise echt an, wie es Charles Dickens, so gern ich ihn auch las, nicht vermochte.
Ich schreibe hier nicht von diesen frühen Erfahrungen, weil ich sie für typisch halte, sondern weil ich sie – ganz im Gegenteil – für sehr untypisch halte. Ich bezweifle, dass viele Menschen meines Alters auch nur diese geringe Leseerfahrung ihrer eigenen Literatur besaßen, so eingeschränkt und zufällig sie in meinem Fall auch war. (Wo ich das so schreibe, fühle ich mich ungefähr wie 102, denn seither hat sich einiges verändert. Doch obwohl hier und dort in unserem Land neue Lehrpläne aufgestellt werden, bin ich noch nicht überzeugt, dass das durchschnittliche kanadische Kind oder der durchschnittliche Highschool-Schüler mit mehr kanadischer Literatur in Berührung kommt, als es damals bei mir der Fall war. Und genau das ist natürlich Teil unseres Problems.)
Dennoch, obgleich ich nur wenige kanadische Werke las, besaßen sie immerhin ihre eigene Form, die sich anders anfühlte als die Formen anderer Bücher. Als was sich diese Form entpuppte, und was sie meiner Ansicht nach für dieses Land bedeutet, wurde mir umso klarer, je mehr ich las. Und das ist, selbstverständlich, das Thema dieses Buches.
***
Ich möchte mit einer dramatischen Pauschalisierung beginnen und behaupten, dass jedem Land und jeder Kultur ein einziges verbindendes und prägendes Symbol zugrunde liegt. (Bitte sehen Sie keine meiner groben Vereinfachungen als dogmatisch und ausnahmslos an; ich will damit lediglich verschiedene Blickwinkel eröffnen, aus denen man Literatur betrachten kann.) Das Symbol also – ob Wort, Wendung, Idee, Bild, oder alles auf einmal – funktioniert wie ein System aus Glaubenssätzen (es ist ein System aus Glaubenssätzen, wenn auch nicht immer als solches ausgewiesen), das im Land für Zusammenhalt sorgt und seinen Bewohnern hilft, auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. Das Symbol für Amerika ist vermutlich die Grenze, the Frontier, ein flexibler Begriff, der viele Elemente umfasst, die dem Amerikaner lieb und teuer sind. Sie steht für einen Ort, der neu ist, an dem die alte Ordnung nicht länger gilt (wie bei der Gründung Amerikas durch einen Haufen unzufriedener Protestanten und wie später zur Zeit der Revolution); eine Linie, die sich immer weiter verschiebt und damit taufrisches, jungfräuliches Land vereinnahmt oder »erobert« beziehungsweise »besiegt« (sei es den Westen, den Rest der Welt, das Weltall, die Armut oder die Geografie des Geistes); die Grenze stellt eine Hoffnung dar, niemals erfüllt, aber stets verheißen; die Hoffnung auf Utopia, die perfekte menschliche Gesellschaft. Der Großteil der amerikanischen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts beschäftigt sich mit der Kluft zwischen dieser Verheißung und der Wirklichkeit, zwischen dem erträumten, idealen, goldenen Westen oder der City upon a Hill, dem Vorbild für die ganze Welt, wie von den Puritanern gefordert, und dem tatsächlichen, verkommenen Materialismus, der kauzigen Kleinstadt, der hässlichen Großstadt oder dem von Rednecks bevölkerten Hinterland. Einige Amerikaner verwechselten sogar Vorhandenes und Verheißung. Da wird ein Hilton-Hotel mit Cola-Automaten zum Himmelreich.
Die symbolische Entsprechung in England ist wohl die Insel, ganz offensichtlich ein passendes Bild. Im siebzehnten Jahrhundert schrieb der Dichter Phineas Fletcher ein Langgedicht namens The purple Island, das sich auf eine erweiterte Metapher des Körpers als Insel stützt, und obwohl das Gedicht fürchterlich ist, meine ich genau diese Art von Insel: der Körper als Insel, eigenständig, ein Staatskörper, der sich organisch entwickelt, mit hierarchischem Aufbau, wo der König den Kopf darstellt, die Politiker die Hände, die Bauern oder Arbeiter die Füße und so weiter. Das englische Sprichwort »My home is my castle« ist die gängigere Ausprägung dieses Symbols, da das herrschaftliche Schloss nicht nur ein inselartiges Gebilde ist, sondern ein eigenständiger Mikrokosmus des Staatswesens insgesamt.
Das zentrale Symbol für Kanada – und diese Annahme gründet sich auf das häufige Vorkommen sowohl in der anglophonen als auch in der frankophonen Literatur Kanadas – ist fraglos das Überleben, Survival, la Survivance. Wie die Grenze oder die Insel ist es eine facettenreiche und wandlungsfähige Idee. Für frühe Entdecker und Siedler bedeutete Survival das nackte Überleben angesichts »feindseliger« Elemente und/oder Ureinwohner; man erkämpfte sich seinen Platz und tat alles, um am Leben zu bleiben. Aber das Wort kann auch für das Überstehen einer Krise oder einer Katastrophe stehen, etwa Orkan oder Schiffbruch, und viele kanadische Gedichte handeln von dieser Art Überleben; man könnte es im Gegensatz zum »nackten« Überleben als »eisernes« Überleben bezeichnen. Für Frankokanada stand diese Idee nach der Machtübernahme der Engländer vor allem für kulturelles Überleben: der Fortbestand als Volk, die Wahrung der eigenen Religion und Sprache unter einer fremden Regierung. Und im englischsprachigen Teil Kanadas bekommt sie jetzt, da der amerikanische Einfluss wächst, eine ähnliche Bedeutung. Doch das Wort wird noch auf eine weitere Weise verwendet: als Überleben des Relikts einer vergangenen Ordnung, die über ihre Zeit hinaus bestehen konnte, wie ein urzeitliches Reptil. Diese Deutung taucht im kanadischen Denken ebenfalls auf, meist bei denen, die Kanada für überholt halten.
Doch die Grundidee ist die erstgenannte: Weiterbestehen, Überleben. Die Kanadier messen fortwährend ihren kulturellen Puls, wie Ärzte am Krankenbett. Das Ziel besteht nicht darin, zu entscheiden, ob der Patient wieder ein gutes Leben führen wird, sondern ob er überhaupt überlebt. Unsere Leitidee erzeugt weder die Spannung und den Sinn für Abenteuer und Gefahr, den die Grenze verspricht, noch die Selbstgefälligkeit und/oder das Sicherheitsempfinden einer Insel, wo alles seinen Platz hat, sondern eine fast schon unerträgliche Furcht. Unsere Geschichten handeln selten von Menschen, die es geschafft haben, und stattdessen von solchen, die es aus einer schrecklichen Erfahrung – dem Norden, dem Schneesturm, dem untergehenden Schiff – wieder zurückgeschafft haben, während alle anderen umgekommen sind. Der Überlebende erfährt keinen Triumph oder Sieg, nur das pure Überleben selbst. Nach seinem Martyrium besitzt er wenig mehr, als er vorher hatte, bis auf die Dankbarkeit, dass er mit dem Leben davongekommen ist.
Die Beschäftigung mit dem eigenen Überleben ist zwangsläufig auch eine Beschäftigung mit allem, was diesem Überleben entgegensteht. Bei früheren Autoren sind solche Hindernisse äußerlich: das Land, das Klima und so weiter. Bei späteren sind sie oft schwieriger zu bestimmen und verlagern sich ins Innere. Sie hindern nicht länger am körperlichen, sondern sozusagen am geistigen Überleben, an einem Leben, das mehr ist als das Mindestmaß des Menschlichen. Manchmal wird die Angst vor diesen Hindernissen selbst zum Hindernis, und eine Figur wird von Schrecken gelähmt (entweder durch Bedrohungen, die sie in der Außenwelt sieht, oder durch Anteile ihrer eigenen Natur, die sie von innen her bedrohen). Sie kann sich sogar vor dem Leben an sich fürchten; und wenn das Leben selbst lebensbedrohlich wird, ist das ein ganz schöner Teufelskreis. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, dass er nur überleben kann, indem er sich amputiert, sich zum Krüppel oder Eunuchen macht, was ist dieses Überleben dann wert?
Zur Illustration will ich in aller Kürze einige kanadische Handlungsverläufe vorstellen. In manchen müssen die Überlebensbemühungen scheitern. Andere behandeln das nackte Überleben oder den verkrüppelten Erfolg (der Protagonist erreicht mehr als das pure Überleben, wird dabei jedoch versehrt).
Pratt
, »Die Titanic«: Schiff rammt Eisberg. Die meisten Passagiere ertrinken.
Pratt
,
Brébeuf und seine Brüder:
Nach schrecklichen Prüfungen überleben die Priester knapp und werden von Indianern
[1]
niedergemetzelt.
Laurence
,
Der steinerne Engel:
Alte Frau krallt sich verbissen ans Leben und stirbt letztlich.
Carrier
,
Ist es die Sonne, Philibert?:
Held entflieht unvorstellbarer ländlicher Armut und entsetzlichen städtischen Bedingungen, kommt beinahe zu Geld und stirbt, indem er sein Auto zu Schrott fährt.
Marlyn
,
Unter den Rippen des Todes:
Held amputiert sich seelisch, um zu Geld zu kommen, scheitert dennoch.
Ross
,
Was mich und mein Haus betrifft:
Pfarrer in der Prärie, der seine Arbeit hasst und sein künstlerisches Talent verdorren ließ, indem er diese Arbeit fortsetzte, eröffnet sich am Ende ein fragwürdiger Ausweg.
Buckler
,
Der Berg und das Tal:
Schriftsteller, der lange nicht schreiben konnte, erahnt schließlich eine Möglichkeit, stirbt aber, bevor er seine Vision umsetzen kann.
Gibson
,
Kommunion:
Mann, der keine Beziehung mehr zu seinen Mitmenschen aufbauen kann, versucht kranken Hund zu retten, scheitert und wird am Ende angezündet.
Und um das Bild zu vervollständigen, könnte man noch ergänzen, dass die einzigen anglokanadischen Spielfilme, die bisher (abgesehen von Allan Kings Dokumentationen) großen Erfolg hatten, nämlich Goin’ down the Road und The Rowdyman, beide das Scheitern inszenieren. Die Helden überleben, aber nur knapp; sie sind geborene Versager, und ihr Scheitern an allem außer dem reinen Überleben hat nichts mit den Filmschauplätzen in den östlichen kanadischen Seeprovinzen oder mit »Regionalismus« zu tun. Es ist echt kanadisch, von einer Küste zur anderen.
Meine Beispiel-Plots stammen sowohl aus Prosawerken als auch aus der Dichtung und aus Gegenden quer durch ganz Kanada; ihre Entstehung umfasst vier Jahrzehnte, von den Neunzehnhundertdreißigern bis in die frühen Siebzigerjahre. Und sie verweisen auf eine weitere Facette des »Survivalism«: Irgendwann wird das Scheitern am Überleben, oder das Scheitern, mehr zu sichern als das nackte Überleben, nicht mehr von einer feindlichen Außenwelt aufgezwungen, sondern zu einer Wahl aus dem Inneren heraus. Treibt man das obsessive Kreisen ums Überleben weit genug, kann es zum Willen werden, gerade nicht zu überleben.
Zweifellos lassen kanadische Autoren ihre Helden unverhältnismäßig oft mit absoluter Sicherheit sterben oder versagen. Viele kanadische Werke legen nahe, dass Scheitern unumgänglich ist, weil es – bewusst oder unbewusst – vom Gefühl her das einzig »richtige« Ende darstellt, den einzigen Ausgang, der die Sicht der Figuren (oder ihrer Autoren) auf das Universum stützt. Sind solche Ausgänge gut angelegt und für das Buch stimmig, gibt es von ästhetischer Seite nichts zu meckern. Doch wenn kanadische Schriftsteller plumpe oder tendenziöse Enden schreiben, dann lenken sie die Handlung mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit in eine negative als in eine positive Richtung, mit anderen Worten: Der Autor wird wahrscheinlich keine plötzliche Erbschaft eines reichen, alten Onkels aus dem Ärmel schütteln, oder die überraschende Neuigkeit, dass der Held in Wirklichkeit der Sohn eines Grafen ist, sondern eher eine plötzliche Naturkatastrophe heraufbeschwören, oder einen außer Kontrolle geratenen Wagen, Baum oder eine durchgedrehte Nebenfigur, sodass der Protagonist auf befriedigende Weise scheitern kann. Woran mag das liegen? Kann es sein, dass die Kanadier einen Verliererwillen in sich tragen, so stark und beherrschend wie der Siegeswille der Amerikaner?
Man könnte wie folgt argumentieren: Da ein Großteil der Canlit im zwanzigsten Jahrhundert geschrieben wurde und das zwanzigste Jahrhundert eine insgesamt pessimistische und »ironische« Literatur hervorgebracht hat, spiegelt Kanada einfach nur einen Trend wider. Außerdem ist es sehr wohl möglich, ein kleines Gedicht über Freude und Entzücken zu schreiben. Aber kein Roman, und sei er noch so kurz, kann alle Gefühle bis auf diese ausschließen. Ein Roman über das pure Glück fiele entweder extrem kurz oder extrem langweilig aus: »Es waren einmal John und Mary, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute …« Beide Einwände haben etwas für sich, doch gewiss ist der kanadische Trübsinn im Durchschnitt nachhaltiger als anderswo, und Tod und Scheitern treten unverhältnismäßig oft ein. Lässt man Kanadiern die Wahl zwischen den positiven und negativen Aspekten eines Symbols – das Meer als lebensspendende Mutter oder das Meer als etwas, in dem dein Schiff untergeht; der Baum als Symbol für Wachstum oder der Baum als etwas, das dir auf den Kopf fällt –, so zeigen sie eine deutliche Vorliebe für das Negative.
Vielleicht denken Sie sich jetzt, dass die meisten kanadischen Autoren, sofern sie auch nur einen Funken Ernsthaftigkeit für sich beanspruchen, neurotisch oder morbid sein müssen, und setzen sich lieber für ein entspanntes Stündchen mit Anne auf Green Gables in den Ohrensessel (auch wenn es in diesem Buch um ein Waisenmädchen geht …). Doch falls all diese Zufälle Sie neugierig gemacht haben – so viele Autoren in einem so dünn besiedelten Land, und alle mit der gleichen Neurose? –, dann habe ich eine Theorie für Sie. Wie jede Theorie wird sie nicht alles erklären, aber sie kann uns Anhaltspunkte liefern.
***
Nehmen wir einmal an, dass Kanada insgesamt ein Opfer ist oder eine »unterdrückte Minderheit« oder »ausgebeutet«. Nehmen wir kurz gesagt an, dass Kanada eine Kolonie ist. Teil der Definition einer Kolonie ist, dass sie ein Ort ist, aus dem jemand Profit schlägt, allerdings sind es nicht die Menschen, die dort leben; der Profit aus einer Kolonie wird hauptsächlich im Machtzentrum des Imperiums gemacht. Dazu sind Kolonien da: Sie sollen dem »Mutterland« Geld einbringen. Und dazu waren sie – vom alten Rom bis zu den ersten dreizehn amerikanischen Kolonien – schon immer da. Natürlich gibt es kulturelle Begleiterscheinungen, die häufig als »koloniale Mentalität« bezeichnet werden, und diese Begleiterscheinungen wollen wir hier näher beleuchten; doch ihre eigentliche Ursache ist wirtschaftlicher Natur.
Wenn Kanada ein kollektives Opfer ist, sollte es einen Blick auf die grundlegenden Opferhaltungen werfen. Sie haben eine ähnliche Funktion wie Ballettpositionen oder Tonleitern auf dem Klavier: Sie bilden die Grundbausteine, erlauben Tänzern und Musikern jedoch alle möglichen Variationen.
Ob man ein schikaniertes Land, eine schikanierte Minderheit oder ein schikaniertes Individuum ist, die Haltungen bleiben die gleichen.
***
Grundlegende Opferhaltungen
Haltung eins: Leugnen, dass man ein Opfer ist.
Das kostet eine Menge Energie, denn man braucht viel Zeit, um das Offensichtliche wegzuerklären, den eigenen Ärger zu schlucken und so zu tun, als würden gewisse unübersehbare Realitäten nicht existieren. Diese Haltung wird häufig von jenen Mitgliedern einer Opfergruppe eingenommen, denen es ein wenig besser geht als den anderen. Sie haben Angst, ihren Opferstatus anzuerkennen, weil sie fürchten müssen, dadurch Privilegien einzubüßen; und sie müssen irgendwie die Nachteile der anderen Gruppenmitglieder erklären, deshalb würdigen sie diese herab. Etwa so: »Ich habe es geschafft, deshalb ist doch klar, dass wir keine Opfer sind. Die anderen sind einfach nur zu faul (oder neurotisch oder dumm); jedenfalls sind sie selbst schuld an ihrem Unglück, seht doch nur, was die alles für Möglichkeiten hätten!«
Wenn Opfer der Haltung eins Zorn empfinden, dann richtet er sich meist gegen ihre Mitopfer, vor allem gegen jene, die über ihren Opferstatus zu sprechen versuchen.
Das Grundprinzip der Haltung eins lautet: »Leugne deine Opfererfahrung.«
Haltung zwei:
Anerkennen, dass man ein Opfer ist, diesen Umstand jedoch als Schicksalsfügung, göttlichen Willen, biologische Gegebenheit (etwa im Fall von Frauen) oder Notwendigkeit erklären, diktiert von Geschichte, Ökonomie, dem Unbewussten oder irgendeinem anderen großen, allgemeinen, machtvollen Konzept.
Jedenfalls ist alles die Schuld dieser großen Sache und nicht die eigene Schuld, daher kann man weder für seine Haltung verantwortlich gemacht werden, noch kann irgendjemand erwarten, dass man etwas daran ändert. Man darf sich resigniert und leidgeprüft zeigen, oder man kann wider den Stachel löcken und groß herumzetern. In letzterem Fall wird die Rebellion als töricht oder gar bösartig empfunden werden, sogar vom Aufbegehrenden selbst, der erwartet, dass er verliert oder bestraft wird, denn wer kommt schon gegen das Schicksal an (oder gegen den göttlichen Willen, die Biologie)?
Man beachte:
Die Erklärung
verschiebt
die Ursache vom wahren Unterdrücker auf etwas anderes.
Ende der Leseprobe