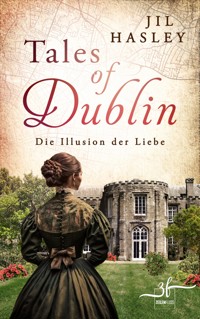
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zeilenfluss
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein bewegender historischer Roman über zwei Menschen, die für ihre Liebe und ihre Überzeugungen kämpfen müssen. Dublin, 1879. In den Wirren des irischen Widerstands ereilt Cecily Lawson ein Los, das sie nie für sich selbst gewählt hätte. Ihr Vater wird verhaftet, die Geschwister verlassen das Land, um ihr Glück am anderen Ende der Welt zu suchen. Und Cecily soll gegen ihren Wunsch mit Lord Noah Riordan verheiratet werden, einem Parteikollegen ihres Vaters im britischen Oberhaus. Von ihm in die Enge getrieben, gibt sie Noah schließlich notgedrungen das Ja-Wort. Schnell wird klar, dass sie in das Leben mit einem Mysterium eingewilligt hat. Nach und nach deckt sie seine vielen Geheimnisse auf – und damit auch den Grund für den Untergang ihres Vaters. Gleichzeitig können sich beide ihren Gefühlen füreinander kaum mehr entziehen. Während sich ihre Liebe inmitten von Täuschung und Sehnsucht langsam entfaltet, droht Noahs wahre Identität an die Öffentlichkeit zu gelangen. Das Ende seines Versteckspiels hätte nicht nur auf Cecilys Zukunft weitreichende Auswirkungen, sondern auch auf die ganz Irlands … Nach "Die Hoffnung auf Freiheit" ist dies der zweite Band der "Dublin-Saga".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Sämtliche politischen Anschauungen und Erwähnungen dienen lediglich dem Handlungsstrang und geben nicht die Meinung der Autorin wieder. Auch erhebt die Autorin trotz ausführlicher Recherchearbeit keinen Anspruch auf die vollständig korrekte Wiedergabe tatsächlich geschichtlich stattgefundener Ereignisse.
PROLOG
Dublin, 13. März 1879
Kleine Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn. Die Sonne schien durch die großen Fenster in das Zimmer und entfaltete ihre Wärme. Für Frühling war das eigentlich zu warm. Zudem bollerte der Kamin, da jemand aus der Dienerschaft ständig Holz nachlegte. Konzentriert setzte sie einen Stich nach dem anderen, den Stickrahmen halb auf dem Schoß ruhend.
Ihre Gedanken drehten sich um Banalitäten. Jolyne war in die Stadt gefahren, Mutter mühte sich unten mit der Farbauswahl neuer Vorhänge für den Speisesalon ab. Und Leo? Ja, ihr Bruder war ein Wildfang. So konnte sie ihn im Garten dabei beobachten, wie er irgendetwas im Schotter der Auffahrt suchte und wild darin herumwühlte. Keiner wollte meinen, dass er schon vierundzwanzig Jahre alt war.
Die vermeintliche Ruhe täuschte. Schon seit einigen Tagen beschlich Cecily ein ungutes Gefühl. Eine nicht beschreibbare Rastlosigkeit hing in der Luft, die vornehmlich von ihrem Vater ausging, wovon der Rest ihrer Familie nichts mitbekam. Sie waren allesamt zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
Von Langeweile getrieben, hatte sie vor einiger Zeit schon damit begonnen, an der Tür zu ihres Vaters Arbeitszimmer zu stehen und zu lauschen. Und sie tat gut daran, mit niemandem darüber zu sprechen. Dennoch beschäftigten sie die erworbenen Informationen. Die Unruhe übertrug sich auf sie.
Ihr Vater war keiner von der fürsorglichen Sorte. Aber ein Schuft war er auch nicht. Eigentlich. Seit einigen Tagen war sie sich diesbezüglich nun doch nicht mehr so sicher.
Irgendwie wurde sie den Eindruck nicht los, dass seine politischen Aktivitäten nicht alle ganz legal waren. Dafür klangen die Unterhaltungen mit seinem Parteikollegen einfach zu diskutiv.
Abgesehen davon erschien ihr besagter Gefährte ohnehin zwielichtig. Lord Riordan ging hier ein und aus, als wäre es sein zweites Zuhause. Der versierte Blick, mit dem er seine Umwelt durchleuchtete, war ihr stets unangenehm gewesen.
Und da erschien er auch schon wieder auf der Bildfläche. Er verließ das Gebäude, trat ins Freie und wartete offenbar auf den Stallburschen, der ihm sein Pferd bringen sollte. Sein Blick wanderte über das Anwesen und schließlich auch zu ihrem Fenster.
Nichtssagend musterte sie ihn, verzog keine Miene und wartete ab, was er tun würde. Nichts. Er tat es ihr gleich und wandte sich wieder ab.
Irgendwie war er ein unangenehmer Mensch. Eingenommen von sich selbst, immer im Recht und wenig sensibel. Zumindest schloss sie das aus ihren bisherigen Begegnungen.
Nein. Sie sah sich an der Seite eines gediegenen Lords der höheren Schicht. Wenn sie in diesem Leben schon eine Frau sein musste, dann wenigstens eine mit Grazie und Ansehen. Eine, vor der man Achtung hatte.
* * *
»Sag bloß. Und ihr konntet sie wirklich abhängen?«
Leos euphorischer Ausdruck löste Neid in Cecily aus. Wie konnte man sich für etwas denn nur so begeistern? Langeweile war für ihn offensichtlich ein Fremdwort. Sie konnte sich nicht entsinnen, ihn jemals tatenlos, in einer Ecke sitzend, Däumchen drehen gesehen zu haben. Was für ein Glückspilz!
Er lauschte den abenteuerlichen Ausführungen ihres Onkels, der von seiner letzten Handelsreise auf die andere Seite der Welt – Australien – zurückgekehrt war. Begleitet wurde er heute Abend von Capt'n Dermot Coldwell, seinem Brötchengeber und besten Freund. Ein durchweg attraktiver Mann, wenn man seinen verwegenen Bart in Gedanken eliminierte. Er saß neben ihr.
Onkel Charly war mehr oder minder die ältere Version ihres Bruders. Schon in jungen Jahren hatte sich Charles dazu entschieden, der Gesellschaft zu trotzen, entsagte allen familiären Verpflichtungen und schloss sich dem Capt'n an, was seinem Bruder – ihrem Vater – bis heute aufstieß.
»Wenn ich es doch sage. Wir hatten einfach Glück, dass sich der Wind gedreht hatte, nicht, Derry?«
Sein Freund brummte nur, begleitet von einem leichten Nicken.
»Charles, wenn du die Güte hättest, meinen Kindern keine Heldengeschichten aufzutischen? Es reicht, dass einer in der Familie sich so verantwortungslos in derartige Risiken stürzt.«
Der Vater war heute wohl nicht gut aufgelegt. Ihre Augen wanderten über die Tafel. Jolyne verkniff sich ein Grinsen, während Mutter keine Miene verzog.
»Bei allem Respekt, Vater«, ergriff Cecily nun das Wort, »aber ist es nicht ebenso riskant, das Haus zu verlassen und auf die Straße zu gehen? Erst neulich las ich in der Zeitung wieder von einem Unfall, wobei ein Fußgänger von einer Kutsche überrollt wurde. Ein argloser Spaziergang.«
Lord Lawson straffte seinen Rücken, legte das Besteck geordnet ab. Seine Nasenflügel bebten kaum merklich, was deutlich machte, dass er über den Verlauf des Gesprächs nicht amüsiert war.
»Was dir, liebste Cecily, wohl kaum widerfahren wird. Bei dem Umfang deiner Kleider und deren Trendfarben, wie du sie bezeichnest, würde dich kein Kutscher übersehen, glaube mir.«
Perplex sah sie auf, die Röte stieg ihr ins Gesicht. Wie konnte Vater sie nur so öffentlich brüskieren? Diese Demütigung war keine Ausnahme. Aus unerfindlichen Gründen schien ihr werter Herr Papa eine Abneigung gegen sie zu verspüren. Jolyne gegenüber hatte er sich noch nie so benommen.
Eine Mischung aus Resignation und Verbitterung machte ich in ihr breit. Es würde sich wohl nicht ändern. Auch wenn sie insgeheim – tief in ihrem Innern – wusste, dass ihr der Respekt und das Wohlwollen des eigenen Vaters alles bedeutet hätten, gestand sie es dennoch nicht einmal sich selbst.
Es würde darauf hinauslaufen, dass sie ihm eines Tages die Stirn würde bieten müssen. Als gestandene Ehefrau eines hoch angesehenen Mitglieds des Clubs. Erst dann würde er ihr wohl die verdiente Achtung als Tochter zukommen lassen.
Sortiert tupfte sie sich mit dem feinen Tuch über die Lippen, ehe sie den Seitenhieb des Lords sanft weglächelte.
Aus dem gewohnt trägen Takt geriet dieser Nachmittag unerwartet, als Howes, der Butler des Hauses, den Raum betrat und mitteilte, dass zwei Constables im Foyer auf ihren Vater warteten.
Und dann ging alles plötzlich ganz schnell. Wie in Trance verfolgte Cecily das Geschehen um sich herum. Sie meinte zu verstehen, dass ihr Vater, der hochdekorierte Lord Lawson, sich eines Vergehens schuldig gemacht haben sollte, welches politischer Natur war.
Die leisen Zweifel in ihr arbeiteten sich wieder nach oben. Hatte sie also doch nichts missinterpretiert bei ihren Lauschereien? Sollte es tatsächlich so gewesen sein?
Jolyne, die geliebte Tochter, wollte ihn gar nicht loslassen. Doch die Constables waren unnachgiebig und forderten Zurückhaltung.
»Miss, treten Sie bitte zurück«, konnte man die Stimme des Älteren vernehmen. Seine strenge Miene verriet, dass auch er seinem Auftrag gerade nicht sonderlich gern nachkam.
Charles und der Capt'n standen fassungslos im Türrahmen und warfen sich gegenseitig vielsagende Blicke zu. Leo hatte bereits entkräftet Platz auf der untersten Stufe der großen Treppe genommen und die Hände in den Kopf gestützt.
Und ihre Mutter? Ihre Fassung als aufgelöst zu bezeichnen, wäre wohl noch untertrieben gewesen.
Alles veränderte sich von einer Sekunde auf die andere.
Eine Bitte.
Ein Satz.
»Lord Lawson, zwei Constables erwarten Sie im Foyer.«
Die Worte hallten nach.
Howes’ Stimme war so gegenwärtig wie nie zuvor.
Zum ersten Mal nahm Cecily ihn wahr.
Als Mensch.
Nicht als Butler.
Etwaige Zeitungsartikel arbeiteten sich in Cecilys Gedächtnis nach oben. Berichte von etablierten Familien, die nach einem Skandal genau dies nicht mehr waren.
Ihre Zukunft löste sich soeben in nichts auf.
Das Ausmaß war schnell klar.
* * *
»Cecily?«
Jemandes Hand ruhte auf ihrer Stirn.
Es war Leo.
Die Sonne schien durch die großen deckenhohen Fenster. Kleine Spatzen saßen auf den Fensterbrettern und unterhielten sich mit Genossen in der Ferne, zwitscherten ihnen fröhliche Töne vor, als wollten sie dem Moment die Tragik nehmen.
»Cecily, wie fühlst du dich?«
Stumm blickte sie in die besorgten Augen ihres Bruders, erwiderte einfach nichts. Sie musste ohnmächtig geworden sein.
Sie fühlte alles und doch nichts. Unsagbare Fassungslosigkeit. Leere. Furcht. Ja sogar Erleichterung.
»Ich weiß es nicht«, flüsterte sie schließlich. Es war, als wimmelte ein großer Ameisenhaufen in ihrem Kopf.
Im Grunde interessierte es sie schon, was denn nun geschehen war. Doch sie war zu erschöpft, um zu fragen.
»Sorge dich nicht, hörst du, Cecily? Es ist sicher nichts. Wahrscheinlich handelt es sich um ein großes Missverständnis.«
Leos Fürsorge ehrte ihn. Und an seinem Gesichtsausdruck erkannte sie, dass er das tatsächlich dachte.
Doch sie wusste, dass dem nicht so war. Und wahrscheinlich war sie damit die Einzige in diesem Haus.
Ob es gut gewesen war, des Vaters Gesprächen zu lauschen? War sie deshalb nun im Vorteil? Sie wusste keine Antwort darauf.
»Ist gut.« Sie nickte und versuchte ein Lächeln, um ihrem Bruder eine letzte Schonfrist zu geben, ehe auch er einsehen musste, dass dieser Tag heute kein Theaterstück war, nach welchem man sorglos nach Hause gehen konnte. Dies heute war real.
Und es würde ihr aller Leben bis ins Mark erschüttern und verändern.
Mit dem Gedanken, dass sie nun nicht mehr mit einer guten Partie rechnen konnte, schlief sie ein und wachte erst wieder auf, als es schon stockdunkel war. Nur eine kleine Glut im Kamin erleuchtete die nähere Umgebung in rötlichen Tönen.
* * *
Tage später waren eine Menge Entscheidungen getroffen worden, auf welche sie selbstverständlich nicht im Ansatz Einfluss hätte nehmen können. Beispielsweise die Tatsache, dass Jolyne eine Stelle als Gesellschafterin in Aussicht stand. Und zwar am anderen Ende der Welt: Australien.
Damit hatte sie immerhin eine Perspektive. Etwas, das für sie selbst zum jetzigen Zeitpunkt in weiter Ferne schien.
Wie sich herausstellte, war ihr Vater wirklich in illegale Machenschaften verstrickt. Er solle Verbindungen zu Organisationen irischer Aufständler gepflegt haben. Tief im Innern fühlte sie sich zu diesen Menschen hingezogen. Heimlich las sie regelmäßig Berichte über deren Aktivitäten und verspürte so etwas wie trotzigen Kampfgeist gegen die affektierte Gesellschaft, der auch in ihren Gefühlen hin und wieder auftauchte.
Trübsal blasen war nicht ihre Art. Entschlossen schlug sie die Bettdecke zur Seite. Seit dem erschütternden Ereignis fühlte sie sich kränklich, wies Symptome einer Erkältung auf und gab sich zudem weinerlich. Wenn auch mehr, um die Verzweiflung mit ihrer Familie zu teilen, um sich nicht zu verraten.
Im Grunde war der Vorfall für sie keine außerordentliche Überraschung. Doch das brauchte ja niemand zu wissen.
Insgeheim tüftelte Cecily jedoch an einer Lösung, um ihrer misslichen Lage abzuhelfen. Es gab immer einen Weg. Diese Worte wiederholten sich wie ein Mantra in ihrem Kopf.
Aufrecht und mit absoluter Haltung tätigte sie die Glocke, auf welche Charlotte herbeieilte und den Raum betrat. Sie half Cecily dabei, in ein dunkles Dress mit wenig Raffinesse zu gelangen. Das Haar ließ sie sich in einen unscheinbaren Dutt stecken.
Gestern um diese Uhrzeit hatten ihre beiden Geschwister in diesem Raum bei ihr gestanden. Man unterhielt sich darüber, welches Glück Jolyne doch mit ihrem Los hatte. Auf dem Handelsschiff Capt'n Coldwells mitreisen zu dürfen kam ihr in diesem Augenblick wie ein Privileg vor.
Heute dagegen war die Zuversicht in ihr stärker, dass es noch bessere Wege geben musste, dem trostlosen Dasein einer Bauersgattin zu entkommen. Einem Schicksal, welches sie ereilen würde, sollte sich nicht unverzüglich in der nächsten Zeit ein gediegener Einfall in ihren Überlegungen einfinden.
So weit wollte sie es nicht kommen lassen.
* * *
Betrübt und mit einer großen Portion Bedauern legte Cecily ihre Arme um ihre Schwester. Jolyne mochte vielleicht eine Prise zu sehr von sich eingenommen sein, doch sie war ihre Schwester. Zu wenig Gelegenheit hatten sie beide sich geschenkt, für die andere mehr als nur blutsverwandt zu sein. Wie sehr wünschte sich Cecily seit Langem eine echte Freundin, die sie nicht nur nach Äußerlichkeiten beurteilte. Doch diese Gesellschaft verbaute so viele Chancen auf vertrauensselige Verbindungen.
Und da bildete sogar Jolyne keine Ausnahme. Sosehr sie dieser Gesellschaft stets mit einem süffisanten Lächeln gegenüberstand, die Etikette für überholt hielt und in ihren eigenen Augen im Denken der Zeit voraus war, so war auch sie zu einem unterkühlten Mitglied dieses Clubs geworden.
Sie lösten sich aus der Umarmung, und Cecily konnte nur zu deutlich das Mitleid in den Augen ihrer Schwester wahrnehmen. Mitleid, das ihr sagte, dass ihre Zukunft um einiges düsterer aussah als die von Jolyne.
Das Versprechen, welches sie einander abrangen, sich zu schreiben, war da auch nur ein kläglicher Trost, verglichen mit den Aussichten. Ein paar Briefe würden ihre Zukunft nicht in trockene Tücher legen. Doch weil sie spürte, dass es der Schwester überraschend viel bedeutete, versicherte sie es ihr.
Die Szenerie am Hafenkai Dublins schaffte Raum in Cecilys Brust. Sie atmete tief durch und verspürte eine Art Erleichterung. In ihrem Kopf manifestierte sich die Ansicht, Probleme ließen sich strategisch und mit Ordnung lösen und beseitigen. So war es eine Entlastung, dass Jolynes Zukunft nun gesichert war. Als Nächstes sollten ihre und die ihrer Mutter an der Reihe sein.
Für Leo gestaltete sich die Lage anders. Für Männer war es in der Gesellschaft zwar auch ein Hieb, doch es bedeutete nicht deren Aus. Daher sorgte sie sich nicht allzu sehr um ihn.
Auf dem Heimweg bat Leo darum, noch Erledigungen tätigen zu dürfen. Daher stieg er nahe dem Hafen bereits wieder aus der Kutsche. So waren es nur noch sie und ihre Mutter Margaret. Müde schweiften Cecilys Gedanken zwischen all dem Menschen- und Straßenlärm allmählich ab.
Tante Marigold war nun nach vielen Jahren wieder auf der Bildfläche erschienen. Sie war eine äußerst paradoxe Persönlichkeit. Ähnlich wie Lady Carmichael in Cecilys eigenem Bekanntenkreis war auch Tante Marigold ungeniert, was das Äußern ihrer eigenen Meinung anging.
Außerdem jedoch besaß ihre Tante das Talent – und damit war sie eine große Ausnahme –, sich finanziell selbst über Wasser halten zu können. Sie hatte nie geheiratet, und dennoch verfügte sie über ein beachtliches Vermögen, von dem keiner wusste, woher sie es hatte.
Zwar hatte sie etwas geerbt, nachdem der Vater der beiden Töchter Marigold und Margaret, seinerzeit Witwer, verstorben war. Doch nach Aussagen zuverlässiger Quellen, nicht zuletzt der von Marigold selbst, hatte es sich hierbei um kein nennenswertes Vermögen gehandelt.
»Liebes, bist du wohlauf? Du bist sehr still.«
Ungläubig richtete Cecily ihre Augen auf ihre Mutter.
»Nein, Mama, das bin ich nicht. Was für eine lächerliche Frage.«
»Kind, zügle dein Mundwerk.« Entrüstet schnaubte Lady Margaret.
»Wozu? Angesichts unserer Lage macht es doch keinen Unterschied, ob ich mich noch pathetisch ausdrücke oder nicht.«
»Da irrst du dich, Cecily. Begib dich nicht unter deine Würde.«
»Keine Sorge, derer hat Vater uns bereits beraubt. Und um ehrlich zu sein, verleiht es mir mehr Würde, auszusprechen, was ich tatsächlich denke. Sei aufrichtig mit dir selbst, liebe Mama. Widerte es dich nie an, dich an derart gezwungenen Konversationen beteiligen zu müssen?«
»Und wie es mich anwiderte«, stieß Lady Margaret verächtlich hervor, ehe ihre Augen die ihrer Tochter suchten und ein schelmisches Schmunzeln auf ihren Lippen erschien.
Erstaunt hielt Cecily sich die Hand vor den Mund und brach schließlich in heiteres Lachen aus, in welches ihre Mutter mit einstieg. Es nahm beinahe hysterische Ausmaße an.
Und genau das war es, was Cecily für einen kleinen Augenblick Licht und Trost schenkte. Zwei hemmungslos lachende Ladys, gedemütigt und diffamiert, in einer offenen Kutsche, gefahren von einem stoisch dreinblickenden Kutscher, inmitten der großen Metropole Dublins. Was für ein Bild.
Schon lange hatten sie die Stadt hinter sich gelassen, ehe sie sich wieder eingekriegt hatten und nun weinend nebeneinandersaßen, die Hand der anderen hielten und die Landschaft an sich vorüberziehen sahen.
»Und jetzt?«
Ratlos musterte Cecily ihre Mutter, die auf sie den Eindruck einer gebrochenen Person machte.
Doch der Ausdruck in deren Augen fing plötzlich Feuer. Eisern fixierte Lady Margaret ihre Tochter. »Jetzt lassen wir uns von Marigold erklären, wie leben geht.«
Unschlüssig, ob sie dieses manische Verhalten ihrer Mutter nun gut finden wollte, zupfte Cecily sich nachdenklich die Handschuhe von den Fingern. Eine undefinierbare Entschlossenheit hing in der Luft.
Zaghaft bewegten sich Cecilys Mundwinkel nach oben.
In diesem Augenblick ertönten die Kirchturmglocken von Stradbrook, dem Ort, der ihr Zuhause war.
»Einverstanden.«
1
Cecily
So viel Entschlossenheit ich vor wenigen Tagen noch empfunden hatte, wurde sie nun auch schon zunichtegemacht. Lebhaft diskutierten Mutter und Tante Marigold über meine Zukunft, fertigten eine Liste etwaiger verrufener Lords und niedriggestellter Persönlichkeiten an, die als zukünftige Gatten infrage kamen. Nur, um mir ein Dach über dem Kopf zu sichern.
Gelangweilt lümmelte Leo am Sitzplatz des Fenstererkers. Es sah so aus, als tüftelte er an Knottechniken der Seefahrtskunde. Seine ganze Präsenz brachte zum Ausdruck, dass er sich hinsichtlich des laufenden Gesprächs in keiner Weise mitverantwortlich fühlte.
Irgendwie machte er es sogar richtig. Er mischte sich nicht ein, begab sich nicht ins Kreuzfeuer und entfloh damit unnötigen Schimpftiraden. Ich erhob mich und gesellte mich zu ihm. Er sah nur einen winzigen Moment auf, registrierte mich und widmete sich wieder den Schnüren in seinen maskulinen Fingern.
Zuerst schaute ich dem wilden Geknote nur desinteressiert zu, doch allmählich erschloss sich mir das System dahinter. Nachdem er sein Werk zum wiederholten Male entfädelt hatte, griff ich – zu meiner eigenen Überraschung – nach den Seilen.
Verblüfft richteten sich Leos Augen auf mich. Ein leichtes Stirnrunzeln bildete sich auf seinen Zügen. Was wohl in ihm vorging? Schließlich überreichte er sie mir und beobachtete meine Bewegungen, korrigierte mich hin und wieder.
Stolz hielt ich mein Ergebnis hoch und strahlte. Das Lächeln meines Bruders ging mir zu Herzen. Er freute sich ernsthaft mit mir. Im selben Augenblick entdeckte ich jedoch auch einen Hauch Kummer in seinem Gesichtsausdruck. Es war typisch für ihn. Leo war schon immer mit dem Vermögen für Empathie gesegnet gewesen.
»Kannst du mir noch welche beibringen?« Ich überreichte ihm die Schnüre wieder.
»Natürlich«, unvermittelt erhob er sich, »vielleicht gehen wir dabei spazieren?«
Nur zu gern. Wahrscheinlich hatte er meine innere Unruhe angesichts des umtriebigen Gesprächs unserer Familie wahrgenommen.
Er entschuldigte uns bei Mutter, und so brauchte ich nur zu nicken und meinem Bruder zu folgen.
»Was willst du tun, Leo? Türmst du und lässt uns hier zurück?«
Ich wusste selbst nicht so genau, ob in dieser Frage mehr Vorwurf oder mehr Neugier steckte. In gemächlichem Tempo betraten wir den Garten unseres Anwesens.
»Ich weiß es noch nicht.«
Seine Antwort versetzte mir einen Stich. Irgendwie hoffte ich, er würde Loyalität bekunden. Neid überkam mich erneut. Im Grunde hatte er die Freiheit schlechthin. Er konnte tun, wonach ihm der Sinn stand. Sofern er sich der familiären Pflichten entsagte, so wie Onkel Charles es tat. Inzwischen verstand ich es sogar.
»Ich werde dafür sorgen, dass es euch an nichts mangelt. Ich vermute, von den Ozeanen der Welt aus ist das eher schwierig zu bewerkstelligen.«
Also fühlte er sich doch verantwortlich.
Aus dem Nichts formte sich in meinen Vorstellungen eine gewagte Idee. Vielleicht …
»Vielleicht sollten wir gemeinsam türmen. Zur See.«
Er lachte freiheraus. Meinen Vorschlag schien er als Witz zu interpretieren. Doch es war mein bitterer Ernst. Das wurde ihm alsbald klar, da ich in seine Lachsalve nicht einstieg.
»Du meinst das ernst, Cecily? Du und ich?«
»So ist es.«
Schlagartig verging ihm das Grinsen. Wie festgefroren blieb er mit einem Mal stehen.
Zweimal öffnete er den Mund, um etwas zu sagen. Doch die nächsten Worte sollten wohl überlegt sein. Diese Reaktion ließ mich hoffen. Zumindest dachte er darüber nach.
»Ich glaube nicht, Cecily. Niemand würde eine Lady beschäftigen.«
»Stimmt. Aber zwei junge, tatkräftige Männer schon.«
In der Erwartung, erneut einem Lachanfall zum Opfer zu fallen, wartete ich still, die Augen auf den Schotterboden unter meinen Füßen gerichtet. Als sich nach langen Sekunden immer noch nichts rührte, sah ich auf und blickte in ein nachdenkliches Gesicht.
»Ist die Aussicht, sich verheiraten zu lassen, derart trüb?«
»Du hast ja keine Vorstellung, Leo. Du hast Mutter vorhin selbst gehört. Lord Riordan wäre ihre erste Wahl. Du kennst den Mann. Ist er nicht eine unausstehliche Kreatur?«
»Ich kenne ihn nicht. Du hingegen wohl eher. Daher dürfte dein Urteil über ihn vertrauenswürdig sein.«
Moment, was brachte ihn zu dieser Annahme?
»Wie meinst du das? Inwiefern kenne ich ihn?«
»Na, so oft, wie du hinter verschlossener Tür standst und gelauscht hast, dürftest du über ein weitaus größeres Maß an Informationen verfügen, oder nicht?«
Ich spürte, wie mir die Hitze in die Wangen kroch.
»Woher weißt du das?«
»Ich habe Augen im Kopf. Abgesehen von einer Menge unnützen Lernstoffs, den ich als Anwärter des Familientitels in der Universität verabreicht bekomme, ist mein Leben vergleichsweise eintönig. Daher habe ich viel Zeit, meine Familie zu studieren. Du hast übrigens bei Weitem am interessantesten abgeschnitten. Wenn andere dich wirklich kennten, wären sie überrascht, wozu du in der Lage bist. Mich hast du überzeugt.«
»Du überraschst wiederum mich, Bruderherz.«
Eine so willige Auffassungsgabe hatte ich in ihm nicht vermutet.
»Nun denn, wo waren wir gleich?«, versuchte ich betreten zurück zum eigentlichen Gespräch zu finden, während mich insgeheim trotzdem die Frage quälte, was er wohl noch von mir wusste.
»Ob du als Kerl durchgingest«, kam es ihm salopp über die Lippen.
Ich schnappte kurz auf, angesichts der formlosen Wortwahl, während er bereits fortfuhr.
»Optisch, möchte ich meinen, bestehen wahrhaftig weniger Probleme. Du hast Vaters kantige Wangenknochen geerbt. Zu klein geraten bist du auch nicht. Wenn wir dein Haar kürzen, dich für einige Wochen hart auf einem Gut schuften ließen, hätten wir Chancen. Deine Hände hätten genügend Schwielen und Blasen, deine Arm- und Beinmuskulatur würde wachsen.«
Auch wenn ich aufrichtig an dieser Lösung interessiert war, empfand ich es als ziemlich unangenehm, derart ungeniert von meinem Bruder beurteilt zu werden.
»Aber was machen wir mit deinen Brüsten?«
»Leo!«, schrie ich entsetzt auf.
Süffisant grinste er mich an.
»Was? Zeit für Scham und Eitelkeit bleibt uns nicht, wenn du tatsächlich gewillt bist, diese Art Flucht anzustreben.«
Da hatte er recht.
Hochzeiten waren heutzutage rasch veranlasst. Mutter konnte im Grunde jeden Tag um die Ecke kommen und mir mitteilen, dass ich des Tags darauf vor den Altar treten müsse.
»Du wärst also dabei? Du würdest das mit mir machen?«
Mein Herzschlag beschleunigte sich ungefähr um das Zweifache. Sollte ich tatsächlich Aussichten auf Freiheit erhalten?
»Ich weiß es nicht. Aber je mehr wir uns darüber unterhalten, desto eher werden wir uns darüber klar, ob dieses Vorhaben überhaupt umsetzbar wäre. Wenn wir es machen, dann richtig. Ohne unerwartete Fehler, die uns unterlaufen, weil wir zu dumm waren, sie vorher abzusehen.«
»Ich liebe dich dafür, Leo.«
Stürmisch umarmte ich ihn, was bisher nie meine Art gewesen war.
Herzerwärmend lächelte er mich an.
»Das wäre ein ziemliches Abenteuer, was?«
Aufgeregt nickte ich.
»Und ob. Stell dir vor, was wir alles erleben könnten. Wir würden so viele Orte kennenlernen, könnten jeden Tag selbst entscheiden, wohin es uns als Nächstes verschlagen soll.«
»Cecily?«
Abrupt hielt ich inne und verschluckte mich beinahe an der eingeatmeten Luft. Mutter?
Ich hatte sie nicht kommen sehen. Wie viel von meinem Gesagten hatte sie wohl gehört?
Furchterfüllt wanderten meine Augen zu Leo, der schmunzelnd meine wohl offensichtliche Frage mit einem kaum sichtbaren Kopfschütteln verneinte und sich gleichzeitig schwertat, ein Prusten zu unterdrücken.
Ja, natürlich fand er das witzig.
»Mutter?«
»Was versetzt dich in derartige Begeisterung?«
»Deine Heiratspläne für mich.«
Meine Lippen verzogen sich zu einem entgeisterten, falschen Lächeln.
»Ich verbitte mir diesen Sarkasmus, junge Dame. Das Dinner ist fertig. Kommt zu Tisch, ihr beiden.«
Damit wandte sie sich ab und schritt, einer Lady angemessen, zurück zum Haus.
Enttäuscht sah ich ihr hinterher. Vor nur wenigen Tagen hatte sie mir für kurze Momente Einblick in ihr wahres Ich gewährt, und ich hatte gewagt, zu hoffen, in ihr eine Verbündete gefunden zu haben. Dieser Traum war nur allzu schnell geplatzt, kehrte in unseren vier Wänden schlagartig die gewohnte Sitte wieder ein.
Es war beinahe unerträglich, wie stoisch das Leben einfach ohne Vater und Jolyne fortgeführt wurde. Als hätte man sich von einem Haustier verabschiedet.
»Sie kann einfach nicht anders, Cecily.«
Tröstend ruhte Leos Hand auf meiner Schulter. Er musste mein Bedauern registriert haben.
»Ich weiß.«
Auch wenn ich in gewisser Weise Mitgefühl angesichts ihres eigenen Gefangenseins empfand, machte es mich dennoch wütend, dass sie uns diesen Moment der Euphorie genommen hatte.
»Komm, wir gehen hinein.« Er schob mich an und zwang mich zur Bewegung. »Wir reden später weiter darüber.«
Mit dieser Zusicherung hielt er den Funken Hoffnung wach.
* * *
»Morgen Abend wird Lord Riordan bei uns gastieren. Ich möchte, dass ihr euch angemessen verhaltet und pünktlich zu Tisch erscheint.«
Die gewohnte Strenge in ihrer Stimme hatte mein Gehör stumpf gemacht. Alles, was sie sagte und tat, war ernst zu nehmen und musste genau eingehalten werden.
»Sein Ruf ist umstritten, Mutter. Was bewegt dich dazu, ihn als geeigneten Kandidaten anzusehen?«
Ich konnte den Unmut in meiner Frage nur mit Mühe zurückhalten.
»Zum einen befinden wir uns nicht in der Position, jetzt noch wählerisch zu sein, mein liebes Kind«, erwiderte sie, während ihr Besteck galant auf dem Teller zum Liegen kam, »zum anderen bekundete Lord Riordan als Einziger sein Interesse an dir. Und das nach der Eskapade deines Vaters. Damit sind die Karten mehr oder weniger gelegt.«
»Pardon?« Entsetzt entgleisten mir alle Gesichtszüge. Das durfte nicht wahr sein. Das konnte unmöglich stimmen.
»Bitte fingiere kein Unverständnis, wenn du meine Worte doch sehr deutlich vernommen hast.«
Ich war kurz davor, meinen Mageninhalt preiszugeben. Schleunigst verließ ich also den Speiseraum und sperrte mich in Vaters Arbeitszimmer ein, ehe meine Atmung unkontrolliert versuchte, die Enge in meinem Hals loszuwerden.
2
Noah
Es war wahrlich ein Jammer, dass wir nun hier saßen. Regen prasselte gegen die undichten Fenster, die mit Gittern versehen waren. Draußen hörte man Männer in Reih und Glied marschieren.
Natürlich nahm man bei den Gefangenen hier keine Rücksicht auf die Gesundheit. Dass die Temperaturen nur fünf Grad über dem Gefrierpunkt lagen, interessierte nicht. Und dass die Inhaftierten, ein jeder, zentimeterweise im Schlamm versanken, schon gleich gar nicht.
Ich hasste diese Anstalten.
»Spricht sich der Anwalt denn für etwaige Chancen auf Milderung aus?«, erkundigte ich mich bei dem Mann, der mir gegenübersaß und sich noch bis vor wenigen Tagen Duke eines ansehnlichen Familienvermächtnisses nennen durfte. Dieser Titel wurde ihm allerdings vom Königshaus aberkannt.
»Die Aussichten sind zu gering, um sie als nennenswert zu bezeichnen.«
Betrübt verschränkte ich die Arme vor meiner Brust und lehnte mich zurück.
»Es tut mir leid, dass ich nicht mehr tun kann«, gestand ich.
Auch wenn ich an und für sich mit wenig Skrupel auskam, fühlte ich dennoch ein deutliches Unbehagen darüber, dass dieser Mann den Kopf für mich hinhielt. Wobei das vielleicht etwas zu grob betrachtet war.
Seiner Ansicht nach ging es hier nur um ›die Sache‹. Und wir sollten uns schlichtweg nicht beirren lassen, sondern ›die Sache‹ um jeden Preis schützen. Und wenn das eben bedeutete, dass er aufflog, um den Rest der Sache zu retten.
Ich rechnete es ihm hoch an, dass er sich den Ermittlungen stellte, um mir Deckung zu geben. Ich wusste nicht, ob ich auch dazu bereit gewesen wäre. Dabei hätte ich weitaus weniger zu verlieren gehabt, als es bei ihm nun der Fall war.
Er hatte eine Familie. Ehefrau, Sohn, Töchter, Angestellte, ein Anwesen, Pächter. Sie alle waren von ihm abhängig. Zwar war ich auch Gutsbesitzer eines nicht zu klein geratenen Vermächtnisses, doch Familie hatte ich bis jetzt noch nicht vorzuweisen.
Meine Mutter hatte ich lediglich die ersten dreizehn Jahre meines Lebens, ehe sie achtzehnhunderteinundfünfzig auf der Überfahrt nach Nordamerika dem Typhus erlegen war. Nach den gigantischen Missernten und den darauffolgenden gravierenden Auswirkungen hatte sie alle Pächter und Angestellten entlassen, ihnen eine beträchtliche Abfindung überreicht und Gottes Segen gewünscht.
Dann hatte sie sich um unser Wohl gekümmert. Nachdem mein Vater sich nur ein Jahr zuvor das Leben genommen hatte, da er die finanzielle Niederlage als unerträglich erachtete, waren nur noch meine Mutter und ich geblieben. Sie hatte mich zurücklassen wollen. Mit ihrer Zofe Ellie und ihrem treusten Gutsverwalter, Sir Fionbarr O´Clery, welche sich um meine Angelegenheiten kümmerten, ehe ich alt genug war.
Ihr Plan war gewesen, in Nordamerika Fuß zu fassen und uns beide alsbald zu sich zu holen. Sie hatte nicht ahnen können, dass sie nicht einmal einen Fuß auf den großen Kontinent setzen würde. Und dass sie ihren einzigen Sohn – mich – nie wieder zu Gesicht bekommen würde.
Vorgesorgt hatte sie trotzdem. Etwaige Fonds, Vormundschaften und Erbschaftsangelegenheiten hatte sie sorgsam vorbereitet. So war ich immerhin abgesichert und hatte zumindest die Perspektive, aus meinem Leben etwas zu machen.
Und das hatte ich.
Die Anzahl meiner Gutspächter war inzwischen auf stolze sechzehn angewachsen. Politisch fand ich mich im Zentrum des House of Lords wieder. Zumindest in der Öffentlichkeit. Und wenngleich sich diverse Gerüchte und Skandale um meine Person rankten, besaß ich doch eine gewisse Machtposition in den Kreisen Dublins, indem ich sie mir mit ausgeklügelten Schachzügen erwarb.
»Sir?«
Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen.
»Ich muss Sie bitten, zu gehen. Die Besuchszeit endet nun.«
Ein junger Wärter baute sich vor uns auf und warf einen langen Schatten durch den Raum.
Gediegen erhob ich mich und war froh, diesem Rattenloch zu entkommen.
»Bitte denken Sie an unsere Abmachung, Lord Riordan. Sie haben es mir versprochen.«
Cecily.
Ja, ich hatte es ihm versprochen.
Und wenn ich mir die Umstände seiner degradierten Familie so ansah, war dieses Versprechen, das er mir abgerungen hatte, wohl auch äußerst nötig.
»Sie haben mein Wort, Lord Lawson.«
»Der bin ich nicht mehr. Für Sie bin ich nur noch Edmund.«
Unschlüssig betrachtete ich diesen Mann, den ich nur um wenige Zentimeter überragte. Trotz seines ergrauenden Haars und der zerschlissenen Kleidung, die er trug, strahlte er eine unantastbare Würde aus. Und insgeheim beneidete ich ihn für seine Bescheidenheit.
»Machen Sie sich keine Sorgen. Vertrauen Sie mir. Ich habe die Initiative bereits ergriffen.«
* * *
Noch lange dachte ich über unser Gespräch im Kilmainham-Gefängnis nach, in dessen Mauern sich die irischen Aufständler inzwischen häuften. Die Untergrabung der britischen Macht war immer noch im Gange. Befürworter der britischen Regierung wiederum versuchten konstant, diese Bemühungen im Keim zu ersticken.
Ein nun schon ewig andauernder Machtkampf, der auf Kosten des kleinen Mannes verrechnet wurde. Eine Tatsache, die mich als angesehenes Mitglied der Oberklasse lange nicht tangiert hatte. Bis Ellie eines Abends zu mir ans offene Kaminfeuer herangetreten war, sich das Recht herausgenommen und auf dem Sessel mir gegenüber Platz genommen hatte. Sie war beauftragt worden, mir einen Brief zu überreichen. Von meiner Mutter.
Der Inhalt ihres Schreibens veränderte meine Sicht der Dinge grundlegend. Nachdem ich durch sie erfahren hatte, wer in Wirklichkeit mein Vater war, war es mir zuerst eiskalt den Rücken hinuntergelaufen. Denn es stellte meine Ansicht über Adelsblut und den Wert eines Menschen gehörig auf den Kopf.
So adelig, wie ich mich immer gefühlt hatte, war ich nämlich gar nicht.
Ich erkannte, dass es mein Ego war, das mich höher von mir denken ließ als angemessen. Vielleicht um mich für diese irrige Ansicht zu bestrafen oder um das dennoch weiterhin vorherrschende Gefühl von Überlegenheit loszuwerden, hatte ich mich geheimen Bewegungen des irischen Landvolkes angeschlossen. Ein Teil von mir bestand schließlich aus demselben Blut wie dem ihren.
»MyLord?«
»Was gibt es, Ellie?«
Sie wusste, dass ich nicht gern gestört wurde, wenn die Tür zum Arbeitsraum geschlossen war. Aber seit eh und je ging sie darüber hinweg.
Diese gutmütige alte Dame hatte das vierundsechzigste Lebensjahr bereits überschritten. Ihre sportliche Statur und Rüstigkeit verdankte sie einem ausgefüllten Zeitplan und arbeitsreichen Dasein unter meinem Dach. Ich hatte ihr schon etliche Male die Möglichkeit geboten, sich mit einer Abfindung ein restliches, ruhiges Leben zu gestalten. Doch sie schlug das Angebot jedes Mal aus.
»Sie erhielten soeben ein Eiltelegramm.«
»Lassen Sie es hier.« Ich klopfte auf die freie Stelle des Tisches, wo sie die Nachricht ablegen konnte. »Was gibt es heute Abend zu essen?«
»Lammkoteletts mit Petersilkartoffeln.«
Sie trat an das Pult und ließ das Stück Papier aus ihren Händen gleiten. Ich sah im Blickwinkel, wie ihre Augen auf meine Unterlagen schielten. Ich wusste, dass sie meine Sachen ohnehin studierte, wenn sie Staub wischte und die Fenster putzte. Und das im Schnitt viermal die Woche.
Und es machte mir nichts aus. Ellie war wohl die einzige Person auf Erden, die mich von vorne bis hinten kannte. Die mich akzeptierte, wie ich war. Ich vertraute ihr. Nicht im Mindesten musste ich befürchten, dass Gefahr von ihr ausging.
»Klingt verführerisch. Sagen Sie Mary bitte, sie soll es nicht zu sehr würzen. Das letzte Mal schmeckte es doch etwas sehr salzig.«
»Sehr wohl, MyLord.«
»Und Ellie?«
»Ja?«
»Danke.«
»Gern geschehen.«
Mit einem mütterlichen Lächeln nickte sie mir zu.
Etwas seltsam war es schon. Sie hatte ich nie als eine Person minderen Wertes aufgrund ihrer Herkunft angesehen. Warum war das bei den anderen nicht ebenso?
Neugierig widmete ich mich einen kurzen Moment später dem Eiltelegramm. Es kam aus dem Hause Lawson. Lady Margaret Lawson lud mich also zum Dinner des morgigen Abends ein. Was bedeutete, sie hatte meine Nachricht bereits erhalten und schien eine Verbindung zwischen Cecily und mir zu befürworten. Andernfalls hätte sie mich nicht eingeladen.
Mit ambivalenten Gefühlen ging ich die ganze Angelegenheit an. Etliche Male war ich vor Ort gewesen, um mit Edmund diffizile Thematiken politischer Natur in gesicherter Umgebung besprechen zu können.
Häufig war auch seine Tochter Cecily zugegen gewesen. Ich konnte nicht behaupten, sie zu mögen. Aber abstoßend fand ich sie auch nicht. Sie wirkte auf eine seltsame Art hilflos und gleichzeitig gewieft. Irgendetwas an ihr löste Faszination in mir aus und im selben Augenblick Skepsis.
Doch nun gab es kein Zurück. Ich hatte dem Lord mein Wort gegeben. Und seit geraumer Zeit wuchs meine Haltung zu Rückgrat. Ich war gewillt, mein Versprechen zu halten. Ob es nun aus dem Verstand heraus war, weil ich wusste, dass es sich so gehörte? Oder ob wahrhaftig so etwas wie Loyalität in mir herangewachsen war?
Ich wusste es selbst nicht.
Fakt war, dass ich Sir Edmund Lawson das Bewahren meiner Reputation verdankte und damit einhergehend auch die Sicherung von überschlagen hundertzwanzig Existenzen, verteilt auf all die Gutshöfe und mein Anwesen, welche von mir abhingen. Allein diese Tatsache verlangte nach Einhaltung der Abmachung.
Was dem noch im Wege stand?
Ich vermutete, Cecilys Einverständnis. Denn so wie sie sich mir gegenüber im Vergleich zu anderen jungen Herren verhielt, ließ erahnen, dass ihr an einer Verbindung mit mir nicht sonderlich gelegen war.
Es würde mehr brauchen als ein einnehmendes Lächeln und eine Einladung zur Oper.
Die Herausforderung weckte Kampfgeist in mir.
3
Cecily
Angespannt widmete sich Charlotte meiner Frisur, während ich auf meinen Fingernägeln kaute und in meinem Kopf weiter an der Idee tüftelte, wie ich dieser grausamen Zukunft entrinnen konnte.
»Möchten Sie das blaue oder das smaragdgrüne Collier tragen, Lady Lawson?«
»Keines, Charlotte. Aber vielen Dank.«
Verblüfft hielt die junge Kammerzofe inne und machte den Anschein, noch verunsicherter zu sein, als sie es ohnehin immer war.
»Ich komme dann allein zurecht, Charlotte. Hab einen schönen Abend.«
Beschwichtigend legte ich meine Hand für einen Augenblick auf ihre Schulter und trat als Nächstes an die große Fensterfront.
»MyLady?«
Überrascht drehte ich mich um. Mit großen Augen sah mich die junge Frau an.
»Was hast du auf dem Herzen, Charlotte?«
»Ich möchte Ihnen danken, dass Sie so nett sind. Ich habe so gern für Sie gearbeitet. Aber ich habe eine neue Stelle gefunden. Als Gesellschafterin. Bei Lady Forrester, wissen Sie?«
Für einen Moment hatte sie mich sprachlos gemacht. Sie würde uns verlassen? Ging das denn einfach so?
Nur eine Sekunde später rügte ich mich für diese absurde Frage.
Natürlich ging das. Charlotte war schließlich nicht unser Eigentum.
»Ich gratuliere Ihnen, Miss Charlotte Weston. Damit haben Sie eine beachtliche Beförderung erlangt. Ich freue mich aufrichtig für Sie.«
Ich reichte ihr beglückwünschend die Hand und versuchte mein Bedauern, sie zu verlieren, zu verbergen.
»Ich möchte nicht undankbar erscheinen, Lady Lawson.«
»Keineswegs. Sie haben es verdient. Freuen Sie sich darüber. Sie sind eine fleißige junge Dame, die mehr kann, als Kleider zu schnüren und aufzubügeln.«
Betreten zog sie einen Briefumschlag aus ihrer Schürze.
»Darf ich Sie um etwas bitten, Lady Lawson?«
»Selbstverständlich.« Ermutigend lächelte ich ihr zu.
»Darf ich Sie bitten, diesen Brief für mich aufzugeben. Er ist für Ihre Schwester. Ich möchte sicher sein, dass er das Postamt erreicht. Der Postjunge verlor hin und wieder schon Umschläge.«
Nachdenklich nahm ich den Brief entgegen.
»Das werde ich, Miss Weston.«
»Nein bitte, nennen Sie mich Charlotte.«
»Lady Forrester kann sich wirklich glücklich schätzen. Ich habe sie einmal auf einem Empfang gesehen. Wir wurden einander nicht persönlich vorgestellt, aber sie machte auf mich einen sympathischen Eindruck.«
»Ich nehme an, so ist es.« Charlotte schmunzelte zaghaft.
Ich wedelte mit dem Kuvert in der Luft. »Ich werde Ihren Brief nicht vergessen. Er wird beim Postamt aufgegeben, alsbald ich wieder in der Stadt bin.«
Minuten später saß ich allein in meinem Zimmer und verdaute die Neuigkeit. Charlotte war – ohne, dass ich es selbst wirklich registriert hatte – eine große Stütze gewesen. Und nun sollte ich auch noch sie verlieren?
All die Entwicklungen brachten mich immer mehr zu der Feststellung, dass es wirklich das Beste war, eine Flucht mit Leo anzustreben. Ich konnte Klippen hinaufklettern, mit Pferden in einer Box übernachten, ohne dass jemand aus meiner Familie je Wind davon bekommen hatte. Gut. Mit Ausnahme vielleicht von Leo, wie ich vor Kurzem erfahren durfte.
Ich fühlte mich dazu in der Lage, die Herausforderungen von schwerer Arbeit und der stetigen Gefahr eines Auffliegens und Erkanntwerdens zu meistern. Und wenn ich die Geschwindigkeit all der Veränderungen momentan betrachtete, durften wir keine Zeit mehr verlieren.
Die große Standuhr aus Teakholz schlug zur vollen Stunde, was mir sagte, dass ich nun hinuntergehen musste, um diesem unerwünschten Gast gegenüberzutreten.
Erhobenen Hauptes und mit gerader Haltung betrat ich den Speiseraum, in dem sich bereits alle anderen eingefunden hatten. Tante Marigold hatte sich besonders herausgeputzt. Ich empfand es als geradezu übertrieben für ein schlichtes Dinner zu fünft.
Aber was sollte es? Im Wesentlichen brauchte es mich nicht zu kümmern. Sollte Lord Riordan denken, was er wollte.
Wenn man von ihm dachte …
Geradewegs steuerte er auf mich zu und deutete eine höfliche Verbeugung an. »Guten Abend, Lady Lawson. Es freut mich, Sie gesunder Natur zu sehen.«
Pardon?
»Guten Abend, Lord Riordan. Sie scheinen den Weg zu uns nicht vergessen zu haben. Es ehrt uns, dass Sie unser Gast sind, gerade angesichts der Umstände.«
Ein missbilligendes Naserümpfen vonseiten meiner Mutter konnte ich im Augenwinkel wahrnehmen.
»Ihr Vater und ich verstanden uns hervorragend. Ich bedauere diesen Verlauf äußerst. Erst des gestrigen Tages besuchte ich ihn.«
Diese Eröffnung kam unerwartet und ließ mich aufhorchen.
»Tatsächlich? Geht es ihm gut?«
»Er ist wohlauf, wenngleich ihn die Sehnsucht nach seiner Familie plagt.«
»Sicherlich. Wie schafften Sie es, Zugang zu erlangen? Uns sagte man, dass er keinen Besuch empfangen dürfe.«
Etwas merkwürdig war es definitiv.
»Nun, ich ließ ein paar Beziehungen spielen. Aber behalten Sie das für sich. Wenn jemand davon erfährt, kann ich mich gleich zu ihm gesellen.«
Perfekt. Meine Augen hielten sinnbildlich nach dem nächsten Constable Ausschau.
Für einen winzig kleinen Moment.
Ich wollte nicht ungerecht sein. Immerhin schien Lord Riordan tatsächlich einer von ganz wenigen zu sein, der sich nicht schlagartig distanzierte.
»Ich werde es für mich behalten.«
Mit einem relativ neutralen Gesichtsausdruck nickte ich noch und war gewillt, die Unterhaltung damit vorerst an jemand anderen abzutreten.
Die Situation hatte etwas Surreales an sich. Während ich mir der Gegebenheiten bewusst wurde, dabei war, die einzelnen Erbsen auf meine Gabel zu spießen und eine dadurch im hohen Tempo über den Tellerrand schoss, hinweg über die weiße Tischdecke rollte und schließlich auf dem dunkelroten Teppich landete, waren die anderen in eine rege Konversation verwickelt.
Keiner hatte es bemerkt. Und auch für den braunen Pfad, den die Erbse ihres Weges in Richtung Boden auf dem weißen Stoff hinterlassen hatte, interessierte sich niemand.
Aus heiterem Himmel brach ich in lautes Lachen aus, hielt mir schlagartig die Serviette vor den Mund und versuchte es zu vertuschen, so als ob ich mich verschluckt hätte. Doch zu spät. Die Nerven schienen einfach mit mir durchzugehen. Mein breites Grinsen wurde ich einfach nicht los. Tränen schossen mir in die Augen.
»Entschuldigen Sie mich. Ich bin untröstlich.«
Ich wusste nicht, ob sie die Worte zwischen meinem Lachanfall vernommen hatten, doch die unterschiedlichen Reaktionen in den Gesichtern meiner Familie und Lord Riordans zu lesen, verursachte lediglich einen weiteren Lachausbruch.
Also deutete ich mit vorgehaltener Hand einen kleinen Knicks an und verließ fluchtartig den Raum. Dabei tauchte immer wieder dieser Moment vor mir auf, in dem sich die Erbse verselbstständigt hatte, sodass mein Lachen im großen Eingangsfoyer geradezu hallte, ehe ich ins Freie trat und Howes am Eingang – einer Säule gleich – dabei beobachten konnte, wie auch er an sich halten musste, um nicht in meinen Anfall einzusteigen.
Was war denn nur los mit mir? Lange konnte ich nicht aufhören zu lachen. Doch mit der Zeit vermischte sich meine Lachsalve mit weiteren Tränen und einem schmerzerfüllten Schluchzen.
Mit vor mir verschränkten Armen stand ich am Treppenabsatz unseres großen Hauseingangs. Die Vögel zwitscherten lebensfroh. Ein Gefühl, das mit meinen gegenwärtigen Emotionen kollidierte. Ich hätte mich gern über den Frühling gefreut. Doch derzeit vermochte ich mich über nichts zu freuen.
Schon jetzt hörte ich die Stimme meiner Mutter, angesichts meines glanzvollen Auftritts. In meinen Augen hatte ich damit nichts verloren. Doch sie sah das sicher ganz anders. Nun war es auch unerheblich, was ich mir noch leisten würde. Verscherzt hatte ich es mir ohnehin bereits.
»Howes, bitte ordnen Sie an, dass mein Pferd gesattelt wird. Ich gedenke, einen Ausritt zu unternehmen.«
Ich nahm noch sein Nicken zur Kenntnis, als ich mich zum Gehen umwandte und unvermittelt vor Lord Riordan stand.
»Machen Sie zwei daraus«, kam es ihm salopp über die Lippen.
Keine höfliche Anrede, kein Blickkontakt.
»Lord Riordan, was tun Sie denn hier? Wurde die Tafel bereits aufgehoben?«
»So ist es. Zwangsläufig, möchte ich sagen. Ein diverser Zwischenfall nötigte Ihre Mutter dazu.«
Lag in seiner Stimme etwa Spott?
Ich suchte nach der richtigen Formulierung. Doch im Grunde, auch wenn er die Aussage schmunzelnd tätigte, klang es in meinen Ohren herablassend. Und wenngleich ich meiner Mutter gegenüber keinerlei Verständnis entgegenbringen konnte, so fühlte ich mich trotzdem persönlich angegriffen.
»Nun. Mein Plan sah vor, mir etwas Zeit für mich zu verschaffen. Sie entschuldigen meine Aufschiebung, aber ich befürchte, wir müssen einen gemeinsamen Ausritt vertagen.«
»Um ehrlich zu sein: Mein Zeitplan ist straff geschnitten. Mir wird sich in absehbarer Zeit kaum die Möglichkeit bieten, Ihre Einladung einer Aufschiebung anzunehmen. Vertrauen Sie mir. Es ist ohnehin besser, Ihrer wohlwollenden Mutter für einen Moment nicht unter die Augen zu treten.«
Perplex ließ ich die Hände sinken.
Selten war mir jemand mit so viel Dreistigkeit begegnet. War ich nun davon angetan oder angewidert?
Ich wusste es nicht.
Doch aus dem Anstand heraus blieb mir nichts anderes übrig, als dem Geschehen seinen Lauf zu lassen.
Schweigend ritten wir kurze Zeit später nebeneinander her. Der Wind blies uns scharf um die Ohren. Das saftige Grün der satten Wiesen umschmeichelte die Beine unserer Vollblüter, die ihr Temperament mit schaukelnden Köpfen zum Ausdruck brachten.
Ursprünglich lag mir eine Entschuldigung auf der Zunge. So war es mir anerzogen worden. Doch da ich mir den Lord nicht zum Freund zu machen ersuchte, ließ ich es einfach bleiben.
»Ich weiß, Sie haben keinen Gefallen an dem Konzept Ihrer Mutter. Ich verstehe das.«
Dass er direkt war und schnell zum Punkt kam, hatte ich früher schon gelernt.
»Wie könnten Sie?«
»Wir ähneln uns, was das angeht. Beide lassen wir uns ungern vorschreiben, was wir zu tun oder zu lassen haben.«
»Wo denken Sie hin, Lord? Als Dame haben wir nicht im Ansatz ein Recht darauf, unseren eigenen Willen zu bekommen, geschweige denn, ihn zum Ausdruck zu bringen. Es sei denn, man schließe sich dem Widerstand an.«
»Diesen Standpunkt vertreten Sie also? Daher der lautstarke Lachanfall vorhin?«
Ich warf ihm einen störrischen Blick zu. »Und was bezwecken Sie mit Ihren Sticheleien? Niemand fragte Sie nach Ihrer Meinung, Lord.«
»Verzeihen Sie. Ich kenne nur wenige, mit denen solche Schlagabtäusche möglich sind. Ich nehme an, in diesem Fall geht mir Ihr Vater wohl ab.«
Überrascht musterte ich ihn, zog skeptisch eine Augenbraue hoch. Sein nachdenklicher Blick, der auf die Mähne seines Pferdes gerichtet war, brachte mich dazu, Aufrichtigkeit seinerseits in Betracht zu ziehen. Weshalb sich mir allerdings immer noch nicht erschloss, warum er sich ausgerechnet um meine Gunst bemühen sollte.
Was hatte er davon?
4
Noah
Ihre Gereiztheit sprühte Funken. Scheinbar brachte ich sie durch mein Verhalten mehr auf die Palme, als damit Eindruck zu schinden. Oder war sie sich noch nicht so ganz schlüssig, was sie denken sollte?
»Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht verärgern. Sie machten auf mich den Eindruck, den gleichen Humor wie Ihr Vater zu besitzen. Ich sollte weniger töricht sein.«
Das Gedankendurcheinander war ihr im Gesicht abzulesen, was mich zuversichtlich stimmte. Ihre Haltung war nicht halb so ablehnend, wie ich zuerst angenommen hatte.
Stumm musterte sie mich von Kopf bis Fuß. Zumindest hatte sie die gleiche Haltung, wie ihr Vater sie stets einzunehmen wusste.
Meine Entschuldigung kommentierte sie nicht. Und auch so stand ihr wohl nicht sonderlich der Sinn nach weiteren Gesprächen. Also bedrängte ich sie nicht mehr.
Die Sonne neigte sich dem Horizont zu und warf goldene Lichtstrahlen in die gedeihenden Felder. Wir passierten eine Baumallee, ritten an diversen Stallungen, Weidegründen und Scheunen vorbei.
Die Atmosphäre hätte friedlich sein können, wäre da nicht das gegenwärtige Thema in der Luft gehangen. Wir waren beide über die gewünschten und angedachten Pläne hinsichtlich unserer Zukunft im Bilde. Es war Zeit, darüber zu sprechen.
Dass sie sich dafür nach über einer Stunde Schweigen immer noch nicht bereit fühlte, konnte ich nicht mehr berücksichtigen.
Die Uhr tickte.
»Was haben Sie an mir auszusetzen, Lady Lawson?«
Unverblümt war ich seit eh und je. Und hin und wieder löste es sogar eine Art Nervenkitzel in mir aus. So wie gerade eben.
»Was meinen Sie?«
»Angesichts dessen, dass Sie über den Wunsch Ihrer Mutter sicher bereits in Kenntnis gesetzt wurden, zeigen Sie mir äußerst deutlich die kalte Schulter.«
Ein verächtliches Schnauben entwich ihr. »Beantworten Sie mir doch zuerst, welche Beweggründe Sie für diese Idee gewonnen haben, Lord Riordan. Dann sage ich es Ihnen vielleicht.«
Bei ihrer Aufforderung sträubte sich alles in mir. Ich war nicht gewillt, mich erpressen zu lassen, und war drauf und dran, ihr das auch entgegenzuschleudern. Doch etwas hielt mich zurück.
Gezielt legte ich mir die passenden Worte zurecht und unternahm noch einen tiefen Atemzug.
»Ihr Vater spielt in meinem Leben eine wohl größere Rolle, als Sie vermuten. Sein Wohl und das seiner Familie sind mir wichtig. Ich bin in meinen besten Jahren und noch unverheiratet. Und Sie, Lady Lawson, sind in einer verhängnisvollen Lage, sind Ihrem Vater sehr ähnlich, und ich bin von Ihnen angetan. Das wären gleich mehrere Argumente, die für uns sprächen, finden Sie nicht?«
Beinahe gelangweilt stöhnte sie auf. »Ihre Worte überzeugen mich nicht, Lord Riordan.«
Stutzig blickte ich drein, hatte eher damit gerechnet, dass sie sich geschmeichelt fühlen würde. Stattdessen fuhr sie mit ihrer Sicht der Dinge fort.
»Mir scheint, Sie berücksichtigen all die Einbußen nicht. Die Nachteile und Defizite, die diese Beziehung mit sich brächte. Oder Sie lassen sie vollkommen gewillt außer Acht. Ihr Leichtsinn macht mich skeptisch. Oder soll ich eher sagen, Ihre Unbekümmertheit dahingehend? Als hätten Sie alles bereits berechnet und kämen dennoch auf Ihren Gewinn. Mir leuchtet nicht ein, weshalb Sie so agieren.«
»Was, wenn ich Ihnen sage, dass es mit Loyalität zu tun hat?«
»Selbige, wie sie mein Vater gelebt hat? Damit hätten wir noch einen Grund mehr, der eher gegen Sie spricht.«
»Offenbar ist es unerheblich, welche Grundlagen ich vorbringe. Sie werden sie abschmettern, nicht?«
»Denken Sie, was Sie wollen. Unsere Wege werden sich künftig nicht wesentlich kreuzen.«
»Sie sind sich so sicher.«
* * *
Sie war sich wirklich sehr sicher.
Mein Kopf arbeitete auf Hochtouren. Warum ließ mich das Gefühl nicht los, dass sie etwas im Schilde führte? Etwas, das meinem Vorhaben in die Quere kommen konnte.
Ob es doch jemanden gab? Einen anderen?
Im Grunde war es mir einerlei, ob es sich um jemanden adeliger Herkunft oder um den Stallburschen aus des Nachbars Sippe handeln würde. Sie durfte nur einfach nicht türmen. Egal, mit wem.
Ein bereits durchdachter Schachzug trat wieder auf den Plan, der die ganze Angelegenheit um Cecilys Zukunft beschleunigen würde. Es war nicht mein alleiniger Einfall, und er war auch nicht die präferierte Option. Es war eine skrupellose Idee. Und ein Spiel mit dem Feuer. Im wahrsten Sinne. Doch damit ließen sich wohl gleich mehrere Probleme mit einem Schlag lösen.
Alle Lawsons wären in kürzester Zeit obdachlos, was Cecily unter Zugzwang setzen würde. Außerdem hätte ich mir mit diesem Fall ihre bornierte Mutter vom Hals geschafft. Die würde aller Wahrscheinlichkeit nach nämlich Zuflucht bei ihrer Schwester Marigold suchen. Und die residierte gut ein paar Stunden südlich von Dublin.
Gedankenversunken begann ich, eine Einladung zu formulieren, in welcher ich die Familie Lawson um Begleitung zu einer Oper ersuchte. Zwar hätte ich diese lieber alleine besucht, doch um mein Ziel zu erreichen, musste ich Kompromisse eingehen.
Bereits vor vielen Jahren hatte ich eine Leidenschaft für den talentierten Musiker und Komponisten Charles Villiers Stanford entwickelt. Er war vierzehn Jahre jünger als ich und besaß herausragendes Talent im Musikwesen. Etwaige Stücke wurden in den Kreisen Dublins bereits seit Jahren wertgeschätzt – so wie auch bei besagter anstehender Oper. Zudem war er seit einiger Zeit zum Organisten am Trinity College ernannt worden. Und all das, obwohl der junge Stanford gerade erst zarte siebenundzwanzig Jahre alt war.
Wann immer ich konnte, verfolgte ich seinen Karriereverlauf in den Zeitungen und besuchte dann und wann musikalische Anlässe, welche Stücke aus seiner Feder in ihren Arrangements würdigten.
Mit seinem Vater hatte ich sogar bereits persönlich Bekanntschaft gemacht. Wir hatten uns in den Gängen des Dubliner Kanzleigerichts getroffen, wo dieser ein Amt innehatte.
Nicht zuletzt war Stanford ein ausschlaggebender Motivator, dass ich meine Fähigkeiten im Klavierspiel unentwegt verbesserte. Zumeist spielte ich für mich allein. Gelegentlich gönnte ich mir den einen oder anderen Lehrgang bei diversen studierten Musikprofessoren der umliegenden Colleges.
Ich zog die unterste Schublade meines pompösen Sekretärs auf und griff nach einer fast leeren Cognacflasche sowie einem kleinen Schnapsglas. In meinem Kopf erklang Orchestermusik. Ich konnte es kaum erwarten, wieder die emotionsgeladenen, musikalischen Gewalten in Dublins geschätztem Queens Theatre in der Great Brunswick Street zu erleben.
Gemächlich schlenderte ich mit Flasche und Glas zu dem Flügel, den ich im westlichen Teil des Raumes platziert hatte. Mehrere hohe Fenster zur West- und Nordseite fluteten das Zimmer mit Tageslicht, wenn denn nicht gerade die schweren, bordeauxroten Stoffvorhänge zugezogen waren.
Ein Stück von John William Glover, ebenfalls einem begnadeten Komponisten, war noch aufgeschlagen. So nahm ich Platz und ließ meine Finger zuerst sanft über drei bis vier Oktaven gleiten, ehe diese zu den ersten Akkorden ansetzten und die Tasten gefühlvoll nach unten drückten.
Eine harmonische Klangfolge erfüllte die Atmosphäre und brachte das Anwesen und die Menschen darin miteinander in Einklang. Schon mehrfach war mir aufgefallen, dass nicht nur ich die Musik genoss.
Mein Personal, das neben meiner obersten Hausdame Ellie auch Mr. O‘Clery, den Butler, den Stallmeister Mr. Brewster sowie einige weitere Bedienstete einschloss, schien die Musik ebenfalls sehr zu genießen. Nicht selten begegnete ich lächelnden Gesichtern, nachdem ich gespielt hatte. Es war, als legte die Musik einen Schleier von Leichtigkeit über das Haus.
Für einen Mann meines Standes und Status war es wahrscheinlich eher unüblich, sich mit derart viel Herzblut dem Erlernen eines Musikinstruments zu widmen. Und ich gab zu, in der Öffentlichkeit sprach ich nicht sonderlich viel darüber. Ich war nicht bekannt dafür, dem Klavier so zugewandt zu sein.
Und so durfte es auch bleiben.
* * *
»Sind Sie häufig Gast im Queens Theatre, Lord Riordan?«
Leonard Lawson – hinter uns seine Mutter und seine Schwester – folgte mir in das stattliche Gebäude, studierte seine Umgebung aufmerksam und war geübt darin, selbstsicher aufzutreten.
»So ist es. Vornehmlich lasse ich mich von Charles Stanfords Werken begeistern. Sie dürften ihn unter Umständen sogar persönlich kennen. Er ist Organist am Trinity College.«
Ich wandte mich dem jungen Mann zu und nahm für einen Augenblick sein Erstaunen wahr.
»Nun. Auf dem Campus hört man hin und wieder von ihm. Allerdings besuche ich das University College. Daher dürften wir uns nicht begegnen.«
Da hatte ich meine Hausaufgaben wohl nicht richtig gemacht. Wieso hatte ich das verwechselt?
»Ach ja, richtig. Verzeihen Sie die Verwechslung. Ich hoffe doch sehr, dass das College Sie für ein Stipendium vorsieht und Ihre tragischen Familienumstände nicht als Anlass betrachtet, sich Ihrer zu entledigen.«
»Ich befürchte, so wird es wohl kommen.«
Leonards Gesichtsausdruck nahm keine deprimierten Züge an. Eher schien es ihm gleichgültig zu sein.
»Sie wirken nicht sonderlich betrübt darüber?«
Nun sah er mich direkt an und schien etwas zu kalkulieren.
Gerade schien es so, als hätte er sich dafür entschieden, meine Frage nicht zu beantworten, da öffnete er sich doch.
»Um ehrlich zu sein, war es nie mein Wunsch, an der Universität zu studieren.«
Das war mir nicht neu. Nur behielt ich das vorerst für mich.
»Ach nein?«
»Vielleicht ist zu viel Erbgut meines Onkels durchgerutscht. Ich fühle mich – wie Onkel Charles – nicht für diese Welt geschaffen. Diese Gesellschaft mit Standesunterschieden, Zeitungen voll Klatsch und der regelrechten Sucht nach aufregenden Ereignissen. Verzeihen Sie, Lord Riordan, bitte nehmen Sie das nicht persönlich. So war es nicht gemeint.«
»Nichts für ungut, ich verstehe sehr gut, was Sie meinen. Mir ging es in Ihrem Alter genauso.«
»Tatsächlich?«
Diese ungläubige Hinterfragung stammte nun nicht von Leonard, sondern von seiner Schwester. In ebendiesem Moment erreichten wir den Treppenabsatz zu den oberen Logenplätzen. Ich trat einen Schritt zurück und bot Cecily meinen Arm an.
»Ja, tatsächlich.«
Ihren Widerwillen hätte wahrscheinlich noch der Türwächter viele Meter von uns entfernt wahrgenommen. Doch sie nahm das Angebot an und legte ihre behandschuhte Hand in meine Armbeuge.
»Ich wurde Vollwaise mit dreizehn Jahren und sollte von da an lernen, was es heißt, seinen eigenen Mann in der Gesellschaft zu stehen. Selbst nach zehn Jahren schienen mir so viele Dinge so vollkommen unlogisch.«
Eine verblüffte Cecily blickte zu mir auf.
Ja, diese Informationen waren sicherlich nie an sie getragen worden, denn nicht einmal mit Edmund hatte ich mich ausführlich über meine Vergangenheit unterhalten. Wir hatten stets ein äußerst arbeitslastiges Verhältnis gepflegt.
5
Cecily
»Und nun ergibt all das für Sie mehr Logik? Was hat Ihren Sinneswandel bewirkt?«
Meine Neugierde war geweckt, auch wenn ich es nicht gern zugab. Im Augenwinkel konnte ich wahrnehmen, dass ich Leo die Frage vorweggenommen hatte.
»Die Politik. Einhergehend mit dem Unverständnis für unsere Gesellschaft drängte sich mir der Wunsch auf, etwas verändern zu wollen. Veränderungen kann ich nur herbeiführen, wenn ich Macht besitze. Und Macht finde ich in der Politik.«
»Verzeihen Sie, aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was hat sich dadurch geändert?«
Ich ließ nicht locker.
Denn entweder, er versuchte einfach nur klug daherzureden oder es steckte wahrhaftig eine plausible Erklärung dahinter. Und wenn dem so war, wollte ich sie hören.
Wissend schmunzelte der Lord uns nacheinander an.
»Es heißt: Wissen ist Macht. Wissen bedeutet auch mehr Einblicke. Und je mehr Einblicke einem vergönnt sind, desto klarer wird die Erkenntnis, dass nicht alles schwarz und weiß ist. Dass nicht alles so einfach ist, wie es scheint. Auch nötige Veränderungen nicht.«
Was er sagte, leuchtete ein. Das musste ich gestehen.
Ganz abgesehen davon, dass ich von meiner Entschlossenheit, mit ihm keine Bindung einzugehen, nicht abrücken wollte, spürte ich in mir dennoch allmählich so etwas wie Sympathie für ihn.
Es war mir schlichtweg unbegreiflich.
Jahrelang kannten wir einander, hatten so oft gemeinsam zu Tisch gesessen, Spaziergänge mit der Familie unternommen – und nie hatte er sich auch nur einen Funken für mich interessiert.
Und erst jetzt, da ich nichts mehr zu bieten hatte, war ich in seinen Fokus geraten. Wie um alles in der Welt sollte ich das verstehen?
Abseits all jener inneren Konflikte, die mir durch den Kopf schossen, übte er leider unumstritten eine gewisse Faszination auf mich aus. Ich wollte ihm glauben. Er brachte seine Argumente und Aussagen stets glaubhaft zum Ausdruck.
Aber irgendetwas in mir konnte es nicht.
Wir erreichten das obere Stockwerk, und in aller Seelenruhe schritten wir durch den Tumult.
Zum ersten Mal spürte ich deutlich die abwertenden Blicke, das bösartige Getuschel hinter vorgehaltener Hand. Es tat unfassbar weh.
Unerwartet legte sich sanft eine Hand auf die meine, welche seit einigen Minuten in der Armbeuge des Lords ruhte. Und es war seine.
Ich blickte zu ihm auf. Und in seinen Augen vermeinte ich etwas Verschwörerisches zu lesen. Und eine stille Aufforderung. Mit leichtem Druck auf die Finger beugte er sich ein wenig zu mir herunter.
»Lassen Sie es sich nicht anmerken. Sonst haben sie gewonnen.«
War mir der Verdruss so deutlich im Gesicht abzulesen?
Seine Züge fanden wieder zurück zu einer undurchschaubaren Maske. Und es schockierte mich doch äußerst, wie wandelbar dieser Mann neben mir war. Und unberechenbar.
Im Grunde hatte ich es bis vor Kurzem nicht anders gehandhabt. Im Gedränge großer Anlässe, inmitten sensationshungriger Menschen war ich stets darauf bedacht gewesen, mir von niemandem in die Karten sehen zu lassen. Erst seit Vaters grandiosem Skandal schien mir diese Fähigkeit plötzlich abhandengekommen zu sein. Ich fühlte mich so ausgeliefert und angreifbar.
Widerstrebend erkannte ich, wie recht mir der Schutz dieses Machtmenschen, Lord Riordan, gerade doch war. Abgesehen davon, dass ich gar nicht hier sein wollte. Aber was blieb mir denn übrig?
Wir erreichten unsere Loge, welche sich zur linken Seite der Bühne befand. Vor etwas mehr als drei Monaten hatte ich zuletzt auf einem solchen Platz eine Oper genossen.
Augenscheinlich desinteressiert schnappte ich mir das Programm und nahm Platz zwischen meiner Mutter und dem Lord. Erst als ich auf dem kleinen Stück Papier den Namen Charles Villiers Stanford erhaschte, schlug mein Herz höher.
»Stanford?«
»Ja. Leider nicht persönlich. Aber einige seiner Stücke werden heute gespielt.«
Mit einem Funkeln in den Augen wandte sich mir der Lord erneut zu.
»Wieso haben Sie mir das denn nicht eher erzählt? Sie haben mich einer guten Portion Vorfreude beraubt, Lord Riordan.«
Heiter lachte er auf. »Sie mögen Stanford?«
»Ich liebe Stanford.«
»Wahrhaftig?«
»Und ob. Er ist nur fünf Jahre älter als ich. Seit ich lesen kann, werde ich nicht müde, seinen Werdegang mitzuverfolgen. Was hätte ich darum gegeben, den gleichen Weg wie er einschlagen zu können.«
»Was für eine angenehme Überraschung. Damit haben wir wohl etwas gemeinsam.«
Nachdenklich ruhten seine grünen Augen auf mir. Was er wohl dachte?
»Spielen Sie Piano, Cecily?«
Es behagte mir nicht im Mindesten, dass er mich bei meinem Vornamen nannte. Und allzu schnell befand ich mich erneut in einem inneren Zwist, ob ich die endlich eingekehrte erholsame Atmosphäre nun wieder zerstören oder lieber einfach darüber hinwegsehen sollte. Ich entschied mich für Zweiteres.
»So ist es.«
Es lag nur einen Tag zurück, als ich mit ebenjenem Mann zu Pferde über die Felder gestreift war, fast als wären wir alte Bekannte. Und diese Begegnung hinterließ noch immer eine gewisse Unschlüssigkeit. Je mehr ich über Lord Riordan erfuhr, desto unsicherer wurde ich mir.
War eine Heirat mit ihm wirklich das Schlimmste, was mich treffen mochte?
Andererseits konnte er es wahrhaft nicht eiliger haben. Uns gleich des darauffolgenden Tages in eine kostspielige Oper einzuladen war ein deutliches Anzeichen dafür, dass er keine Zeit verlieren wollte. Doch warum nur?
* * *
»Haben Sie wahrgenommen, wie der ganze Theatersaal erbebte? Es war atemberaubend.«
Meine Euphorie ließ sich nicht in Schach halten. Ich musste meine Freude darüber einfach kundtun.
»Ja, es war unvergesslich. Ich möchte meinen, dass das Orchester heute eine seiner besten Aufführungen verzeichnen kann«, stimmte der Lord zu.
»Eine sehr gelungene Inszenierung, da pflichte ich Ihnen durchaus bei«, beteiligte sich auch Leo an den Lobeshymnen, und Mutter nickte ebenfalls.
Wohlwollend streifte sich diese ihre langen Handschuhe über, ehe ihr Leo den teuren Pelzmantel über die Schultern legte, welcher damit gut die Hälfte des dunkelroten Tournüre-Kleids verdeckte. Sie hatte ihr Haar zu einer äußerst aufwendigen Steckfrisur drapiert. Etliche Accessoires zogen die Aufmerksamkeit noch mehr als üblich auf sie.
Ich hingegen hatte mich heute für ein dezentes Tournüre-Kleid ohne aufwendige Drapierungen im sanften Mintton aus Chiffon entschieden. Ein hochstehender Kragen verlief zu einem dezenten V-Ausschnitt. Eine unauffällige Brosche zierte den Dekolleté-Ansatz. Mein Haar war zu einem schlichten Zopf nach hinten gebunden und von Charlotte in große Korkenzieherlocken gedreht worden. Einige wenige Strähnen umspielten mein Gesicht. Und im Gegensatz zu Mutters Garderobe trug ich lediglich einen kurzen, mit Satin überzogenen, gefütterten Mantelet.





























