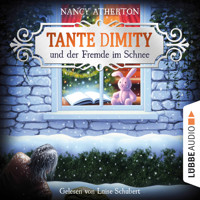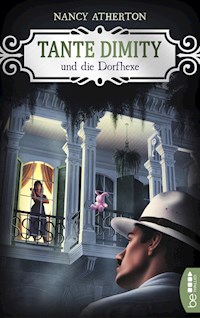5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Emma Porter hat die Nase voll. Ihr langjähriger Freund hat sie wegen einer jüngeren Frau verlassen und ihre Mutter und Freundinnen hören nicht auf, sie deswegen zu bemitleiden. Kurzentschlossen macht sie sich auf den Weg nach Südengland, um sich dort die wunderschönen Gärten anzusehen. Emma ahnt nicht, dass die geheimnisvolle Tante Dimity ihre Hände im Spiel hat, als sie ausgerechnet in Penford Hall landet, einem alten Schloss in Cornwall. Dort erwarten sie ein mysteriöses Rätsel um eine Zauberlaterne und andere mörderische Geheimnisse.
"Tante Dimity und der verschwiegene Verdacht. Wie alles begann" spielt chronologisch vor Loris Ankunft in Finch und erzählt die Geschichte von Emma Porter, die später zu Loris bester Freundin wird. Daher kann der Band außerhalb der Reihe gelesen werden.
Ein zauberhafter Wohlfühlkrimi für gemütliche Lesestunden. Jetzt als eBook bei beTHRILLED.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Nells Erdbeertörtchen.
"Ein Buch, mit dem man sich geborgen und glücklich fühlt." (The Denver Post)
"Kein anderer Krimi ist so liebenswert wie ein Tante-Dimity-Abenteuer!" (Kirkus Reviews)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Nells Erdbeertörtchen
Über dieses Buch
Emma Porter hat die Nase voll. Ihr langjähriger Freund hat sie wegen einer jüngeren Frau verlassen und ihre Mutter und Freundinnen hören nicht auf, sie deswegen zu bemitleiden. Kurzentschlossen macht sie sich auf den Weg nach Südengland, um sich dort die wunderschönen Gärten anzusehen.
Emma ahnt nicht, dass die geheimnisvolle Tante Dimity ihre Hände im Spiel hat, als sie ausgerechnet in Penford Hall landet, einem alten Schloss in Cornwall. Dort erwarten sie ein mysteriöses Rätsel um eine Zauberlaterne und andere mörderische Geheimnisse.
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten „Tante Dimity“ Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Englischen von Christine Naegele
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Alvaro Cabrera Jimenez | Montreeboy
Illustration: © Jerry LoFaro
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3370-1
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity and the Duke« bei Penguin Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 1994 by Nancy T. Atherton
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2006
by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
»KOMMEN SIE ZURÜCK, Master Grayson!«
»Master Grayson, halt!«
»Grayson Alexander! Wenn ich dich in die Finger kriege ...«
Das wütende Brüllen seines Vaters wurde vom aufkommenden Wind übertönt, während der Junge die Terrassenstufen hinunterstürmte und auf die Burgruine zurannte. Sein Hemd war aus der Hose gerutscht und wehte wie eine Fahne hinter ihm her. Er achtete weder auf die Rufe des Dieners noch auf den Zorn seines Vaters, sondern stürmte davon, nur auf sein Entkommen bedacht. Schwarze Wolken ballten sich am Himmel zusammen, und von der See her peitschte ein kalter Wind, der die Klippen heraufheulte und an Graysons Haaren zerrte, während er durch leere Torbögen stürzte und an zerbröckelnden Mauern vorbeihetzte. Blind von Tränen stürzte er über einen halb versunkenen Granitquader und lag einen Moment lang keuchend da, dann raffte er sich auf und rannte weiter.
Er erreichte die grüne Tür, stieß sie weit auf und stolperte die Steinstufen hinunter in Großmutters Garten, der von einer Mauer umgeben war. Hier, hoch auf den schroffen Felsen, die die Bucht flankierten, stand ein kleines, dem Wind trotzendes Bauwerk. Man nannte es die Marienkapelle, obwohl es niemandem besonders heilig war, außer vielleicht dem Jungen. Es thronte über der hinteren Gartenmauer und blickte auf das sturmgepeitschte Meer hinaus wie ein Schiff, das auf dem Wellenkamm reitet; ein kleines, rechteckiges Gebäude aus grob behauenen Granitquadern und mit spitzem Dach, die Tür in einem Rundbogen mit vom Alter schwarzen Scharnieren. Uralt und moosbedeckt erhob es sich, als sei es hier gewachsen, mit Wurzeln, die tief in die dunkle Vergangenheit von Cornwall hinabreichten. Der Junge reckte sich, um den Riegel zu erreichen, dann stemmte er sich mit der Schulter gegen die Tür und schlüpfte hinein. Immer noch keuchend stieß er die Tür hinter sich zu.
Stille. Ruhe.
Licht?
Er wurde unsicher. Er nahm Kerzenlicht wahr, das von irgendwoher kam, wo kein Kerzenlicht hingehörte, nämlich dort vom Sims unter dem Glasfenster – dem bunt leuchtenden Fenster, das aufs Meer hinausging.
»Hallo, Grayson.« Die Stimme klang freundlich und beruhigend. »Jetzt müssen wir wohl erst mal sehen, was wir mit deinem Knie machen, nicht wahr?«
In der ersten Reihe des hölzernen Gestühls saß eine Frau. Als sie sich umdrehte, fiel das Kerzenlicht auf ihr weißes Haar und die grauen Augen in dem freundlichen, runzligen Gesicht, und als sie lächelte, erinnerte er sich: Großmutters Freundin, eine Frau, für die Crowley seine tiefsten Verbeugungen reserviert hatte und in deren Gegenwart sogar Nanny Coles Stimme sanft geworden war. Wenn sie Geschichten erzählte, drängten sich die Bediensteten um die Tür zum Kinderzimmer, um ihr zuzuhören. Zuerst hatte sie Miss Westwood geheißen, aber dann hatte sie einen anderen Namen bekommen.
»Tante Dimity?« Er wischte sich die Tränen ab und ging den Mittelgang entlang zu ihr.
»Das wird eine ungemütliche Nacht, fürchte ich«, sagte sie, indem sie ihre perlgrauen Handschuhe abstreifte. »Ein richtiger Cornwall-Sturm, der sich da zusammenbraut. Aber hier sitzen wir im Warmen und Trockenen.«
Aus den Tiefen ihrer voluminösen Tasche aus Gobelinstoff, die zu ihren Füßen lag, zog sie ein Tüchlein hervor sowie ein Fläschchen und eine Mullbinde. »Setz dich, mein Junge«, befahl sie. »Es wird ein bisschen brennen.« Mit geschickten Händen reinigte und verband sie ihm das Knie, das er sich beim Sturz in der Ruine verletzt hatte. Nachdem sie Tuch und Fläschchen wieder in die Tasche gesteckt hatte, lehnte sie sich zurück, faltete die Hände und wartete.
»Warum bist du nicht gekommen?«, fragte er.
»Ich wusste es nicht«, antwortete sie.
Natürlich. Großmutters Beerdigung war eine jämmerliche Angelegenheit gewesen. Vater hatte es sicher nicht bekannt gegeben.
»Es tut mir schrecklich leid, Grayson«, fügte sie hinzu. »Ich kann mir vorstellen, wie sehr du sie vermisst.«
Grayson rieb sich mit den schmutzigen Fäusten die Augen, dann starrte er auf seine immer noch geballten Hände, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Crowley war als Erster weg gewesen. Dann waren Newland, Bantry und Gash gefolgt. Nanny Cole würde die Nächste sein. Zusammen mit der kleinen Kate würde man sie aus Penford Hall wegschicken, genau wie die restlichen Bediensteten, und er würde sie nie wiedersehen.
Er fing an, Tante Dimity alles zu erzählen, langsam zunächst, dann mit immer größerer Dringlichkeit, und in seiner Stimme schwangen Zorn und Verzweiflung. Es gab sonst niemanden, dem er es hätte erzählen können. Jetzt, wo seine Großmutter tot und das Dorf verwaist war, wo die Hausangestellten entlassen waren, war der zehnjährige Grayson der einzige Zeuge des Verrats, den sein Vater begangen hatte.
»In Penford Hall ist niemand mehr«, beendete er traurig seine Erzählung. »Und jetzt ... jetzt verkauft er alle ihre Sachen.« Er sagte es leise, den Blick zu Boden gerichtet, als ob er dieses Geständnis den Fliesen anvertraute. »Großmutters Schmuck, ihre Bilder ... ihre Harfe.«
»Ach Gott.« Tante Dimity seufzte. »Charlottes wunderschöne Harfe ...«
»Er hat ihre Laterne verkauft.« Graysons Finger zeigte anklagend auf den Granitsims unter dem Kirchenfenster, wo jetzt die Kerze stand. »Wie können wir denn ohne die Laterne das Fest feiern?« Er ließ den Kopf hängen, als ob er sich des Vaters schämte, der selbst keine Skrupel kannte.
Mit leicht gerunzelter Stirn fragte Tante Dimity: »Weißt du ganz bestimmt, dass er das getan hat?«
Der Kopf des Jungen schoss hoch.
»Bist du wirklich ganz sicher, dass die Laterne verkauft wurde?«, fragte Tante Dimity noch einmal. »Ich denke nämlich, dass Charlotte niemals damit einverstanden gewesen wäre, dass sich die Familie von diesem Stück trennt, was meinst du?«
»Wo sollte sie denn sonst sein?«, fragte Grayson ohne Umschweife.
»Ich weiß nicht.« Tante Dimitys Blick wanderte über das Buntglasfenster und die schwach beleuchteten Wände der Kapelle, dann richtete sie sich auf und sah den kleinen Jungen an. »Aber es ist noch lange hin bis zum Fest, und im Moment müssen wir uns um wichtigere Dinge kümmern. Um dein Gesicht zum Beispiel.« Mit einem leisen missbilligenden Laut holte sie ein sauberes Tuch aus ihrer Tasche und machte sich daran, die Tränenspuren in Graysons staubigem Gesicht wegzuwischen. »Ich kann mir vorstellen, wie schrecklich alle diese Veränderungen für dich sein müssen«, sagte sie leise, »und ich werde dir auch nicht sagen, dass du sie wie ein Mann ertragen musst. Erwachsene Männer vergessen viel zu oft, was für Träume sie einmal hatten, doch manche Träume sind es wert, dass man an ihnen festhält.«
Tante Dimity hob das Kinn des Jungen an und sah ihm ins Gesicht, dann strich sie ihm das blonde Haar aus der Stirn. »Du hast doch auch Träume, wenn du an Penford Hall denkst, nicht wahr?«, ermunterte sie ihn. Als der Junge missmutig schwieg, beharrte sie: »Oder meinst du etwa, dass es in Penford Hall wirklich nichts gibt, was dir etwas bedeutet? Nichts und niemanden?«
Alles, was ich liebe, ist hier, dachte Grayson. Ich würde alles tun, um es zu retten, alles, um Kate hier zu behalten und die anderen Bediensteten zurückzubringen. Und laut sagte er: »Was nützt das denn? Bald sind alle weg, und nichts wird mehr so sein wie früher.«
»Ach, Unsinn. Das ist doch dummes Zeug.« Tante Dimity schnaubte verächtlich. »Mein lieber Junge, wenn du erwartest, dass ich dir über den Kopf streichle und sage: ›Ach wie traurig, was für ein schreckliches Schicksal‹, dann hast du dich in mir geirrt, dann hältst du mich offenbar für jemanden, mit dem ich persönlich lieber nicht bekannt sein möchte. Ich habe für derlei Torheiten nicht viel übrig, und deine Großmutter hätte es auch nicht gehabt. Denk daran, dass dein Vater nicht ewig der Herzog sein wird. Eines Tages wird Penford Hall dir gehören.«
»Dann wird es aber leer sein.«
»Dann musst du es wieder mit Leben füllen.«
»Es wird noch Jahre dauern, bis ...«
»Wenn eine Sache es wert ist, dass man sie besitzt, dann ist sie es auch wert, dass man darauf wartet.«
»Aber ...«
»Und Penford Hall ist es wert, dass man sich darum bemüht«, sagte Tante Dimity mit Bestimmtheit. »Wenn du im Moment nicht so verstört wärst, würdest du es genauso sehen wie ich. Aber vielleicht drücke ich mich nicht klar genug aus«, fügte sie hinzu. Nachdenklich betrachtete sie das Kirchenfenster, dann legte sie den Arm um den Jungen und strich ihm das wirre Haar glatt. »Sie hätte nicht aufgegeben«, sagte Tante Dimity und blickte mit ihren grauen Augen in die braunen des Jungen. »Und ihr standen weitaus schlimmere Dinge bevor als dir. Kennst du die Sage von der Laterne?«
Grayson nickte und wiederholte pflichtbewusst die Worte, die er so oft gehört hatte: »Vor langer, langer Zeit lebte eine schöne Dame, die einen mutigen Kapitän liebte ...«
»Großer Gott!«, entfuhr es Tante Dimity. »Hat Nanny Cole dir das etwa erzählt? Eine Dame und ein Kapitän? Du liebe Zeit, warum stopft man die Köpfe der Kinder nur mit solchem Unsinn voll? Sie war keine schöne Dame, mein Junge, sondern ein Mädchen aus dem Dorf, das schwer arbeiten musste. Sie war Stubenmädchen in Penford Hall. Und sie liebte keinen Kapitän, sondern den Sohn des Herzogs, der als gewöhnlicher Matrose zur See geschickt wurde. Und ungefähr das Einzige, was an Nanny Coles Version der Geschichte stimmt, ist, dass sie sich liebten.« Tante Dimitys weißer Kopf nickte bedächtig.
»Nun hör mir gut zu, Grayson, ich erzähle dir jetzt die Geschichte von der Laterne, wie sie sich wirklich ereignet hat. Vielleicht verstehst du dann, warum du Penford Hall nicht aufgeben darfst, egal, was passiert.«
Grayson bezweifelte, dass die Geschichte Penford Hall retten oder die Dienerschaft zurückbringen könnte, aber Tante Dimitys Arm lag warm um seine Schultern, und er wusste nicht, was er sonst tun sollte. Also nickte er, lehnte sich gegen Tante Dimity und baumelte gelangweilt mit dem verbundenen Bein.
»Es ist meist nicht sehr klug«, begann Tante Dimity, »wenn sich ein armes Mädchen in den Sohn eines Herzogs verliebt. Die Liebe mag blind sein, aber Väter sind es ganz bestimmt nicht, und der Herzog fand die Aussicht, ein Zimmermädchen als Schwiegertochter zu bekommen, ganz und gar nicht lustig. Er liebte seinen Sohn zu sehr, um ihm die Sache rundweg zu verbieten – das muss man ihm lassen –, aber er beschloss, die Liebe des Jungen auf die Probe zu stellen, um seiner selbst und um der Familie willen.« Sie sah hinab auf den Jungen, der das Bein jetzt stillhielt, und fuhr fort.
»Das Mädchen wurde ins Dorf zurückgeschickt und durfte sich in Sichtweite von Penford Hall nicht mehr blicken lassen. Der Sohn hingegen wurde dazu verpflichtet, für ein Jahr und einen Tag als gewöhnlicher Matrose auf See Dienst zu tun. Der Herzog hoffte, dass die harte Arbeit ihm seine Verliebtheit austreiben würde.
Aber es war keine bloße Verliebtheit. Der Sohn des Herzogs hatte seine große Liebe gefunden, und er schwor, dass seine erste Reise zugleich seine letzte sein würde. ›Wenn du noch da bist, wenn ich wiederkehre‹, versprach er dem Mädchen, ›dann werde ich dich nie mehr verlassen.‹ Und damit ruderte er aus dem Hafen von Penford, um auf dem großen Viermaster an Bord zu gehen, der draußen im tieferen Wasser auf ihn wartete.«
Grayson wandte Tante Dimity das Gesicht zu. Plötzlich leuchteten die Augen der alten Frau auf, und ein Blitz schien den Himmel zu zerreißen. Der darauffolgende Donner ließ den Jungen zusammenfahren. Schützend zog Tante Dimity ihn noch fester an sich, dann fuhr sie fort.
»Ein Jahr und ein Tag vergingen, und in der Nacht, in welcher der Sohn zurückkehren sollte, gab es ein schweres Unwetter auf dem Meer. Es war ein schrecklicher Orkan mit Wellen so hoch wie Penford Hall und Stürmen, die die stärksten Segel zerfetzten. Die Dorfbewohner, die warm und sicher um ihre Öfen saßen, wussten, dass sich in dieser Nacht kein Schiff in die Nähe der Untiefen vor der Küste wagen würde.«
»Aber sie hat es nicht geglaubt?«, fragte Grayson, die Augen zum Fenster gewandt.
»Nein, das hat sie nicht«, bestätigte Tante Dimity. »Obwohl ihre Mutter sie inständig bat, zu Hause zu bleiben, ließ sich das Mädchen nicht davon abbringen. ›Ich muss da sein, wenn er zurückkommt‹, sagte sie. Und damit nahm sie die Laterne – eine einfache Blendlaterne, nicht höher als fünfundzwanzig Zentimeter, wie es in jedem Haus im Dorf eine gab – und machte sich auf zu den Klippen, wo sie auf die Rückkehr ihres Liebsten warten wollte.«
Der Junge saß angespannt da und rückte noch näher an Tante Dimity heran. Er stellte sich die gefährlichen Klippen vor, die hinter der Rückwand der Kapelle in die Tiefe stürzten, und den langen Weg hinunter in die tobende See.
»Es war ein gefährlicher Gang«, fuhr Tante Dimity mit tiefer, geheimnisvoller Stimme fort. »Den bequemen Weg durfte sie nicht nehmen, denn der führte in Sichtweite an Penford Hall vorbei, und der andere Weg war sehr schwierig. Der Regen peitschte auf sie ein, der Wind zerrte an ihrem Umhang, vor ihr toste die Brandung gegen die Felsen, und überall sah sie dunkle Schatten. Sie fiel wohl ein Dutzend Mal hin, aber immer wieder rappelte sie sich auf ... und nochmals ... und immer wieder ... bis sie im tosenden Wind auf den Klippen stand.«
»Und dann?«, fragte Grayson atemlos.
»Dann passierte es. Das, was niemand erklären konnte. Als sie ihre kleine Laterne hochhielt, fing diese an, mit einem überirdischen Licht zu leuchten, ganz sanft erst, dann immer heller und schließlich wie ein Leuchtfeuer, dessen Schein blendend durch die Dunkelheit drang.« Tante Dimity ließ ihre Worte wirken – Grayson sollte sich eine klare Vorstellung von dieser leuchtenden Laterne machen können –, ehe sie leise fortfuhr.
»Im ersten Morgengrauen sah sie dann das Schiff, den großen Viermaster, beladen mit Gold und Gewürzen, der ihre große Liebe zurückbrachte und jetzt die sicheren Gewässer vor dem Hafen erreicht hatte. Ein winziges Boot löste sich von ihm, das wie ein Pfeil über die Wellen geschossen kam und dann den Hafen von Penford erreichte.«
»Sie trafen sich auf dem Kai«, flüsterte Grayson, der sich wieder auf vertrautem Boden fand.
»Und er erzählte ihr von dem Licht, das sein Schiff durch die Dunkelheit geführt hatte, bis es in Sicherheit war. Und sie erzählte ihm von der Laterne ...«
»Und zusammen erzählten sie es dem Herzog ...«
»Und der Herzog war zutiefst verwundert«, sagte Tante Dimity. »Und von dem Augenblick an liebte er das Mädchen genauso sehr wie seinen Sohn. Und ihr zu Ehren ließ er diese Kapelle erbauen, genau an der Stelle, an der sie gestanden hatte, und er ließ Handwerker kommen, die dieses Fenster mit ihrem Bild darin schufen. Und in die Kapelle stellte er die Laterne, damit bei seinen Nachkommen die Erinnerung an das wundersame Licht niemals erlöschen würde, das seinen Sohn gerettet hatte. Ein Licht, das so hell leuchtete wie ein Blitz und das von der Liebe eines jungen Mädchens entfacht worden war.«
Tante Dimity sah auf den zerzausten Haarschopf an ihrer Schulter. »Und einmal alle hundert Jahre ...«, forderte sie ihn leise auf fortzufahren.
»Und einmal alle hundert Jahre«, murmelte der Junge, »leuchtet die Laterne ganz von allein, und der Herzog von Penford muss den Dorfbewohnern ein Fest ausrichten zum Andenken an das Mädchen aus dem Dorf, sonst wird Penford verfallen und das Geschlecht der Penfords für immer aussterben.«
»Du musst die Laterne finden, Grayson«, sagte Tante Dimity eindringlich. »Du musst Penford Hall retten. Sieh dir das Mädchen an, Grayson, sieh es dir gut an.«
Grayson blickte unbewegt auf das Glasfenster. Das schwarze Haar des Mädchens wehte wild um die Kapuze ihres hellgrauen Umhangs, aber sie stand ungebeugt und mit erhobenem Kopf da. Entschlossen hielt sie die Laterne dem Sturm entgegen, und ihre sanften braunen Augen schienen auf etwas geheftet zu sein, das nicht zu sehen war. Von diesem Blick ermutigt, stand Grayson auf.
Tante Dimitys Stimme klang, als würde sie von weit her kommen: »Weder die Bitten ihrer Mutter noch die Befehle des Herzogs vermochten sie abzuhalten, weder Wind noch Wellen konnten sie schwankend machen, denn ihr Herz war treu und sie gab die Hoffnung nicht auf. Wie ist es nun mit dir, Master Grayson, wirst du weniger standhaft sein?«
Blitze zuckten, der Donner grollte, und Regen hämmerte aufs Dach, aber Grayson Alexander, der eines Tages der vierzehnte Herzog von Penford sein würde, hatte keine Angst mehr.
Kapitel 1
Zwanzig Jahre später
»ALLE NETTEN MÄNNER sind entweder verheiratet oder schwul«, erklärte Rita. »Und nun ist Richard auch verheiratet.« Mit einem Knall schloss sie den Aktenschrank.
Emma Porter rückte sich die Nickelbrille auf der Nase zurecht und warf einen verstohlenen Blick auf die Freesien auf dem Aktenschrank, die sie am frühen Morgen in ihrem Garten gepflückt hatte. Die Vase schwankte, blieb aber stehen, und Emma wandte sich schnell wieder dem Keyboard ihres Computers zu. Sie beugte sich vor und ließ ihr langes Haar wie eine Sichtblende zu beiden Seiten des Gesichts herunterfallen. Sie war entschlossen, sich nicht erneut auf die gleiche langweilige Unterhaltung einzulassen, die sie seit sechs Wochen jeden Tag mit Rita geführt hatte.
»Damit will ich aber keineswegs sagen, dass Richard ein netter Mann war«, fuhr Emmas Assistentin fort, als sie sich einen weiteren Stapel Akten auf den Arm lud. »Ich hätte ihm die Augen ausgekratzt, wenn er mich so behandelt hätte. Keine Augen mehr, um sich an hübschen jungen Dingern aufzugeilen ...« Eine weitere Schublade wurde krachend herausgezogen und bekam Ritas Wut zu spüren.
»Bitte, Rita – die Freesien!«
»Tut mir leid, Emma.« Ritas Stimme bebte vor Empörung. »Aber wenn ich daran denke, wie Richard dich sitzen gelassen hat, nach fünfzehn Jahren ...«
»Wir waren nicht verheiratet«, gab Emma zurück.
»Aber ...«
»Wir haben in verschiedenen Häusern gewohnt.«
»Trotzdem ...«
»Wir sind zwei unabhängige Erwachsene.«
»Ihr wart ein Paar!« Rita kam zurück und stellte sich vor Emmas Schreibtisch. »Fünfzehn Jahre lang habt ihr alles zusammen gemacht. Ihr habt sogar diese große Reise zusammen geplant. Und dann geht er und ... und ...« In Ritas Augen glitzerten Tränen.
Ohne vom Bildschirm aufzusehen, angelte Emma eine halbvolle Schachtel Papiertaschentücher vom Fensterbrett hinter sich und reichte sie Rita, wobei sie hoffte, dass sie auf dem Heimweg daran denken würde, eine neue Packung zu kaufen. Es schien ihr, als ob seit Richards Eheschließung die Hälfte der weiblichen Bevölkerung Bostons bei ihr vorbeigekommen wäre, um ihr Beileid zu bekunden, und alle waren in Tränen ausgebrochen.
»Ach Emma«, brachte Rita mühsam heraus, indem sie versuchte, die Tränenflut zu dämmen, die ihre Wimperntusche zu ruinieren drohte, »wie bringst du es nur fertig, so tapfer zu sein?«
Eine Hand voll Papiertaschentücher gegen die Wangen gedrückt, kehrte Rita an ihren eigenen Schreibtisch zurück, der vor Emmas Bürotür stand; augenblicklich wurde sie von den anderen Frauen der Abteilung umringt. Emma stand auf und schloss die Tür. Die vergangenen sechs Wochen hatten sie gelehrt, dass eine fest geschlossene Tür die einzige Möglichkeit war, sich ihre mitleidigen Kolleginnen vom Leib zu halten.
Seufzend langte sie nach der Vase auf dem Aktenschrank, zupfte eine der duftenden Blüten ab und schnupperte daran. Sie wünschte sich, dass ihre Kolleginnen sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern würden. Schließlich handelte es sich bei ihr und Richard nicht um einen Scheidungsprozess, bei dem schmutzige Wäsche gewaschen wurde. Sie war genauso abgeneigt gewesen wie er, eine Ehe einzugehen. Sie hatten eine eher pragmatische Beziehung geführt, jeder für sich, aber gleichberechtigt, und diese Beziehung hatte die meisten konventionellen Ehen überdauert. Richard hatte sein Stadthaus in Newton, sie hatte ihr Cottage im Cape-Cod-Stil in Cambridge. Er hatte als Fotograf Karriere gemacht, sie als Informatikerin. Sie waren fünfzehn Jahre lang ein Paar gewesen, und jetzt waren sie es nicht mehr. Mehr gab es dazu nicht zu sagen.
Das Lämpchen auf ihrem Telefonapparat blinkte, und Emma sah auf ihre Uhr. Mutters Morgenansprache, dachte sie und verzog das Gesicht. Sie ging zu ihrem Schreibtisch zurück, warf die Blüte in den Papierkorb und langte nach dem Hörer.
»Hallo, Mama.« Emma drehte ihren Stuhl herum, sodass sie zum Fenster hinaussah, wo die trostlose Skyline von Boston sich gegen den regnerischen Aprilhimmel abhob.
»Hi, Emma. Na, hat sich der Schuft schon gemeldet?«
Emmas Blick wanderte an den Efeuranken entlang, die das Fenster einrahmten. Sie griff nach einer Schere. »Nein, Mama, ich habe noch nichts von Richard gehört, und ich erwarte es auch nicht.«
Sie stand auf, klemmte den Hörer zwischen Kinn und Schulter und fing an, die Ranken des Efeus zu beschneiden. »Ich vermute, dass Richard mit seinem neuen Leben viel zu beschäftigt ist ...«
Ihre Mutter schnaubte verächtlich. »Mit seiner neuen Frau, meinst du wohl. Ich habe dir ja tausendmal geraten, den Kerl endlich zu heiraten.«
»Und ich habe dir immer wieder gesagt, dass ich nicht sehe, was das an der Situation geändert hätte«, sagte Emma.
»Dann hättest du jetzt vor Gericht etwas in der Hand! Aber so ...«
»Aber so gehört mir mein Haus, ich habe eine leitende Stellung in einem erfolgreichen Computer-Unternehmen, und ich genieße meine Freiheit. Ich glaube, dass ich mich nicht beklagen kann, oder?«
Ihre Mutter seufzte. »Also wirklich, Emma, ich hätte nie gedacht, dass meine Tochter das so einfach mit sich machen lässt.«
»Was sollte ich denn deiner Meinung nach tun, Mama?«
»Wütend werden! Sein Bild an die Wand schmettern! Irgendwie reagieren! Das, was jede normale Frau tun würde. Aber nicht meine Tochter. Emma, Liebes, ich weiß ja, dass du versuchst, tapfer zu sein. Aber musstest du wirklich auch noch zu dieser Hochzeit gehen?«
»Das hatte nichts mit Tapferkeit zu tun«, erklärte Emma zum hundertsten Male – wie es ihr vorkam. »Es ging mir einfach darum, den Tatsachen ins Auge zu schauen.«
»Ich will dir mal sagen, was die Tatsachen sind«, sagte ihre Mutter verächtlich. »Wenn eine neununddreißigjährige Frau für ein zweiundzwanzigjähriges Flittchen sitzen gelassen wird, dann sollte sie nicht nur mit den Schultern zucken. Du musst deinen Ärger rauslassen, meine Liebe, statt ihn in dich hineinzufressen und krank zu werden!«
»Du hast sicher Recht, Mama.«
Ihre Mutter schwieg, dann sagte sie: »Nun gut. Du musst ja damit klarkommen. Aber eines möchte ich noch wissen, Emma. Hast du den Kerl geliebt?«
Emma zuckte zusammen, als sie bemerkte, dass sie aus Versehen eine lange Efeuranke durchschnitten hatte. »Mama, es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Der Danbury-Auftrag muss fertig sein, ehe ich nach England fliege, und ...«
»Aha. Dachte ich es mir doch.«
»Tschüs, Mama.« Emma legte den Hörer auf und steckte die Schere in den Becher mit den Stiften. Sie fürchtete, dass in ihrer momentanen Verfassung sonst nicht viel vom Efeu übrig bliebe. Es sah ihrer Mutter ähnlich, dass sie auch die unmöglichsten Fragen stellte.
Emma war keine verträumte Idealistin. Sie hatte von Anfang an gewusst, dass ihre Karriere ihr wenig Raum für ein romantisches Liebesleben lassen würde. Ehe und Familie kamen für sie nicht infrage, und sie hatte Richard unter anderem auch deshalb geliebt, weil er das verstanden hatte. Richard war nicht vollkommen – seine Leidenschaft für schlechte Science-Fiction-Filme und Heavy Metal waren zwei Gründe, warum sie froh gewesen war, dass sie getrennt lebten –, aber er hatte ihre Selbstständigkeit respektiert. Ihre Mutter konnte sagen, was sie wollte: Emma konnte sich nicht beklagen – wirklich nicht.
Sie holte tief Luft, um sich zu beruhigen, drehte ihren Stuhl wieder zum Schreibtisch, wo sie die Ellbogen aufstützte und das Gesicht auf die Hände legte. In zwei Wochen würde sie in England sein. Sie konnte es nicht mehr erwarten.
Auch wenn sie nicht damit gerechnet hatte, allein zu reisen. Emma band das lange Haar zu einem Pferdeschwanz zurück, dann bückte sie sich, um die Mappe mit den Prospekten aus der unteren Schublade hervorzuholen. Sie blätterte sie durch, bis sie die Landkarte gefunden hatte, die sie über den Datenblättern des Danbury-Auftrags ausbreitete. Das Kinn auf die Hand gestützt, betrachtete Emma sie aufmerksam.
Da lag Cornwall. Wie ein abgebrochener Ast ragte es aus der südwestlichen Spitze Englands heraus, eine zerklüftete Halbinsel mit dem Atlantik im Norden und dem Ärmelkanal im Süden. Emma war schon oft in England gewesen und hatte zahlreiche Gärten besucht, aber die Gärten von Cornwall hatte sie noch nicht gesehen. Mit dem Finger fuhr sie die geplante Reiseroute entlang, um bei den eingekreisten Namen jeweils innezuhalten: bei Cotehele, Glendurgan, Killerton Park und all den anderen privaten Landhäusern, die jetzt in der Hand des National Trust waren und von zahlenden Besuchern besichtigt werden konnten.
Richard hatte die Absicht gehabt, das Studio für den Sommer zu schließen und die Modefotografie für eine Weile ruhen zu lassen, um ein ganz anderes – anspruchsvolleres – Projekt anzugehen: einen Bildband mit Schwarz-Weiß-Fotografien über die neolithischen Steinkreise, die über ganz Cornwall verstreut waren. Emma war so damit beschäftigt gewesen, neben ihrer eigenen auch noch seine Reise zu planen, dass sie es als Erleichterung empfunden hatte, als er für ein paar Wochen verschwand.
Sie hatte keinen Grund zur Sorge. Natürlich hatten sie in einer offenen Beziehung gelebt, und Richard hatte eine ganze Reihe kurzer Affären gehabt. Es gab keinen Grund zu der Annahme, dass es diesmal anders sein würde.
Dann hatte das Reisebüro angerufen und ihr mitgeteilt, dass Richard seinen Flug storniert habe. Kurz darauf rief Richard an, um ihr zu sagen, dass es eine andere Frau in seinem Leben gebe. Und dann war die Einladung zur Hochzeit gekommen, der endgültige Beweis dafür, dass Richard für immer aus ihrem Leben verschwunden war. Zum Entsetzen ihrer Mutter und all ihrer Bekannten hatte Emma die Einladung angenommen. Sie musste die Märchenprinzessin mit eigenen Augen sehen.
Emma legte die Landkarte wieder zusammen und lächelte leise. Die Märchenprinzessin, so hatte Rita Richards Braut genannt, und Emma musste zugeben, dass die Bezeichnung zutraf. Schlank und elegant, zwanzig Jahre jünger als Richard, mit Haar, das wie gesponnenes Gold glänzte, und Augen wie ein Sommerhimmel, so war die Märchenprinzessin zum Altar geschritten – nein, sie war geschwebt. Und dort hatte Richard sie erwartet. Rundlich in seinem Kummerbund, einen leichten Hauch von Schweiß auf seinem spärlich behaarten Kopf, strahlte er seine zukünftige Frau mit einem väterlichen Lächeln an, das leicht beunruhigend wirkte. Noch bei der Erinnerung daran errötete Emma. Es war so traurig gewesen, ihren freien, unabhängigen Richard plötzlich als Opfer einer ganz banalen Midlife-Crisis zu sehen.
Und doch war es so. Eine fünfzehnjährige Beziehung war zu Ende gegangen, weder mit lautem Knall noch auf leisen Sohlen, sondern mit dem knisternden Geräusch eines Briefes, der durch den Türschlitz fiel.
Nach der Hochzeit hatte sie viel Zeit in ihrem Garten zugebracht. Sie hatte den Komposthaufen umgesetzt und sich dabei gewundert, warum sie sich so ... taub fühlte. Es war Emma nicht gegeben, starke Gefühle zu äußern, aber sie war selbst überrascht gewesen über die Stille, die sich um sie auszubreiten schien. Stand sie wirklich unter Schock, wie ihre Mutter behauptete? Oder befand sie sich lediglich in einer natürlichen Phase des Übergangs, aus der sie reifer und ihre neue Lage akzeptierend hervorgehen würde? Emma zog diese Erklärung vor. Sie wusste, dass es einige Dinge im Leben gab, die sie nicht ändern konnte.
Aber es gab auch Dinge, wo sie es konnte. Sie war ins Haus zurückgegangen und hatte den Rest des Abends damit verbracht, die Sachen zusammenzutragen, die Richard zurückgelassen hatte: einen alten Bademantel, ein kaputtes Stativ, einen Stapel CDs und Videos mit Rockmusik. Als sie die grellbunten Videokassetten in den Karton für den Flohmarkt legte, kam ihr der Gedanke, dass Richards Musikgeschmack genauso unreif war wie sein Geschmack für Bräute, und dieser kleine Witz hatte sie aufgemuntert. Ihr Sinn für Humor war ihr nicht abhanden gekommen, und das schien ihr die Bestätigung dafür zu sein, dass sie in der Lage war, es auch ohne Richard mit der Welt aufzunehmen.
Ihre Freunde und ihre Mutter waren keineswegs überzeugt davon. Sie sahen Emma als Opfer und erwarteten, dass sie sich entsprechend benahm.
Es war lächerlich. Warum waren ihre Freunde nicht ehrlich? Warum konnten sie nicht einfach sagen, wie sie wirklich über die Sache dachten? »Du bist kein Kind mehr, Emma. Du bist vierzig, du hast ein paar Pfund zu viel auf den Hüften und wirkst ein wenig tantenhaft, und deine Chancen, einen anderen Mann zu finden, sind im Moment gleich null. Wir verstehen dich, und du hast unser Mitgefühl.«
Das leise Lächeln kehrte zurück, als sie die Landkarte wieder in die unterste Schublade legte. Wäre es nicht eine tolle Überraschung, wenn sie mit einem neuen Mann aus England zurückkäme – mit einem richtigen Prachtexemplar, eins achtzig groß, blauäugig, mit breiten Schultern und ...
Emmas Traum verflüchtigte sich und ihr gesunder Menschenverstand kehrte zurück. Sie brauchte ihre Mutter nicht, um sich daran zu erinnern, dass Männer, egal welchen Alters, Frauen vorzogen, die jünger als sie selbst waren, schlanke, grazile Mädchen mit Haaren wie Sonnenschein. Rundlichen Frauen hingegen, die zudem nicht besonders hübsch waren und langsam ins mittlere Alter kamen, wurde das Tor zur großen Liebe meist vor der Nase zugeschlagen.
Emma war stolz auf ihre Fähigkeit, den Tatsachen ins Auge zu sehen, und so bereitete sie sich entsprechend auf ihre Reise vor. Im Mai würde sie in Cornwall sein; sie würde sich die Teekuchen mit Erdbeerkonfitüre und dicker Sahne schmecken lassen, sich in den hübschen Fischerdörfern umsehen und, worauf sie sich am meisten freute, die Azaleen in voller Blüte genießen. Sie würde alles tun, was ihr Herz begehrte. Außer sich verlieben.
»Nie wieder«, flüsterte sie und unterdrückte einen Seufzer. »Und wenn ich aus Cornwall zurückkomme, kaufe ich mir eine Hängematte für den Garten und führe das Leben einer umtriebigen alten Jungfer. Aber Liebe – nie wieder.«
In Oxford, auf der anderen Seite des Ozeans, wischte zur gleichen Zeit Derek Harris die letzten Spuren feuchter Erde vom Grabstein seiner Frau. Er hätte es auch dem Totengräber überlassen können, aber Derek hatte lange genug mit den Händen gearbeitet und wusste, dass man etwas, das richtig gemacht werden sollte, am besten selbst tat.
Er steckte den Lappen in die hintere Tasche seiner ausgebleichten Jeans und richtete sich auf. Er war ein großer Mann, etwas über einen Meter achtzig. Seine tiefblauen Augen waren voller Trauer, als er die Lettern las, die er in den rötlichen Marmor gemeißelt hatte. Es war etwas über fünf Jahre her, seit sie an Lungenentzündung gestorben war. Der Gedanke machte ihm das Herz so schwer, dass er Mühe hatte zu atmen.
»Ach Mary«, flüsterte er, »du fehlst mir.«
Die dicht verzweigten Äste der Bäume, die schon dicke Knospen trugen, hoben sich gegen den dunklen Himmel ab, und ein kalter Aprilwind pfiff um die Grabsteine. Derek erschauerte und dachte daran, dass es Zeit war, wieder nach Hause zu gehen. Peter würde inzwischen aus der Schule gekommen sein und Nell aus dem Kindergarten, und Tante Beatrice würde da sein, um nach den beiden zu sehen.
Aber noch immer verweilte er am Grab, er hatte keine Lust auf all die Fragen, mit denen Beatrice ihn wieder überschütten würde. Sie hatte sich bereits nach seinen Plänen für das nächste Jahr erkundigt. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, wie seine süße Mary so einen Drachen als Schwester haben konnte.
Sie hielt es für eine Schande, dass Derek seinen Universitätsabschluss in Geschichte – den er überdies in Oxford erlangt hatte – hier verschwendete, indem er sich die Hände als Restaurator schmutzig machte. Man sollte es nicht für möglich halten, dass er der Sohn eines Earls war – wie peinlich für seine Familie und was für eine Enttäuschung für die arme Mary! Alle seine Freunde von der Universität waren inzwischen respektable Männer, die meisten im Finanzwesen oder in der Politik tätig, während sich Derek mit seinen fünfundvierzig Jahren immer noch mit undichten Strohdächern, bröckeligen Steinmauern und albernen Messingplatten abplagte. Beatrice hatte bei dem Gedanken, dass ihre einzige Schwester in solch ungeordneten Verhältnissen lebte, ganz graue Haare bekommen.
Und jetzt wurden ihre Haare weiß (»weiß wie frisch gefallener Schnee«), wenn sie an die armen Kinder, Peter und Nell, dachte. Hatte Derek inzwischen nicht eingesehen, dass ein Mann nicht dazu fähig war, Kinder großzuziehen? Es war unnatürlich, ungesund. (»Das geht nicht gut, du wirst dich noch an meine Worte erinnern.«) Er müsste doch einfach einsehen, dass Peter und Nell in einem geregelten Haushalt besser aufgehoben wären, bei einem Onkel und einer Tante, die sie liebten und nur ihr Bestes wollten. Also wirklich ...
Wütend zertrat Derek mit dem Stiefelabsatz einen Erdklumpen. Er hatte Mary versprochen, die Familie zusammenzuhalten, und nichts würde ihn dazu bewegen, dieses Versprechen zu brechen. Mrs Higgins war eine wunderbare Haushälterin, die alles im Griff hatte, wenn Derek nicht zu Hause war. Sie hielt das Haus makellos sauber, die Kinder sahen immer ordentlich aus, und Beatrice konnte suchen, so viel sie wollte, sie fand einfach nichts zu beanstanden. Er nahm sich vor, Mrs Higgins eine kleine zusätzliche Geldsumme zukommen zu lassen, ehe er mit den Kindern nach Cornwall aufbrach.
»Danke, Grayson«, murmelte Derek und blies in die kältegeröteten Hände. Die Bitte des Herzogs war letzten Monat gekommen – ein Glasfenster in Penford Hall zu restaurieren verbunden mit einer Einladung. »Bring doch Peter und Nell mit«, hatte sein Freund geschrieben, »und bleibt den Sommer über hier.« Es würde bedeuten, dass er Peter aus der Schule nehmen müsste, ehe die Ferien anfingen, aber Grayson hatte versprochen, dass sich eine Hauslehrerin um den Unterricht des Jungen kümmern würde. Und Beatrice, beeindruckt von Graysons Titel, hatte nichts einwenden können.
Bei all ihren sonstigen Fehlern war Beatrice zum Glück keine Leserin der Regenbogenpresse, das musste Derek ihr zugutehalten. Beatrice hielt die Illustrierten für »ordinär« und hatte deshalb nichts von den Gerüchten und Andeutungen mitbekommen, die fünf Jahre zuvor um den Nachkommen von Penford Hall kursierten. Und zum Glück sprach Mrs Higgins, deren Leidenschaft für gerade diese Art von Zeitschriften nur noch von ihrer Leidenschaft für die Seifenopern im Radio übertroffen wurde, nicht mit der bösen Bea.
Derek musste sich eine gewisse Neugier bezüglich dieser Sache eingestehen, ebenso wie auf Grayson. Ihre Freundschaft war alt; sie war in jenem Sommer entstanden, als Derek die Decke in der Christ-Church-Kathedrale restaurierte, wo Grayson, der noch studierte, für den Bach-Chor die Orgel spielte. Grayson hatte ein großes Interesse an Dereks Arbeit bekundet, und so waren viele lebhafte Gespräche über manch einem Glas Bier im Blue Boar gefolgt. Gegen Ende des Sommers, nach dem Tod des alten Herzogs, war der junge Mann auf und davon gegangen, ohne sein Studium zu beenden. Derek war nicht weiter überrascht gewesen. Er erinnerte sich, wie Graysons Augen immer geleuchtet hatten, wenn er von dem Haus seiner Kindheit erzählte. Und wie unternehmungslustig sie gefunkelt hatten, wenn er von seinen Plänen für die Restaurierung sprach.
In den zehn Jahren, die seitdem vergangen waren, hatte Derek sich oft gefragt, ob sich die großen Pläne seines Freundes wohl verwirklicht hatten. Bald würde er es wissen. Im Mai würde er in Cornwall sein und an dem Fenster in der Kapelle des Herzogs von Penford arbeiten.
Und danach? Er wollte nicht weiter denken als bis zum Sommer. Irgendwo, in einem tiefen Winkel seines Unbewussten, gab es ein Gefühl, dass Peter und Nell wieder eine Mutter brauchten, die sich um sie kümmerte, aber an diesen Gedanken wagte er sich noch nicht heran.
Er bezweifelte, ob er jemals dazu bereit sein würde. Er wusste, dass er nicht »um der Kinder willen« jemanden heiraten könnte. Bei dieser Vorstellung lief es ihm kalt über den Rücken. Nein, wenn er wieder heiraten sollte, dann nur, weil er jemanden gefunden hatte, den er liebte, aufrichtig und von ganzem Herzen. Und wie konnte er das, da sein Herz hier zu seinen Füßen begraben lag?
»Nie wieder«, flüsterte er, als er sich mit versteinertem Gesicht auf den Heimweg machte. »Nie wieder.«
Peter Harris streute die Essensreste für die Katzen vor die Hintertür und sagte laut zu sich selbst: »Der erste Mai. Am ersten Mai fährt Dad mit uns nach Cornwall, und dann wird alles gut.«
Beruhigt schloss er die Hintertür, stellte das Frühstücksgeschirr ins Spülbecken, wischte den Tisch ab und fegte die Küche. Mrs Higgins hätte sich darum kümmern müssen, ehe sie auf ihr Zimmer ging – schließlich wurde sie von Dad dafür bezahlt –, aber Mrs Higgins hatte den größten Teil des Nachmittags schnarchend im Wohnzimmer auf dem Sofa gesessen. Er mochte gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn Tante Beatrice sie so vorgefunden hätte.
»Bald ist es vorbei«, flüsterte er glücklich und voller Überzeugung. Dad hatte es ihm auf der Karte gezeigt, Penford Hall war weit weg von Tante Beatrice.
Peter verschloss die Milchflasche und stellte sie in den Kühlschrank, dann sah er nach, ob die Hackfleischpastete auch wirklich im Backofen war – Mrs Higgins vergaß das manchmal –, und nahm die Packung mit Seifenflocken aus dem Schrank unter der Spüle.
Seit dem Tod seiner Mutter hatte Peter gelernt, wie man den Abwasch erledigte, wie man Wäsche zusammenlegte und wie man Nells Haare wusch, ohne dass sie Seife in die Augen bekam. Er hatte gelernt einzukaufen, die Rechnungen zu sortieren und Dad daran zu erinnern, dass sie bezahlt wurden. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass es am besten war, mit den Hausaufgaben zu warten, bis Nell schlief, und auch den Boden unter den Betten zu wischen, weil Tante Beatrice immer nachsah, ob es dort auch sauber war. Im Laufe der letzten Jahre hatte Peter gelernt, wie es war, wenn man ständig pflichtbewusst und aufmerksam sein musste und sich dabei oft todmüde fühlte. Ein kleiner Junge zu sein, hatte er im Grunde genommen nicht gelernt. Der zehnjährige Peter schob den Hocker vor die Spüle, stieg darauf und drehte den Hahn auf. Für sein Alter war er klein und schmächtig; er hatte die tiefblauen Augen seines Vaters und das dunkle, glatte Haar seiner Mutter. Von seiner Mutter hatte er auch die praktische Art geerbt, und vielleicht war das der Grund dafür, dass niemand die Veränderung bemerkte, die mit ihm vorgegangen war.
Peter selbst war sich keiner Veränderung bewusst. Er hatte sein Schicksal von Anfang an auf sich genommen und gehofft, dass er eines Tages den Grund dafür verstehen würde. Und mit der Ankunft des Briefes, den der Herzog geschrieben hatte, war ihm der Grund endlich klar geworden.
Es war das Fenster. Das Fenster würde die wichtigste Arbeit sein, die Dad je gemacht hatte, die wichtigste Arbeit, die man sich nur vorstellen konnte, und es war Peters Aufgabe, dafür zu sorgen, dass nichts dazwischenkam. Denn erst wenn dieser Auftrag erledigt war, würde Mama wirklich Ruhe finden. Und Peter auch.
Peter drehte den Wasserhahn zu, dann hielt er inne, denn aus dem Flur kam ein seltsames klapperndes Geräusch. Es klang irgendwie vertraut, aber er konnte sich nicht mehr erinnern, wo er es schon einmal gehört hatte. Neugierig stieg er vom Hocker und schlich zur Küchentür, um in den Flur zu schauen. Der Anblick, der sich ihm dort bot, machte ihn sprachlos vor Entsetzen.
So hätte er normalerweise nicht reagiert. Im Gegensatz zu anderen großen Brüdern liebte Peter seine fünfjährige Schwester. Dad nannte Nell seinen Wechselbalg, weil sie so blond war und seltsame Einfälle hatte, aber Peter fiel bei ihrem Anblick immer das Bild ein, das er in einem Buch von Dad gesehen hatte und das einen rotbäckigen Trompetenengel zeigte mit leuchtend blauen Augen und einem Lockengewirr, wie Dad es hatte, nur dass es bei Nell goldblond war statt braun. Mit dem Unterschied, dass der Engel im Bilderbuch keinen schokoladenbraunen Teddy in der Hand hatte, aber für Peter war Nell ohne Bertie ebenso wenig vorstellbar wie ein Engel ohne Flügel. Doch bei diesem Anblick hier bekam er Bauchweh.
»Wo hast du diese Sachen gefunden, Nell?«, fragte Peter.
»Ich bin Königin Eleanor«, verkündete Nell, indem sie mit der einen Hand Bertie festhielt und mit der anderen den Saum ihres Kleides anhob, »und das hier ist Sir Bertram of Harris, und mit Bauarbeitern sprechen wir nicht.«
»Mit Bauern, Nell.« Peter hatte geahnt, dass es nichts Gutes bringen würde, wenn Dad ihr die Sage von König Artus vorlas, aber darum ging es im Moment nicht. Das Problem lag darin, dass Nell Bertie in Mamas besten Seidenschal gehüllt hatte und dass sie selbst Mamas rosageblümtes Kleid und ihre weißen Schuhe mit den hohen Absätzen trug, und dass Papa jede Minute heimkommen konnte.
»Du musst mich mit Majestät anreden«, korrigierte Nell ihn. »Und zu Bertie musst du ›Sir Bertram‹ sagen ...«
»Nell, wir spielen jetzt nicht.«
»Ich bin Königin ...«
»Nell.«
»Tante Bea?« Nell sprach jetzt mit ihrer normalen Stimme und sah besorgt zur Wohnzimmertür.
Erleichtert schüttelte Peter den Kopf. Wenn er einmal ihre Aufmerksamkeit hatte, konnte Nell sehr kooperativ sein, aber als Königin Eleanor war sie störrisch wie ein Esel.
»Nein«, erklärte Peter, »es sind diese Sachen. Dad wird schrecklich traurig sein, wenn er sie sieht.«
»Ja?« Nell machte eine kurze Pause, dann kam das Unvermeidliche.
»Warum?«
»Weil sie Mama gehört haben. Und wenn ihr sie tragt, wird Dad an sie erinnert.«
»Und davon wird er traurig?«
»Ja«, erkläre Peter geduldig, »es macht ihn sehr traurig.« Er überlegte, ob er Nell von dem Kirchenfenster erzählen sollte, entschied sich aber dagegen. Königin Eleanor würde womöglich eine königliche Verkündigung daraus machen. »Komm jetzt, Nell. Hilf mir, die Sachen wieder wegzupacken, und dann suchen wir dir und Bertie etwas anderes zum Spielen.«
»Etwas Schönes?«
Er nickte. »Etwas Schönes.« Peter wickelte Bertie aus dem Schal, dann half er Nell aus den hohen Schuhen und zog ihr das Kleid über den Kopf. Er war erleichtert, als ihr grüner Pulli und die blaue Latzhose darunter zum Vorschein kamen, bei Nell wusste man nie, was einen erwartete.
Er folgte ihr in die Abstellkammer, wo sie einen der Kartons geöffnet hatte, in dem Mamas Sachen verstaut waren. Nachdem er Kleid und Schal wieder zusammengefaltet hatte, legte er die Sachen ehrfürchtig zurück, dann wischte er die Sohlen der Damenschuhe an seinem Hosenbein ab und legte sie verkehrt herum auf den Schal. Schließlich schloss er den Karton und sah sich in der Kammer um.
»Nell«, sagte er, während seine Idee Gestalt annahm, »kannst du dich an die Geschichte von den alten Römern erinnern, die Dad dir vorgelesen hat?«
»Die von den Löwen?«, fragte Nell und ihr Gesicht hellte sich auf. »Und von den Streitwagen und den Schwertern und ...«
»Und von den edlen Römern in ihren schönen weißen Gewändern?«
»Ja, daran erinnern wir uns, Bertie und ich.« Nell nickte eifrig.
»Also«, sagte Peter und nahm ein sauberes Laken von dem Stapel auf dem Wäschetrockner, »dieses Gewand nannte man eine Toga. Und nur die reichsten und schönsten Römer durften sie tragen.« Peter vermutete, dass das nicht ganz der Wahrheit entsprach, aber im Moment war es egal. Er drapierte das Laken über Nells linke Schulter, dann schlang er es ihr um den Rücken und schlug den Zipfel über die rechte Schulter.
»Und sie haben es immer getragen, wenn sie den Löwen zusehen wollten«, sagte Nell verträumt, indem sie nach einem Kopfkissenbezug griff, den sie Bertie anziehen wollte, »und den Streitwagen und den Schwertern und ...«
Als Nells Augen ihren vertrauten verträumten Blick annahmen, verließ Peter leise die Abstellkammer. Jetzt würde sie bis zum Abendessen beschäftigt sein. Er könnte das Laken wieder zusammenlegen, wenn Nell und Bertie zu Bett gegangen waren.
Auf seinem Weg in die Küche blieb Peter stehen. Langsam drehte er sich um und ging zur Tür der Werkstatt seines Vaters. Ab und zu musste er dort hineinschauen, um sich daran zu erinnern, warum Dad ihm so viel Arbeit überließ. Vorsichtig und leise drückte er die Klinke herunter und öffnete die Tür, gerade weit genug, um hineinzuspähen.
Dort waren die Fotos, die der Herzog geschickt hatte, sowie die Regale mit dem Buntglas, das Dad für das Fenster verwenden wollte. Sein Vater hatte ihm die Bilder vom Fenster gezeigt und ihm erklärt, wie er es reinigen und so restaurieren würde, dass es wieder wie neu aussah. Sein Vater hatte ihm nicht alles erklärt, aber das war auch nicht nötig, denn Peter verstand es auch so.
Peter hatte gehört, wie der Pfarrer es einigen Besuchern erklärt hatte, nicht lange nachdem Mama gestorben war. Dass die Seele wie ein Fenster war, durch das Gottes Licht schien. Tante Beatrice hatte es nicht richtig verstanden, sie sagte, dass Mamas Seele für alle Ewigkeit im Himmel bleiben würde. Aber Peter wusste, dass sie dort nur wartete, bis Dad diesen Ort auf der Erde für sie geschaffen hatte, diesen vollkommenen Ort aus den Farben des Regenbogens, durch den Gottes Licht für immer scheinen würde.
Kapitel 2
EMMAS ERSTES ZIEL auf ihrer sorgfältig geplanten Reiseroute war Bransley Manor. Von diesem Landsitz hatte sie zum ersten Mal auf einem Gartenseminar gehört, und hier war sie mit Richard schon einmal gewesen. Sie war von der Allee aus chilenischen Araukarien, den Bäumen, »die Affen Rätsel aufgeben«, ebenso entzückt gewesen wie Richard von dem Irrgarten mit seinen hohen Hecken auf der anderen Seite des Teichs. Bransley Manor war zwar nicht berühmt dafür, dass es hier besonders viele Azaleen gegeben hätte, aber Emma hatte es dennoch auf ihrer Route miteinbezogen. Der Landsitz war eine unauffällige Kostbarkeit, weitab von der üblichen Route der Touristenbusse, und nach ihrer ersten Woche in London mit den Theaterbesuchen freute sich Emma darauf, diesen Garten jetzt für sich allein zu haben.
Sie parkte ihren Mietwagen neben einem älteren Morris, dem einzigen weiteren Wagen auf dem Parkplatz. Dann nahm sie den ausgedruckten Reiseplan aus ihrer Umhängetasche und machte sorgfältig ein X neben die erste Position. Ehe sie ausstieg, hielt sie einen Augenblick inne, um ihre Umgebung zu genießen.
Die Araukarien waren noch genau so, wie Emma sie in Erinnerung hatte; mit ihren dornigen, verdrehten Ästen wirkten sie auf bizarre Weise großartig. Die Rabatten mit den Schachbrettblumen waren indes neu, und sie konnte sich nicht entscheiden, ob sie ihr gefielen. Die stacheligen Kapseln erschienen ihr etwas zu theatralisch für diese Umgebung, und ihr Orangeton biss sich mit den buttergelben steinernen Torpfeilern. Wenn sie hier Gärtnerin gewesen wäre ...
»Alles in Ordnung, Ma’am?«
Emma fuhr zusammen. Ein paar Meter von ihrem Auto entfernt stand ein junger Mann; etwas vorgebeugt schaute er sie an, in der Hand eine kleine erdverkrustete Schaufel.
»Kann ich Ihnen behilflich sein, Ma’am?« Er trug ein hellbraunes Hemd und enge Jeans, sein kastanienbraunes Haar glänzte in der Sonne wie ein Kupferpfennig. Er war nicht älter als zwanzig, braunäugig, sommersprossig und muskulös, und in seiner Stimme schwang der höfliche Unterton, in dem ein gut erzogener junger Mann mit älteren oder gebrechlichen Menschen redete. Vor allem dieses wiederholte »Ma’am« ging Emma auf die Nerven. Genauso gut könnte er mich »Oma« nennen, dachte sie.
»Haben Sie sich verfahren, Ma’am?«, fragte er.
»Nein danke«, sagte Emma. »Ich weiß ganz genau, wo ich bin.«
»Na gut«, sagte der junge Mann. »Ich hoffe, dass Ihnen Ihr Besuch hier gefällt, Ma’am.« Mit höflichem Lächeln ging er an Emmas Auto vorbei und verschwand durch das Tor. Emma beobachtete, wie sich seine schmalen Hüften beim Gehen wiegten, und das Selbstmitleid übermannte sie. Wäre es wirklich moralisch verwerflich gewesen, fragte sie sich trübsinnig, wenn sie das unscheinbare Dunkelblond etwas freundlicher, heller getönt hätte?
Sie betrachtete sich im Rückspiegel und zog Bilanz. War ihre Nase nicht eine Spur zu lang, ihr Kinn nicht ein wenig zu stark, als dass man sie schön nennen konnte? Hatte sie zu viele Stunden ohne Sonnenschutz im Garten verbracht, sodass sich Falten in ihre Stirn gegraben hatten, ebenso wie Krähenfüße um ihre klaren grauen Augen? War ihre Nickelbrille nicht allzu langweilig und altmodisch? War sie nicht selbst vielleicht langweilig und altmodisch?
Wir können nicht alle Märchenprinzessinnen sein, dachte sie niedergeschlagen. Außerdem wollen wir das gar nicht! Während ihr Selbstmitleid in Wut umschlug, schloss Emma die Augen, holte tief Luft und flüchtete sich in den Galgenhumor. »Also los, Oma«, sagte sie und sah auf ihre Uhr. »Nimm deinen Stock und wandle. Die Zeit wartet auf keine Frau.«
Die Blumenmeere von Bransley mit ihrem Goldlack, den Akeleien und Tulpen hätten Emma eigentlich in helles Entzücken versetzen müssen, aber je länger sie zwischen den Beeten umherschlenderte, desto tiefer sank ihre Stimmung. Als sie den Irrgarten auf der anderen Seite des Teichs erreicht hatte, war ihr zumute, als ob eine dunkle Wolke über ihr schwebte. Sie stand am Eingang des Labyrinths und hörte im Geiste wieder Richards Triumphschrei, als er den Mittelpunkt erreicht hatte. Jetzt wusste sie, dass es ein Fehler gewesen war, nach Bransley Manor zurückzukehren.
Die logische Konsequenz wäre gewesen, jetzt sofort zu gehen, um diesen Ort so schnell nicht wieder aufzusuchen, aber als sie sich umwandte, stand der junge Mann mit der Schaufel auf der anderen Seite des Teichs. Emma erschrak und rettete sich in den Irrgarten, ohne den Winkeln und Windungen Aufmerksamkeit zu schenken. Lieber wollte sie den restlichen Sommer hier zwischen den Hainbuchenhecken verbringen, als das höfliche Lächeln dieses jungen Mannes noch einmal über sich ergehen lassen zu müssen. Als sie ihn jedoch aus den Augen verloren hatte, fing Emma an, Spaß an der Sache zu haben. Sie hatte ein gutes Gedächtnis und liebte Puzzles aller Art. Es dauerte gar nicht lange, bis sie den freien Platz im Zentrum des Labyrinths erreicht hatte. Hier hob sie triumphierend den Blick, kniff die Augen zusammen und schüttelte dann den Kopf, wie um ihn wieder klar zu bekommen.