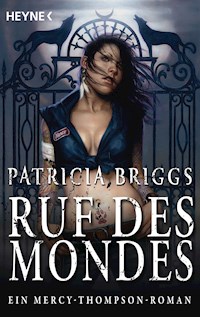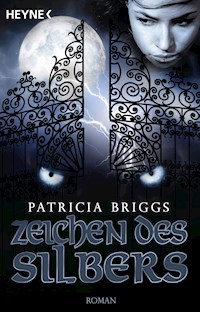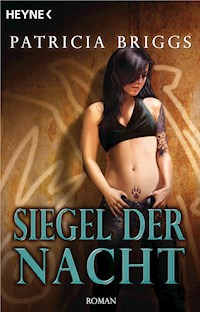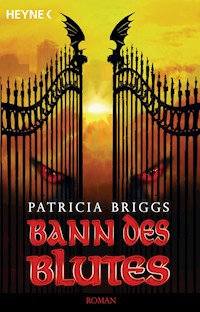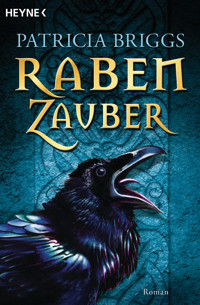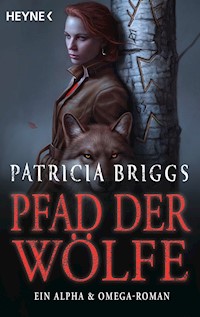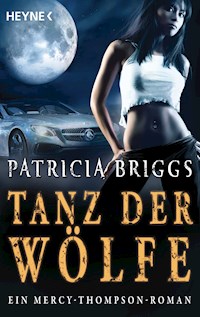
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mercy-Thompson-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Mercy Thompson ist zurück – ein neues Abenteuer für die coolste Gestaltwandlerin aller Zeiten
Mercy Thompson ist ohne Zweifel die heißeste Automechanikerin in den ganzen Tri-Cities, und sie hat die außergewöhnliche Gabe, sich in eine Kojotin zu verwandeln. Doch Mercys Leben gerät aus den Fugen, als ihr Gefährte Adam, der Alpha des mächtigsten Werwolfrudels der Stadt, entführt wird – zusammen mit seinem ganzen Rudel, den Wölfen, die inzwischen zu Mercys Familie geworden sind. Mercy setzt alles daran, ihre große Liebe und das Rudel zu retten, und kommt dabei einer gewaltigen Verschwörung auf die Spur. Einer Verschwörung, die das Leben aller Gestaltwandler in Nordamerika bedrohen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Ähnliche
Patricia Briggs
Ein MERCY-THOMPSON-Roman
Deutsche Erstausgabe
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Eigentlich wollte Automechanikerin und Walkerin Mercy Thompson ganz gemütlich Thanksgiving im Kreise ihrer Lieben verbringen, doch dann wird ihr Leben von einer Sekunde auf die andere auf den Kopf gestellt: Ihr geliebter Gefährte Adam, der Alpha des mächtigsten Werwolfrudels der Stadt, wird zusammen mit seinen Wölfen entführt und an einem geheimen Ort gefangen gehalten. Über ihre Gefährtenbindung zu Adam, kann Mercy zwar spüren, dass es Adam nicht gut geht, aber sie hat keine Ahnung, wo er und die anderen sich aufhalten. Zusammen mit Werwolf Ben – dem einzigen, der den Entführern entkommen konnte – und dem Feenwesen Tad macht sich Mercy auf die Suche nach dem Rudel. Als ein Mitglied des Rudels getötet wird, begreift Mercy, dass die Entführung erst der Beginn einer gewaltigen Verschwörung ist – einer Verschwörung, die nicht nur ihr eigenes Rudel, sondern alle Werwölfe Nordamerikas in den Untergang reißen könnte …
Die MERCYTHOMPSON-Serie
Erster Roman: Ruf des Mondes
Zweiter Roman: Bann des Blutes
Dritter Roman: Spur der Nacht
Vierter Roman: Zeit der Jäger
Fünfter Roman: Zeichen des Silbers
Sechster Roman: Siegel der Nacht
Siebter Roman: Tanz der Wölfe
Die ALPHA & OMEGA-Serie
Erster Roman: Schatten des Wolfes
Zweiter Roman: Spiel der Wölfe
Dritter Roman: Fluch des Wolfes
Die Autorin
Patricia Briggs, Jahrgang 1965, wuchs in Montana auf und interessiert sich seit ihrer Kindheit für Phantastisches. So studierte sie neben Geschichte auch Deutsch, denn ihre große Liebe gilt Burgen und Märchen. Neben erfolgreichen und preisgekrönten Fantasy-Romanen wie Drachenzauber und Rabenzauber widmet sie sich ihrer Mystery-Saga um Mercy Thompson. Nach mehreren Umzügen lebt die Bestsellerautorin heute gemeinsam mit ihrer Familie in Washington State.
Für Mike, der Farbe in mein Leben bringt.
1
Wir hätten mit dem Transporter kommen sollen«, verkündete meine Stieftochter. Sie klang wieder wie sie selbst, auch wenn ihre Miene immer noch ein wenig angespannt wirkte.
»Wir sollten überhaupt nicht hier sein«, murmelte ich, während ich gegen die Heckklappe drückte. Mein Golf bot eine Menge Laderaum für so ein kleines Auto. Dabei waren wir nur zwanzig Minuten hier gewesen. Ich kaufe ständig bei Walmart ein und komme nie mit so viel Zeug raus. Wir waren sogar vor dem großen Mitternachtsverkauf aufgebrochen. Und trotzdem … hatte ich jetzt all dieses Zeug. Und das meiste davon war nicht im Angebot gewesen. Wer tut so etwas?
»Ach, komm schon«, spottete sie betont gut gelaunt. »Es ist Schwarzer Freitag, da geht jeder einkaufen.«
Ich hob meinen Blick von der widerspenstigen Heckklappe meines armen, überlasteten Autos, um mich auf dem Parkplatz des Home Depot umzuschauen. »Offensichtlich«, murmelte ich.
Home Depot hatte am Schwarzen Freitag, dem Tag nach Thanksgiving, nicht bis Mitternacht geöffnet, aber der Parkplatz war riesig und gab sich redliche Mühe, den Massenandrang von Walmart aufzufangen. Auf dem Parkplatz des Supermarktes selbst hätte nicht mal mehr ein Fahrrad Platz gehabt. Ich hätte nie vermutet, dass im Einzugsgebiet der Tri-Cities so viele Leute lebten – und das hier war nur einer von drei Walmarts und derjenige, von dem wir angenommen hatten, er wäre am wenigsten überlaufen.
»Als Nächstes sollten wir zu Target fahren«, sagte Jesse. Der nachdenkliche Ton in ihrer Stimme jagte mir einen kalten Schauder über den Rücken. »Sie haben das neue Dread Pirate’s Booty 4 zum halben Preis. Verkaufsstart sollte heute um Mitternacht sein. Es gab Gerüchte über Produktionsengpässe vor Weihnachten.«
Codpieces and Golden Corsets: Dread Pirate’s Booty 3, besser bekannt als CAGCDPBT – ich mache keine Witze, wenn man die Buchstabenkombination nicht zehnmal hintereinander unfallfrei aussprechen konnte, galt man nicht als wahrer Spieler – war das Lieblingsspiel des Rudels. Zweimal im Monat schleppten sie ihre Laptops und ein paar Computer zu uns, bauten sie im Versammlungsraum auf und spielten bis zum Morgengrauen. Bösartige, fiese Werwölfe, die im Internet Piratenspiele spielten – die Sessions waren immer ziemlich intensiv. Es wunderte mich ein wenig, dass wir keine Leichen gefunden hatten – noch nicht.
»Gerüchte über Engpässe, die zufällig kurz vor dem Schwarzen Freitag durch die Presse geistern«, moserte ich.
Jesse grinste. Ihre Wangen waren vom kalten Novemberwind gerötet, und ihre gute Laune wirkte nicht mehr so aufgesetzt wie direkt nach dem Anruf ihrer Mutter während des Thanksgiving-Dinners. Sie hatte Jesses Besuch an Weihnachten abgesagt. »Zyniker. Du verbringst zu viel Zeit mit Dad.«
Also fuhren wir auf der Suche nach Piratenschätzen quer über die Straße zum Parkplatz von Target, der sich in einem ähnlichen Zustand befand wie der von Walmart. Anders als Walmart hatte Target nicht durchgehend geöffnet. Vor dem Markt drängelten sich die Leute, um darauf zu warten, dass die Türen um Mitternacht aufschwangen. Das dauerte meiner Uhr zufolge noch zwei Minuten. Die Schlange begann bei Target, schlängelte sich vor dem Schuhladen und der Zoohandlung entlang und verschwand in der Dunkelheit neben dem Einkaufszentrum.
»Sie haben noch nicht geöffnet.« Ich wollte nicht denselben Weg nehmen wie all diese Leute. Ich fragte mich, ob die Soldaten im Bürgerkrieg sich wohl so gefühlt hatten, wenn sie über einen Hügel schauten und die Truppen der Gegenseite sahen, grimmig und kampfbereit. Diese Streitmacht hier schob Kinderwägen statt Kanonen, doch in meinen Augen wirkte sie nichtsdestotrotz bedrohlich.
Jesse musterte meine Miene und kicherte bösartig.
Ich zeigte mit dem Finger auf sie. »Damit kannst du gleich aufhören, Missy. Das ist alles deine Schuld.«
Sie blinzelte mich fröhlich an. »Meine Schuld? Ich habe doch nur gesagt, dass es Spaß machen könnte, loszuziehen und die Sonderangebote zu nutzen.«
Und ich hatte gedacht, es wäre eine gute Möglichkeit, sie von den gebrochenen Versprechen ihrer Mutter abzulenken, die immer mit einer guten Portion Schuldgefühlen aufgeladen waren. Mir war nicht klar gewesen, dass Shoppen am Schwarzen Freitag (obwohl es meiner Uhr zufolge, zumindest für die nächste Minute, immer noch Donnerstag war) ungefähr dem Sprung auf eine Granate gleichkam. Ich hätte es trotzdem getan – ich liebe Jesse, und langsam erfüllte das Ablenkungsmanöver seinen Zweck –, doch es wäre schön gewesen, vorher zu wissen, wie übel es werden würde.
Wir folgten langsam den anderen Autos, die ebenfalls nach einem Parkplatz suchten, und kamen schließlich direkt vor dem Laden vorbei, wo die Einkaufenden lauerten, zusammengekauert und bereit für den Angriff. Im Laden näherte sich ein junger Mann in dem traurigerweise passenden roten Target-Shirt langsam den Türen, die das Einzige waren, was ihn vor den angreifenden Horden schützte.
»Er wird sterben.« Jesse klang ein wenig besorgt.
Die Menge fing an zu schwanken wie ein chinesischer Neujahrsdrache, als der Mann langsam die Hand ausstreckte, um den Schlüssel im Schloss zu drehen.
»Ich möchte auf keinen Fall mit ihm tauschen«, stimmte ich zu, während der Junge sich nach erfüllter Mission sofort umdrehte, um zurück in den Laden zu rennen, die Horde aus geifernden Käufern dicht auf den Fersen.
»Ich werde da nicht reingehen«, erklärte ich bestimmt, als eine alte Frau einer anderen alten Frau den Ellbogen in den Magen rammte, weil diese versucht hatte, sich an ihr vorbeizuschieben.
»Wir könnten immer noch ins Einkaufszentrum«, meinte Jesse nach kurzer Überlegung.
»Das Einkaufzentrum?« Ich zog ungläubig die Augenbrauen hoch. »Du willst ins Einkaufszentrum?« Es gab die verschiedensten Einkaufszentren in den Tri-Cities, und zusätzlich auch noch ein Factory-Outlet, doch wenn man einfach von »dem Einkaufszentrum« sprach, meinte man gewöhnlich die große Mall in Kennwick. Die jeder, der am Schwarzen Freitag einkauft, garantiert als Erstes aufsucht.
Jesse lachte. »Mal ehrlich, Mercy. Kitchenaids sind im Angebot, hundert Dollar billiger. Darryls ist kaputtgegangen, als meine Freundinnen und ich damit Brownies gemacht haben. Mit meinem Babysitting-Geld habe ich gerade genug, um ihm zu Weihnachten eine neue zu schenken, wenn ich das Ding hundert Dollar billiger bekomme. Wenn wir die Küchenmaschine kriegen, bin ich bereit, dieses Experiment für beendet zu erklären.« Sie warf mir einen kläglichen Blick zu. »Wirklich, es geht mir gut, Mercy. Ich kenne meine Mutter; ich hatte damit gerechnet, dass sie absagt. Es ist sowieso lustiger, Weihnachten mit dir und Dad zu verbringen.«
»Nun, wenn das so ist«, meinte ich, »warum gebe ich dir nicht einfach hundert Dollar, und wir sparen uns das Einkaufszentrum?«
Jesse schüttelte den Kopf. »Nö. Du bist noch nicht lange Teil dieser Familie, also kennst du noch nicht alle Regeln. Wenn man ein Spielzeug kaputtmacht, muss man es ersetzen, und zwar vom eigenen Geld. Also auf zum Einkaufszentrum.«
Ich seufzte hörbar, während ich aus dem Regen des Target-Parkplatzes hinausfuhr und auf die Traufe des Columbia-Einkaufszentrums zuhielt. »Auf in den Kampf. Wir werden uns gegen die Horden aus Müttern und Furcht einflößenden alten Drachen durchsetzen.«
Jesse nickte heftig und hob ein imaginäres Schwert. »Und mag sich wahren, wer zuerst Halt! ruft, soll zur Hölle fahren.«
»Ich fordere dich heraus, vor Samuel Shakespeare falsch zu zitieren«, erklärte ich, und sie lachte.
Die Stiefmutterrolle war neu für mich. Manchmal ähnelte es einem Drahtseilakt – auf einem eingefetteten Seil. So sehr Jesse und ich uns auch mochten, wir hatten mitunter Probleme. Doch sie jetzt lachen zu hören, sorgte dafür, dass ich unsere Chancen hoffnungsfroher einschätzte.
Das Auto vor mir hielt plötzlich an, und ich trat auf die Bremse. Der Golf war ein alter Gefährte aus meinen Teenagerjahren (die schon lange zurücklagen), den ich behielt, weil ich ihn einfach liebte – und weil ich als Automechanikerin arbeitete und es die beste Werbung war, ein altes, billiges Auto wie den Golf am Laufen zu halten. Die Bremsen funktionierten wunderbar, und das Auto stoppte rechtzeitig – mit noch ungefähr zehn Zentimetern Abstand.
»Ich bin wirklich nicht die Erste, die Macbeth missbraucht«, sagte Jesse und klang dabei ein wenig atemlos – allerdings wusste sie auch nicht, dass ich die Bremsen erst letzte Woche erneuert hatte, weil ich zufällig die Zeit dafür gehabt hatte.
Ich sog missbilligend die Luft durch die Zähne, während wir darauf warteten, dass irgendein feiger Fahrer ein paar Autos vor uns es endlich wagte, nach links auf die Schnellstraße abzubiegen. »Das Schottische Stück. Man sagt ›Das Schottische Stück‹. Du solltest es besser wissen. Es gibt Dinge, die man nie beim Namen nennt, wie Macbeth, die Steuerbehörde und Voldemort. Nicht, wenn du es heute Abend noch zum Einkaufszentrum schaffen willst.«
»Oh«, meinte sie mit einem fiesen Lächeln in meine Richtung. »An so etwas denke ich nur, wenn ich in einen Spiegel blicke und sorgfältig darauf achte, weder ›Candyman‹ noch ›Bloody Mary‹ zu sagen.«
»Weiß dein Vater, welche Art von Filmen du schaust?«, fragte ich.
»Mein Vater hat mir zum dreizehnten Geburtstag Psycho geschenkt. Und ich bemerke, dass du nicht fragen musst, wer der Candyman ist. Welche Art von Filmen schaust du, Mercy?« Jesse klang ein wenig selbstgefällig, also streckte ich ihr die Zunge heraus. So reif benehme ich mich als Stiefmutter.
Der Verkehr am Einkaufszentrum war eigentlich gar nicht so schlimm. Alle Fahrspuren waren bis zum Bersten gefüllt, aber es lief in relativ normaler Geschwindigkeit. Im Vorweihnachtsstress kamen selbst Schnecken schneller voran als ein Auto in der Nähe des Einkaufszentrums.
»Mercy?«, fragte Jesse.
»Hmmmm?«, antwortete ich, als ich die Spur wechselte, um nicht von einem Minivan gerammt zu werden.
»Wann werden du und Dad ein Baby bekommen?«
Kälte breitete sich in meinem gesamten Körper aus. Ich konnte nicht atmen, konnte nicht sprechen, konnte mich nicht bewegen – und rammte den SUV vor mir mit ungefähr fünfzig Stundenkilometern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Schottische Stück nichts damit zu tun hatte.
»Das war meine Schuld«, sagte Jesse kurze Zeit später, als sie neben mir auf dem Gehweg saß. Die blinkenden Lichter der verschiedenen Notfallfahrzeuge erzeugten interessante Effekte auf ihrem kanarienvogelgelb-orange gefärbten Haar. Sie scharrte nervös mit den Füßen – vielleicht allerdings auch, um sich warmzuhalten. Die Temperatur lag höchstens um den Gefrierpunkt, und der Wind war beißend kalt.
Ich bemühte mich immer noch, herauszufinden, was passiert war – allerdings war ich mir sicher, dass es nicht Jesses Schuld gewesen war. Ich lehnte meinen Kopf gegen den Sockel einer großen Ampelanlage und drückte weiter den Eisbeutel auf meinen linken Wangenknochen und die Nase – die endlich aufgehört hatte zu bluten. »Der Kapitän hat die Befehlsgewalt über das Schiff. Meine Schuld.«
Panikattacke, dachte ich. Jesses Frage hatte mich überrascht – doch ich hatte nicht geahnt, dass mich die Vorstellung eines Babys so verängstigte.
Eigentlich gefiel mir der Gedanke an ein Baby sogar. Warum also die Panikattacke? Ich fühlte, dass die Reste des Schocks immer noch meine Gedanken umnebelten und etwas Ähnliches wie Kältekopfschmerz erzeugten – aber das konnte auch etwas damit zu tun haben, dass mein Kopf auf die Lenksäule geknallt war.
Der Golf war ein altes Auto, und das bedeutete: keine Airbags. Allerdings war er auch ein gutes deutsches Auto, also brach die Karosserie um den Passagierbereich herum, sodass Jesse und ich nur blaue Flecken, eine blutige Nase und ein blaues Auge davongetragen hatten. Ich war die ständigen Veilchen ziemlich leid. Bei meinem Teint fielen sie allerdings nicht so auf wie bei Jesse. Schon in einer oder zwei Wochen würde niemand mehr vermuten, dass wir in einen Autounfall verwickelt gewesen waren.
Selbst mit dem Eisbeutel als Barriere zwischen mir und dem Rest der Welt wusste ich, dass die Beifahrerin des SUVs, den ich gerammt hatte, immer noch mit der Polizei sprach. Ihre Stimme war laut. Ihre spürbare Wut verriet, dass auch sie nicht schwer verletzt war. Der Fahrer hatte bisher nicht viel gesagt, doch auch er schien okay zu sein. Er stand ein paar Schritte von seinem Auto entfernt und starrte es an.
Der jüngere Polizist sagte etwas zu der Frau, und sie zuckte, als wäre sie mit einem Viehtreiber traktiert worden. Der Mann, der das Auto gefahren hatte, sah zu Jesse und mir, während die Frau anfing zu zischen wie ein Teekessel.
»Sie hat uns gerammt!«, kreischte sie. Das war zumindest der Kern ihrer Aussage. Verpackt war sie in eine Menge Worte, die mit »Sch…« anfingen, mit unzähligen persönlichen Beschimpfungen dazwischen. Ihre offensichtliche Angetrunkenheit schien ihre Stimmlage ungünstig zu beeinflussen. Ich verzog das Gesicht, als ihre Stimme wie ein Messer durch meinen Schädel schnitt und den Druck auf meinen schmerzenden Wangenknochen scheinbar noch verstärkte.
Ich verstand ihre Erregung. Selbst wenn man an einem Unfall nicht selbst schuld ist, ergibt sich daraus höllisch viel Arbeit. Man muss mit Versicherungen reden, das Auto zum Mechaniker bringen und irgendwie klarkommen, während das Auto dort herumsteht. Noch schlimmer, wenn es ein Totalschaden ist, muss man sich mit der gegnerischen Versicherung darüber streiten, wie viel der Wagen noch wert gewesen war. Ich hatte ziemliche Schuldgefühle, doch Jesses Kommentar sorgte dafür, dass ich meine eigenen Gefühle in den Hintergrund stellte und mich auf sie konzentrierte.
»Ben kann das besser«, murmelte ich. »Er flucht kreativer.«
»Und er tut es mit einem englischen Akzent, was ziemlich cool ist.« Jesse entspannte sich ein wenig und lauschte der Tirade mit mehr Interesse und weniger Sorge.
Die Frau fing an, auf den jüngeren Polizisten einzuschlagen und dabei zu fluchen. Ich achtete nicht genau darauf, aber anscheinend war sie jetzt wütend auf ihn und nicht mehr auf uns.
»Und Ben ist zu klug, um Polizisten zu beschimpfen«, erklärte Jesse mit ehrlichem, wenn auch fehlgeleitetem Vertrauen in Bens Weisheit. Sie hatte sich zu mir umgedreht und erhaschte dabei über meine Schulter einen guten Blick auf das einzige echte Opfer des Unfalls. »Himmel, Mercy. Schau dir den Golf an.«
Bis jetzt hatte ich genau das erfolgreich vermieden, doch irgendwann musste es sein.
Das kleine, rostfarbene Auto stand in Kontakt mit dem SUV vor sich und hatte es irgendwie geschafft, sich an ihm hochzuziehen, sodass die Vorderräder, von denen das eine nicht mehr rund war, ungefähr fünfzehn Zentimeter über dem Boden hingen. Außerdem befand sich die Motorhaube circa sechzig Zentimeter näher an der Windschutzscheibe als vorher.
»Er ist tot«, erklärte ich Jesse.
Vielleicht hätte ich den Golf retten können, wenn Zee noch da gewesen wäre, um mir zu helfen. Zee hatte mir fast alles beigebracht, was er über Autoreparaturen wusste. Doch es gab einige Schäden, die sich ohne die Hilfe eines eisengeküssten Feenwesens einfach nicht beheben ließen. Und Zee hatte sich im Reservat von Walla Walla verkrochen. Dort hielt er sich auf, seitdem einer der Grauen Lords den Sohn eines US-Senators getötet und erklärt hatte, dass die Feenwesen sich ab jetzt als unabhängige, eigenständige Nation betrachteten.
Schon Minuten nach dieser Erklärung waren alle Feenwesen verschwunden – genauso wie alle Reservate. Die sechzehn Kilometer lange Straße in das Reservat in der Nähe von Walla Walla war jetzt nur noch zwölf Kilometer lang, und nirgendwo auf der Strecke konnte man das Reservat sehen. Ich hatte gehört, dass an einem der Reservate ein Dickicht aus Blaubeerbüschen in die Höhe geschossen war und es vollkommen verbarg.
Mir waren auch Gerüchte zu Ohren gekommen, dass die Regierung versucht hatte, eines der Reservate zu bombardieren – nur dass dabei das gesamte Flugzeuggeschwader verschwunden war, um Minuten später über Australien wieder aufzutauchen. Australische Blogger hatten Fotos ins Netz gestellt, und der US-Präsident hatte eine formelle Entschuldigung ausgesprochen, also schien dieser Teil der Geschichte wahr zu sein.
Für mich persönlich bedeutete die ganze Sache, dass ich niemanden mehr hatte, an den ich mich wenden konnte, wenn ich Hilfe in der Werkstatt brauchte oder mal freinehmen wollte. Ich hatte nicht mal mehr mit Zee sprechen können, bevor er verschwunden war. Ich vermisste ihn, und das nicht nur, weil mein armer Golf aussah, als müsste ich ihn auf die große VW-Rallye im Himmel schicken.
»Zumindest sind wir nicht mit dem Vanagon gefahren«, meinte ich.
Mein Teenager-Ich – das in Fast-food-Läden gearbeitet hatte, um sich das Auto, die Versicherung, das Benzin und die Reparaturen leisten zu können – hätte um den armen Golf geweint, doch das hätte Jesse belastet. Und ich war kein Teenager mehr.
»Es ist schwerer, einen Syncro Vanagon zu finden als einen Golf?«, meinte Jesse, halb fragend, halb nachdenklich. Ich hatte ihr beigebracht, wie man einen Ölwechsel machte, und hin und wieder half sie mir in der Werkstatt. Überwiegend allerdings flirtete sie mit Gabriel, meiner Aushilfe. Gabriel war nur wegen Thanksgiving vom College nach Hause gekommen. Doch selbst die kleinste Hilfestellung war nützlich, jetzt, wo ich mein einziger Angestellter war. Meine Werkstatt bot nicht genug Arbeit für einen weiteren, festangestellten Mechaniker, gleichzeitig fehlte mir die Zeit, einen anderen Teenager auszubilden, um Gabriels Platz einzunehmen. Besonders, nachdem ich vermutete, dass es reine Zeitverschwendung gewesen wäre.
Ich wollte die Werkstatt nicht schließen, doch gleichzeitig fürchtete ich, dass es so kommen musste.
»Vor allem wird man in einem Vanagon eher verletzt«, erklärte ich Jesse. Der Verlust des Golfs und mein Schlafmangel versetzten mich in eine melancholische Stimmung. Aber das wollte ich mir ihr gegenüber nicht anmerken lassen, also sprach ich locker und fröhlich. »Keine Knautschzone. Das ist einer der Gründe, warum sie nicht länger hergestellt werden. Im Van wäre keiner von uns heil aus diesem Auto rausgekommen – und ich bin es wirklich leid, in einem Rollstuhl zu sitzen.«
Jesse lachte kurz auf. »Mercy, wir alle waren deinen Rollstuhl leid.«
Ich hatte mir im letzten Sommer auf meiner Hochzeitsreise das Bein gebrochen (ich will nicht drüber reden). Außerdem hatte ich es geschafft, mir die Hände übel zu verletzen, was bedeutete, dass ich nicht mit Krücken laufen oder den Rollstuhl selbst bewegen konnte. Ja, ich hatte ziemlich schlechte Laune verbreitet.
Die Frau diskutierte immer noch mit der Polizei, doch der Fahrer näherte sich uns. Es konnte natürlich sein, dass er nur deswegen zu uns kam, weil er rausfinden wollte, ob ich ordentlich versichert war oder etwas in der Art, doch mir lief ein warnender Schauder über den Rücken. Ich ließ den Eisbeutel sinken und stand vorsichtshalber auf.
»Trotzdem«, sagte Jesse, die Augen immer noch auf das Auto gerichtet. Sie reagierte nicht auf meine Bewegung; vielleicht hatte sie es gar nicht bemerkt. »Ich habe deinen kleinen Golf geliebt. Es war mein Fehler, dass wir den Unfall hatten. Es tut mir wirklich leid.«
Und in diesem Moment stürzte sich der Fahrer des anderen Wagens auf Jesse wie ein bissiger Wachhund. Während er näher kam, quollen Worte über seine Lippen, für die meine Mutter ihm den Mund mit Seife ausgewaschen hätte.
Jesse riss die Augen auf und sprang unsicher auf die Beine. Ich trat zwischen die beiden und sagte, unterstützt von etwas Macht, die ich mir vom Alpha des ansässigen Werwolfrudels lieh, der zufällig auch mein Ehemann war: »Es reicht.«
Der Mann wandte sich von Jesse ab, drehte sich zu mir um, öffnete den Mund und erstarrte einfach. Ich konnte eine deutliche Alkoholfahne riechen.
»Ich bin gefahren, nicht Jesse«, sagte ich ruhig. »Sie haben angehalten – ich bin auf Sie aufgefahren. Mein Fehler. Ich bin gut versichert. Es wird sicherlich nervig – wofür ich mich entschuldigen möchte –, doch Ihr Auto wird entweder repariert oder ersetzt.«
»Dämlicher Mosquito«, spuckte er mir entgegen, fälschlicherweise, nachdem ich amerikanische Ureinwohnerin bin und keine Hispaniola. Dann schlug er mit der Faust nach mir.
Ich mochte ja nur eine Kojote-Gestaltwandlerin sein und kein muskelbepackter Werwolf, doch unter meinem braunen Gürtel steckte jahrelanges Training in Vollkontakt-Karate. Der wütende Besitzer des SUVs war vielleicht um einiges größer als ich, aber seinem Geruch und seinen unsicheren Bewegungen zufolge war er außerdem betrunken. Das konterkarierte die meisten Vorteile, die seine Größe ihm eingebracht hätte.
Ich ließ seine Faust auf mich zuschnellen, trat vor, bis meine Hüfte auf derselben Höhe wie seine war, packte seinen Ellbogen und die Hand des vorschießenden Arms und schmiss ihn mit dem Gesicht nach vorne auf den Beton, wobei ich überwiegend seinen eigenen Schwung ausnutzte.
Trotzdem tat es auch mir weh, verdammt noch mal. Autounfälle waren nervig. Beißender Schmerz schoss durch meinen belasteten Nacken und in eine Hüfte, an der ich mich eigentlich gar nicht verletzt hatte. Ich blieb für einen Moment angespannt und bereit, doch der Aufprall auf dem Boden schien dem großen Mann jede Wut ausgetrieben zu haben. Nachdem er nicht sofort wieder zum nächsten Angriff aufsprang, trat ich zurück. Dann berührte ich meine Wange und wünschte mir, ich hätte den Eisbeutel nicht fallen gelassen.
Der ganze Kampf hatte nicht mehr als ein paar Sekunden gedauert. Bevor der Mann auch nur zucken konnte, war schon einer der Polizisten da, stemmte ein Knie in sein Kreuz und legte ihm Handschellen an. Die Bewegung war geschmeidig und geübt, was mich vermuten ließ, dass auch der Polizist irgendeine Art von Kampfsport betrieb.
»Du fährst heute Nacht nicht mehr«, erklärte der Polizist ihm fröhlich. »Und du schlägst auch keine netten Damen mehr. Jetzt geht es zur Ausnüchterung ins Kittchen.«
»Kittchen?«, fragte ich.
Der andere Polizist, ein älterer, weniger energiegeladener Mann, sagte: »Nielson schaut gern alte Filme.« Er drückte mir einen Strafzettel für zu dichtes Auffahren in die Hand und deutete auf den Mann in Handschellen. »Seine Freundin haben wir wegen Angriff auf einen Polizeibeamten verhaftet. Möchten Sie Anzeige wegen tätlichen Angriffs erstatten? Wir haben alle gesehen, dass er zuerst ausgeholt hat.«
Ich schüttelte den Kopf. Plötzlich fühlte ich mich müde. »Nein. Sagen Sie ihm nur, dass seine Versicherung sich mit meiner in Verbindung setzen soll.«
Ein lautes, kratzendes Geräusch, gefolgt von einem Knirschen, hallte durch die Luft. Ein Abschleppwagen zog den SUV nach oben. Der Golf sackte nach unten, begleitet von einem Seufzen, einem Gurgeln und dem zischenden Geräusch von Frostschutzmittel auf kaltem Asphalt, weil der Kühler endgültig brach.
Jesse zitterte neben mir. Ich musste sie dringend ins Warme bringen.
»Wann kommt dein Dad?«, fragte ich. Sie hatte ihn angerufen, während ich damit beschäftigt war, mit den Beamten und Sanitätern zu reden, die mir Eisbeutel gebracht hatten.
»Er hat nicht abgehoben«, sagte Jesse. »Also habe ich Darryl angerufen. Da ist auch niemand drangegangen. Das hätte ich dir früher sagen müssen.«
Adam ging nicht ans Telefon? Das war merkwürdig. Adam wäre auf jeden Fall erreichbar geblieben, während wir inmitten der wilden Horden einkaufen gingen. Er hatte sogar angeboten, mitzukommen. Das wäre … interessant geworden. Adam tickte schon an einem ruhigen Tag im Walmart fast aus. Dass Darryl, sein Stellvertreter, nicht ans Telefon ging, störte mich weniger, war aber trotzdem seltsam.
Ich zog mein Handy heraus und entdeckte, dass ich eine SMS von Bran hatte – was noch seltsamer war. Der Marrok, der Herrscher über die Werwölfe, schrieb normalerweise keine SMS.
Ich öffnete die Nachricht und entdeckte folgenden Text: Das Spiel hat begonnen.
»Bran wurde von Arthur Conan Doyle übernommen«, sagte ich. Sofort spähte Jesse neugierig über meine Schulter.
Ich versuchte, Bran zurückzurufen (meine Finger waren einfach zu kalt, um in anständiger Geschwindigkeit SMS zu schreiben), doch seine Nummer war »vorübergehend nicht erreichbar«, was auch heißen konnte, dass der Anschluss nicht länger existierte. Dann versuchte ich es bei Samuel, dem Sohn des Marroks, und erreichte nur sein Sekretariat.
»Nein, ist schon in Ordnung«, erkläre ich der netten Dame, die ans Telefon ging. »Wenn Dr. Cornick gerade nicht erreichbar ist, gehe ich einfach in die Notaufnahme.« Es gab keinen Grund, Samuel eine Nachricht mit dem wahren Grund meines Anrufes zu hinterlassen. Die SMS von Bran hatte mich beunruhigt. Meine Panikattacke – der Grund für den Unfall – brachte mich noch mehr aus dem Gleichgewicht.
Ich versuchte es nacheinander bei allen Rudelmitgliedern: Warren, Honey, Mary Jo und sogar bei Ben. Für ihre Handys galt – der Reihe nach: aus, Mailbox, aus, Mailbox.
Ich dachte immer noch über Brans Nachricht nach, während ich Paul anrief – der mich lieber umgebracht hätte, als mich zu retten, auch wenn er in Bezug auf Jesse anders empfand. Während das Telefon vergeblich klingelte, erinnerte ich mich daran, dass die Werwölfe sich gerne Top-Secret-Notfallcodes bedienten. Das hatte nichts mit ihrer Existenz als Werwolf zu tun, dafür sehr viel mit der Tatsache, dass viele Werwölfe irgendwann in ihrem Leben einmal beim Militär gedient hatten, was dafür sorgte, dass sie alle ein wenig zu Paranoia neigten. Pfadfinder waren bei Weitem nicht so »allzeit bereit« wie Werwölfe.
Ich wusste von den Geheimcodes, weil ich mit Werwölfen aufgewachsen war, aber ich hatte sie nie gelernt, weil ich eben kein Werwolf war. Adam hatte sie mir wahrscheinlich irgendwann beibringen wollen, nachdem ich jetzt Mitglied des Rudels war, doch mit Flussmonstern und gebrochenen Beinen und anderen Rudeldramen war es kein Wunder, dass dieses Thema nicht ganz oben auf seiner Liste gestanden hatte.
Paul hob ebenfalls nicht ab. Ich hätte, gestützt auf die Beweise, darauf gewettet, dass Brans Nachricht »keine Telefone« bedeutete. Was ja schön und gut war, aber Jesse und ich hingen hier beim Einkaufszentrum fest, bis wir irgendwen fanden, der an sein dämliches Handy ging. Wenn das nur ein Test für das Notfall-Code-System war, würde ich jemanden beißen.
Wenn nicht … Mein Magen verkrampfte sich, und die Panikattacke, die den Unfall verursacht hatte, erschien mir plötzlich in viel finstererem Licht. Ich war doppelt gebunden, einmal an Adam, einmal an das Rudel. Was, wenn Adam oder dem Rudel etwas zugestoßen war? Ich griff nach der Verbindung in mir …
»Mercy?«, fragte Jesse und brach damit meine Konzentration, bevor ich mit Adam oder dem Rudel Kontakt aufnehmen konnte.
»Ich weiß nicht, was los ist«, erklärte ich. »Lass es mich weiter versuchen.«
Nach einem Moment des Nachdenkens rief ich Kyle an. Er war kein Werwolf, also hatte er das Memo über die Handys vielleicht nicht bekommen. Und als bessere Hälfte des Dritten im Rudel wusste er vielleicht, was vor sich ging. Ich erreichte nur seine Mailbox und hinterließ keine Nachricht. Als Nächstes versuchte ich es bei Elizaveta, der Hexe. Elizaveta hatte einen Vertrag mit dem Rudel – ich hatte vor Kurzem erst gesehen, was Adam ihr jeden Monat zahlte und hatte dementsprechend keinerlei Skrupel, sie als Taxidienst zu missbrauchen – aber auch sie ging nicht dran. Vielleicht wusste sie von den Codes – oder sie war gerade shoppen, und die schreienden Horden verhinderten, dass sie ihr Handy hörte.
Vielleicht befand sich das ganze Rudel auf einem Shoppingtrip, und ich war einfach nur paranoid.
»Wie stehen die Chancen, dass das gesamte Rudel sich dem Rest der Tri-Cities angeschlossen hat und mitten in der Nacht shoppen gegangen ist?«, fragte ich laut.
»Nicht allzu gut«, erklärte Jesse ernst. »Die meisten von ihnen sind wie Dad; schon allein der Lärm wäre ihnen unheimlich. Stopf sie mit einer Menge normaler Leute in einen engen Raum, und ein Blutbad lässt nicht lang auf sich warten. Das kann ich mir bei keinem von ihnen vorstellen. Außer vielleicht bei Honey, die es zumindest versuchen würde.«
»Das denke ich auch«, stimmte ich zu. »Irgendwas ist los. Wir sind auf uns allein gestellt.«
»Ich rufe Gabriel an«, sagte sie.
Gabriel, mein fleißiger Helfer, kämpfte wie ein Dämon darum, sich nicht in Jesse zu verlieben. Er hatte im September, als er nach Seattle zum College aufgebrochen war, mit ihr Schluss gemacht – obwohl sie gar nicht offiziell zusammen gewesen waren. Doch beim Thanksgiving-Dinner vor ein paar Stunden hatte er neben ihr gesessen und so heftig geflirtet, wie es mit ihrem aufmerksamen Vater am Tisch eben möglich war.
Liebe wartet nicht auf den passenden Zeitpunkt.
Wenn er in der Stadt war, lebte Gabriel in meinem winzigen Fertighaus hinter dem Zaun des Hauses, das ich mir mit Adam und Jesse teilte. Als er und seine Mutter einen heftigen, unerbittlichen Streit darüber gehabt hatten, ob er Kontakt mit mir und meinen Werwolf-Freunden haben sollte oder nicht, war er dort eingezogen. Überwiegend lebte er in Seattle – doch das Haus wartete auf ihn, wann immer er in den Ferien nach Hause kam.
Er stand auf keinen Fall auf irgendeiner Werwolf-Notfall-Telefonliste, also verstärkte sich meine Sorge, als Jesse nur den Kopf schüttelte. War dem Rudel etwas geschehen, während wir unterwegs waren?
»Verdammt«, sagte ich und versuchte ein weiteres Mal, Adam durch die emotionale Kette zu erspüren, die uns als Gefährten zusammenschweißte. Die Verbindung war stark und unerschütterlich, doch manchmal kostete es Mühe, Informationen zu erhalten. Als ich besorgt mit Adam darüber geredet hatte, hatte er nur mit den Achseln gezuckt.
»Es ist, was es ist«, sagte er. »Manche Leute müssen quasi in ihren Gefährten kriechen, um sich sicher zu fühlen. Wie würde es dir gefallen, wenn das für uns gälte?« Er grinste mich an, als ich versuchte, mich zu entschuldigen. »Kein Problem. Ich liebe dich genau so, wie du bist, Mercy. Ich muss dich nicht in einem Stück verschlingen. Ich muss nicht ständig in deinem Kopf sein. Ich muss einfach nur wissen, dass du da bist.«
Es gab eine Menge Gründe, Adam zu lieben.
Ich versenkte mich tiefer in die Gefährtenbindung, was mein heftiges Kopfweh noch verstärkte. Mühsam überwand ich die Barrieren, die mein Unterbewusstsein offensichtlich errichtet hatte, um nicht von der Persönlichkeit Adam Hauptmans, des charismatischen Alpha der Alphas, überwältigt zu werden. Endlich erreichte ich ihn …
»Hey, Mercy«, sagte eine tiefe Stimme. »Alles okay?«
Ich sah auf und erkannte den Fahrer des Abschleppwagens. Ich kenne die meisten Fahrer in der Gegend – ich besitze eine Autowerkstatt, und das gehört einfach dazu.
»Hey, Dale«, sagte ich, während ich mich bemühte, nicht zu wirken, als hätte ich gerade mit Werwolfmagie gespielt. Das wäre um einiges einfacher gewesen, wenn mich nicht erneut dieses unangenehme, zittrige, beklemmende Gefühl übermannt hätte, das in erster Linie dafür verantwortlich war, dass ich den SUV gerammt hatte. Ich kämpfte darum, die zweite Panikattacke zu unterdrücken. Dale nahm wahrscheinlich an, dass meine Zähne wegen der Kälte zitterten. »Jesse und mir geht es gut, aber ich hatte schon bessere Tage.«
»Das sehe ich.« Er klang besorgt, also musste ich ziemlich schrecklich aussehen. »Soll ich den Golf zu deiner Werkstatt schleppen? Oder möchtest du deine Niederlage gleich eingestehen und ihn zum Pasco-Schrottplatz bringen lassen?«
Ich richtete meinen Blick auf ihn, als mir ein Gedanke kam.
Er sah auf seine Jacke hinunter. »Was starrst du an? Habe ich einen Fleck auf der Jacke? Ich habe sie mir vom Stapel mit der sauberen Wäsche genommen.«
»Dale, wenn ich dich dafür bezahle, dass du mein Auto zu meiner Werkstatt schleppst, wäre im Wagen dann auch noch genug Platz für Jesse und mich? Wir erreichen meinen Ehemann nicht. In der Werkstatt habe ich einen Wagen, mit dem ich nach Hause fahren kann.«
Er lächelte fröhlich. »Sicher. Kein Problem, Mercy.«
»Das wäre toll«, meinte ich. »Danke.« Das konnte funktionieren. Mein Laden war ein sicherer, warmer Ort, an dem ich nachdenken konnte. Das ging. Ich brauchte meine Festung, um mich gegen die aufsteigende Panik wehren zu können. Denn als ich mich in dem Band zwischen Adam und mir versenkt hatte, hatte ich nichts außer Wut und Schmerz gefühlt.
Jemand quälte meinen Ehemann, das war das Einzige, was ich wusste.
Dales Abschleppwagen roch nach alten Pommes, Kaffee und vergammelten Bananenschalen. Ich zwang mich dazu, leichte Konversation zu machen, ließ mir von seiner Tochter und ihrem Neugeborenen erzählen und unterhielt mich mit ihm über die steigenden Dieselpreise und alles andere, was mir so einfiel. Ich durfte Jesse nicht merken lassen, welche Sorgen ich mir machte, bis ich mehr Informationen hatte.
Meine Werkstatt sah aus, wie sie aussehen sollte. Der kleine Friedhof (wo die Überreste einiger kaputter Autos darauf warteten, ihre Teile lebenden Verwandten zu spenden) und der Parkplatz waren gut beleuchtet. Neue Halogenlampen strahlten auf die vier Autos herab, die auf den Plätzen für die Wagen standen, die zwar noch liefen, aber dringend Hilfe benötigten. Ich tätschelte Jesse die Schulter, als sie tief einatmete.
Dann sprang ich aus dem Führerhaus und half Dale dabei, den Golf loszumachen. Jesse schickte ich ins Büro. Sie warf einen Blick auf die vier Autos auf dem Parkplatz, auf dem eigentlich nur drei hätten stehen sollen, und lief ohne Widerspruch nach drinnen. Sie hatte keinerlei Probleme damit, die Tür zu öffnen, die eigentlich hätte verschlossen sein müssen – und als sie hineinging, schaltete sie nicht das Licht an, weil sie die Tochter ihres Vaters war. Sie war nicht so dumm, in einem Raum mit Fenstern ein Licht anzuschalten, wenn es vielleicht etwas zu verstecken gab.
»Armes Ding«, sagte Dale und tätschelte den Kofferraum meines Autos, ohne auf Jesse zu achten. »Es gibt nicht mehr viele davon in der Gegend.« Er sah mich an und meinte dann beiläufig: »Ich könnte einen Jetta von 1989 mit hundertzehntausend auf dem Tacho besorgen. Ein wenig verbogen, aber nichts, was ein wenig Spachtelmasse und Farbe nicht beheben könnten.«
»Ich behalte es im Hinterkopf«, meinte ich. »Was schulde ich dir?«
»Der Boss schickt dir die Rechnung«, sagte er, was dafür sorgte, dass mein gezwungenes Lächeln plötzlich aufrichtig wurde – Dales »Boss« war seine Ehefrau.
Ich winkte ihm hinterher, als er davonfuhr, dann rannte ich zum Büro. Denn das vierte Auto, das zwischen einem Käfer von 1968 und einem alten Type II stand, war ein ramponierter 1974er Mercedes, der Gabriel gehörte.
Ich schlüpfte durch die Tür und schloss sie. Das unbeleuchtete Büro hatte mir verraten, dass Gabriel etwas wusste und dass es wichtig war, damit hinter dem Busch zu halten – sonst wäre der Raum hell erleuchtet gewesen. Als ich mich umdrehte, stieg mir Gabriels Duft in die Nase, und das war in Ordnung, doch da war noch jemand anderes …
Starke Arme schlangen sich um meine Hüfte und rissen mich fast von den Füßen. Meine Nase verriet mir, dass die Arme Ben mit dem britischen Akzent und der Tendenz zum unflätigen Fluchen gehörten, während er sein Gesicht an meinem Bauch vergrub. Also legte ich das Stemmeisen, das ich mir vom Tresen geschnappt hatte, wieder dorthin, wo es hingehörte, ohne ihm den Schädel damit zu spalten. Er bewegte den Kopf, bis mein Hemd nach oben rutschte und ich seine stoppelige Wange an meiner Haut spürte.
Ich hatte so etwas schon einmal bei einem Werwolf erlebt, dasselbe Zittern, dieselbe unregelmäßige Atmung. Ich war mir ziemlich sicher, dass Ben nicht hungrig war (wie es bei dem anderen Wolf der Fall gewesen war), weil seit dem Truthahnessen noch nicht allzu viel Zeit vergangen war. Also legte ich eine Hand auf seinen Kopf und warf einen kurzen Blick auf die zwei schockierten Teenager, die vor einem Regal voll alter, nicht zusammenpassender Felgenkappen standen. Es war dunkel im Büro, doch Kojoten wie ich können im Dunkeln problemlos sehen.
Ben gab halb knurrend, halb sprechend etwas von sich, doch ich konnte ihn nicht verstehen. Die Hitze seiner Haut verriet mir, dass er versuchte, sich gegen die Verwandlung zu wehren. Ich brummte beruhigend, doch ich berührte ihn nicht weiter, weil die Haut eines Werwolfs ziemlich empfindlich ist, wenn er sich verwandelt. Ben hörte auf zu reden und gab sich mit Atmen zufrieden. Ich sah zu Gabriel.
Er hielt Jesses Hand fest – oder ließ sich von ihr festhalten – und wirkte kaum ruhiger als Ben.
»Fang noch mal an«, sagte Jesse. »Mercy muss alles wissen.«
Gabriel nickte. »Gegen Mitternacht kam Ben in mein Wohnzimmer gestürzt, hat mich und meine Autoschlüssel gepackt und mich aus der Tür gezerrt. Sobald wir draußen waren, konnte ich sehen, dass bei eurem Haus eine Menge los war. Es gab keine Scheinwerfer, aber ich konnte Autos hören – irgendetwas mit Dieselmotoren, in der Größe von Lastwagen. Ben sagte, wir müssten hierherkommen und dich holen. Glaube ich zumindest. Er klang ziemlich seltsam. Er hat mich auf den Fahrersitz geschubst und seitdem kein verständliches Wort mehr gesprochen. Ich wollte dich anrufen, aber …«
Er nickte in Richtung Boden, wo ich die zersplitterten Trümmer des Bürotelefons entdeckte. »Ben hielt das anscheinend für keine gute Idee. Ich bin wirklich, wirklich froh, dich zu sehen.«
»Ben?«, fragte ich. »Kannst du …?«
Er hob den Arm und ließ einen Beruhigungspfeil in meine Hand fallen. Er war ungefähr zur Hälfte mit etwas gefüllt, das aussah wie Milch. Doch ich wusste es besser. Jemand kannte unsere Geheimnisse.
»Er wurde unter Drogen gesetzt«, sagte ich und schnupperte an der Nadel, um sicherzugehen. Der Geruch wirkte vertraut. »Es sieht aus wie das Zeug, das Mac getötet hat.«
»Mac?«, fragte Gabriel.
»Das war vor deiner Zeit«, erklärte ich. »Mac war ein frisch verwandelter Werwolf, der einem komplizierten Plan zum Opfer fiel, der eigentlich gegen Bran gerichtet war. Wir hatten immer geglaubt, Werwölfe seien immun gegen Drogen aller Art. Doch der Bösewicht, der zufällig selbst ein Werwolf war, entwickelte einen Drogencocktail, der aus Substanzen bestand, die jeder Tierarzt in seiner Praxis hat.« Dieses Wissen hätte eigentlich mit Gerry gestorben sein sollen. »Die meisten Werwölfe, die damit betäubt wurden, haben sich erholt. Doch frisch verwandelte Werwölfe sind empfindlicher, und Mac ist daran gestorben.«
Wir alle sahen Ben an, der nicht gerade gesund wirkte.
»Wird er sich erholen?«, fragte Gabriel. »Können wir irgendetwas für ihn tun?«
»Ich brenne es raus«, knurrte Ben.
Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden hatte, denn er sprach undeutlich und lallend. »Ben? Du brennst die Droge raus?« Seine Haut fühlte sich in der Tat fiebrig an. »Erhöhst deinen Grundumsatz?« Ich hatte nicht gewusst, dass Werwölfe so etwas konnten.
»Brenne es richtig raus«, sagte er, was ich als Zustimmung auffasste. »Aber es wird … eine Minute.«
»Was können wir tun, um dir zu helfen?«, fragte ich. »Wasser? Essen?« Ich hatte irgendwo ein paar Müsliriegel herumliegen.
»Nur dich«, sagte er. »Rudelgeruch. Alphageruch. Das hilft.« Er zitterte an meinem Körper. »Tut weh. Der Wolf will raus.«
»Dann lass ihn raus«, meinte Jesse.
Aber Ben schüttelte den Kopf. »Dann kann ich nicht reden. Muss berichten.«
Er roch nach Adrenalin und Blut.
»Sind wir hier sicher?«, fragte ich. »Sollten wir verschwinden?«
»Kurzzeitig sicher«, erklärte Ben nach einem Moment. »Glaube ich. Sie sollten mit dem Rest … dem Rest des Rudels beschäftigt sein.«
»Könnte Kaffee helfen?«, fragte Jesse.
Ich dachte kurz darüber nach, dann schüttelte ich den Kopf. »Ich bin kein Arzt. Aber ein Stimulans mit in die Mischung zu werfen, könnte es schlimmer machen.«
»Du könntest Samuel anrufen.«
Ich sah in ihre angsterfüllten Augen und versuchte, ihr zuliebe stark zu sein. »Samuels Telefon ist aufs Sekretariat umgeleitet. Wir sind auf uns allein gestellt.«
»Was ist mit Zee?«, fragte Gabriel. Er hatte gesehen, was Zee mit einem Auto anstellen konnte, und hatte eine gewisse Heldenverehrung für den grummligen alten Feenmann entwickelt. »Könnte er nicht etwas mit dem Silber anstellen?«
»Zee versteckt sich mit dem Rest der Feenwesen im Feenland«, erklärte ich ihm, obwohl er das bereits wusste. »Er wird uns nicht helfen können.«
»Aber …«
»Was auch immer Zee sonst ist«, erklärte ich, »zuallererst ist er ein Feenwesen.«
»Tut weh«, sagte Ben gedämpft an meinem Bauch. Er wand sich. So reagieren Werwölfe auf Silber. Ich wünschte mir, ich könnte etwas tun.
»Ja, du kannst helfen«, sagte er, als hätte er meine Gedanken gelesen. Manchmal funktionierte die Rudelverbindung so – das war eine der Sachen, an die ich mich noch gewöhnen musste. »Du kannst mich aushorchen … das könntest du tun. Stell mir Fragen. Rede mit mir, damit ich den Wolf zurückdrängen kann. Du musst es erfahren.«
»Alle sind noch am Leben«, antwortete ich. »So viel kann ich sagen. Was ist passiert?«
»Gefangen«, sagte er, dann: »Regierungsagenten.«
Mir lief ein kalter Schauder über den Rücken. Ich hatte einen Abschluss in Geschichte. Wenn die Regierung gegen einen Teil ihrer eigenen Bevölkerung vorgeht, ist das übel. Mehr als übel. Völkermord-übel. Wir brauchten die Regierung, um die Werwölfe vor den Eiferern in der Bevölkerung zu beschützen. Wenn die Regierung sich gegen uns gewandt hatte, würden die Wölfe sich selbst verteidigen müssen. Und daraus konnte kein Happy End entstehen.
»Regierungsagenten von welcher Behörde?«, fragte ich. »Homeland Security? Cantrip? FBI?«
Ben schüttelte den Kopf. Dann sah er zu mir auf und starrte mich für einen Moment an, als könnte Augenkontakt ihm dabei helfen, sich in den Griff zu bekommen. Er setzte ein paarmal an, um etwas zu sagen.
»Sie haben alle mitgenommen, die dort waren?«
»Alle«, sagte er. Wieder drückte er seine Wange gegen meinen Bauch. »Alle, die da waren.«
Ich wechselte einen verzweifelten Blick mit Jesse. Es war Thanksgiving gewesen. Ein Großteil des Rudels hatte sich im Haus aufgehalten.
»Honey und Peter und Paul und Darryl und Auriele.« Er hielt kurz inne, um Luft zu holen. »Mary Jo. Warren.«
»Mary Jo war nicht da«, sagte ich. »Genauso wenig wie Warren.« Warren und sein Freund hatten ein Thanksgiving-Dinner für all ihre Freunde organisiert, die niemanden hatten, den sie besuchen konnten. Schwul zu sein bedeutete, dass die beiden diverse Freunde hatten, deren Familien sie nicht mehr willkommen hießen. Mary Jo, eine Feuerwehrfrau, hatte Dienst gehabt.
»Gewittert«, knurrte Ben. Dann stoppte er, und sein Körper versteifte sich. »Gesagt … Sie haben gesagt, nicht Adam. Sie haben gesagt … ›Kommen Sie ruhig mit, dann wird niemand verletzt, Mr. Hauptman.‹ Adam sagte ›Ich rieche Blut an ihren Händen. Warren und Mary Jo. Was haben Sie meinen Leuten angetan?‹ Sie haben wieder gesagt: ›Regierungsagenten‹. Sagten: ›Hier sind unsere Ausweise.‹«
Er atmete tief durch. »Adam hat gesagt: ›Ausweise in Ordnung. Aber Sie sind keine Regierungsagenten.‹ Lügner. Adam hat gesagt, sie hätten gelogen.«
Ich war mir nicht mehr sicher, ob Ben mich festhielt oder ich ihn.
»Wie haben sie Mary Jo gefunden?«, fragte ich. Mary Jo machte sich Sorgen, dass sie ihren Job verlieren könnte, wenn herauskam, dass sie ein Werwolf war. Wenn sie von Mary Jo und von dem Beruhigungsmittel wussten, dann kannte jemand zu viele unserer Geheimnisse. Es war eine rhetorische Frage. Ich rechnete nicht damit, dass Ben die Antwort kannte.
»Handys«, erklärte er mir. »Bran hat eine SMS geschickt.«
»Verstanden«, sagte ich. »Ich dachte, die Nachricht bedeutet, dass die Handybenutzung nicht sicher ist.«
Er schüttelte den Kopf. »Es bedeutete, dass jemand unsere Handys ortet. GPS-Tracking. Charles hat Spinnen.« Charles war der Sohn des Marrok, des Mannes, der die Werwölfe regierte. Zu Charles’ vielen Talenten gehörte auch, Leute umzubringen und Geld zu scheffeln. Außerdem verstand er gespenstisch viel von Technologie jeder Art – doch für Spinnen interessierte er sich nicht. Zumindest, soweit ich wusste.
»Spinnen?«, fragte ich.
Ben lachte keuchend. »Spinnen. Kleine Codeteile, die Wache halten. Nach genau so etwas suchen. Spyware in den Systemen der Telefonanbieter. Ich glaube, er hat einen Spion. Die Warnung kam allerdings zu spät.«
»Wie bist du entkommen?«, fragte ich.
»Ich war oben.«
Bens Stimme nahm langsam wieder einen normaleren Klang an, und er drückte sich deutlicher aus. »Habe Klopapier fürs Sch… für das Bad im Erdgeschoss geholt«. Er gab ein Geräusch von sich, das wie ein halbes Schluchzen klang. Ich umarmte ihn fester.
»Fluch nur«, sagte ich. »Ich verspreche, dass ich Adam nichts davon erzähle.«
Er schnaubte. »Schlechte Angewohnheit.« Ich hatte keine Ahnung, ob er über sein Fluchen sprach oder darüber, dass ich es Adam nicht erzählen wollte.
»Du hast recht«, sagte ich, weil es so war. »Also hast du sie gehört und bist zu Gabriel gerannt?«
»Ich habe sie gehört«, erklärte er. »Habe gewartet. Das gesamte Rudel war dort unten. Dann sagte Adam: ›Bei aller Gnade, Benjamin Speedway.‹ Adam hat das gesagt, als wäre es ein Fluch, aber ich wusste es. Ich bin Benjamin. Gnade bist du. Er hat mir befohlen, wegzulaufen, dich zu finden. Hat den Befehl heimlich ausgesprochen, um mir einen Moment Vorsprung zu geben, bevor sie dahinterkommen. Auch im hinteren Teil des Gartens waren Leute, und sie haben gesehen, wie ich aus dem Fenster gesprungen bin. Haben mich mit dem verdammten Pfeil beschossen, und ich bin auf den Fluss zugelaufen. Dann umgekehrt, um Gabriel zu finden. Habe ihn fahren lassen. Doch du warst nicht da. Du solltest hier sein.«
Hätten wir nicht den Unfall gehabt, hätten Jesse und ich unseren Einkauf beendet und wären nach Hause gefahren. Und dabei wahrscheinlich direkt den Leuten in die Arme gelaufen, die jetzt Adam in ihrer Gewalt hatten. Schieres Glück. Ich atmete tief durch und bemerkte dabei wieder den Geruch, den ich bereits seit einer Weile in der Nase hatte.
»Blut.« Ich lehnte mich zurück, um ein wenig Platz zwischen uns zu bringen. »Ben, wo blutest du?«
2
Brauchen wir Licht?«, fragte Jesse.
»Ich hole den großen Verbandskasten aus der Werkstatt«, sagte Gabriel und rannte los. Für ihn war die Nacht dunkel, doch er kannte sich in der Werkstatt gut aus, und der Erste-Hilfe-Kasten stand an der Wand zum Büro. Gabriel war nicht so schnell wie ich, aber er wurde im Moment nicht von einem Werwolf umklammert.
Ich wusste genau, was Adam dazu sagen würde, wenn ich das Licht anschaltete, während wir uns wahrscheinlich vor einer unbekannten Gruppe versteckten, die ein gesamtes Rudel Werwölfe angreifen und aus der Konfrontation als Sieger hervorgehen konnte. Doch meine Nachtsicht war einer Erste-Hilfe-Aktion nicht gewachsen.
»Taschenlampe«, erklärte ich. »Unter dem Tresen. Bring auch das Teppichmesser mit, für den Fall, dass wir seine Kleidung aufschneiden müssen.« Ich legte meine Hände an Bens Gesicht und versuchte, ihn dazu zu bringen, mich anzusehen. »Ben. Ben.«
»Ja?« Das Wort klang klar und so britisch, wie es bei Ben, mit seinem wunderbaren Fluchwortschatz, selten der Fall war. Doch er ließ nicht zu, dass ich ihm ins Gesicht sah.
»Wo bist du getroffen?«
»Pfeil. Arsch.« Das klang nicht so klar, doch ich konnte ihn verstehen. Allerdings ging ich davon aus, dass es eine Ortsangabe war und kein Schimpfwort, auch wenn das bei Ben immer schwer einzuschätzen war.
»Nein. Nicht der Pfeil.« Ein Beruhigungspfeil hätte ihm keine Wunde zugefügt, die so viel später noch blutete. »Jemand hat dich angeschossen, Ben. Wo?«
Jesse richtete die Taschenlampe auf ihn. »Bein«, sagte sie. »Direkt über seinem rechten Knie.«
Ben wollte mich nicht loslassen, also schnitt Jesse den Stoff seiner Khakihose mit dem Teppichmesser auf. Gabriel nahm die Taschenlampe und sah sich die Wunde genau an.
»Glatter Durchschuss«, erklärte er. Er klang ruhig, auch wenn sein Gesicht bleich wurde und einen grünlichen Stich annahm.
Die Wunde war nicht verheilt, also benutzte derjenige, der ihn angeschossen hatte, entweder silberne Kugeln – oder das Silber in der Beruhigungsdroge verlangsamte den Heilungsprozess. Was auch immer es war, wir mussten die Blutung stoppen.
»Sterile Binde«, erklärte ich Jesse. »Es ist wichtig, nichts zu verwenden, was an der Wunde festkleben könnte.« Bens Haut könnte darüberwachsen, sobald er anfing, mit der für Werwölfe normalen Geschwindigkeit zu heilen. »Dann Gaze, dann elastischer Verband. Dann packen wir zusammen, fahren zu Samuel und hoffen, dass er zu Hause ist.«
Samuel Cornick war gleichzeitig Arzt und Werwolf. Er würde wissen, was das Beste für Ben war. Er ging ebenfalls nicht an sein Telefon, also hatte er anscheinend Brans Nachricht erhalten. Außerdem gehörte er nicht zum Rudel. Es bestand die reelle Chance, dass er übersehen worden war, als sie – wer auch immer sie waren – den Rest der Wölfe eingesammelt hatten. Ich hoffte wirklich inständig, dass man ihn übersehen hatte.
Ich musste Ben zu Samuel bringen und dann Hilfe holen – was ich hoffentlich auch über Samuel bewerkstelligen konnte. Ich musste Adam und das Rudel finden sowie die anderen Wölfe suchen, die nicht beim Thanksgiving-Dinner gewesen waren – und sicherstellen, dass niemand sonst entführt oder verletzt worden war, wie Warrens Freund oder Mary Jos Feuerwehrkollegen.
Da unsere Feinde gewusst hatten, wo sie Mary Jo und Warren finden konnten, wussten sie mehr über die Identität der Werwölfe, als sie sollten. Wenn sie Menschen waren – und hätte Ben bemerkt, dass sie einer anderen Art angehörten, hätte er mir davon berichtet – und trotzdem bereit, fast dreißig verdammte Werwölfe zu kidnappen, dann waren sie entweder verrückt, hatten vor, sie alle gleichzeitig zu töten oder waren zumindest bewaffnet und sehr, sehr gefährlich. Und sie könnten tatsächlich Regierungsagenten sein, auch wenn Adam sie der Lüge bezichtigt hatte.
»Kannst du stehen?«, fragte ich Ben, sobald Jesse ihm einen akzeptablen Verband angelegt hatte.
Er grunzte.
»Wir müssen verschwinden. Wenn sie genug wussten, um Warren und Mary Jo zu erwischen, dann müssen wir davon ausgehen, dass sie auch die Werkstatt kennen.«
»Gefahr«, sagte er und klang wieder schlimmer. »In Gefahr. Du.« Dieser Gedanke schien ihn zu inspirieren. Mit einem Geräusch, das eher wölfisch als menschlich klang, stand er auf, nur um sofort zusammenzusacken, bis er sozusagen über meiner Schulter hing.
»Es ist nicht das Bein«, sagte er, wobei er ein wenig zu deutlich sprach. »Es ist die Droge. Schwach. Schwach. Schwach.« Er versteifte sich, und seine Augen leuchteten golden von dem Drang des Wolfes, sich zu schützen. Kein Raubtier mag es, geschwächt und verletzlich zu sein.
»Es ist in Ordnung«, erklärte ich bestimmt, weil es wichtig war, dass er mir glaubte. Wenn er es nicht tat, würde er aggressiv werden, und wir steckten in noch größeren Schwierigkeiten. »Du bist unter Freunden. Gabriel, schnapp dir den Schlüssel zu dem Mercedes, der in der Garage steht, und hilf mir, Ben zum Auto zu bringen.«
Marsilias dunkelblauer Mercedes, ein S 65 AMG, stand in meiner Garage, nur für den Fall, dass jemand auf den Parkplatz kam und beschloss, den Lack zu verkratzen oder einen Stein darauf zu werfen. Der Wagen war drei Monate alt und bekam gerade seinen ersten Ölwechsel. Und war so teuer, dass ich mir für weniger eine zweite Werkstatt hätte kaufen können.
»Den AMG?«, fragte Gabriel, doch er griff bereitwillig nach den Autoschlüsseln. »Du willst Ben eine Mercedes S-Klasse vollbluten lassen?«
»Er blutet gerade schon auf einen Mercedes«, bemerkte Jesse trocken. Dann drehte sie sich zu mir um. »Moment mal. Die S-Klasse? Der AMG? Mercedes Athena Thompson-Hauptman, was denkst du dir dabei? Du kannst Ben nicht in Marsilias Wagen bluten lassen.«
»Marsilia, die Vampirkönigin?«, keuchte Gabriel. »Mercy, das ist einfach dämlich. Nimm meinen Wagen.«
»Sie ist keine Königin, sondern nur die Herrin der Siedhe«, korrigierte ich ihn. »In das Auto passen vier Leute, und es schreit nicht in die Welt hinaus: ›Automechanikerin mit verwundetem Werwolf auf der Flucht‹.« Meine sonstigen Überlegungen sprach ich nicht aus, weil ich niemanden in Panik versetzen wollte. Da die Vampire so eine Art Kombination aus CIA und Mafia waren, hatte der Mercedes außerdem kugelsichere Scheiben. Und was noch wichtiger war, sollten wir es wirklich mit dem Angriff einer Regierungsbehörde zu tun haben: Dieses Auto war frei von Peilsendern. Ich und Wulfe – der magiewirkende Vampir, der Marsilia diente – deaktivierten immer jedes Peilgerät, das routinemäßig an neuen Autos befestigt wurde, bis hin zu den RFID-Chips in den Reifen.
Und im Moment hatte ich größere Sorgen, als mir den Kopf darüber zu zerbrechen, ob ich Marsilia auf den Schlips trat … so unheimlich sie auch war.
Ich musste Ben zu Samuel bringen, damit Samuel dann behandeln konnte, was auch immer mit Ben nicht stimmte.
Ich musste Jesse und Gabriel an einen sicheren Ort bringen.
Ich musste denjenigen finden, der meinen Gefährten entführt hatte, und mir meinen Mann zurückholen.
Adams Schmerzen waren ein Brüllen in meinem Herzen, und ich würde jeden dafür zahlen lassen, der ihm wehtat.
Das Ganze erinnerte mich an die Ersteinschätzung an einem Unfallort. Schritt eins – die Unverletzten in Sicherheit bringen. Schritt zwei – den Rest finden. Schritt drei – dafür sorgen, dass diejenigen, die sie entführt hatten, es bereuten.
Mit diesem Gedanken im Kopf rannte ich ins Büro zurück. Auf Adams Drängen hin hatte ich angefangen, meine 9mm Sig Sauer im Safe aufzubewahren. Mit dem ortsansässigen Alpha verheiratet zu sein hatte mir einen gewissen Ruf verschafft, und Adam fühlte sich besser, wenn er wusste, dass ich bewaffnet war. Ich schob mir zwei weitere (volle) Magazine in die Handtasche und schnappte mir noch eine zusätzliche Schachtel voller Silbermunition. Hätte ich eine Atombombe besessen, hätte ich sie mir ebenfalls gegriffen – aber ich musste mit dem auskommen, was ich hatte.
Jesse hatte sich mit Ben auf den Rücksitz gesetzt. Kluges Mädchen. Ben kannte Gabriel unter normalen Umständen gut genug, doch Jesse roch nach Adam. Ben konnte nicht mit mir vorne sitzen, weil die Kombination aus Droge und Wunde ihn zu unberechenbar machte. Er war zu stark, als dass ich mit ihm hätte ringen können, während ich am Steuer saß. Außerdem hatte Jesse eine alte Decke gefunden und den Sitz damit abgedeckt.
Ich fuhr den Mercedes rückwärts aus der Garage und wartete darauf, dass Gabriel die Tür verschloss und einstieg.
»Deine Augen leuchten golden, Mercy«, sagte Gabriel, als er auf den Beifahrersitz glitt. »Ich wusste nicht, dass sie das tun.«
Genauso wenig wie ich.
Samuel wohnte ungefähr zwanzig Minuten von meiner Werkstatt entfernt, doch es fühlte sich an wie Stunden. Die Versuchung, das Gaspedal durchzudrücken, war fast überwältigend. Marsilias Auto fuhr an die 300 km/h – außerdem hatte ich auf ihr Verlangen hin den elektronischen Regler ausgeschaltet, der das Auto an menschliche Sicherheitsreflexe anpasste. Doch selbst zu dieser späten Stunde war eine Menge Polizei unterwegs, weil immer mehr Leute einkaufen gingen. Solange ich einen Mann mit einer Schusswunde auf dem Rücksitz herumfuhr, musste ich unbedingt verhindern, an den Straßenrand gewinkt zu werden.
Mit unter hundert Stundenkilometern brummten wir am Fluss entlang zu Samuels Haus in Richland.
Bevor ich Adam geheiratet hatte, war Samuel mein Mitbewohner gewesen. Er kam mich immer noch oft besuchen. Ein Wolf, besonders ein Einzelgänger, brauchte die Gesellschaft anderer Wölfe. Obwohl Adam Alpha war und Samuel sehr dominant, hatte sich zwischen den beiden eine vorsichtige Freundschaft entwickelt.
Samuel besaß in Richland eine Eigentumswohnung direkt am Fluss, wo die Grundstückspreise am höchsten waren. Ihm war vollkommen egal, wie seine Wohnung aussah – er hatte fast zwei Jahre lang ohne große Beschwerden mit mir in meinem alten vier mal zwanzig Meter langen Wohnwagen gewohnt – aber er liebte das Wasser. Für den Preis, den er für diese Wohnung gezahlt hatte, hätte er überall anders in der Stadt ein riesiges Haus bekommen.
Das Gebäude war weniger als zwei Jahre alt, bestand aus Stein und Stuck und war unglaublich gepflegt. Ich parkte den Mercedes vor Samuels Garage, ließ meine Mitstreiter im Auto und klopfte an die Tür.
Niemand öffnete. Ich drückte meine Stirn gegen das kalte Fiberglas der Tür und lauschte, doch ich konnte nichts hören.
»Bitte, bitte, Samuel. Ich brauche dich.« Wieder klopfte ich.
Als die Tür sich schließlich öffnete, erschien dahinter nicht Samuel, sondern Ariana, Samuels Gefährtin. Sie trug ein Sweatshirt und eine flauschige, mitternachtsblaue Pyjamahose mit weißen Kätzchen, die mit pinken Wollknäueln spielten.
Feenwesen besitzen Schutzzauber – das macht sie zu Feenwesen. Sie können jede Gestalt annehmen, die ihnen gefällt, und überwiegend zeigen sie sich unauffällig. Ariana war ich zuerst in der Verkleidung einer gut situierten Großmutter begegnet. Ich hatte sie auch schon in einer Form gesehen, die ich für ihre wahre Gestalt hielt – atemberaubend und schön.
Arianas momentane Gestalt war weder schön noch hässlich, eher angenehm mittelmäßig. Fahlgoldenes Haar, wie man es vor der Erfindung von Haarfarbe eher bei Kindern als bei Erwachsenen gesehen hatte, umrahmte ihr Gesicht und betonte ihre sanften grauen Augen. Ihr scheinbares Alter lag irgendwo zwischen fünfundzwanzig und dreißig und passte somit zu Samuels Aussehen. Es gab Andeutungen ihres Feen-Ichs in ihrem Gesicht, genauso wie das wahre Antlitz meines alten Mentors Zee dem menschlichen Gesicht geähnelt hatte, an das ich gewöhnt war.
Mich verwirrte nur, dass Ariana gar nicht hier sein sollte. Sie gehörte zum Feenvolk. Sie hätte mit allen anderen im Reservat sein müssen. Als ich herausgefunden hatte, dass das Feenvolk sich zurückgezogen hatte, hatte ich bei Ariana angerufen und stattdessen Samuel erreicht. Er hatte mir erklärt – auf eine Art, die mir im Rückblick verdächtig entspannt vorkam –, dass Ariana in Sicherheit war und zurückkehren würde, sobald sie konnte. Anscheinend war das um einiges früher geschehen als beim Rest des Feenvolkes.
»Ariana«, sagte ich. »Ich dachte …«
»Dass ich mich zusammen mit dem Rest meines Volkes in ein Reservat zurückgezogen habe?«, fragte sie. »Mein Gefährte ist hier. Ich schulde niemandem Gefolgschaft, und meine Treue gilt nicht länger den Grauen Lords, wenn es denn je so war. Sie haben mir erlaubt hierzubleiben – unter der Bedingung, dass ich nichts tue, was Aufmerksamkeit auf mich ziehen könnte.« Sie grinste mich spitzbübisch an. »Sie haben verlangt, dass wir all unsere Artefakte oder magischen Gegenstände mit in die Reservate bringen. Ich habe das Silbergeborene mitgebracht – und sie waren überraschend erpicht darauf, mich damit auch wieder gehen zu lassen.«
Das Silbergeborene war ein Artefakt, das Ariana geschaffen hatte, lange bevor Christopher Kolumbus auch nur ein Glänzen im Auge seines Vaters gewesen war. Es fraß die Magie jedes Feenwesens, das sich in seine Nähe begab. Das Artefakt war zu mächtig, um an einem Ort zu verbleiben, wo es Menschen in die Hände fallen könnte – und zu schädlich, um in eines der Reservate gebracht zu werden.
Dann wurde Arianas Gesicht ernst. »Doch ich schwätze hier, während du verletzt bist. Komm aus der Kälte.«
»Es ist nicht mein Blut«, erklärte ich ihr. »Ist Samuel da? Ich habe eine Warnung und einen Patienten für ihn. Abgesehen davon sollten wir wahrscheinlich besser von hier verschwinden.«
»Er ist nicht hier«, erklärte Ariana. »Sein Vater hat ihn vor ein paar Tagen zu sich gerufen. Er sagte, es hätte etwas mit einem Treffen wegen ›Störungen in der Truppe‹ zu tun.«
Ich warf ihr einen langen Blick zu, und wieder grinste sie. »Ich schwöre dir, dass er mir exakt das gesagt hat. Aber bring deinen Verwundeten. Ich habe einige Erfahrung als Bader, und Samuel besitzt einen sehr gut ausgestatteten Verbandskasten.«
Ich zögerte, und sofort veränderte sich ihr Gesichtsausdruck. Ariana war uralt – älter als Bran, vermutete ich –, doch sie hatte eine Weichheit an sich, eine Empfindlichkeit, die sie verletzlich machte.
»Ich zweifle nicht an dir«, erklärte ich. »Doch mein Verwundeter ist ein Wolf. Im Moment ist er in menschlicher Gestalt, doch sie zu halten kostet ihn all seine Kraft.«
Ariana empfand eine tiefsitzende und absolut begründete Panik vor allen hundeartigen Wesen, die sie nur bei Leuten überwand, die sie gut kannte – das bedeutete, bei Samuel. Der Rest von uns gab sein Bestes, in ihrer Nähe nicht allzu wolfs- oder kojotenartig zu sein.
Sie holte tief Luft. »Ich wusste, dass der Patient wahrscheinlich einer deiner Werwölfe ist. Wer sollte es sonst sein? Bring ihn rein.«
Ich holte meine Leute aus dem Auto, Menschen und Wölfe. Allerdings war ich mir nicht sicher, ob ich wirklich das Richtige tat. Ich hatte Ariana einmal in den Fängen der Panik gesehen, und das war so unheimlich gewesen, dass ich so etwas nie wieder erleben wollte. Aber ich hatte sie gewarnt, und sie ging davon aus, dass sie damit umgehen konnte. Na gut.