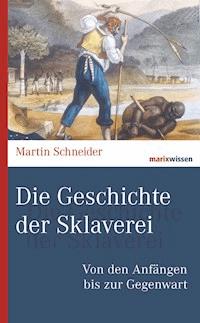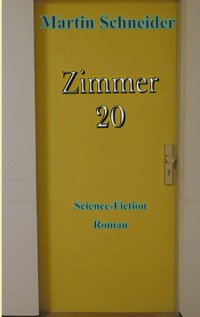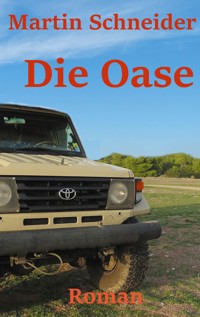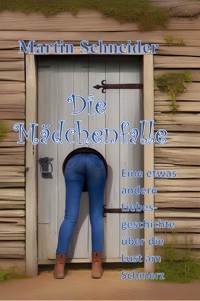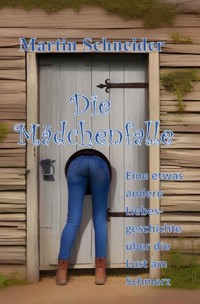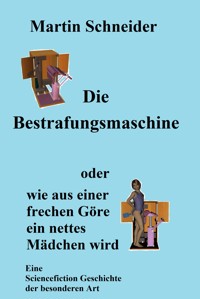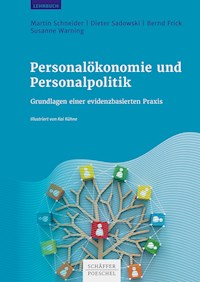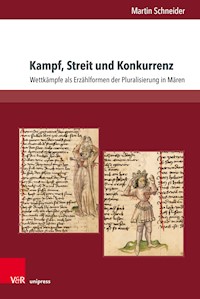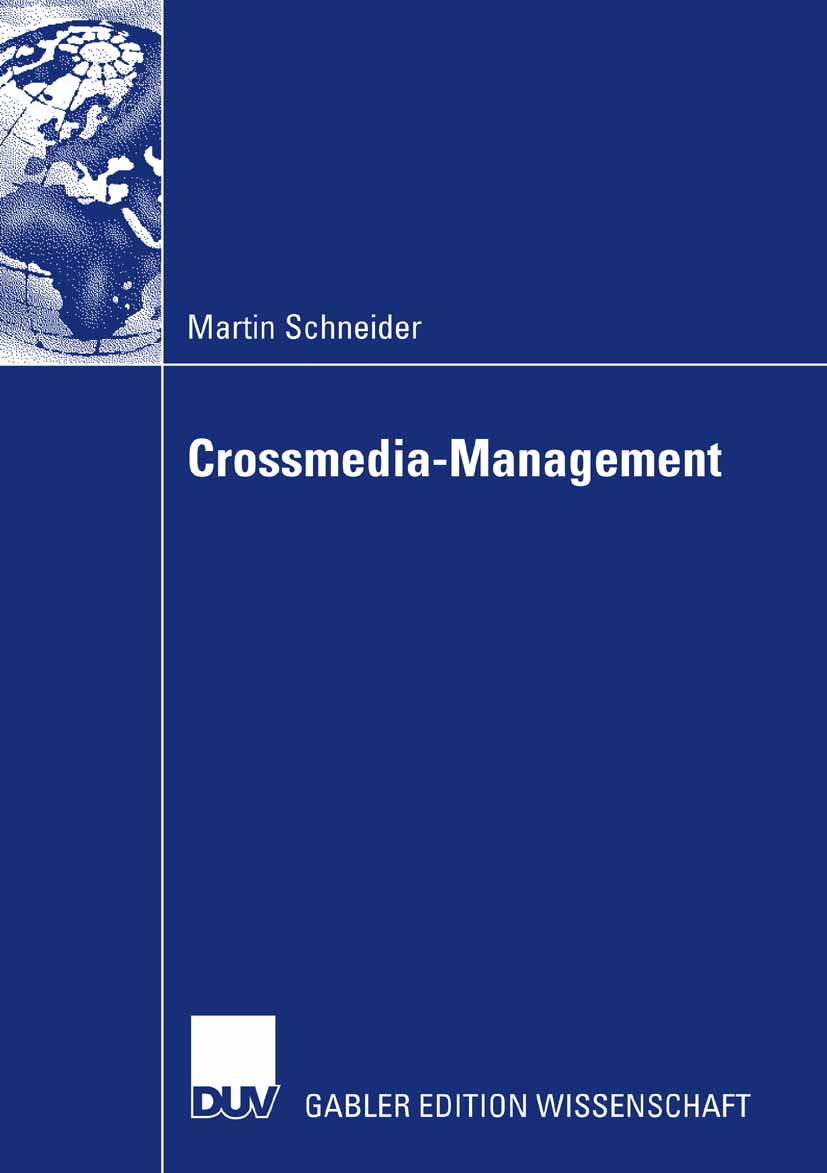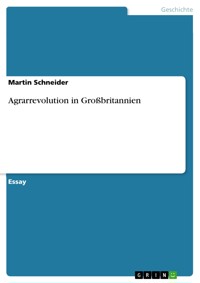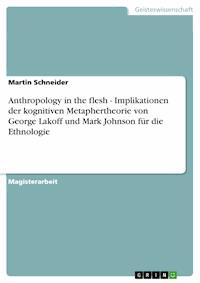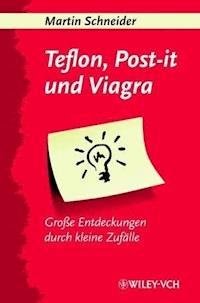
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Erlebnis Wissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Was haben Penicillin und Röntgenstrahlen mit Teflonpfanne und Viagra gemeinsam? Ebenso wie Polyethylen oder die praktischen gelben Post-it-notes wurden sie zufällig entdeckt; die Erfolge ergaben sich "nebenbei", bei der Grundlagenforschung oder auf der Suche nach etwas völlig anderem. So mancher Flop im Labor führte so zu Produkten, die aus unserem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Der allgegenwärtige Tesafilm etwa ist letztlich ein verunglücktes Wundpflaster, auf dem man heute sogar Daten wie auf CD-ROMs speichern kann. Und die Teflonpfanne verdanken wir nicht der Raumfahrt, sondern der Suche nach einem neuen Kältemittel für Kühlschränke Diese Geschichten rund um Zufälle in der Forschung, vom bekannten Wissenschaftsjournalisten Martin Schneider lebendig und nuancenreich erzählt, garantieren jede Menge Lesespaß. Die Reise durch drei Jahrhunderte Entdeckungsgeschichte zeigt, dass auch in der Wissenschaft nicht immer alles nach Plan läuft; selbst die besten Forscher brauchten oft ein Quäntchen Glück, um einen Treffer zu landen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Ähnliche
Contents
Author
Einleitung
1 Von der Atombombe zur Bratpfanne
2 Klare Sache
3 Göttliche Eingebung oder langweilige Predigt?
4 Vom Gummibaum zum Autoreifen
5 Schimmel in der Petrischale
6 Rasterfahndung nach Wirkstoffen
7 Bakterien im Magen
8 Über eine neue Art von Strahlen
9 Der trübe Himmel über Paris
10 Der gespaltene Kern
11 Auf der Suche nach Gold
12 Die Entzauberung der Lebenskraft
13 Brennende Schürzen und explodierende Billardkugeln
14 Heiße Geschäfte durch kaltes Ziehen
15 Der Kunststoff aus dem Einmachglas
16 Das Geheimnis des Schrankes
17 Die Farbe Lila
18 Die Suche nach der blauen Farbe
19 Von der Unterhaltungsshow in den Operationssaal
20 Vom Sprengstoff zur Potenzpille
21 Wie Schmetterlinge die Welt verändern
22 Fußbälle aus Kohlenstoff
23 Die älteste Rundfunksendung der Welt
24 Epilog: Entdeckungen nach Rezept?
Register
Weitere Sonderausgaben der „Erlebnis Wissenschaft“
John Emsley
Parfum, Portwein,PVC …
Chemie im Alltag
3-527-30789-3
2003
John Emsley
Sonne, Sex und Schokolade
Mehr Chemie im Alltag
3-527-30790-7
2003
Jan Koolman, Hans Möller, Klaus-Heinrich Röhm
Kaffee, Käse, Karies ….
Biochemie im Alltag
3-527-30792-3
2003
Friedrich R. Kreißl, Otto Krätz
Feuer und Flamme, Schall und Rauch
Schauexperimente und Chemiehistorisches
3-527-30791-5
2003
Peter Häußler
Donnerwetter – Physik!
3-527-31644-2
2006
Heinrich Zankl
Fälscher, Schwindler, Scharlatane
Betrug in Forschung und Wissenschaft
3-527-31646-9
2006
Autor
Martin Schneider
SWR Wissenschaft
Hans-Bredow-Str.
76530 Baden-Baden
Auflage 2002
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorhegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratsdilägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 9783527298730
Epdf ISBN 978-3-527-60222-3
Epub ISBN 978-3-527-66303-3
Mobi ISBN 978-3-527-66302-6
Einleitung
Inspiration, Transpiration und der vorbereitete Geist
Der amerikanische Chemiker Roy Plunkett hätte sich verärgert mit der Zwangspause abfinden können, die eine vermeintlich leere Gasflasche seinen Experimenten bescherte. Ebenso wäre es verständlich gewesen, hätte Alexander Fleming seine verschimmelten Bakterienkulturen einfach in den Müll geworfen, als er aus dem Urlaub zurück ins Labor kam. Dass sich beide näher mit dem vermeintlichen Missgeschick beschäftigten, bescherte der Menschheit so nützliche Dinge wie Teflon und Penicillin.
Plunkett und Fleming sind keine Einzelfälle. Seit grauer Vorzeit begleiten Anekdoten von Zufällen die Geschichte der Entdeckungen. Schon die Ägypter sollen das Bier zufällig dadurch erfunden haben, dass einige Brotreste in einen Wasserkrug fielen und dort vergoren, Archimedes bescherte bekanntlich eine überlaufende Wanne sein Heureka-Erlebnis und Newton brachte ein fallender Apfel auf sein Gravitationsgesetz. Die Spur des Zufalls zieht sich bis in unsere Zeit: Die Mikrowelle in der Küche, so wird berichtet, verdanken wir einem Techniker, dem vor einem Radargerät ein Schokoriegel schmolz und den Velcro-Klettverschluss einem Schweizer Erfinder, dem nach einer Wanderung hartnäckige Kletten an der Kleidung hafteten. Als erster Eindruck drängt sich auf: In der vermeintlich so rationalen Welt von Wissenschaft und Forschung scheint nicht immer alles nach Plan zu laufen.
Aber wie groß ist die Rolle des Zufalls in der Forschung tatsächlich – und wie groß ist der Anteil des Entdeckers, dem er zustößt? Will man es nicht bei dem oberflächlichen Eindruck belassen, Glück spiele in der Wissenschaft eine mindestens ebenso große Rolle wie Verstand, muss man näher hinschauen und die vielen Geschichten über Zufälle zunächst einmal grob „vorsortieren“. Wie nämlich schon die obigen Beispiele erahnen lassen, sind sie von recht unterschiedlicher Qualität. Da gibt es zum einen die „wissenschaftlichen Mythen“ à la Archimedes oder Newton: kaum überprüfbare, ausgeschmückte Berichte des Augenblicks, in dem jemand einen Einfall hat, angeregt durch irgendetwas in seiner Umgebung. Wo solche Einfälle herkommen, mag ein interessantes Feld der Psychologie sein; als außergewöhnlich allerdings kann man das „Haben von Einfällen“ schwerlich bezeichnen. In jedem kreativen Gewerbe, und bis zum Beweis des Gegenteils ist auch die Wissenschaft ein solches, sind ungewöhnliche Einfälle an der Tagesordnung. Die Liste ausgeschmückter Berichte solcher Einfälle ließe sich daher auch beliebig verlängern: James Watt beobachtet einen pfeifenden Wasserkessel und erfindet daraufhin die Dampfmaschine, August Kekulé bringt der Traum von einer sich in den Schwanz beißenden Schlange auf die ringförmige Struktur des Benzols, und John Dunlop bekommt die Grundidee zur Erfindung des Luftreifens durch einen Gartenschlauch. Ein Beweis dafür, dass in der Forschung das „Gesetz des Zufalls“ herrsche, sind derartige wissenschaftliche Mythen nicht.
Neben derartigen Legenden aber gibt es eine Fülle von Berichten über Zufälle in der Forschung, die sich nicht auf vom Baum fallende Äpfel oder überlaufende Badewannen reduzieren lassen. Auffallend viele große, oftmals nobelpreisgekrönte Entdeckungen waren nicht Ergebnis eines streng geplanten Forschungsprogramms; kleine Laborunfälle oder das unvorhersehbare Zusammentreffen zweier Ereignisse hatten die entscheidenden Weichen gestellt, unscheinbare „Dreckeffekte“ im Experiment, von aufmerksamen Forschern bemerkt, den richtigen Weg gewiesen.
Auch wenn Letztere dabei höchst selten nackt durch die Straßen ihrer Universitätsstadt liefen und „Heureka“ riefen, scheinen derartige Vorfälle ein wichtiges Element des wissenschaftlichen Fortschritts darzustellen; in verschiedenen Variationen nämlich treten sie quer durch die Wissenschaftsgeschichte immer wieder auf, wie schon ein grober Überblick zeigt.
Da findet man zunächst die Forscher, die nach einer bestimmten Sache lange vergeblich suchten, bis sich der Zufall einmischte und ihren Bemühungen den letzten „Kick“ gab. Charles Goodyear etwa war regelrecht besessen davon, Gummi anwendungstauglich zu machen; nach jahrelangem Experimentieren brauchte es aber doch eine glückliche Fügung, die ihn die Vulkanisation entdecken ließ. Louis Daguerre verfolgte über ein Jahrzehnt lang die Idee, Abbildüngen der Welt erstellen zu können, ehe ihm letztlich ein zerbrochenes Thermometer bei der Erfindung der Fotografie half. Und auch Alexander Fleming suchte nach einer bakterientötenden Substanz, auf die ihn dann erst eine zufällig ins Labor gewehte Pilzspore brachte.
Andere Forscher machten zufällig epochale Entdeckungen, obwohl sie nach ganz etwas anderem suchten. DuPont-Mitarbeiter Roy Plunkett etwa sollte eigentlich ein neues Kältemittel für Kühlschränke entwickeln und entdeckte Teflon, William Perkin suchte nach der Möglichkeit, Chinin künstlich herzustellen und erfand den ersten künstlichen Farbstoff, Mauvein, und Johann Friedrich Böttgers Versuche, Gold zu machen, führten auf verschlungenen Wegen zum Porzellan.
Und dann sind da noch die Grundlagenforscher, die eigentlich nach gar keiner konkreten Anwendung suchen, aber dennoch zufällig eine wichtige Entdeckung machen. Wilhelm Conrad Röntgen zum Beispiel wollte gar nichts „entdecken“ – als theoretischen Physiker interessierte ihn ein eigentümliches Leuchten, das bei einer bestimmten Art von Strahlung auftrat; und Karl Ziegler, der mit einem neuen Herstellungsverfahren für Polyethylen das Kunststoffzeitalter einläutete, hat stets „ganz frei gearbeitet, um die Erkenntnisse der Chemie zu mehren“, wie er betonte. Er wollte einfach bestimmte Vorgänge bei der Katalyse besser verstehen.
Wichtiger als die Unterschiede dieser verschiedenen Zufalls-Spielarten in der Forschung aber sind ihre Gemeinsamkeiten, und die ziehen sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Kapitel dieses Buches. So wird etwa schnell deutlich werden, dass es sich nie um wirklich „blinde Zufälle“ handelt. Der Wissenschaftsbetrieb ist alles andere als eine große Lotterie, in der mal der eine, mal der andere das große Los zieht. Keinem der vom Zufall beglückten Forscher ist seine Entdeckung einfach in den Schoß gefallen, in den er seine Hände in Erwartung einer glücklichen Fügung schon lange zuvor gelegt hatte. „Der Zufall begünstigt nur einen vorbereiteten Geist“, bringt es der französische Chemiker Louis Pasteur auf den Punkt, und die Geschichten in diesem Buch werden zeigen, was das im Einzelnen bedeutet. Ähnlich wie das biblisch-sprichwörtliche Samenkorn auf fruchtbaren Boden fallen muss, um zu keimen, braucht der Zufall Rahmenbedingungen, um zu einer Entdeckung zu werden. Sicher nicht zufällig waren die Wissenschaftler, denen das Glück hold war, in aller Regel Experten auf ihrem Gebiet, besessene Arbeiter, mit täglichen Arbeitszeiten, bei denen eigentlich die Berufsgenossenschaft hätte einschreiten müssen. Sie haben mühsam, durch oft jahrelange Arbeit, den Boden bereitet, auf dem der Zufall erst zur Entdeckung gedeihen konnte. Das Wort vom „Glück des Tüchtigen“ scheint selten so angebracht wie hier. Nur wer sein Gebiet in- und auswendig kennt, kann zum Beispiel eine Unregelmäßigkeit im Versuchsablauf überhaupt als solche erkennen, die den Keim für eine völlig neue Sicht der Dinge in sich bergen kann.
Die Aufmerksamkeit vermeintlich unwichtigen Nebensächlichkeiten gegenüber ist ein weiterer verbindender Charakterzug der Forscher, die eine „Begegnung der zufälligen Art“ hatten. „Entdeckung bedeutet zu sehen, was jeder gesehen hat, aber zu denken, was noch keiner gedacht hat“, definierte Medizin-Nobelpreisträger Albert Szent-Gyorgyi, womit er ein allgemeineres Wort des Physikers Georg Christoph Lichtenberg präzisierte: „Die Neigung der Menschen, kleine Dinge für wichtig zu halten, hat sehr viel Großes hervorgebracht.“
Zu einem wachen Geist und einer unbändigen Neugier, ohne die im Forschungsbetrieb ohnehin niemand weit kommt, muss aber noch etwas kommen, um aus einem glücklichen Zufall eine Entdeckung werden zu lassen. Um im biblisch-agrarischen Bild zu bleiben: Der gut vorbereitete Boden und der Samen, der zu keimen beginnt, sind nur der Anfang. Die zarten Keimlinge brauchen jede Menge Hege und Pflege, damit aus ihnen eine widerstandsfähige, fruchttragende Pflanze werden kann. „Entdeckung ist ein Prozent Inspiration und 99 Prozent Transpiration“, besagt ein geflügeltes Wort. Glück und Zufall sind in der Regel nur an dem einen Prozent „Inspiration“ beteiligt. Jede Menge mühsame, oft wenig kreative Arbeit ist nötig, um die Idee „umzusetzen“, zur Anwendungs“reife“ zu bringen. Auch wenn dies den Beruf des Wissenschaftlers für manchen angehenden Gelehrten, der sich ein leichtes Leben erhofft, unattraktiver macht: Blinde Hühner mögen hin und wieder ein Korn finden; der große Wurf in der Forschung wird ohne Weitblick und viel Arbeit kaum gelingen.
Und die „dümmsten Bauern“ sind es auch nicht, die in der Wissenschaft die dicksten Kartoffeln ernten. Im angloamerikanischen Sprachraum gibt es einen seltsam schillernden Begriff für die Art von Zufällen, die den Forschern in diesem Buch zustoßen: Serendipity bezeichnet die „Eigenschaft, wünschenswerte Entdeckungen durch Zufall zu machen“, wie das Unabridged Dictionary erklärt. Was sich wie ein Widerspruch in sich anhört, lässt sich im Deutschen vielleicht am ehesten mit „Finderglück“, übersetzen, ein Moment von „Spürsinn“ und dem erwähnten „Glück des Tüchtigen“ schwingt dabei mit. Den Ausdruck übrigens prägte der britische Schriftsteller Horace Walpole bereits 1754. Ihn hatte die Sage „The Three Princes of Serendip“ beeindruckt. Serendip ist ein alter Name für Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, und besagte drei Prinzen machen in dieser Sage durch eine Mischung von Glück und Weisheit eine Fülle nützlicher Entdeckungen, nach denen sie gar nicht gesucht hatten. Interessanterweise ging der Begriff Serendipity erst in den 1970er-Jahren in den Alltagssprachgebrauch vor allem in den USA ein, wo er heute eine Art Modebegriff ist. Weingüter, Hotels und Modeboutiquen führen diesen Namen, und sogar ein im Jahre 2001 erfolgreicher Kinofilm hatte im Original diesen Titel (auf Deutsch „Weil es Dich gibt“ – die Übersetzer kapitulierten vor dem schillernden Originaltitel).
Während der Zufall also auf jeden Fall sein „Gegenstück“ in einem „vorbereiteten Geist“ finden muss, zeigen die vielen Geschichten auf den folgenden Seiten vor allem eins: Der wissenschaftliche Fortschritt ist nur in Grenzen wirklich planbar. Die landläufige Vorstellung, Forschung laufe ab wie der Entwurf eines neuen PKW, ist einfach falsch. Die Autoingenieure bekommen (oder setzen sich) bestimmte Vorgaben, und dieses „Lastenheft“ wird dann abgearbeitet. Geplant wird vom Ende her. Man weiß, was man haben will, und arbeitet darauf hin. In der Wissenschaft aber läuft es anders. „Die meisten Fragen, mit denen sich die gegenwärtige Wissenschaft herumschlägt, hätten bei dem Stand der Dinge vor einer Generation nicht einmal aufgeworfen werden können“, formuliert der Philosoph Nicholas Rescher, und der Heidelberger Physiker Wolfgang Krätschmer pflichtet ihm bei: „Wenn man Forschung dirigiert, kommt halt entweder das heraus, was man sich vorstellt, oder gar nichts, aber es kommt halt nie das Unerwartete heraus, und das Unerwartete ist das, was die Forschung wirklich weiterbringt.“
Krätschmer, der bei astrophysikalischen Experimenten zufällig die Fullerene, eine völlig neue Zustandsform des Kohlenstoffs, entdeckte, lässt hier das Leid der Grundlagenforscher anklingen – der Forscher, denen es bei ihrer Arbeit nur um die Erweiterung unseres Wissens als solches geht und die keine konkrete Anwendung im Sinn haben. In Zeiten knapper werdender Mittel sehen sie sich einem wachsenden Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. Wer heute einen Antrag auf Forschungsförderung stellt, muss am besten den Business-Plan für die Vermarktung des erwarteten Ergebnisses gleich mit einreichen, will er seine Chancen auf Bewilligung erhöhen. Dabei wird vergessen, dass jedes Forschungsvorhaben nur auf dem Stand des jeweiligen Wissens begonnen werden kann, aber ja gerade dazu beitragen soll, die Grenzen dieses Wissens zu erweitern. Platt gesagt: Wüsste man schon, was dabei heraus kommt, brauchte man ja nicht mehr zu forschen. Eine Konsequenz daraus mahnte schon der Physiker und Physiologe Hermann von Helmholtz vor fast 150 Jahren an: „Wer in den Naturwissenschaften nach unmittelbarem Nutzen jagt, kann ziemlich sicher sein, dass er vergebens jagen wird.“ Nur eine solide, ergebnisoffene Grundlagenforschung, die sich mit Dingen beschäftigt, die wir einfach noch nicht verstehen, bereitet den Boden für eventuelle künftige Innovationen, von denen wir heute nicht die leiseste Ahnung haben. „Dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen“, gab Max Planck zu bedenken und trat damit Forderungen nach stärkerer Anwendungsnähe der Forschung entgegen, die auch schon Anfang des letzten Jahrhunderts aufkeimten. Ohne Frage sind angewandte
Forschung und Entwicklung, die nach dem Schema des Entwurfs eines neuen Autos ablaufen, wichtig; völlig neue Phänomene aber können sie nicht erschließen.
Interessanterweise sind es keineswegs nur Grundlagenforscher, die eingedenk der im wahrsten Sinne unvorstellbaren Wissensschätze der Zukunft um mehr Freiheitsgrade in der Forschung werben. „Wenn ich meinem Auftraggeber Forschungserfolge garantieren können will, werden diese Erfolge ziemlich langweilig ausfallen. Wenn man in der Forschung unerwartete Resultate bekommen möchte, muss man Risiken eingehen.“ Dieser Satz stammt von Nathan Myhrvold, dem ehemaligen Forschungschef des weltgrößten Softwarekonzerns Microsoft, dem man kaum unterstellen kann, Forschung als l’art pour art zu betreiben. Auch große Firmen wissen, dass sie „breit aufgestellt“ sein müssen, um auch auf künftigen Märkten bestehen zu können. Die folgenden Kapitel werden einige Produkte präsentieren, die zu „Megasellern“ wurden, obwohl sie niemand geplant oder vorhergesehen hatte – vom schon kurz angesprochenen Teflon bis zu den Post-it Notizzetteln. „Was wir morgen wissen werden, wird zu 80 Prozent eine Erweiterung des heutigen Wissens sein, aber 20 Prozent werden völlige Überraschungen sein“, glaubt Art Fry, Erfinder der besagten gelben Haftnotizzettel. Er weiß, wovon er spricht: Niemand in seiner Firma hätte sich vor 25 Jahren seine Erfindung, bei der der Zufall gleich auf mehreren Ebenen half, überhaupt vorstellen können; heute ist sie aus Büro und Haushalt kaum mehr wegzudenken. Nebenbei bemerkt hat früher auch niemand die Post-its so recht vermisst – und das beleuchtet einen interessanten weiteren Aspekt des wissenschaftlichen Fortschritts: Nicht immer steuert ein konkreter Bedarf seine Entwicklung. Niemand brauchte wirklich Fernsehen, Personalcomputer, Biotechnologie – oder Post-it Notes. Einmal erfunden, fanden sie aber schnell ihre Märkte. „Not macht erfinderisch“ mag ja stimmen, aber der Umkehrschluss, dass es immer eine Art „Not“, einen Bedarf, geben muss, damit etwas erfunden wird, ist sicher nicht richtig.
Die folgenden Geschichten (deren Lektüre übrigens an keine bestimmte Reihenfolge gebunden ist) sind keine vollständige Enzyklopädie sämtlicher Entdeckungen, bei denen in irgendeiner Weise der Zufall mitgespielt hat. Ich habe nur Geschichten aufgenommen, bei denen die Datenlage mehr ermöglichte als die bloße Wiedergabe einer Legende. Dabei habe ich stets nicht nur den Moment skizziert, in dem der Zufall „seines Amtes“ waltete, sondern jede Entdeckung in einen größeren Zusammenhang gestellt. Nur eine kleine Reise in die Geistesgeschichte der jeweiligen Zeit nämlich verdeutlicht ihre Besonderheit – sowohl die der Entdeckung als auch die des Forschers, dem sie zustieß. Nicht selten nämlich mussten Letztere nicht nur einen „vorbereiteten Geist“ haben, sondern sich auch noch aus etablierten Denkstrukturen befreien, sie hinterfragen, um sich für das Neue zu öffnen. Oder wie schon Aristoteles wusste: Wer recht erkennen will, muss zuvor in richtiger Weise gezweifelt haben.
Dank an …
Den Anstoß, mich mit den Zufällen in der Forschung zu beschäftigen, verdanke ich meinem früheren Redaktionsleiter beim Süddeutschen Rundfunk, Walter Sucher. Seine Anregung mündete in einer Fernsehdokumentation über „Zufall in der Forschung“. Bei den Dreharbeiten dazu lernte ich Prof. Royston Roberts aus Austin/Texas kennen, der mich auf viele Beispiele von Zufällen in der Forschung aufmerksam machte. Mein Kollege Dr. Siegfried Klaschka hat mit kritischem Blick die Geschichten in diesem Buch gegengelesen und mir manchen wertvollen Hinweis gegeben (gleichwohl liegen natürlich alle etwaigen Fehler oder Ungenauigkeiten allein in meiner Verantwortung). Dr. Gudrun Walter vom Wiley-VCH Verlag hat trotz vieler Verzögerungen stets an diesem Projekt festgehalten. Und ich danke meiner Lebensgefährtin Heidi Schnell, die über eine lange Zeit mein freizeittötendes „Hobby“, zufälligen Entdeckungen in der Wissenschaft nachzuspüren, erdulden musste.
1
Von der Atombombe zur Bratpfanne
Teflon wird bei der Suche nach einem neuen Kältemittel entdeckt
Wann immer nach sachlichen Argumenten für das teure Abenteuer der bemannten Weltraumforschung gefragt wird, ist von den möglichen „Spin-off-Effekten“ die Rede. Techniken, die für die Raumfahrt erfunden wurden, so heißt es, hätten seit jeher als „Zweitverwertung“ zu Entwicklungen geführt, die unseren Alltag angenehmer machen. So gab zweifellos der Zwang zur Miniaturisierung in der Elektronik in den 1960er-Jahren die entscheidenden Anstöße für die Entwicklung des Personal Computers, und auch der Kugelschreiber, der über Kopf schreibt, ist sicher eine Segnung der Raumfahrt. Bei einem Lieblingsargument liegen die Raumfahrt-Enthusiasten allerdings leider gänzlich daneben: Die Wundersubstanz Teflon wurde bei Raumfahrtmissionen zwar großzügig eingesetzt, keineswegs aber eigens dafür entwickelt. Die erste Teflonpfanne konnte man schon 1954 in Frankreich kaufen, vier Jahre bevor Sputnik 1 die ersten Piepssignale aus der Erdumlaufbahn sandte; und das Material an sich – chemisch Polytetrafluorethylen (PTFE) – wurde bereits in den 1930er-Jahren entdeckt – durch einen Zufall.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!