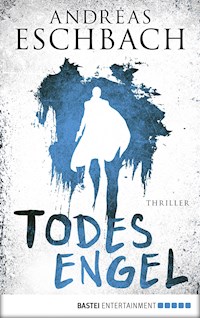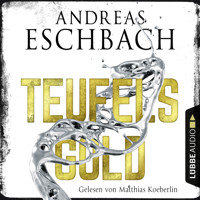
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Auf der Jagd nach dem Stein der Weisen - Wer sind die Alchemisten unserer heutigen Zeit?
Nach dem Ende der Kreuzzüge taucht er das erste mal auf: der Stein der Weisen, mit dem man Gold machen kann - gefährliches Gold, radioaktives Gold nämlich. Der Stein erscheint, als ein Alchemist Gott verflucht, und er zieht eine Spur der Verwüstung durch Europa. Die Deutschordensritter erklären es zu ihrer geheimen neuen Aufgabe, ihn zu finden und sicher zu verwahren. Für alle Ewigkeit.
Doch in unserer Zeit kommen zwei Brüder, die unterschiedlicher kaum sein könnten, dem wahren Geheimnis des Steins auf die Spur: Er ist ein Schlüssel - ein Schlüssel, der unser aller Leben zum Guten hin verändern könnte.
Oder öffnet er die Pforten der Hölle?
"Teufelsgold" - der spannende Thriller von Bestsellerautor Andreas Eschbach!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:9 Std. 12 min
Sprecher:
Ähnliche
Inhalt
Über den Autor
Andreas Eschbach, geboren am 15.09.1959 in Ulm, ist verheiratet, hat einen Sohn und schreibt seit seinem 12. Lebensjahr.
Er studierte in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst als Softwareentwickler. Von 1993 bis 1996 war er geschäftsführender Gesellschafter einer EDV-Beratungsfirma.
Als Stipendiat der Arno-Schmidt-Stiftung »für schriftstellerisch hoch begabten Nachwuchs« schrieb er seinen ersten Roman »Die Haarteppichknüpfer«, der 1995 erschien und für den er 1996 den »Literaturpreis des Science-Fiction-Clubs Deutschland« erhielt. Bekannt wurde er vor allem durch den Thriller »Das Jesus-Video« (1998), der im Jahr 1999 drei literarische Preise gewann und zum Taschenbuchbestseller wurde. ProSieben verfilmte den Roman, der erstmals im Dezember 2002 ausgestrahlt wurde und Rekordeinschaltquoten bescherte. Mit »Eine Billion Dollar«, »Der Nobelpreis« und zuletzt »Ausgebrannt« stieg er endgültig in die Riege der deutschen Top-Thriller-Autoren auf.
Nach über 25 Jahren in Stuttgart lebt Andreas Eschbach mit seiner Familie jetzt seit 2003 als freier Schriftsteller in der Bretagne.
ANDREAS
ESCHBACH
TEUFELSGOLD
THRILLER
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Copyright © 2016 by Andreas Eschbach
Hardcover-Ausgabe 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Stefan Bauer
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | puchdesign, München
Einband-/Umschlagmotiv: Johannes Wiebel | puchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von © shutterstock / R. P. Visual
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-2951-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Dieses eBook enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes »NSA – Nationales Sicherheits-Amt« von Andreas Eschbach.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Redaktion: Stefan Bauer
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München unter Verwendung von Motiven © Ozen Guney/shutterstock.com
Am Anfang steht die Gier nach Gold …
es folgt die Gier nach Unsterblichkeit …
dann die Gier nach
Prophezeijung des hochberühmten
D. Philippi Theophrasti Paracelsi,
Anno 1546
Prolog
»Ich sehe, dass Ihnen eine wichtige Reise bevorsteht«, sagte die Frau im Zigeunerkleid. Sie saß schief da, über Hendriks Hand gebeugt. »Sie werden sie bereichernd finden, denn Sie lieben ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung. Wenn Einschränkungen Sie hemmen, fühlen Sie sich unzufrieden. Sie besitzen erhebliches Potenzial, aber Sie nutzen es bis jetzt noch nicht zu Ihrem Vorteil. Manchmal fragen Sie sich, ob Sie die richtigen Entscheidungen im Leben getroffen haben.«
Das alles rasselte die Wahrsagerin genauso gelangweilt herunter wie ein Losbudenverkäufer seine immer gleichen Sprüche. Auch nur ein Job. Ein Job in einem muffigen, abgewetzten Zelt, in dem jedes Detail Kitsch und Klischee war: die Kristallkugel (die vermutlich einfach aus Glas bestand) auf dem mit dunklem Stoff verhängten Tisch, die enormen goldenen Ohrringe, das grelle Make-up, die wasserstoffblonde Mähne.
Nun, was hatte er erwartet? Auf einem Jahrmarkt? Enttäuschung war doch bei all diesen sogenannten Attraktionen fest eingebaut. Zehn Euro beim Teufel, für nichts. Reingefallen auf das Versprechen, etwas Außerordentliches zu erleben.
»Sie fühlten sich von Ihren Eltern oft missverstanden«, fuhr sie fort. Hendrik erwog, aufzustehen und zu gehen. Es sich so einfach zu machen! Gab es auf dieser Welt einen einzigen Menschen, der sich von seinen Eltern je nicht missverstanden gefühlt hatte?
Na gut. Er hatte es angefangen, er würde es durchstehen. Sonderlich lange konnte es ohnehin nicht mehr dauern, wie er diese Kirmesbetrüger kannte.
Sie hielt einen Moment inne, als sei ihr entfallen, was sie sagen wollte. Hendrik verzog die Mundwinkel. Nicht nur eine betrügerische Vorstellung, auch noch eine lausige! Nicht zu fassen. Wie sie in seine Handfläche starrte, als könne sie tatsächlich darin lesen! Wie sie seine Hand umkrampfte, hineinstarrte wie in einen tiefen Brunnen, während sie wahrscheinlich in Wahrheit nur ihr dumpfes Gedächtnis durchstöberte auf der Suche nach dem entfallenen Stichwort!
»Sie haben einen Bruder«, sagte sie schließlich.
Der Klang ihrer Stimme hatte auf einmal etwas, das Hendrik unwillkürlich den Atem anhalten ließ.
»Sie haben einen Bruder«, wiederholte sie, »aber Sie haben kaum noch Kontakt zu ihm.«
Hendrik nickte verwirrt. Wie konnte sie das jetzt wissen? Wieso fing sie ausgerechnet von seinem Bruder an, von dessen Existenz praktisch niemand wusste?
Die Hellseherin starrte immer noch auf seine Hand hinab, hielt sie mit ihren schwitzigen Fingern fest. Die blonden Haare hingen ihr übers Gesicht, und ihr Oberkörper schwankte sachte vor und zurück, wie Schilfgras im Wind. Falls sie vortäuschte, in einer Trance zu sein, dann spielte sie jetzt gut.
»Es gibt ein Geheimnis, das Sie und Ihren Bruder trennt«, sagte sie. Ihre Stimme war dunkel geworden, schien plötzlich die eines anderen Menschen zu sein, aus einem tiefen Schacht zu ihm zu dringen. »Ein zweites Geheimnis wird Sie beide wieder zusammenbringen. Es wird Sie unauflöslich aneinanderketten, bis die Frage beantwortet ist.«
Hendrik räusperte sich. »Welche Frage?«
Sie schien ihn nicht zu hören. »Einer von Ihnen«, hauchte sie, »wird die Frage mit dem Leben beantworten. Der andere mit dem Tod.«
Sie ließ seine Hand los. Atmete schwer. Dann strich sie sich die Haare zurück und sah ihn mit verschleierten Augen an, das Gesicht von Erschöpfung gezeichnet. Sie versuchte ein Lächeln, aber es wurde eine Grimasse. »Das war alles.«
Als er aus dem Halbdunkel des Zeltes trat, zurück in den Trubel des Volksfests, musste er blinzeln. Was das eben gewesen war, darauf konnte er sich noch immer keinen Reim machen.
»Na?«, fragte Miriam. »Hat es sich gelohnt?«
Er überlegte einen Moment, lachte dann. Die Gespenster, die die blonde Hexe vor ihm heraufbeschworen hatte, lösten sich auf. »Ach was«, meinte er. »Natürlich war es Talmi und Humbug, wie alles hier. Aber«, fügte er hinzu, »es war wenigstens mal was anderes!«
Miriam musterte ihn befremdet, so, wie sie ihn oft musterte. »Oh Hendrik«, seufzte sie. »Du suchst halt immer, nicht wahr? Du bist nie zufrieden.«
»Nein«, gab er freimütig zu. »Das Drama meines Lebens.« Er schaute auf ihre Tochter hinab, die mit geduldigem Ernst auf den Fortgang des Ausflugs wartete. »Na, was ist? Was willst du als Nächstes machen?«
»Karussell fahren?«, meinte Pia, aber ihr Blick wanderte dabei an den glitzernden Streben des Riesenrades empor.
Hendrik ging vor ihr in die Hocke. »Nein, weißt du was? Wir fahren Riesenrad! Ganz hoch hinauf! Ich halt dich auch fest. Ganz fest.«
Wie sie strahlte! So sah pures Glück aus. Die Ekstase eines Kindes, für das die Welt noch ein großes, wunderbares Versprechen war. »Au ja!«
»Was hast du denn dem grade erzählt?«, wollte Rolo wissen, als Seraphina ins Freie trat.
Die Frau schien ihn nicht zu bemerken. Ihr Blick ging in die Ferne. Sie starrte auf das Gewimmel und die bunten Wagen und nahm doch nichts davon wahr; schien durch all das hindurchzusehen zu unsichtbaren, ungreifbaren Horizonten.
»He«, quengelte Rolo weiter, »du sollst die Leute zufriedenstellen – nicht sie zu Tode erschrecken. Der Mann war weiß im Gesicht wie ein Leintuch!«
Seraphina würdigte ihn immer noch keines Blickes. Sie fingerte eine Zigarettenschachtel aus einer der Schubladen in Rolos Kassentisch, schob sich eine Zigarette zwischen die Lippen und griff dann nach seinem Feuerzeug. »Ich mache meinen Job«, sagte sie. »Und du machst einfach deinen Job.« Sie zündete sich die Zigarette an, inhalierte tief, wie eine Ertrinkende, die nach Luft schnappt, und stieß den Rauch mit einem seufzenden Laut wieder aus. »Okay?«
1.
Die Rüstung, die weinte
Es begab sich im Jahre des Herrn 1295, dass Knappen des Ritters Bruno von Hirschberg in dessen Wäldern, genauer an der Furt, die über den Fluss führte, auf einen einsamen Reisenden trafen. Ein armseliger Wagen stand schief inmitten des schimmernden Stromes, als sie des Weges kamen, und auf dem Kutschbock saß ein grauhaariger Mann, der fluchend mit seiner Peitsche auf das davor gespannte Pferd einschlug. Dessen Fell glänzte schon vom Schweiß, doch sosehr es sich, kläglich wiehernd, ins Geschirr legte, der Karren stak im Kies des Flussbettes fest und rührte sich nicht von der Stelle.
»He-ho!«, rief einer der Schildknappen, ein Mann namens Egbert, und preschte mit seinem Pferd in die Furt. »Können wir Euch helfen, Fremder? Mir scheint, Ihr habt es schlecht getroffen.« Die anderen Reiter folgten ihm, fünf an der Zahl, junge und kräftige Burschen.
Der Mann auf dem Kutschbock senkte die Peitsche und wandte sich den Reitern zu. Graues, ungepflegtes Haar und ein filziger Bart rahmten ein Gesicht, in das Zeit und Wetter tiefe Furchen gegraben hatten. Gekleidet war er in ein grobes Gewand aus Sackleinen, das alt und zerschlissen aussah, ebenso wie der Wagen, den er fuhr. Allein seine Augen waren nicht die eines gewöhnlichen alten Mannes – ein merkwürdiges Feuer loderte in ihnen, eine argwöhnische Wachsamkeit, wie sie Verfolgte zeigen, die seit Jahren auf der Flucht sind.
Holla!, dachte Egbert bei sich. Er hatte seinen Herrn auf dem letzten Kreuzzug begleitet, und sein Instinkt, der sich auf dieser gefahrvollen Reise bewährt hatte, warnte ihn, dass es mit diesem Mann eine besondere Bewandtnis haben musste.
»Eines der Räder ist eingesunken«, sagte der Fremde mit einer Stimme, die brüchig klang und doch, als sei sie in Wahrheit aus Eisen. »Wenn Ihr mir helft, es freizubekommen, kann ich meine Fahrt wohl ohne Schwierigkeiten fortsetzen.«
Egbert nickte den anderen zu, und sie sprangen von ihren Pferden in den Fluss. Das Wasser reichte ihnen bis zu den Hüften und umströmte sie kalt und nass, als sie sich gemeinsam gegen den knarrenden Holzkasten stemmten. Der alte Mann ließ wieder die Peitsche sprechen, sie drückten und stöhnten und spornten sich gegenseitig an und bekamen das Rad schließlich frei.
»He-ho!«, rief Egbert noch einmal und watete rasch zu seinem Pferd, griff nach dessen Zügeln und schwang sich zurück auf den Sattel, um eilig dem Gespann zu folgen, das rumpelnd quer durch die Strömung fuhr und sich daranmachte, das Ufer zu erklimmen.
Es war Egbert nicht entgangen, wie unerhört schwer der Wagen gewesen war. Kein Wunder, dass seine Räder eingesunken waren in dieser Furt, die sonst die größten Handelstrosse ohne Weiteres passierten.
»Fremder!«, rief er dem Wagen nach, als der wieder trockenes Land unter den Rädern hatte, und winkte seinen Begleitern, rasch aufzuschließen. »Wer seid Ihr, und wohin wollt Ihr?«
»John Smith ist mein Name«, gab der Reisende zurück, ohne anzuhalten, »und ich bin Angelsachse, auf dem Weg nach Hause!«
Egbert holte ihn ein und ritt neben ihm her, auf der Höhe des Kutschbocks. »Seid Ihr ein Bader?«
»Nein.«
»Ihr fahrt einen Wagen, wie Bader ihn fahren.«
»Ich habe ihn von einem Bader gekauft, aber ich bin kein Bader. Ich bin nur ein Reisender.«
»Und woher kommt Ihr, John Smith?«
Der alte Mann, der sich John Smith nannte, warf ihm einen unwilligen Blick zu. »Aus dem Süden.«
»Wollt Ihr uns nicht erzählen, woher?«, beharrte Egbert und sah sich nach seinen Kameraden um.
»Was geht Euch das an?«, fragte der Fremde zurück.
Da hieb Egbert seinem Pferd in die Seiten, sprengte voran und versperrte dem Gespann den Weg. Zornig straffte der alte Mann die Zügel, aber sein Pferd blieb ohnehin mit bebenden Flanken stehen. »Was soll das?«, rief er mit funkelnden Augen.
»Ihr seid uns noch einen Dank schuldig«, erklärte Egbert, während sich die anderen zu ihm gesellten und sich auf sein Kopfnicken hin um den Wagen des Fremden verteilten. »Wir haben Euch geholfen, aber Ihr seid einfach weitergefahren ohne ein Wort des Dankes.«
»Also schön«, knurrte der Reisende. »Ich danke Euch.«
Egbert schüttelte den Kopf, und er tat es ganz langsam. Wer ihn kannte, wusste, dass dies eine Drohung war. »Ihr werdet uns begleiten, John Smith. Unser Herr wird es interessant finden, Eure Bekanntschaft zu machen.«
Ritter Bruno von Hirschberg war ein Mann, der rund und gemütlich wirkte, solange er still dasaß. Bewegte er sich jedoch, merkte man ihm ein feuriges Ungestüm an, eine brennende Ungeduld, die ihn vorantrieb. Er kannte wenig Nachsicht mit seinen Untergebenen, hetzte die Diener unentwegt, war den ganzen Tag rastlos unterwegs, Befehle bellend, als würde er von tausend Geistern gehetzt und als stünden die Sarazenen vor den Toren der Burg. Auch des Nachts, so erzählte man sich, war er rastlos, und so trug seine Gemahlin, die ihm in den Jahren des Kreuzzugs treu gewesen war, endlich ein Kind unter dem Herzen, von dem die Wahrsagerinnen weissagten, dass es ein Sohn werden würde.
Normalerweise nahm Ritter Bruno von niemandem einen Rat entgegen, am allerwenigsten einen Rat, was er tun oder lassen sollte. Einzig auf seinen Schildknappen Egbert hörte er, ab und zu wenigstens. So kam es, dass der Ritter, sein Schildknappe und sein Medicus, ein Bär von einem Mann namens Mengedder, hinter einem der Fenster des Burgturms standen und hinabsahen auf den Burghof, in dessen Mitte das kuriose Gespann des Fremden wartete.
»Habe ich nichts Besseres zu tun, als mich um jeden Reisenden zu scheren, der meine Ländereien durchquert?«, schnaubte Bruno aufgebracht. »Unterdessen schaffen meine Bauern ihre halbe Ernte beiseite und betrügen mich um den Zehnten.«
»Mit diesem da hat es etwas auf sich, Herr«, meinte Egbert ruhig, der solchen Ton gewöhnt war.
Der Medicus spähte lustlos hinunter auf den Fremden, der schief auf seinem Kutschbock saß und seinem Pferd zusah, wie es an einem Büschel Heu fraß. »Was soll es mit dem wohl auf sich haben?«, brummte er. »Ein alter Angelsachse mit unfreundlichen Manieren. Na und?«
»Als wir seinen Wagen aus der Furt befreiten, fiel mir auf, dass er so schwer war, als sei er vollgeladen mit purem Eisen. Seht Ihr, wie zerschunden das arme Pferd ist? Es ist kaum zu glauben, dass es allein eine solche Last zu ziehen vermag.«
»Was ist so seltsam an einer schweren Last?«
Egbert sah den Ritter an, als er antwortete. »Ich habe einen Blick hinein getan in den Wagen«, sagte er ernst. »Und das Seltsame ist: Er ist so gut wie leer. Ich sah ein paar Kleider, ein paar Vorräte, eine Tasche und eine kleine Kiste – das war alles!«
Bruno machte zischende Geräusche mit den Zähnen. »Und du sagtest, es sei etwas in seinem Blick?«
»Ja«, erwiderte der Schildknappe und nickte. »Er schaut drein wie einer, der Verfolger hinter sich weiß.«
»Ihr denkt, er hat ein Verbrechen begangen?«, fragte der Medicus.
»Ich bin mir nicht sicher«, gestand Egbert. »Es könnte auch sein, dass er einen Schatz erbeutet hat, den er nach Hause bringen will.«
Der Ritter schnaubte triumphierend. »Vielleicht ist es der Wagen selber, der so schwer ist«, überlegte er laut. »Mag sein, dass er nur so aussieht, als sei er aus Holz.«
Sie lockten den misstrauischen Fremden von seinem Gespann fort, indem sie vorgaben, ihm ein Gemach zuweisen zu wollen, in dem er sich ausruhen könne, bis der Burgherr ihn zu sprechen wünschte. Doch kaum war der Mann mit seinem Begleiter in der Tiefe der Burg verschwunden, machten sie sich über den Wagen her, stießen mit ihren Messern in die Holzlatten und hoben die Dielen des Wagenbodens an, um zu sehen, ob etwas darunter sei. Wie sich rasch herausstellte, war der Wagen tatsächlich aus Holz, aus altem, brüchigem Holz noch dazu – es würde heikel werden, dem Angelsachsen die Beschädigungen an seinem Karren zu erklären. Was so unerhört schwer war, war die kleine Kiste.
Egbert hatte sie herausziehen wollen, allein, er vermochte die Kiste, die kaum so lang war wie ein Unterarm und kaum so hoch wie ein Stiefelschaft, nicht von der Stelle zu bewegen. Zuerst glaubte er, sie sei festgenagelt, aber unter Aufbietung aller Kräfte zog er sie doch eine Handspanne fort, und da wusste er, dass er den Schatz gefunden hatte.
Er holte einen seiner Kameraden zu Hilfe, einen jungen, starken Burschen namens Arved, und gemeinsam mit zwei weiteren Männern brachten sie glücklich die schwere Kiste aus dem Wagen und auf den Boden des Burghofs.
»Bei Gott«, rief Arved aus, »dieses Ding muss inwendig mit purem Gold gefüllt sein.« Und er versuchte, den Deckel zu öffnen, doch der war verschlossen. Wer den Schlüssel zu der Kiste bei sich trug, war nicht schwer zu erraten.
Egbert kniete sich nieder und studierte die Kiste. Bei Tageslicht sah man, dass sie saubere Schreinerarbeit war, aus hellem, festem Holz gemacht und an allen Ecken mit stählernen Beschlägen versehen. Dass der Deckel durch ein eingebautes Schloss gesichert war, versprach wertvollen Inhalt.
»Wir werden den Angelsachsen zwingen, sie zu öffnen«, beschloss der Schildknappe und erhob sich. »Und das falsche Spiel mit ihm können wir beenden.« Er gab einem der Burschen einen Wink. »Geh und hol den Fremden her. Und sag, dass ich es angeordnet habe.« Der Bursche rannte los.
»Was brauchen wir den Angelsachsen?«, meinte Arved geringschätzig. »Sollten wir so ein Schloss nicht leicht selber aufbekommen?« Und er zückte sein Messer.
Egbert beschlich ein Gefühl drohender Gefahr, als Arved anfing, mit seinem Messer an der Kiste herumzufuhrwerken. Er sah sich um, sog witternd die Luft des späten Nachmittags durch die Nase und roch doch nur Küchendünste, Schweiß, Staub und Fäkalien. Er blickte hoch zu den Zinnen der Burg, sah die Wachen stehen, wie immer. Und trotzdem …
»Ein verteufeltes Schloss«, schimpfte Arved. »Wer das gebaut hat, versteht etwas vom Schlosserhandwerk …«
Die Kiste. Es hatte mit der Kiste zu tun. Doch was konnte schon gefährlich sein an einer Kiste?
»Lass sie in Ruhe«, sagte Egbert, obwohl er wusste, dass Arved nicht auf ihn hören würde. Dabei musste jeden Augenblick der alte Mann zurückkommen, und sie würden ihn heißen, ihnen den Inhalt der Kiste zu zeigen.
»Ich hab den Riegel getroffen, glaube ich«, verkündete Arved, der verbissen mit der Spitze seines Messers in der dünnen Ritze zwischen Deckel und Kasten hantierte. »Oha! Und auf ist sie!«
»Nicht!«, schrie da eine Stimme vom Haupthaus her. »Nicht die Kiste!«
Egbert fuhr herum. Der alte Angelsachse. Mit wehenden Haaren kam er angestürzt, offensichtlich außer sich vor Entsetzen. Die Gefahr! Also doch …
»Arved!«, rief der Schildknappe. »Lass sie zu!« Und er stürzte nach vorn, um den Kameraden zu hindern.
Aber er kam zu spät. Keiner von ihnen würde jemals im Leben vergessen, was sich ihren Augen darbot: Arved lüftete den Deckel der Kiste, nur einen Daumen breit – doch schon aus diesem winzigen Spalt schoss ein Strahl grellen weißen Lichts hervor, heller als die Sonne am Himmel, gleißender als alles Gold im Palast der Königin von Saba … Arved, der ahnungslos mitten hineingeblickt hatte in dieses Licht, das so hell war wie das Antlitz Gottes, schrie auf, ließ los und fiel schreiend hintenüber, schreiend wie ein Tier, die Hände vor die Augen gepresst. Der Deckel klappte zu, und das Erlöschen des Lichts ließ den hellen Tag ringsum auf einmal dunkel aussehen.
»Narren!«, donnerte der Angelsachse. »Narren! Was habt ihr an meinem Wagen zu schaffen, ihr nichtsnutzige Bande von Wegelagerern …?«
Egbert erwachte aus seiner Starre. Egal, was dies alles zu bedeuten hatte, es musste gehandelt werden. »Soldaten, zu mir!«, befahl er und reckte sich, damit jeder sah, wer dies rief. Den ersten beiden Waffenmännern gebot er, auf den Angelsachsen zeigend: »Nehmt diesen Mann fest und bringt ihn ins Verlies!« Und während der Fremde protestierend abgeführt wurde, ließ er die anderen Soldaten einen weiten Kreis rund um den Wagen, das müde Pferd und ihren grausigen Fund bilden: »Dass mir niemand in die Nähe der Kiste kommt!«
Arved schrie nicht mehr, er wimmerte nur noch, und sein Atem ging röchelnd. Die Hände hatte er immer noch vor den Augen, und ein immer stärker werdendes Zittern beherrschte seinen Körper. Egbert drängte die Kameraden beiseite, die sich um den Jungen bemühten, kniete bei ihm nieder und beugte sich über ihn. Arved schien fast wahnsinnig vor Schmerz. Behutsam griff Egbert nach Arveds Händen, versuchte vergebens, sie ihm vom Gesicht wegzuziehen. Die Gesichtshaut war rot, wie von der Sonne verbrannt, und begann sich zu schälen und aufzuplatzen. Man musste ihm nasse Tücher auflegen, Heilerde aufbringen … Er durfte sich nicht das Gesicht durch den Druck seiner Hände zerstören, schon um der Frauen willen nicht, deren Herzen für ihn schlugen.
»Holt Mengedder«, sagte Egbert, zu niemand Bestimmten, und es genügte ihm, daraufhin eilige Schritte zu hören.
Er packte noch einmal die Hände Arveds. Diesmal ließ Arved zu, dass er sie beiseitezog, und als Egbert sein Gesicht sah, wusste er, warum der Junge sich gewehrt hatte. Er wusste auch, dass hier kein Medicus mehr helfen konnte. Er hatte viel gesehen während der Schlachten gegen die Heiden, doch dies hier ließ selbst ihn würgen.
Die Augen. Arved hatte keine Augen mehr. Was einmal seine Augen gewesen waren, rann ihm als schleimige Gallerte aus den Höhlen.
Sie verhörten den Fremden im Großen Saal. Sie hatten die Tische zu einem Geviert zusammengestellt, in dessen Mitte der geheimnisvolle Reisende stand. Im Schein der Kerzen und des Feuers im Kamin sah sein Gesicht dämonisch aus und sein Bart wie der eines Zauberers.
»Ich bedaure, was geschehen ist«, erklärte er zum wiederholten Male, »aber niemand hat ihn geheißen, Hand an meinen Besitz zu legen.«
Der Ritter saß in seinem hohen Lehnstuhl, wie es seiner Würde gebührte, doch er hatte eine Hand um den Knauf der Lehne geschlossen, und diese Hand bebte, so fest presste er das Holz. »Wer seid Ihr?«, fragte er, auch zum wiederholten Male. »Und was ist das in dem Kasten?«
Der fremde Reisende blickte ihn müde an. »Es ist ein Fund, den ich getan habe. In dem Kasten liegt ein leuchtender Stein, so groß wie eine Männerfaust und so schwer wie ein ganzer Mann; ein Stein, der eines Nachts vom Himmel fiel unweit der Stelle, wo ich mein Lager aufgeschlagen hatte. Als ich mich ihm näherte, sah ich, dass Vögel, die in seine Nähe kamen, tot zu Boden fielen. Ich sah Mäuse daneben verenden und das Gras verdorren. Ich fand schließlich, dass man sich dem Stein einzig unter dem Schutz von reinem Blei nähern kann, und deswegen ist der Kasten inwendig aus Blei gemacht und so schwer. Es war eine Narretei, ihn leichtfertig zu öffnen«, schloss er grimmig.
»Und was wollt Ihr mit diesem gefährlichen Stein?«, begehrte Bruno von Hirschberg zu wissen.
»Hätte ich ihn liegen lassen sollen?«
Alles sah auf, als sich in diesem Moment das schwere Hauptportal knarrend öffnete und Mengedder eintrat, der Medicus, einen dicken Folianten unter dem Arm und Trübsinn im Blick. »Gott in seiner Gnade hat Arved zu sich geholt«, erklärte er grollend und hustete. »Es gab nichts mehr, was man hätte tun können.«
Unter den Anwesenden entstand Unruhe. Man bekreuzigte sich und murmelte Gebete. Das Licht der Kerzen schien dunkler zu werden.
»Sagt mir, Angelsachse«, fragte Mengedder, während er an einen der Tische trat und das Buch vor sich hinlegte, »aus welchem Grund führt Ihr ein so teuflisches Mineral mit Euch auf Euren Reisen?«
Der Fremde sah ihn misstrauisch an. »Das ist schwer zu erklären«, meinte er dann. »Vielleicht könnte man sagen, aus Neugier?«
»Ah, aus Neugier!«, wiederholte der Medicus und schlug wie nebenbei den Einband des Folianten auf, den er mitgebracht hatte. »Da Ihr Neugier offenbar für eine schätzenswerte menschliche Eigenschaft haltet, werdet Ihr mir sicher verzeihen, dass ich noch einmal bei Eurem Wagen war und mir erlaubt habe, in Euren Aufzeichnungen zu lesen …«
Der bärtige Reisende kniff die Augen zusammen, dass sie funkelten, und zischte einige schier unverständliche Laute.
»Aber, aber, das war ein Fluch! Ein lateinischer zwar, und ein interessanter dazu, aber ein Fluch«, mahnte Mengedder. »Und seid gewiss, dass ich des Griechischen ebenso mächtig bin.« Er blätterte mit grimmiger Gelassenheit die ersten, eng beschriebenen Seiten um. »Es war zweifellos klug von Euch, Euren richtigen Namen zu verschweigen, denn sonst hätte ich schon viel früher Verdacht geschöpft.«
»Heraus mit der Sprache, Mengedder!«, drängte Bruno von Hirschberg. »Was habt Ihr herausgefunden?«
»Ich lese hier von Transmutationen und Ammoniak, von den fünf Elementen und den antagonistischen Kräften, von Amalgamen und Sulfuren und von getöteten und wiederbelebten Metallen. Ich finde ganze Seiten, die abgeschrieben sind aus Werken Al’Razis und des Zosimos von Panopolis. Dieser Mann, Herr, ist tatsächlich Angelsachse. Jedoch ist sein Name nicht John Smith, sondern John Scoro, und er ist ein Alchemist, dessen Name bekannt ist in Kreisen der Gelehrten. Das, was er in seinem Kasten mit sich führt und was dem armen Arved zum Verhängnis wurde, ist nichts anderes als der Stein der Weisen.«
2.
Allerhand, dachte Hendrik und klappte das Buch zu, um es einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Es handelte sich um ein ausgesprochen schmales Bändchen, in festen, leinenbezogenen Karton gebunden, mit einer Art Wappen mit einem schlichten Kreuz auf der Vorderseite und der Ziffer 1 auf dem Rücken, in Gold geprägt, das allerdings schon reichlich abgegriffen wirkte. Auf der Rückseite Reste eines Aufklebers: Collec … Ott … ließ sich noch entziffern. Auf dem Deckblatt stand unter dem Titel Band 1, weiter unten Gedruckt 1880, sonst nichts – kein Verlag, kein Autor, keine anderen Informationen. In der rechten unteren Ecke fand sich ein uralt aussehender handschriftlicher Vermerk, zwei Zahlen: 21/20.
Das war nicht der Preis, oder?
Hendrik schob sich an zwei staubigen Kartons vorbei und machte sich auf die Suche nach dem Antiquar.
Der stand an dem Schreibtisch im vorderen Teil des Ladens und telefonierte gerade, in einem Schwiizerdütsch, von dem Hendrik kein Wort verstand. Er war ein gutes Stück jünger als Hendrik, Mitte zwanzig vielleicht, trug ein klein kariertes, blassrosa Hemd mit einem abgewetzten Kragen, der ihm zu eng war, und hatte Pickel.
Endlich beendete er das Gespräch, knallte den schwarzen Hörer auf das ebenfalls äußerst antiquarisch wirkende Telefon und fragte barsch: »Ja?«
»Das hier«, sagte Hendrik und reichte ihm das Büchlein. »Was soll das kosten?«
»Das steht immer auf dem –« Er hielt inne, das Buch in Händen, bekam auf einmal große Augen. »Woher haben Sie das?«
»Das lag da hinten auf –«
»Das ist nicht zu verkaufen«, schnappte der Antiquar. »Das ist bereits für einen Kunden reserviert.« Er drückte das Buch an sich, als befürchte er, Hendrik könne es ihm entreißen, und machte eine ausholende Geste mit der freien Hand. »Bei den anderen Büchern steht der Preis auf dem Deckblatt. Rechts oben, mit Bleistift.«
Damit ließ er Hendrik stehen und marschierte, das Buch an der Brust gesichert, zurück in den hinteren Ladenraum. Dort stand noch ein Schreibtisch, ein wurmstichiger Sekretär, über und über mit betagten Druckwerken vollgestapelt wie jede freie Fläche in diesem Antiquariat. Hendrik folgte ihm, sah verdattert zu, wie der Mann aus einer überquellenden Schublade einen wattierten Briefumschlag zerrte, in den er das Buch hineinstopfte.
In dem Moment klingelte erneut das Telefon. Der Antiquar gab einen Laut von sich, der wie »Chogä!« klang, klatschte den Umschlag auf einen der Stapel und hastete wieder nach vorne.
Hendrik wandte sich den Regalen zu. Schade, er hätte zu gerne gewusst, wie die Geschichte weiterging. Er spähte aus dem Fenster des im Souterrain gelegenen Antiquariats, sah dann auf seine Armbanduhr. Der Regenschauer, der ihn hereingetrieben hatte, schien vorüber zu sein, doch sein Zimmer im Hotel war bestimmt immer noch nicht bezugsbereit.
Die Müdigkeit, die ihm in den Knochen saß, hatte einen Punkt erreicht, an dem sie ihn spürbar aggressiv machte. Das würde hoffentlich bis zum Beginn des Seminars vergehen, aber jetzt gerade hätte er seinen Chef auf den Mond schießen können. Um halb vier Uhr morgens war er aufgestanden, um den ersten Flug nach Zürich zu erwischen, und einzig aus dem Grund, weil das der billigste war!
Hendrik zog aufs Geratewohl weitere Bücher aus den Regalen, las die Titel, um sich abzulenken. Böhmische Sagen und Märchen. Baltische Schicksale im Spiegel der Geschichte einer kurländischen Familie 1756 bis 1919. Friedrich Förster, Ausführliches Handbuch der Geschichte, Geographie und Statistik des Preußischen Reichs – zweihundert Franken sollte das alte Buch kosten, allerhand! Oder hier: Ernst Willkomm, Wanderungen an der Nord- und Ostsee, aus dem Jahre 1850, aber erstaunlich gut erhalten.
Hendrik schob den Band zurück ins Regal, atmete tief durch. Es roch nach Staub und vergilbtem Papier und von draußen nach feuchtem Asphalt. Er hörte die eiligen Schritte von Passanten, Motorengeräusch, das Gurgeln von Wasser in Gullis.
Und den Antiquar, der immer noch telefonierte.
Hendrik sah den Briefumschlag an, der auf dem Sekretär lag. Unverschlossen.
Auf einmal fand er den Gedanken, dass er nie im Leben erfahren sollte, wie die Geschichte um den Angelsachsen und dessen geheimnisvollen Stein weiterging, unerträglich. Geradezu empörend. Infam. Eine Ungerechtigkeit des Schicksals, die zum Himmel schrie.
Das Telefonat wurde auf Französisch geführt, Hendrik verstand kein Wort. Aber es klang irgendwie, als würde es noch eine Weile dauern.
Hendrik ging das Regal ab, zog ein Buch heraus, das dem im Umschlag in Größe und Farbe ähnelte: Braune, Gotische Grammatik stand auf dem Rücken. Auch in Gold geprägt. Gedruckt in Halle, 1887. Harter, dunkelbrauner Leineneinband.
Nicht identisch, aber ähnlich genug.
Es waren nur drei rasche Schritte bis zum Schreibtisch. Nur eine kühne Bewegung, das eine Buch herauszuziehen und in die Regenjacke zu stecken, das andere an seiner Stelle in den Umschlag zu schieben. Dann die Jacke zugezogen, damit das gestohlene Buch an seinem Platz blieb, und los.
Aber langsam. So, als wenn nichts wäre.
»Auf Wiedersehen«, sagte Hendrik zu dem Antiquar im rosa Hemd.
Der sah auf, ohne den Gruß zu erwidern, musterte ihn argwöhnisch, dem Hörer in seiner Hand lauschend. Hendrik spürte sein Herz bis in den Hals herauf schlagen, während er die bimmelnde Tür aufzog und die drei ausgetretenen Steinstufen hinauf auf die Straße nahm. Er war überzeugt, dass der Mann ihn gleich verfolgen würde.
Er entfernte sich von der Ladentür, zügigen Schrittes, aber nicht zu zügig. Alles in ihm schrie danach loszurennen, so schnell er konnte, doch das wäre zweifellos ausgesprochen dumm gewesen.
Nur sein Herz raste wie verrückt. Das Buch, das er unter der Jacke eingeklemmt trug, schien zu brennen. Auf seltsame Weise war er überzeugt, dass man es ihm ansah, ein Dieb zu sein, und zugleich, dass diese Überzeugung Unsinn war, eine Stressreaktion.
Er wich einer Pfütze aus. Es war kalt, kälter als heute Morgen, oder kam es ihm nur so vor, weil er schwitzte? Der graue Himmel riss auf, Sonnenlicht fiel herab wie der Strahl eines Suchscheinwerfers.
Jemand hinter ihm schrie. Hendrik fuhr herum, aber es war nicht der Antiquar, sondern ein Mann in einem grünen Lodenmantel, der jemandem auf der anderen Straßenseite etwas zugerufen und gewunken hatte.
Noch mehr Schweiß, der ihm kalt und klebrig den Rücken hinablief. Und Erleichterung.
Verrückt, das alles. Verrückt, so etwas zu tun, für ein blödes altes Buch!
Endlich eine Straßenecke, um die er biegen, Gleise, die er überqueren konnte, und schließlich ein großes blau-weißes Ungetüm von Straßenbahn, das ihn forttrug, das ihn rettete.
Er stempelte, ließ sich in einen freien Sitz fallen, schaute aus dem Fenster auf die davonziehenden Fassaden der Züricher Altstadt und hätte am liebsten laut gelacht, gejubelt, triumphiert. Alle Müdigkeit war weg wie nie gewesen, er war hellwach, fast, als hätte er Aufputschmittel genommen. Was für eine Aufregung! Ein regelrechtes Abenteuer.
Vielleicht musste er das öfter machen: Dinge, die sich nicht gehörten. So eine kleine Grenzübertretung gab dem Leben doch gleich eine ganz andere Würze.
Er ließ das Buch, wo es war, befühlte es nur durch den Stoff seiner Jackentasche hindurch, vergewisserte sich, dass es nicht herausfallen konnte. Nach ein paar Stationen fiel ihm ein, dass er gar nicht wusste, wohin er eigentlich fuhr, also stand er auf und studierte den Verkehrslinienplan an der Decke des Wagens.
Nach einmal Umsteigen und weiteren zwanzig Minuten Fahrt kam er wieder zum Grandevue au Lac, dem Viersternehotel, in dem das Anlegerseminar stattfinden würde. Anders, als er es erwartet hatte, hieß es nicht, sein Zimmer sei noch nicht bereit, sondern im Gegenteil: »Ihr Gepäck ist schon auf Ihrem Zimmer, aber wenn wir das mit dem Seminarraum vielleicht jetzt sofort erledigen könnten?«, bat die Frau von der Rezeption. »Nachher wird es ein bisschen eng mit dem Personal.«
Hendrik hielt das Buch im Innern seiner Jacke umklammert. »Ja, gut«, gab er nach. »Aber ich muss trotzdem vorher noch auf mein Zimmer, wenigstens ganz kurz.«
Die Frau lächelte angespannt. »Dann schlage ich vor, unser Herr Zurbrügg holt Sie gleich am Zimmer ab, ja?« Sie reichte ihm den Schlüssel, der an einem schweren vergoldeten Anhänger befestigt war. »Zimmer 101, im ersten Stock.«
»Gut, ja«, stammelte Hendrik und kam sich überrumpelt vor. Er war noch nie in einem so luxuriösen Hotel gewesen, wurde die Furcht nicht los, unter den anderen Hotelgästen als Trampel aufzufallen. Die zwei Nächte hier kosteten fast so viel wie Miriam und er monatlich an Miete zahlten; unfassbar, dass sich manche Leute das wirklich leisten konnten.
Keiner der Aufzüge wollte kommen, also nahm er die Treppe. Zimmer 101, das war gleich das erste Zimmer. Es stimmte, das Gepäck war da. Hendrik legte das gestohlene Buch auf den Schreibtisch, zog die Jacke aus, kramte die Seminarunterlagen aus dem Koffer und aus diesen die Checkliste, die er jetzt brauchen würde. Dann klopfte es schon.
Er öffnete. Ein junger Mann in einer Livree in den Hausfarben stand vor der Tür. »Ich soll Ihnen den Seminarraum –«
»Ja, alles klar«, sagte Hendrik hastig. »Ich komme.«
Der diensteifrige junge Mann, bei dem es sich wohl um den angekündigten Herrn Zurbrügg handelte, ging vorweg, in einem Tempo, dem Hendrik nur mit Mühe folgen konnte.
»Was die Ausstattung anbelangt, habe ich mich an das Fax gehalten, das mir Ihre Kollegin geschickt hat«, erklärte er auf ihrem Weg durch die mit dicken Teppichen ausgelegten Flure. »Frau von Steinheim, nicht wahr?«
»Steinfeld«, sagte Hendrik.
»Frau von Steinfeld«, wiederholte der Junge und räusperte sich. »Nüt für unguät.« Es schien ihm schrecklich unangenehm zu sein, sich falsch erinnert zu haben.
Endlich der Seminarraum. Wow. Der sah eher aus wie ein Klubraum für Millionäre: alle Wände in edlem Holz getäfelt, goldene Wandlampen, schwere gelbe Vorhänge, dazwischen ein Bilderbuchblick auf den Zürichsee … Hier zu stehen war, als schnuppere man mal eben ins wahre Leben hinein, schoss es Hendrik durch den Kopf.
Was vermutlich auch so gedacht war. Das ideale Ambiente für ein Seminar, dessen Teilnehmer von Reichtum träumten.
»Da es nur sechzehn Personen sind«, erläuterte der eifrige Hotelangestellte, »erlaubt das, die Tische u-förmig aufzustellen. Ist Ihnen das recht? Ich kann es auch anders machen, kein Problem.«
»Nein, nein, das ist wunderbar so.« Hendrik fühlte sich immer noch leicht überwältigt. Die Stühle waren mit Leder bezogen und sahen genauso teuer aus wie die Tische. An jedem Platz lagen eine lederne Schreibunterlage, ein Notizblock und ein Kugelschreiber. Kleine Flaschen Perrier und Evian standen bereit, Kaffeetassen, Gläser, Schälchen mit einzeln verpackten Schokoladentäfelchen …
Die Checkliste fiel ihm ein. Er zog sie heraus. »Am besten, wir gehen einfach das hier durch, würde ich sagen. Ob alles da ist, was ich brauchen werde.«
Das Anlegerseminar fand vier- bis sechsmal pro Jahr statt, je nach Nachfrage, und neben Zürich hatten sie noch Verträge mit Luxushotels in Antwerpen und Potsdam. Laut Ausschreibung diente das Seminar dem Ziel, den privaten Anleger sicherer und erfolgreicher in seinen Entscheidungen zu machen, und auf den ersten Blick war es auch eine durchaus seriöse Sache: Im Lauf der anderthalb Tage würden sie die Vor- und Nachteile sowie das Prozedere sämtlicher Anlageformen durchgehen – Sparkonten, Festgeldanlagen, Termingelder, Obligationen, Rentenpapiere, Staatsanleihen, Aktien, Warentermingeschäfte, Fonds und so weiter –, und die vermittelten Informationen waren alle korrekt. Trotzdem war das Seminar so konzipiert, dass die Teilnehmer zu dem Schluss kommen mussten, mit Investmentfonds am besten zu fahren, und zwar am allerbesten mit jenen, die Hendriks Firma, WCM Trust Frankfurt, selber auflegte und managte.
Das Seminar diente also in erster Linie der Kundengewinnung und Kundenbindung und war deswegen rein kostendeckend kalkuliert. Hendriks Firma wollte nicht an den Seminaren verdienen, sondern an den dadurch angeregten Investments der Teilnehmer.
Ob diese Rechnung auch diesmal aufgehen würde, stand in den Sternen. Denn es war das erste Mal, dass Hendrik dieses Seminar leitete. Es war sogar das erste Mal, dass er überhaupt ein Seminar leitete, und er war sich ziemlich sicher, dass es gewaltig in die Hose gehen würde.
Normalerweise war es Freifrau Sylvia von Steinfeld, die diese Seminare hielt oder, besser gesagt, zelebrierte. Ihr Adel war zwar nur angeheiratet, nichtsdestotrotz wirkte sie beeindruckend aristokratisch, und von ihr als »Kollegin« zu sprechen kam Hendrik geradezu blasphemisch vor. Genau genommen war sie auch gar keine Kollegin, sondern eine externe PR-Beraterin, die ausschließlich für diese Seminare engagiert wurde – und vor allem dafür, so zu tun, als gehöre sie den obersten Rängen des WCM Trust an, dem inneren Zirkel, Gefilden also, in denen mit sicherer Hand Millionen verdient wurden.
Doch nun war sie, mit knapp vierzig, noch einmal schwanger geworden und würde für anderthalb Jahre aussetzen. Warum man ausgerechnet ihn als Ersatz auserkoren hatte, war Hendrik ein Rätsel; vermutlich war aber bloß niemand anders verfügbar gewesen. Die bevorstehende Einführung des Euro als Buchgeld zum Jahreswechsel 98/99 und die Entwicklungen am Neuen Markt hielten alle in Atem.
Hendrik inspizierte die Checkliste, versuchte die handschriftlichen Anmerkungen darauf zu entziffern. Dieses Seminar und auf jeden Fall das in Potsdam Mitte Juli, das stand schon fest. Danach, so hatte Gerhard, sein Chef, gemeint, würde man weitersehen.
Oder auch nicht.
Eins nach dem anderen, sagte sich Hendrik. Overheadprojektor? Vorhanden, ein teures Modell. Eingesteckt, blitzsauber, funktionierte auf Anhieb, war sogar scharf gestellt. Flipchart? Stand bereit, Stifte in vier Farben in der Ablage, alle frisch.
»Von hier aus können Sie alle Lampen ein- und ausschalten«, erklärte ihm der junge Hotelangestellte ein Schaltpult, das unter einer Klappe im Referententisch verborgen lag. »Das da steuert die Verdunkelung der Fenster und dieser Regler das Mikrofon.«
Das testeten sie. Es war ein etwas altertümliches, drahtloses Mikrofon zum Umhängen, aber die Klangqualität war beeindruckend.
Und dann waren sie auch schon durch. Es gab nichts auszusetzen. Alles war da, alles funktionierte. Nun musste es nur noch vierzehn Uhr werden.
»Das ging ja schnell«, meinte Hendrik, faltete die Checkliste wieder zusammen und steckte sie ein.
Er hatte erwartet, dass der Hotelangestellte ihn nun schnellstmöglich aus dem Raum komplimentieren würde, um seinen anderen Aufgaben nachgehen zu können, doch tatsächlich blieb er stehen, rieb nervös die Hände und fragte: »Ähm, Herr Busske … wenn ich mir vielleicht eine Bitte erlauben dürfte?«
Hendrik nickte verdutzt. »Ja?«
»Es ist so«, begann der junge Mann zögernd, der laut goldenem Namensschild am Revers Michel hieß, »dass ich auch ein bisschen in Aktien mache … im kleinen Maßstab natürlich, große Sprünge erlaubt mein Gehalt nicht … Andererseits bietet der Neue Markt derzeit unerhörte Chancen … Kurz und gut: Ob Sie vielleicht einen Tipp für mich hätten?«
Ah. So war das. Mit derlei müsse er rechnen, hatte ihn die Steinfeld während ihres Briefings gewarnt. Und ihn auch gleich mit der Antwort versehen, die er darauf geben sollte.
»Es geht in diesem Seminar nicht um Tipps«, erklärte Hendrik also. »Es macht wenig Sinn, auf einzelne Aktien einzugehen, denn es kommt ja immer auf die Situation an. Ziel des Seminars ist, dem Einzelnen das nötige Wissen und die Instrumente an die Hand zu geben, um seine Anlagen kompetent selber entscheiden zu können.«
»Ach so. Ja. Verstehe.«
Der junge Mann nickte enttäuscht. Er hatte eine schlecht vernähte Hasenscharte, sah Hendrik erst jetzt. Irgendwie rührte ihn das. Er hätte ihm durchaus gerne einen Tipp gegeben, bloß hatte er selber keinen. Mit Aktienhandel hatte er selber ja nichts zu tun. Sein Job waren die Kleinanleger – Leute, die ein paar Tausend Mark anzulegen hatten und das Geld möglichst in WCM Trust-Fonds stecken sollten.
Er zögerte. »Was haben Sie denn so im Portfolio?«
Der magere junge Mann zog den Kopf ein. »Nichts Besonderes. Dies und das. Ein paar Aktien von Bayer … Allianz … VW … Thyssen …«
»Klingt alles solide.«
»Ja, schon, aber jetzt reden doch alle von diesem Neuen Markt. Bloß ist der so schrecklich unübersichtlich!«
Hendrik hatte eine Idee, wie er sich aus der Affäre ziehen konnte. »Passen Sie auf – ich kann Ihnen eine Methode zeigen, mit der Sie die Entwicklung von Aktien besser verfolgen können als mit den üblichen Charts. Wenn Sie wollen.«
Er sah in aufleuchtende Augen. »Oh ja, gern!«
Also griff Hendrik nach Block und Kugelschreiber und erklärte ihm, wie man den Kursverlauf von Aktien nach der Point & Figure-Methode notierte und wie man Kauf- und Verkaufssignale aus der Darstellung herauslas. Die Methode war eigentlich uralt, aber kaum jemand benutzte sie heutzutage noch. Hendrik kannte sie aus einem amerikanischen Buch, das er in einem Antiquariat aufgestöbert hatte.
Was ihn an seinen heutigen Besuch in einem Antiquariat denken ließ und an das Buch, das er gestohlen hatte.
Das jetzt einfach so in seinem Zimmer lag.
Was, wenn jemand hineinging, solange er hier zu tun hatte? Mist, er hätte es zumindest in den Koffer stecken können!
»Also, solange der Kurs fällt, tragen Sie untereinander das Zeichen O ein, und solange der Kurs steigt, übereinander das Zeichen X«, fasste er hastig zusammen. »Und immer, wenn der Kurs die Richtung wechselt, fangen Sie eine neue Spalte an.«
Der junge Mann nickte fasziniert.
»Und so sieht ein Kaufsignal aus«, fuhr Hendrik fort. »Drei Säulen. Die erste aufwärts. Die zweite abwärts, aber nicht mehr Einheiten, als die vorige aufwärtsgegangen ist. Und die dritte muss die erste um mindestens eine Einheit übersteigen.«
»Und ein Verkaufssignal wäre das gleiche, nur auf den Kopf gestellt?«, begriff der junge Mann.
»Genau.«
Hendrik riss das Blatt ab, reichte es ihm. Der Angestellte nahm es ehrfürchtig entgegen, faltete es behutsam zusammen und steckte es ein, als wäre es eine Kostbarkeit. »Vielen Dank«, sagte er. »Man merkt gleich, dass Sie ein Experte sind. Danke.«
Wenn du wüsstest, dachte Hendrik mutlos, lächelte tapfer und sagte: »Keine Ursache.«
Er hatte es eilig, zurück in sein Zimmer zu kommen – einerseits. Andererseits hätte er am liebsten die Zeit angehalten. Sein Schritt verlangsamte sich wie von selbst, während er den endlosen Flur entlangging und der dicke Teppich das Geräusch seiner Schritte schluckte. Er versuchte, sich auszumalen, wie es wäre, eine solche Umgebung gewohnt zu sein. Immer so zu nächtigen. Jemand zu sein, der in dieser Etage der Welt zu Hause war – nicht bloß jemand, der verstohlen durch den Spalt eines Vorhanges blickte, auf dem »Zutritt für Unbefugte verboten« stand.
Er erreichte seine Zimmertür viel zu rasch. Der Schlüssel lag schwer in der Hand, fühlte sich gediegen an, wertvoll, fast, als wäre er wirklich aus Gold. Auch das Schloss: flüsterleise, solide, makellos funktionierend.
Das Buch lag noch da, wo er es hingelegt hatte. Er schlug es auf, schlug es wieder zu. Nein, erst duschen. Sein Hemd klebte am Rücken. Er war am ganzen Körper verschwitzt von dem Flug, dem frühen Aufstehen und seinem haarsträubenden Abenteuer in der Innenstadt.
Er packte aus, hängte den anderen Anzug – den, den er im Seminar tragen würde – auf einen Bügel, nahm den Waschbeutel und ging das Bad inspizieren. Ringsum weißer Marmor. Dusche, Badewanne, ein Bidet. Sogar ein eigenes Telefon neben der Toilette!
Er stellte die Tasche ab, kehrte zurück ins Zimmer. Tatsächlich, ein Telefon auf dem Nachttisch und eines auf dem wuchtigen Schreibtisch. Und dazu ein eigenes Faxgerät!
Eindeutig ein Zimmer für Leute, die wirklich etwas zu sagen hatten.
Während er sich auszog, fiel ihm auf, dass die dem Bad gegenüberliegende Wand nicht gerade verlief, sondern sich nach innen wölbte, deutlich sogar.
Ein bizarrer Anblick. Hendrik musste die Wand betasten, um sich zu vergewissern, nicht nur einen absurden Traum zu träumen. Als er den Zimmerplan auf der Innenseite der Tür konsultierte, fand er die Erklärung: Sein Zimmer grenzte unmittelbar an die runde, hohe Eingangshalle. Nicht genug, dass sein Zimmer nicht auf den berühmten See blickte, sondern nur auf den langweiligen Hotelvorplatz, es war überdies kleiner als alle anderen Zimmer auf diesem Flur. Eine Art Notzimmer, so sah es aus.
Hendrik sah sich ernüchtert um. Okay, Ende der süßen Träume. Er war weit davon entfernt, zu dieser Welt zu gehören. Er war hier gewissermaßen nur geduldet.
Zu duschen tat trotzdem gut. In den mahagonibraunen, flauschigen Bademantel mit dem goldgestickten Signet des Hotels gehüllt und seine Armbanduhr in der Hand, musste er eine Entscheidung treffen: entweder Mittagessen im Hotelrestaurant – oder in dem Buch weiterlesen.
Für das Buch sprach, dass ihn die Lektüre vielleicht ablenken würde, von seiner Nervosität, von dem Lampenfieber, das ihn mit der Gewissheit eines nahenden Todes zu erfüllen versuchte. Weil er das Seminar versieben, in den Sand setzen, an die Wand fahren würde. Weil er sich unsterblich blamieren würde. Weil man ihn auslachen und mit den zusammengeknüllten Unterlagen bewerfen würde, bis er schamhaft fliehen musste, außer Landes, nach Hause, wo ihn bereits die fristlose Kündigung erwartete, ach was, Schadenersatzforderungen seiner Firma in fünfstelliger Höhe …
Er musste sich wirklich ablenken. Auf der anderen Seite hatte er auch wirklich Hunger.
Hendrik schlug die Zimmerkarte auf. Saftige Preise, alles, was recht war: zwanzig Franken für einen Salat, vierzig für ein warmes Gericht …
Egal. Das würde er sich jetzt einfach gönnen. Heute war schließlich der Tag der Grenzüberschreitungen. Er konnte es ja als Henkersmahlzeit betrachten, sagte er sich, hob den Hörer ab und bestellte ein »Sandwich au Lac«, mit gebratenen Putenbruststreifen, Salat und Kräutersoße. Für dreißig Franken.
Er war noch nicht fertig mit Föhnen, als es schon klopfte. Eine junge Frau mit Pferdeschwanz, auch in Livree, das Tablett mit seiner Bestellung in Händen.
Hendrik fühlte sich auf einmal schrecklich unbeholfen. Wie benahm man sich in einer solchen Situation? Noch dazu nur mit einem Bademantel bekleidet?
Zum Glück übernahm die Frau die Initiative, sagte: »Ihre Bestellung, Herr Busske«, trat ein, ohne die Miene zu verziehen, und stellte ihm das Tablett auf den Schreibtisch. Hendrik leistete die geforderte Unterschrift auf dem ausgedruckten Beleg, dann war sie wieder verschwunden.
Duften tat es jedenfalls gut. Hendrik nahm den weißen Plastikdeckel ab und entdeckte ein Monster von einem Sandwich, umlagert von ein paar dicken Pommes und garniert mit Unmengen Salat. Eine richtige Mahlzeit, nicht nur ein Imbiss.
Umso besser. Er holte sich – wenn schon, denn schon – ein alkoholfreies Bier aus der Minibar, schob den Sessel so hin, dass er das Tablett neben sich hatte, und machte es sich bequem. Er nahm einen ersten Bissen, schlug, während er genussvoll kaute, das Buch auf und suchte die Stelle, an der er im Antiquariat aufgehört hatte.
3.
Die Rüstung, die weinte (…)
Der Fürst hatte sich mit dem Medicus und einigen anderen Vertrauten zur Beratung zurückgezogen. Als sie zurück in den Großen Saal kamen, erwarteten sie aufgerissene Augen und gespannte Gesichter. Der Alchemist stand in der Mitte der Tische wie einer, der ein Gerichtsurteil erwartet, womit er wohl recht behalten sollte.
»Gebt ihm einen Stuhl«, verfügte der Burgherr. Dann, als der Fremde saß, eröffnete er ihm seinen Beschluss: dass John Scoro für ihn, Bruno von Hirschberg, Kreuzritter und Fürst, Gold machen solle, und zwar so viel, dass er imstande sein werde, einen neuen Kreuzzug aufzustellen.
Ein Raunen ging daraufhin durch den Saal. Einer stieß den anderen am Ellbogen, einige bekreuzigten sich, und allen rann ein Schauer über den Rücken, als spürten sie den Hauch der Geschichte durch den Raum ziehen. Ein neuer Kreuzzug! Die Mamelucken vertreiben aus Palästina, das Heilige Land endgültig zurückführen in die Hände der Christenheit! Das menschliche Seelenheil zu entscheiden und zu erringen, für alle Zeit! Gewisslich würde es das Ende aller Tage näherbringen, die Wiederkehr des Herrn und den Anbruch seines ewigen Reiches!
Und all das sollte möglich werden durch diesen Mann, der da in ihrer Mitte saß? Der Mann, dessen Bart grau und filzig war und dessen Augen dunkel und finster dreinblickten? Jedermann wusste, dass die letzten Kreuzzüge kostspielig gewesen waren und die Herrscher der Deutschen und der Franken ihre Völker mit schweren Steuern hatten bedrücken müssen, um sie zu bezahlen. Könige und Königreiche waren an den Kosten zerbrochen, Päpste gestürzt, und Schlachten waren verloren gegangen, weil es an Geld gefehlt hatte. Doch all das würde nun anders werden, da dieser Mann, der da vor ihnen saß, in grauen, schmutzigen Kleidern, Gold zu machen vermochte, so viel er wollte.
John Scoro sah den Burgherrn unverwandt an, während das Raunen anschwoll und wieder abebbte. Dann sagte er, leise, kaum hörbar: »Verlangt das nicht von mir.«
Der Ritter ließ krachend die flache Hand auf den Tisch fallen. »Euren eigenen Aufzeichnungen zufolge habt Ihr Gold gemacht für die mohammedanischen Gewalthaber, John Scoro! Oder leugnet Ihr das?«
Scoro schüttelte langsam den Kopf. »Nein.«
»Und war es nicht so, dass sie mit Eurem Gold den Krieg gegen die Kreuzritter bezahlten?«
»Ja. Aber sie zwangen mich dazu, ich tat es nicht freiwillig. Wenn ich ihnen nicht gehorcht hätte, hätten sie mich getötet.«
Bruno von Hirschberg lächelte ein kaltes, mitleidloses Lächeln. »Seht Ihr? Genauso wird es Euch hier ergehen.«
Der Alchemist blickte zu Boden. »Verlangt das nicht von mir, bitte«, wiederholte er.
Der Ritter beugte sich vor. Seine Nasenflügel bebten. »Ich war beim letzten Kreuzzug dabei. Ich bin endlose Wochen durch den Sand Ägyptens marschiert, ich habe um Tripolis gekämpft, und ich bin der Schlacht von Akkon mit Mühe entkommen. Meine Gefährten sind neben mir gestorben, von mameluckischen Soldaten niedergestreckt. Mein eigener Bruder starb von der Hand der Heiden. Und alles war bezahlt mit Eurem Gold, John Scoro! Sagt mir, warum ich nicht von Euch verlangen soll, was Ihr für die Heiden getan habt?«
Es war, als hätten diese wütenden Worte die Maske der Unnahbarkeit zertrümmert, die der Alchemist bis jetzt getragen hatte. Es zuckte in dem düsteren, mürrischen Gesicht wie Wetterleuchten, und die knochigen Hände krallten sich ineinander, so ingrimmig, dass die Knöchel weiß schimmerten. Einen Augenblick lang sah es aus, als wollten sich jahrelang angestaute Tränen Bahn brechen, doch dann fing er an zu sprechen mit einer Stimme, in der panische Verzweiflung schwang. »Es ist wahr, dass ich Gold machen kann«, gestand Scoro. »Und es ist wahr, dass ich für die Sultane Gold gemacht habe. Aber als ich aus der Gefangenschaft entkam, habe ich einen Schwur getan, es nie wieder zu tun. Ich habe gehungert, obwohl ich in Saus und Braus hätte leben können, ich trage Lumpen, obwohl ich Purpur tragen könnte, alles, um meinen Schwur zu halten. Bitte verlangt nicht von mir, diesen Schwur zu brechen, um meinetwillen nicht und auch um Euretwillen nicht, denn mein Gold ist Teufelsgold.«
Einen Herzschlag lang herrschte Stille, ein großes Luftanhalten. Bruno und Mengedder tauschten einen Blick, und der Medicus runzelte dabei misstrauisch die Stirn, als wittere er eine weitere Lüge.
»Teufelsgold?«, wiederholte Bruno. »Wie meint Ihr das?«
»Wer ruft hier fortwährend den Namen des Verderbers?«, knurrte es vom Ende der Tafel. Pater Augustinus, der wohlbeleibte Beichtvater des ritterlichen Hofstaates, war aus seinem berüchtigten Dämmerschlaf erwacht, in dem er die Tage zu verbringen pflegte, vorwiegend deshalb, weil er in seinen wachen Momenten dem Essen und dem Bier in reichlichem Maße zugetan war.
»Wie meint Ihr das, John Scoro?«, insistierte der Ritter.
»Ihr habt gesehen, was mit dem Jungen passiert ist, der die Kiste öffnete«, grollte der Alchemist. »Es ist eine gefährliche Kunst, und das Gold wird Euch kein Glück bringen. Ich sage Euch, es ist Teufelsgold. Verlangt es nicht von mir, denn Ihr verlangt Euer Verderben!«
Bruno von Hirschberg sah sich um in der Runde seiner Getreuen und las das Entsetzen in ihren Augen, sah ihre Angst. Widerwillig fühlte er Respekt vor dem alten Angelsachsen. Der Mann wusste, welche Töne man anschlagen musste, um das gemeine Volk zu beeinflussen! Sogar Pater Augustinus schien beeindruckt zu sein.
»Herr, wir brauchen nichts zu überstürzen«, raunte ihm Egbert, sein Schildknappe, unruhig zu.
»Der Glanz des Goldes darf uns nicht so sehr blenden«, mahnte der Pater mit schwerer Zunge, »dass wir den Einflüsterungen des Verderbers anheimfallen.«
Der Ritter trommelte ruhelos mit den Fingerspitzen beider Hände auf dem Tisch. Ein Blick hinüber zu Mengedder brachte auch keine Hilfe, selbst der Medicus war unsicher geworden.
»Ihr sagt, John Scoro, es sei Teufelsgold. Wir werden das zu prüfen wissen«, erklärte Bruno, einer plötzlichen Eingebung folgend. Innerlich lachte er auf. Damit würde er ihn kriegen, den alten Fuchs! »Ihr werdet Gold machen. Währenddessen holen wir einen Goldschmied, der aus dem Gold ein Kruzifix schmieden soll. Ist es nicht so, Pater Augustinus, dass sich das Gold, wenn es des Teufels ist, weigern wird, die Gestalt des Heilands anzunehmen?«
Der Pater starrte ihn mit weiten, stumpfsinnigen Augen und halb offenem Mund an. Er kippte den Kopf zuerst zur einen, dann zur anderen Seite, als müsse er diese Frage gründlich durch sein Gehirn sickern lassen, und nickte schließlich heftig. »Zweifellos!«, verkündete er.
»Also«, beschloss Bruno, »werden wir es genau so machen. Wenn es gelingt, ein Kruzifix aus Eurem Gold zu machen, Scoro, so ist bewiesen, dass es kein Teufelsgold sein kann. Und dann werdet Ihr die Chance haben, reumütig Eure Schuld an der Christenheit abzutragen …«
Unter der Aufsicht Mengedders und nach den Vorgaben des Alchemisten wurde im Keller der Burg ein alchemistisches Laboratorium eingerichtet. Ein gewaltiger Schmelzofen wurde in der Mitte des Gewölbes hochgemauert, allerlei Tiegel und Pfannen und Flaschen mit seltsamen Essenzen die engen Wendeltreppen hinabgetragen, und misstrauische Soldaten wachten über jeden Schritt John Scoros, der überdies eine festgeschmiedete Kette um das rechte Fußgelenk trug. Jede Anweisung des Alchemisten wurde von dem Medicus geprüft, der zudem dessen Aufzeichnungen unter Verschluss genommen hatte. Niemand tat etwas, ohne dass Mengedder zuvor genickt hätte.
Diese Arbeiten machten rasche Fortschritte. Schwieriger war es, das Ausgangsmaterial zu beschaffen, aus dem Scoro Gold machen wollte.
»Ich dachte, ein Alchemist kann aus allen Metallen Gold machen?«, fragte Bruno nach, als er zum ersten Mal davon hörte. »Aus Eisen, Kupfer, Blei …«
»Aus Blei offensichtlich nicht«, erklärte Mengedder, »da der Kasten, in dem er den Stein der Weisen verwahrt, aus Blei ist und es sich noch nicht in Gold verwandelt hat. Nein, er benötigt tatsächlich Merkurium, das man auch Quecksilber nennt – ein flüssiges Metall, das man in Italien und Spanien findet.«
»Er will Gold machen aus einem flüssigen Metall?«, wunderte sich der Ritter. Aber sie kauften Quecksilber, so viel sie bekommen konnten, und dazu Sulfur, Phosphor und Ammoniak sowie einen großen Bergkristall, der in die Wand des Schmelzofens eingemauert wurde, sodass man zu sehen vermochte, was darin geschah. Der Fürst ließ in weitem Umkreis die Holzvorräte für den Winter beschlagnahmen, denn der alchemistische Prozess würde ungeheure Hitze benötigen, und die Wälder von Hirschberg hallten danach wochenlang von Axtschlägen wider, da es galt, die Vorräte neu anzulegen.
Schließlich entzündete man das Feuer unter dem Schmelztiegel. Beißende Dämpfe begannen, das Gewölbe zu erfüllen und zu durchdringen, und das Quecksilber fing an zu sieden und Blasen zu schlagen. Der Alchemist mischte nach seinen geheimnisvollen Rezepturen allerlei Ingredienzien hinein, rührte und rührte und rührte, und Mengedder, der aufmerksam dabeistand, hörte ihn halblaut unverständliche Worte murmeln.
»Beschwört Ihr die Geister?«, fragte er schließlich. »Oder gar …« Er wagte nicht, den Verderber beim Namen zu nennen.
»Es sind persische Kinderreime«, erklärte John Scoro, ohne den Blick von seinem Sud zu wenden. »Die persischen Kinder verwenden sie, um die Zeit zu bestimmen, wenn sie Verstecken spielen. Ich habe sie ihnen abgelauscht, und ich verwende sie, um die Zeit zwischen den alchemistischen Schritten zu messen.«
Schließlich kam der heikelste aller Schritte – die Zuführung des Steins der Weisen. Das Laboratorium wurde abgeriegelt, nur Scoro und Mengedder und zwei Gehilfen blieben darin sowie die geheimnisvolle Kiste. Den beiden Helfern, die Mengedder aus der Burgküche abkommandiert hatte, stand der Schweiß auf der Stirn, als sie mit vereinten Kräften den bleiernen Kasten auf die Umrandung des Schmelztiegels wuchteten. Sie hatten vom Schicksal Arveds gehört, und so handelten sie mit äußerstem Bedacht, als sie nach den Anweisungen des Alchemisten eine Kette an einem Ring befestigten, der im Deckel des Kastens eingelassen war. Dann legten sie den Kasten auf die Seite und schoben ihn dicht an das siedende Quecksilber heran. Endlich hieß Scoro sie, zu ihnen hinter den Schutz der Ummauerung zu kommen, wo er stand und das andere Ende der Kette in der Hand hielt.
Er sah den Medicus noch einmal an. »Auch wenn Ihr mir nicht glauben werdet, es ist Teufelsgold«, sagte er auf Lateinisch, sodass die Helfer ihn nicht verstanden. »Wollt Ihr wahrhaftig, dass ich es mache?«
»Gewiss«, versetzte Mengedder, der bei sich eine grausige Faszination feststellte, die das Prozedere in ihm ausgelöst hatte.
Der Alchemist nickte entsagungsvoll. »So sei es«, seufzte er und zog heftig an der Kette.
Mit einem Ruck schlug der Deckel auf, und das überirdische Licht, das der Stein der Weisen verbreitete, brach heraus wie ein nicht enden wollender Blitzstrahl. Es drang durch hastig geschlossene Augenlider und brannte gleißend wie Feuer, und es schien selbst durch ihre Kleider, ihre Körper, ja sogar durch die Verliesmauern zu dringen. Später sollte sich Mengedder einmal daran erinnern, dass er in diesem Augenblick mit heißem Schreck gedacht hatte: Das muss ein Stück des Höllenfeuers sein!
Doch dann rumpelte der Stein aus seinem Behältnis und fiel in das brodelnde, glitzernde, dünnflüssige Quecksilber, und die Helligkeit erlosch.
»Ihr könnt die Augen jetzt öffnen«, hörten sie John Scoros müde Stimme.
Was sie sahen, war womöglich noch unirdischer als das Licht, das sie geblendet hatte. Sie sahen den Stein auf dem Grund des Schmelztiegels liegen, so strahlend, dass seine Helligkeit durch das kochende Quecksilber hindurchschimmerte und das flüssige Metall in etwas Geisterhaftes, ganz und gar Unheimliches zu verwandeln schien. Es war, als sei der Schmelzofen angefüllt mit nebelartigem, körperlosem Glanz, als sei es ihnen gelungen, ein Stück des Himmels zu Beginn der Abenddämmerung im Sommer herauszuschneiden und auf die Erde herabzubringen. Rund um den Stein wirbelten und tanzten elfenhafte Schlieren, und während man ihren trunkenen Tänzen zusah, konnte man die ersten goldenen Funken entdecken.
»Nun darf der Nachschub an Brennmaterial und Quecksilber nicht mehr ausgehen«, erklärte der Alchemist ruhig. »Das Gold amalgamiert mit dem Quecksilber. Bald werden wir beginnen können, es herauszulösen.«
Mengedder konnte den Blick nicht von dem quirlenden Schmelztiegel wenden, von den goldhellen Streifen, die inmitten des grellen, fast blau schimmernden Prozesses entstanden. Das also war die große Transformation, die Transmutation, das Große Werk. Diesem John Scoro war gelungen, wonach Alchemisten seit Jahrhunderten gestrebt hatten: die fünf Elemente Luft und Wasser, Feuer, Erde und Raum zu beschwören, die innere Reinigung zu vollziehen und das reinste aller Metalle aus den unedlen erstehen zu lassen – Gold.
Wie würden sie den Stein der Weisen einst wieder zurückbekommen in seinen Kasten? Einen Herzschlag lang hatte Mengedder die Vision, dass sie nun dazu verurteilt sein könnten, ohne Unterlass Gold zu produzieren, immer weiter und weiter, weil der Stein der Weisen sie vernichten würde, sobald er aus dem Quecksilber zum Vorschein kam.
»Wir wissen nicht, was er tut«, stieß Bruno hervor. »Er kann alles Mögliche im Schilde führen.«
Der Morgen brach an, ein grauer, trüber Morgen, der sich wie eine bleierne Kuppel über ihnen wölbte. Der Ritter sah so müde aus, als hätte er die Nacht auf den Zinnen seiner Burg verbracht. Die Wälder ringsum lagen fahl und stumm, kaum, dass einmal ein Ast knackte oder ein Tier Laut gab. Als hielte die ganze Welt den Atem an.
Egbert räusperte sich. »Herr, Mengedder ist bei ihm. Der Alchemist kann nichts ohne ihn tun.«
Bruno sah seinen Schildknappen mit rot geränderten Augen an. »Wieso dieser Schwur? Wieso schwört einer, der Gold machen kann, dass er keines mehr machen wolle? Er könnte der Herr der Welt sein – wovor fürchtet er sich?«
Egbert wich dem Blick seines Herrn aus. So hatte er sich das noch nicht gefragt, aber er konnte spüren, wovor der Alchemist Angst hatte. Es war hier, um sie herum, in jedem Raum und in jedem Stein der Burg. Sie hatten es eingeladen, und nun war es da. Er wünschte sich, sie hätten es nicht getan.
Doch er war Schildknappe, und seine Pflicht war es, seinem Herrn beizustehen. Er hob den Kopf, zog witternd die Luft durch die Nase. »Erinnert Ihr Euch an den Morgen, bevor wir Tripolis stürmten?« Er flüsterte unwillkürlich. »Damals war es genauso ruhig. Genauso grau.«
»Tripolis?« Der Ritter trat an das Burgwehr und sah hinab auf den Hof, unter dem das Laboratorium lag. »Nein, es war Akkon. Es war der Morgen, bevor die Mamelucken stürmten.« Er verharrte eine Weile schweigend, dann hob er den Kopf und ließ einen düsteren Blick über den Horizont schweifen. »Nein. Der Morgen nach der Kreuzigung unseres Herrn. So muss er gewesen sein.«