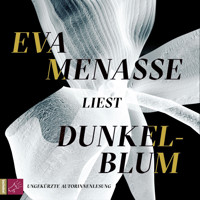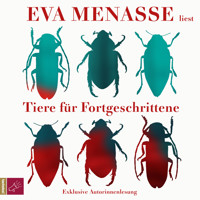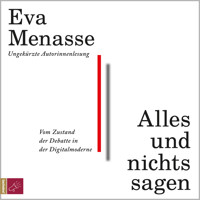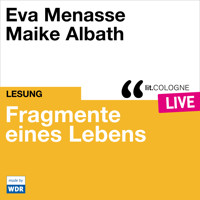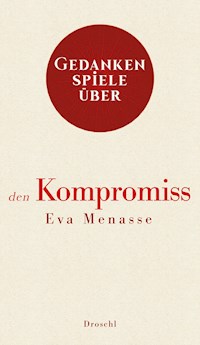9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
»Wer die Welt so anlächelte, musste eine Schraube locker haben. Oder ein Schutzblech zu wenig über der Seele.« Raupen, die sich ihr eigenes Grab schaufeln, Haie, die künstlich beatmet werden, Enten, die noch im Schlaf nach Fressfeinden Ausschau halten, Schafe, die ihre Wolle von selbst abwerfen. Jede von Eva Menasses Erzählungen geht von einer kuriosen Tiermeldung aus und widmet sich doch ganz der Gattung Mensch. Wie in ihrem ersten, hochgelobten Erzählungsband »Lässliche Todsünden« studiert sie ihre Objekte mit einem liebevollen und unerbittlichen Forscherinnenblick. Ein alter Despot, der sich gegen jede Veränderung wehrt, kann nicht verhindern, dass die Demenz seiner Frau auch die eigene Vergangenheit löscht. Einer engagierten Mutter, die ein muslimisches Kind gegen Anfeindungen in Schutz nimmt, verschwimmen schließlich selbst die Grenzen zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch. Eine Frau realisiert, wie sehr das Schicksal ihres Vaters sie geprägt hat, in ihren Marotten ebenso wie in ihren tiefsten Ängsten. Und eine Gruppe handverlesener Künstler und Wissenschaftler probt in südländischer Gluthitze eine groteske Revolution. Jahrelang hat Eva Menasse Tiermeldungen gesammelt, die ihr, wie umgekehrte Fabeln, etwas über menschliche Verhaltensweisen zu verraten schienen. Wer daran Vergnügen hat, kann teilhaben am Gestaltungsprinzip ihrer Erzählungen, indem er Mustern und Motiven nachspürt. Alle anderen Leser werden sich, wie bei Menasses bisherigen Büchern, von ihrem erzählerischen Talent mitreißen lassen, einer Mischung aus pointiertem Witz, Geheimnis und melancholischem Ernst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 402
Ähnliche
Eva Menasse
Tiere für Fortgeschrittene
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Eva Menasse
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Zur Erinnerung an Michael Glawogger
1959–2014
Um eine Spezies zu verstehen, braucht man mehrere Exemplare. Eines reicht nicht aus.
Audioguide im Natural History Museum, London
Schmetterling, Biene, Krokodil
Auf der Suche nach Nahrung werden Bienen und Schmetterlinge auch an ungewöhnlichen Plätzen fündig. Weil sie nährstoffreiches Wasser trinken, sitzen sie oft an Regenpfützen. Wie ein Foto eines in Puerto Rico forschenden Ökologen belegt, setzen sie sich sogar auf den Kopf von Krokodilen, um deren salzige Tränen aufzusaugen.
Ihr Jugendfreund Martin ist gestorben, und Tom, die Frau, die auf einem Männernamen besteht, sitzt ratlos am Computer und bucht einen Türkeiurlaub mit Wasserrutschen. Die Herbstferien stehen ins Haus. In acht Wochen werden sich die Kinder nicht mehr daran erinnern können, dass Tom an diesem Abend ein bisschen geweint und sich an Papas Schulter versteckt hat. Geschweige denn, dass die Kinder diesen leicht irritierenden, aber lange zurückliegenden Umstand als Erklärung dafür akzeptieren würden, dass ihnen nicht die allerbuntesten, ausgefallensten Wasserrutschen geboten werden, nachdem sie am Frühstücksbuffet noch einmal mit Schokoladefingern unterstrichen haben, dass ausgewogene Ernährung in den Ferien ausgesetzt ist.
Wenn es ein Unfall gewesen wäre, ein plötzlicher Tod, dann könnte sie das ja nicht, sich durch all die Angebote klicken, Bungalow mit zwei Schlafzimmern, Spa-Landschaft, Indoor-Pool, all inclusive mit oder ohne Tischwein, Direktflug oder nicht. Aber dass Martin sterben würde, war seit Monaten in das Bewusstsein seiner Freunde gedrungen wie dickflüssiger Schlamm. Der stirbt doch, oder, hat Judith, die ihn ebenso lange kennt und in den letzten Jahren ebenso viele Schwierigkeiten mit ihm hatte, Tom schon zu Ostern gefragt. Typisch Judith, allen anderen ihre frommen Wünsche zu zertrümmern, um aus ihrem Erschrecken einen perversen Trost zu ziehen. Tom, deren Schwester immerhin Ärztin, wenn auch keine Onkologin ist, hat ihr aufgebracht einen mit Fachbegriffen gespickten Kurzvortrag gehalten, der das Gegenteil behauptete: Operation, neue Methoden, und mit den Chemos ist man heute ganz woanders als noch vor ein paar Jahren. Dass Judith, die Tom normalerweise provoziert, wo sie nur kann, ihr damals nicht widersprach, ließ allerdings tief blicken.
Und jetzt ist Martin tot, liegt irgendwo gekühlt und atmet nicht mehr, und man nimmt es einfach zur Kenntnis, bedauernd, bestürzt, aber nicht entsetzt. Er hätte schon gestern sterben können, oder noch ein paar Stunden länger kämpfen. Jetzt, in diesem Moment, könnte er noch kämpfen, wobei sich Tom nicht vorstellen mag, wie das genau aussähe. Wahrscheinlich sehr viel stiller als das Bewegung vortäuschende Verb. Oder kämpft man an einem solchen Ende vielmehr darum, dem Leben endlich zu entkommen? Eineinhalb Stunden später wäre sein Todestag erst der morgige. Es ist aber dieser Tag, der da jetzt liegt wie ein extraharter Riegel zwischen gestern und morgen. Er wird für alle Zeiten Martins letzter bleiben. Für alle Zeiten? Solange noch jemand lebt, der sich an ihn erinnern kann. Bei solchen gedanklichen Riesensprüngen in die Zukunft wird Tom schwindlig.
Sie entdeckt ein buntgestrichenes Riesenrad mit Glühbirnenketten an den Stangen, altmodisch, wie aus ihrer Kindheit. Man kann das Bild nicht vergrößern, aber in der Beschreibung steht, das Clubhotel verfüge über einen kostenlosen Lunapark. Dem Jüngsten könnte das noch gefallen, eine kleine Bahn in Form einer Raupe, ein Kettenkarussell und dieses lächerliche Riesenrad, ein Zwergenrad. Als sie noch Kinder waren, Judith, Martin und sie, trugen sie Mützen, die ihre Mütter und Großmütter gestrickt oder gehäkelt hatten. Ungefähr in den Farben dieses türkischen Lunaparks. Tom nimmt das als Fingerzeig und bucht den Club, obwohl er vierhundert Betten hat.
Jonas und Karo haben diesmal eine eigene Reisetasche dabei, weil sie aus unbekannten Gründen erst am selben Vormittag zu ihnen gebracht werden konnten. Die halbe Stunde Zeitpolster, die ihre Mutter diesmal einzuhalten geschafft hat, nutzt Tom wie folgt: Sie bittet ihren Mann Georg, mit den Kindern ein paar Runden Quartett zu spielen, während sie sich mit ebenjener Tasche ins Schlafzimmer zurückzieht. Seinem Einwand, dass man in letzter Minute nicht noch etwas Neues anfangen sollte, begegnet sie mit einer expressiven Tus-halt-bitte-Grimasse. Aber genauer wird sie ihm nicht erklären, was sie vorhat, denn er würde ihr wieder sagen, dass sie langsam co-abhängig wird. Aber wenn, womit sie fest rechnet, es nach dem Urlaub wieder zu einer entsprechenden Anklage kommen sollte, wird sie gerüstet sein. Und dann wird er noch froh sein über ihre Co-Abhängigkeit. Mit wenigen Handgriffen hat sie die Tasche auf dem Ehebett ausgeleert, die Hosen, T-Shirts, Kleider, die Unterwäsche, Socken, Strümpfe und Badesachen wie auf einem Ladentisch ausgelegt, in thematisch zusammengehörenden Gruppen. Die Brieflein, die die Mutter den Kindern dazugepackt hat, eins blau, eins rosa, legt sie zur Seite. Das fällt ihr nicht ganz leicht, sie sind nicht zugeklebt, aber sie kann sich die Vergissmeinnicht-Orgeln ohnehin vorstellen. Sie hat Vergleichstexte gelesen, auf Geburtstags- und Ferienpostkarten, die die Kinder offen herumliegen lassen, weil sie eben Kinder sind. Mit ihrem Handy fotografiert sie die fremde Kleidung ab; das ist die einzige Möglichkeit, später zu beweisen, dass in der Zeit bei ihnen nichts verloren oder zurückbehalten worden ist. Tom führt seit Jahren einen stummen Abwehrkampf gegen Georgs Exfrau, deren Beschwerden so kleinlich wie zahlreich sind. Immer fehlt angeblich etwas, immer vermisst sie ein nagelneues Geschenk, ein besonderes Paar Schuhe, das sie störrisch in Georgs und Toms Haushalt vermutet. Wenn es nach der Exfrau geht, werden bei ihnen überdies Brotdosen verspeist, paniert, gegrillt oder über den Salat geraspelt, denn sie verschwinden offenbar im Dutzend, obwohl die Kinder jeden zweiten Montag mit einer kommen und am Montag darauf wieder mit einer gehen. Einmal haben Tom und Georg sich ausgemalt, wie sie bei Aldi zwanzig dieser bunten Plastikboxen kaufen und ihr im Paket schicken, mit herzlichen Grüßen, ein kleiner Vorrat. Sie haben viel gelacht dabei, das glückliche Paar, und noch mehr dazu getrunken. Und dann hat Tom geweint und gefragt, wann diese Schlammschlacht endlich zu Ende sei.
Wichtigere Dinge als Brotdosen tauchen nach einer Weile wieder auf – war eh bei Mama, erfährt man auf Nachfrage von den Kindern –, weshalb Georg bei den entsprechenden Telefonaten inzwischen grundsätzlich brüllt, die Exfrau solle erst ihren eigenen Saustall in Ordnung bringen, denn bisher sei es doch jedes Mal so gewesen, dass sie alle anderen falsch beschuldigt habe. Tom läuft in solchen Fällen von Zimmer zu Zimmer und schließt die Flügeltüren, doch natürlich bekommen Karo und Jonas gelegentlich etwas davon mit. Die Kinder reagieren unterschiedlich auf diese Querelen. An Jonas, dem Älteren, scheint alles spurlos vorbeizugehen. Wenn von seinen Sachen etwas vermisst wird oder er etwas verloren hat, zuckt er die Schultern und schweigt. Er weiß nichts, er kann sich nicht erinnern, er hat nichts gesehen und nichts damit zu tun. Die Teflonschicht nach allen Seiten muss ihn Kraft kosten, aber vermutlich spart sie sie ihm an anderer Stelle. Tom bewundert ihn dafür. Karo dagegen ist eine Träumerin und widerlegt mit ihrer Zerstreutheit alle Thesen von den ordentlichen Mädchen. Doch nimmt sie sich jeden Verlust umso mehr zu Herzen, sucht so unsystematisch wie unberuhigbar im Backrohr, in der Speisekammer, in den tiefsten Schubladen von Toms Schreibtisch. Aber um überhaupt dahin zu gelangen, hätte der neue und angeblich besonders wertvolle Teddybär von jener Oma mütterlicherseits, die ihn geschenkt hat, zusätzlich noch Leben eingehaucht bekommen müssen.
Tom liebt die struppige kleine Maus, obwohl sie ihnen mit ihren Wutanfällen das Leben schwer macht. Und anders als Georg hat Tom im Blick, dass sich das Problem gerade verschiebt. Karo hat sich endlich schweren Herzens abgewöhnt, Lieblingsspielsachen oder Geschenke zwischen Mama und Papa hin und her zu tragen. Die Verwirrungs- und Vorwurfsquote wurde auch dem Kind zu hoch. Aber indem Karo reif genug geworden ist, die wochenweise Trennung von ihren Kuscheltieren zu verkraften, wurde sie auch stark genug, zu rennen, von Klettergerüsten zu springen und sich die Kleidung zu zerreißen. Und zerrissene Kleider werden von der Mutter der Kinder derzeit zum nächsten Kampfplatz hochgejazzt. Wo sie aufmarschiert und man ihr auf eine unheimliche Weise, die außer Georg und Tom niemand versteht, einfach nicht ausweichen kann.
Obwohl die Scheidung Jahre zurückliegt, verkehrt seine Exfrau mit Georg weiterhin im immer-und-nie-Modus, den jeder, der schon einmal eine Eheberatungskolumne gelesen hat, als Melodie des Finales erkennt. Der letzte hochinfektiöse Satz seiner Ex, den Georg in dem Moment vergisst, in dem er ihn bei Tom abgeladen hat, lautet: Nie haben die Kinder etwas Sauberes an, wenn sie zu mir zurückkommen, immer sind die Sachen, die ich gekauft habe, zerrissen und kaputt.
Tom wendet daher inzwischen geheimpolizeiliche Methoden an. Sie hat alle verwechselbaren Kleidungsstücke, vor allem Jonas’ Hosen sowie Karos süße kleine Jeansröcke, an unauffälligen Stellen mit winzigen silberfarbenen Ösen markiert. Sie weiß also, welche Kleidungsstücke ihre und welche die der anderen Seite sind. Sie könnte es beweisen. Natürlich hofft sie, dass das nie nötig sein wird, weil sie sich dafür auch ein bisschen schämt. Weil es ja im Grunde nicht um eine Hose für neunzehn Euro neunzig geht. Und natürlich denkt sie manchmal unbehaglich an Georgs Satz, dass man an dieser Front niemals recht bekommen wird, weil es gerade darum geht, immer, immer, immer im Unrecht zu sein.
In normalen Wochen sorgt sie dafür, dass die Kleider, mit denen die Kinder angekommen sind, noch am selben Abend in der Wäsche verschwinden und von dort erst am letzten Abend, dem folgenden Sonntag, gewaschen und gebügelt ihren Weg zurück ins Kinderzimmer finden. Dann kann das Loch am Knie, für das die Ex sie am Montagnachmittag telefonisch anklagt, nur tagsüber entstanden sein, was sie Tom und Georg natürlich keinesfalls glauben wird. Absolute Sicherheit gibt es nicht, das ist schon klar. Aber eine Woche in der Türkei mit einer Reisetasche voller Anderer-Seite-Klamotten, mit dem vervielfachten Risiko, während der Reise, am Strand, im Meer fremde Dinge zu zerstören oder gar zu verlieren, das ist für Tom ein Horror; vergleichbar dem eines Leibwächters, wenn sich Papst oder Präsident spontan entschließen, ein Bad in der Menge zu nehmen. Und nur deshalb kommt sie auf die Idee, die gefährdetsten Kleidungsstücke, zwei Paar Jeans von Jonas, zwei dünne Sommerhosen und ein Röckchen von Karo, gegen eigene, mit Ösen markierte, auszutauschen. Wenn die im Urlaub kaputtgehen – egal. Ein weiteres stilles Opfer für den Seelenfrieden dieser armen Kinder. Tom darf nach der Rückkehr bloß das Umpacken nicht vergessen. Aber auf ihren lebenstechnischen Überblick ist sie gelegentlich fast ungebührlich stolz.
Als sie mit großer Verspätung ankommen, ist es nicht nur dunkel, sondern stockfinster. Wie umfassend fremd alles ist, kann man dennoch riechen und hören. Das bisschen, was an Umrissen zu erkennen ist, scheint einerseits die übliche Flughafengegend zu sein, Parkplätze, Scherenschnitte von Hangars und Flugzeugtreppen, aber dank der feuchten Wärme, der Zäune, Stacheldrähte, Scheinwerfer erinnert es sie ein bisschen an Guantánamo, eine Assoziation, die sich Tom gleich als Rassismus vorwirft.
An kleinen Tischen im Freien stehen Raucher mit Schnauzbärten. Bei ihnen bekommt man nach Vorlage des Vouchers eine Nummer, die zu einem der vielen Busse gehört. In der Nummer 927, einem Kleinbus, sitzt bereits eine hübsche, aber sehr dicke junge Frau, ein aufgepumptes Rapunzel mit Alabasterhaut und Korkenzieherlocken. Sie hält die Hand eines schmalen, kaum erwachsenen Jungen, den man lieber für ihren Sohn gehalten hätte.
Georgs Kinder sind still und müde, Lenny, ihr gemeinsames Kind, sitzt auf Toms Hüfte und versucht, sich zu beruhigen, indem er seine Nase an ihrem Schlüsselbein reibt. Im Bus riecht es nach Wunderbaum Grüner Apfel. Als Karo sich anschnallen will, stellt sich heraus, dass sich nur an zwei Sitzen Gurte befinden. Tom wirft ihrem Mann einen Blick zu, und sie schieben sich selbst und die Kinder so herum, dass wenigstens Jonas und Karo angeschnallt sind. Die Blondine in der Reihe davor wird aufmerksam und sucht ihrerseits vergeblich nach Gurten. Sie spricht in einer fremden Sprache auf den Jungen ein, der daraufhin aussteigt und einen Schnauzbart zurückbringt, der offenbar der Fahrer ist und sich nur auf Türkisch und mittels Gebärden verständigt. Seine weit von sich gestreckten, nach außen weisenden Handflächen sind aber international verständlich.
I don’t go, sagt das dicke Mädchen und klettert aus dem Bus, I don’t go.
Ist das Schwedisch, fragt Tom ihren Mann.
Ich halte das für Englisch, antwortet er.
Sie gibt ihm einen Stoß: Du weißt schon.
– Ich weiß es eben nicht. Dänisch, Finnisch, Norwegisch?
Tom stöhnt und vergräbt das Gesicht im Schopf ihres Kindes. Solange man kleine Kinder hat, bieten sie einem rein physisch Fluchtmöglichkeiten aus vielen Lagen, das ist einer der unabweisbaren Vorteile und funktioniert sogar mit Stiefkindern.
Nach einigen Minuten findet vor dem offenen Bus eine Schnurrbartversammlung statt, der Rauch zieht herein, die Zigaretten stinken nach Torf oder verbranntem Stroh, wie in Toms Kindheit.
Martins Vater hat so ein Kraut geraucht. Er war gar nicht sein richtiger Vater, er rauchte diese Zigaretten und hatte eine Stimme wie Louis Armstrong. Als sie noch klein waren, spielten sie abends mit ihm Bär. Immer, wenn Judith und Tom bei Martin übernachteten – Tom weiß nicht mehr, warum, und ob es so häufig gewesen ist, wie es ihr nun vorkommt, nur dass Martins Mutter nie da war, daran meint sie sich zu erinnern –, hat dieser merkwürdige Mann die Kinder ins Bett gebracht. Sie warteten im Dunkeln, die Tür stand einen Spaltbreit offen, das Licht fiel vom Vorzimmer herein. Langsam wurde der Lichtstrahl breiter, sie hielten den Atem an. Leise knurrend kam Martins Vater auf allen vieren herein, er brummte und schmatzte, er war der hungrige, große Bär. Am Matratzenlager der Kinder angekommen, richtete er sich auf, fletschte die Zähne, brüllte, als wollte er sie alle fressen, und ohne einen sicheren Beweis dafür zu haben, glaubt Tom bis heute, dass Martin sich am meisten gefürchtet hat, gefürchtet bis an die Grenze des Anpinkelns. Aber der Bär ließ sich wieder nieder und beschnupperte ihre Gesichter. An jedem knurrte und brummte er herum, in verschiedenen Tonlagen, sie lagen still, hatten Gänsehaut, und manchmal streichelten sie ihn, wie um ihn zu beruhigen. Er summte dann traurige Melodien an ihren Hälsen und Ohren, und am Ende, wenn er wieder hinauskroch, schliefen sie selig ein, da sich das Monster als starker Beschützer zu erkennen gegeben hatte.
Die Schwedin steht vor dem Bus und starrt vor sich hin. Ihr Begleiter sieht zwischen ihr und den rauchenden Schnauzbärten hin und her. Einer der Kapos steckt den Kopf herein und entschuldigt sich auf Englisch. Solange die anderen Gäste nicht einstiegen, könne man leider nicht losfahren. Georg steigt aus und schlägt den beiden Schweden vor, ein Taxi zu nehmen. If you pay, antwortet die junge Frau mit ansatzloser Härte. Offenbar hat sie gelernt, den Platz, den sie rein physisch ausfüllt, auch auratisch zu beanspruchen.
Die Schnauzbärte versichern, keinen anderen Bus zu haben, schon gar nicht um diese Uhrzeit. Karo steigt aus und sagt zu ihrem Vater: Sie kann doch meinen nehmen.
Georg nimmt seine Tochter an der Hand und fragt den jungen Mann, ob auch er unbedingt einen Gurt brauche, oder ob es reiche, wenn seine Freundin angeschnallt sei. Er benutzt das Wort »Girlfriend«. Der junge Mann drückt sich auf übertriebene Weise nonverbal aus, mit den Augen, den Schultern, den Händen, die alle dasselbe, nämlich frenetisches Einverständnis bedeuten, und bekommt dafür von seiner Prinzessin einen bösen Blick. Sie beansprucht alles, und er zelebriert das überbleibende Nichts, denkt Tom. Wahrscheinlich wäre auch ihr lieber, wenn die Extrempositionen ein bisschen angenähert werden könnten. Aus ihr würde dann ein verträglicherer Mensch. Aber dann müsste er aufhören, sich im Verzicht zu suhlen.
Georg setzt Karo auf Jonas’ Schoß, obwohl beide protestieren, schnallt sie gemeinsam an und überlässt den Platz daneben mit einer Geste dem dicken Rapunzel.
Und der Kleine, flüstert Tom vorwurfsvoll, als sich der Bus in Bewegung setzt, – und ich?
Wir sind nicht in Zentralafrika, sagt Georg.
Die Fahrt über denkt Tom darüber nach, dass Karo ihrem Bruder im Fall einer Vollbremsung mit dem Hinterkopf die Zähne einschlagen oder die Nase brechen wird. Und darüber, wie sich eine Beziehung anfühlen mag, in der der andere sein Leben für schützenswerter hält.
Das Hotel ist eine Freizeitfabrik von erträglichen Graden. Die Architekten haben sich bemüht, den Lagercharakter vergessen zu machen, indem sie alle großen Flächen in kleinere Stücke gehackt haben. Wer ein paar Hektar für die Massentouristenhaltung kauft, es aber nicht danach aussehen lassen will, breitet ein Netz von Raumteilern darüber; die Speisesäle voller geschnitzter Paravents und quer gestellter Buffet-Tresen, die Gärten voller mäandernder Wege oder sinnlos sich schlängelnder Buchsbaumhecken. Wenn je ein Architekt genausoviel Anstrengung in die Unterscheidbarkeit der einzelnen Segmente gelegt hätte wie in ihre bloße Erzeugung, hätte es klappen können. Da dafür jedoch weder Zeit noch Geld reichen, entstehen Freiluftlabyrinthe, in denen man sich verläuft wie in riesigen Shoppingmalls. Zum Glück wissen die Kinder immer sofort, in welcher Richtung es zum Strand geht, und lassen sich als vorauslaufender Kompass benutzen. Eingenordet auf das Meer.
Anfangs ist Tom lüstern fasziniert vom reibungslosen Ablauf in der Fabrik: Die Kellnerschar in dunkelbraunen Anzügen, Männer und Frauen, die wie vielarmige indische Götter abräumen und Unmengen Essensreste in Mülleimer kippen, die seitlich an ihren Geschirrwagen befestigt sind. Sie tragen Gummihandschuhe und werfen das benutzte Besteck in Plastikwannen. Die schwitzenden Köche hinter den Buffets, die Fleisch und Beilagen auf ihnen entgegengereckte Teller häufen. Fast könnte man meinen, es gäbe gar keinen Zwischenschritt. Der Schöpflöffel teilt im Akkord aus, sonnenverbrannte Hände tragen die Beute durchs Gewühl, stellen sie ab und stochern darin, dann schon streckt sich der exekutierende Gummihandschuh danach aus. An vielen Tischen haben sämtliche Familienmitglieder ein elektronisches Gerät vor sich. Hypnotisierte Zweijährige wischen auf iPads herum, anstatt zu essen, Eltern beantworten währenddessen E-Mails und haben nur Sorge, dass ihnen Soße auf das Gerät tropft.
Die Welt ist dem Untergang geweiht, sagt Tom.
Um das zu kapieren, verlässt man die geschmackvolle Altbauwohnung und fährt in den Urlaub, antwortet ihr Mann.
Wie recht er hat, und doch wünscht Tom, dass alles genau umgekehrt wäre. So wie ihre Kinder Fischgrätparkett für langweilige Normalität halten, aber den Rest des Jahres von diesem aquamarinblauen Meer träumen werden.
Die Schwedin und ihr Freund sitzen jeden Morgen an einem Tisch am Rand. Sie isst zwei bis drei Croissants mit Nutella und sammelt am Ende mit abgelecktem Finger alle Krümel vom Teller auf. Ihre Zunge, die spitz und flach zu sein scheint, fährt in kurzen Abständen heraus.
Er, der aussieht, als wäre er noch nicht volljährig, sucht ihren Blick, allzeit lächelbereit, aber sie starrt gekränkt und beleidigt vor sich hin. Tom findet das alles rätselhaft, ein unbegreifliches Paar, aber Georg behauptet, es sei alles immer viel einfacher, als man denke.
Was ist daran einfach, fragt Tom.
Sie bezahlt den Pfleger ihrer Launen nachts, mit diesem Übermaß an weichem Fleisch, sagt Georg: Alle Beziehungen sind doch Geschäfte.
Tom schüttelt nur den Kopf. Sie wüsste gar nicht, wo anfangen mit ihrem grundsätzlichen Widerspruch.
Nach dem Frühstück geht Georg mit den Kindern zum Strand, während sie sich auf eine Liege am Pool zurückzieht. Sie schlägt einen Roman auf, doch ihr Blick rutscht an den Zeilen ab. Wenn alle Beziehungen Geschäfte sind, welches ist dann ihres? Was bekommt sie, was gibt sie? Was hat es zu bedeuten, dass ihr höchstens Antworten auf die zweite Frage einfallen? Früher hätte sie gesagt, dass Loyalität das Wichtigste sei.
Vor einigen Jahren haben sie den schwer betrunkenen Martin in einem Wirtshaus getroffen. Tom lief hin, um ihn zu begrüßen, da stand er auf, langte ihr grob an den Bauch und sagte: Bist du jetzt auch so ein Spießer geworden? Ich habe gehofft, wenigstens du kannst auf diesen Reproduktionsscheiß verzichten!
Und daraufhin hat Tom mit ihm gebrochen. Sie hat ihm am nächsten Tag einen Brief geschrieben, in dem es hieß, dass er aufhören müsse, anderen seinen Weltschmerz unterzuschieben. Mit einem schlechtgelaunten Daueropfer wolle niemand befreundet sein, das müsse ihm doch langsam auffallen. Damals ist ihr das alles sehr schlüssig erschienen. In Gesprächen mit Dritten hat sie mit schriller Stimme Martins Psychogramm gezeichnet, das eines zweifellos Hochsensiblen, der leider glaube, sein Recht auf Glück und Erfolg einklagen zu können. Und der mit seinem Lamento aus Mangel an anderen Adressaten schließlich bei seinen alten Freunden lande.
Schon ein paar Monate später hatte sich diese Schlüssigkeit verflüchtigt. Und schließlich hat sie, von Martins einmaliger Rüpelei abgesehen, gar nicht mehr gewusst, worum es eigentlich gegangen war. Irgendeine Rechnung schien doch auch sie mit ihm offen gehabt zu haben, obwohl sie nicht mehr wusste, welche. So hat sie sich mit der Zeit unbeholfen wieder angeschlichen, und Martin ließ es geschehen. Zwischendurch war sie manchmal gekränkt, dass er umgekehrt nichts dergleichen versuchte, keine noch so verschämte, nonverbale Entschuldigung.
So wie früher wurde es nie mehr.
Immer noch kann sie sich an die Szene im Blaubichler schärfer erinnern als an das meiste danach, Martins schmucklose, fast ruppige Einäscherung ausgenommen. Gerade anhand des Blaubichler-Beispiels hat sie sich selbst oft versichert, wieviel es wert ist, dass der Partner solidarisch ist. Dass Georg nicht gesagt hat, ach, der war doch betrunken, sieh’s nicht so eng. Aber in letzter Zeit scheint ihr manchmal, dass vieles im Leben ganz anders gewesen sein könnte. Dass sie von manchem die falsche Version abgespeichert hat. Dass damals Georg besonders empört und beleidigt war, dass er gesagt haben könnte, er habe diesen verkorksten Typen noch nie leiden können. Und dass sie, Tom, nur deshalb zu einer so pathetischen Geste wie dem Brief gegriffen hat, die zu ihr, Judith und Martin eigentlich gar nicht passte.
Am Strand ist es windig. Weiße Wölkchen von beinahe genormter Größe fahren über den Horizont wie Milchpäckchen auf einem Förderband. Alles flattert, die Handtücher auf den Liegestühlen, die Strandhemden der Menschen, die am Ufer entlanggehen, und die Schilfmatten, mit denen die schattenspendenden Holzgerüste gedeckt sind, unter denen die Liegen aufgereiht stehen. All das Flattern und Knattern und dazu das Sonnenlicht sind so dramatisch herbstmelancholisch, dass Tom meint, den Wind und die Wellen an ihr Herz anbranden zu spüren.
In den tiefen Dünen hinter dem Strand steht eine einzelne Dusche, bloß ein dickes Rohr mit Sprühkopf, trotzig in ihrer Überflüssigkeit. Man schwimmt im Meer, dann spült man sich am Pool den Sand von den Füßen. Was soll die Dusche hier? Vielleicht strukturiert auch sie nur den allzu weiten Raum. Tom geht genau hierher, bis in diese leere Mitte zwischen der Gartenanlage und dem Strandbereich. Sie stellt sich neben das Duschrohr und versucht, ihre Familie zu finden wie in einem Wimmelbild. Schließlich erkennt sie Karo an ihrem Gang, hüpfend wie ein junges Kitz, aber mit diesem winzigen Hinken. Tom hat bei der Mutter nachfragen lassen, ob sie, Georg oder Tom, mit dem Kind zum Orthopäden gehen sollten. Da ist nichts, das wäre mir doch aufgefallen, war die schnippische Antwort, der Tom noch in der Übermittlung durch Georg den Ärger über den Angriff auf die Mutterkompetenz anmerkte. Karo und Jonas spielen sich einen roten Wasserball zu, Toms eigener kleiner Sohn läuft entzückt hinter dem Ball her, ohne zu versuchen, ihn zu fangen. In Toms Kopf sagt Martins Stimme: Verlogenes Familienidyll. Tom antwortet kleinlaut: So idyllisch ist es selten. Meistens ist man ja mitten drin.
Wo ist Georg? Jemand, der Georg sein könnte, lehnt mit der Schulter an einem Pfosten des Sonnenschutzgerüsts, aber er kann es nicht sein, denn dieser Mann unterhält sich mit einer gertenschlanken Frau, die endlos lange Haare hat und ihm einmal kurz die Fingerspitzen auf den Unterarm legt. Das wäre ja schnell gegangen. Jedenfalls fasst diese Frau ihren Haarvorhang mit beiden Händen, dreht ihn zu einem Seil und stopft es in den Kragen ihres zitronengelben Leinenhemds. Der Wind, der Wind.
– Man kann sich ja gar nicht unterhalten, wenn einem dauernd die Haare um den Kopf fliegen.
– Und ich habe gedacht, wenn Haare nur lang genug sind, werden sie nicht mehr so lästig.
– Stimmt. Wie Sie sehen, kann man sie sich dann als Tau unter die Kleidung stecken.
– Aber die Spitzen werden Sie an der Hüfte kitzeln.
– An der Hüfte? Was geht Sie meine Hüfte an?
– Verzeihen Sie, derzeit natürlich nichts.
– Sie meinen, das kann ja noch werden?
Tom gibt sich einen Ruck und marschiert los. Anstatt weiter auf die Frau und den Mann zu achten, vertieft sie sich in den Anblick des hocherregten, schaumschlagenden Meers. Kinder springen wie in einem Stummfilm über die Wellen, denn obwohl sie vermutlich kreischen, hört man nur das Donnern des Wassers. Ein Bademeister mit einer Pfeife geht wachsam auf und ab. Deutsche Verhältnisse an der türkischen Riviera. Sicherheit und Obsorge. Solange man die Tourismusfabrik samt ärmlichem Riesenrad im Rücken hat, könnte man sich einbilden, an einem unberührten Strand zu sein; Herbstbadeglück in den Sechzigerjahren, welche ja auch die Mode derzeit wieder nach Kräften beschwört. Martin wurde noch in den Sechzigern geboren, sie knapp nicht mehr.
Bei den Sonnenliegen angekommen, verliert Tom einen Moment die Orientierung. Sie glaubt, zu weit nach links abgekommen zu sein, hebt den Blick, sucht nach dem Mann an dem Pfosten, nach den Ball spielenden Kindern. Ein paar Meter weiter stößt sie mit dem Schienbein hart an den Rand einer Liege. Sie erschrickt, tritt einen Schritt zurück und sieht zwei Hände, die einen walartigen, blendend weißen Rücken eincremen. Zwar verharren die Hände nun, aber ihr Gehirn spielt Tom die vorangegangenen Sekunden mit kleiner Verzögerung vor: Wie diese Hände das Fleisch kneten, es tatsächlich zwischen den Fingern hervorquellen lassen, es hin und her streichen, als wäre es lose und könnte neu angeordnet werden. Der Inhaberstolz, der darin liegt. Das ist mehr als das Verreiben von Sonnencreme, das ist eine Form von besitzanzeigender Massage. Im nächsten Moment erkennt sie den schwedischen Boyfriend, der ihr sein Milchbubengesicht zuwendet und so errötet, dass auch Tom die Augen niederschlägt. Das Rapunzelmädchen hebt den Kopf und blickt blinzelnd über die Schulter. Tom entschuldigt sich wortreich, schilt sich der Unaufmerksamkeit, bedauert unendlich. Never mind, sagt das Rapunzel mit seiner angerauhten Stimme und macht dazu eine Handbewegung. Während Tom flieht, fragt sie sich, ob es wirklich sein kann, dass die Schwedin sie nicht mehr erkannt hat, während der Junge weiß, wer sie ist, es nur zu genau weiß und sich deshalb so ertappt fühlt.
Georg sitzt inzwischen auf dem Boden, mit dem Rücken an einen der Holzpfosten gelehnt, und schaut den Kindern zu. Der Kleine gräbt ein Loch in den feuchten Sand, Karo sammelt am Wasser Kieselsteine, Jonas kickt abwesend den Ball hin und her. Fünfzig Meter weiter liegt eine langhaarige Frau im Bikini in der Sonne, aber das zitronengelbe Hemd ist nirgends zu sehen, nicht neben ihr und nicht an ihrem Sonnenschirm. Das, was Tom beobachtet hat, kann woanders gewesen sein, weiter in Richtung Westen. Toms Orientierung war nie besonders gut, und sie hat den Verdacht, dass ihre Augen wieder schlechter geworden sind. Sie setzt sich neben Georg und versucht, sich unter seinen Arm zu kuscheln. Er wehrt sie ab, indem er zur Seite rückt und ihr den Pfosten als Lehne überlässt. Das wollte ich nicht, protestiert Tom.
Aber wenn du dich an mich lehnst, kippe ich um, sagt Georg.
Tom erzählt von der Schwedin und ihrem Freund, dass sogar das Eincremen mit Sonnenmilch zur Erregung öffentlichen Ärgernisses werden könne. Ihr Mann fragt sich, aber wohl doch eher sie, warum sie sich so für die beiden interessiert.
– Weil ich nicht verstehe, wie man so jung schon so unglücklich sein kann.
Wann, wenn nicht dann, fragt Georg.
Für den Abend ist »großes Fischgrill an Buffet« angekündigt, Jonas macht sich darüber lustig. Karo verteidigt die Bediensteten in den dunkelbraunen Anzügen mit dem rührenden Satz, dass sie gern so gut Türkisch könnte wie diese Kellner Deutsch. Tom staunt, dass ein Kind, das sich vor gleißender Wut manchmal nicht anders zu helfen weiß, als Bleistifte zu zerbrechen, Bücher oder die T-Shirts ihres Bruders zu zerfetzen, zu dieser feinen Unterscheidung fähig ist. Karos Wut schlägt normalerweise in sie ein wie ein Blitz – man sieht sie nicht kommen. Ein Mal hat Tom etwas gesehen oder geahnt, und das war auch das einzige Mal, wo es schlimm hätte werden können. Sie saßen am Tisch und aßen, ein großes Messer steckte in der Lammkeule, Jonas flüsterte etwas, das sowohl er als auch Karo später zu wiederholen sich weigerten, und Tom bemerkte, dass Karos Nasenspitze weiß wurde. Wut ist nicht rot, sondern weiß wie die heißeste Hitze, jene, in der sich alles auflöst, ohne überhaupt noch zu brennen. Toms Hand und die von Karo schnellten fast gleichzeitig zum Messergriff, Tom war den Sekundenbruchteil schneller. In dem Augenblick, in dem sie das Messer packte und herauszog, stieß Karo einen grellen Schrei aus. Und dann stach sie mit der geballten Faust auf ihren eigenen, auf dem Tisch liegenden linken Handrücken ein, ohne etwas darin, aber alle anderen glaubten dort die Umrisse des Messers zu sehen, das Tom in Wirklichkeit langsam, als wäre es zerbrechlich, auf ihren Schoß sinken und damit außer Sicht geraten ließ. Aber Georg sagte nachher, das hätte sie doch nie getan, niemals. Karo habe überhaupt erst mit der dramatischen Show begonnen, als sie, Tom, so hektisch das Messer geschnappt habe. Du bringst sie erst auf Gedanken, sagte er und lachte. Und Tom, die gelobt hatte werden wollen, machte als Antwort nur ein Geräusch, das klang, als sitze in ihrem Hals einer dieser bunten Blechfrösche, die Martin und sie als Kinder auf der Straße hatten springen lassen.
Mit ihrem kleinen Sohn auf dem Arm steht Tom vor einem Marktstand, so neu und holzgewachst, dass er selbst zu Hause auf dem Biomarkt auffallen würde. Hier in der Türkei blinkt er hervor wie die goldenen Schneidezähne der Taxifahrer. Auf diesem Kulissen-Marktstand wird ein ganzer Thunfisch präsentiert, dick und schimmernd. Am Ende des Grillabends wird er ein anklagendes Skelett sein. Dahinter stehen lächelnde Köche in langen weißen Schürzen, mit langen weißen Zähnen und schwingen ihre Messer, – ein bewegliches Werbefoto. Ein Koch greift sich einen Hummer vom Eis und hebt ihn Toms Sohn entgegen, durch diskretes Rütteln vorspielend, er sei noch lebendig. Aber auch dieses Kind reagiert selten so, wie man es erwartet. Lenny ekelt sich nicht, er lacht nicht, er verbirgt nicht das Gesicht an Mutters Schulter. Er starrt dem auf ihn zuschwebenden Hummer gebannt entgegen. Das wird ein Intellektueller, sagte der Kinderarzt, als er ihm bei einer der Kontrolluntersuchungen eine Rassel wegnahm und sie an die Seite legte. Die meisten Kinder würden sich in Richtung der Rassel drehen und versuchen, sie wiederzubekommen. Doch Toms Baby starrte den Arzt an, wie um herauszufinden, warum er so etwas Unhöfliches getan hatte. Ein Intellektueller, kein Sportler, hat der Arzt gesagt und gelacht.
Der türkische Koch schaut ein wenig enttäuscht. Tom macht eine begeisterte Bemerkung zu dem riesigen Fisch, wie um den Koch zu trösten. So etwas gibt es bei uns zu Hause nicht, sagt sie, doch er antwortet: Dafür alles andere. Tom ist sich nicht sicher, ob sie sich verhört hat, deshalb dreht sie sich mit einem vagen Lächeln um und sucht nach dem Rest der Familie, der ihr schon wieder abhanden gekommen ist. Am anderen Ende der Terrasse sitzen zwei Kinder an einem Tisch und essen. Das könnten Jonas und Karo sein. Georg dagegen ist nicht zu sehen; seit sie hier sind, ist er immer wieder für eine Weile verschwunden oder taucht aus ganz unerwarteten Richtungen auf.
In diesem Moment greift jemand von der Seite, aus einer Menschentraube heraus, nach ihrem Unterarm und drückt so fest, dass es wehtut.
Es ist ein kleiner alter Mann mit drahtigen grauen Haaren, der sich von unten und hinten in ihr Blickfeld schiebt. Seine Augen sind rot und wässrig, er hält ihren Arm im Klammergriff fest und streichelt ihn mit der anderen Hand. Langsam, wie jemand, der erst zu sich kommt, begreift Tom, dass er weint. Ihr Sohn starrt von ihrer Hüfte auf ihn hinunter, Tom lässt das Kind vorsichtig zu Boden rutschen.
Verzeihen Sie, wispert der alte Mann, ich bitte Sie höflich um Verzeihung, aber Sie sehen aus wie sie, meine Schwester, damals, entschuldigen Sie bitte tausend Mal.
Er hat einen leichten Akzent. Russischer Jude, kommt Tom in den Sinn, und etwas Kühles fasst ihr ans Herz. Ihr Sohn zerrt an ihrem Bein und beginnt zu heulen, was kein Wunder ist, sie dreht sich zu ihm, der Mann lässt los und ist im nächsten Augenblick verschwunden.
Wo seid ihr gewesen, fragt da Georg direkt neben ihr, hast du noch nichts zu essen geholt, was hat der Kleine denn?
Und sie verschweigt ihm die Hälfte, erwähnt bloß einen unheimlichen alten Mann, der sie offenbar mit seiner Schwester verwechselt hat.
Du hast keine Doppelgängerin, sagt Georg, du bist einzigartig. Und dabei lacht er auf eine so begeisterte Weise, dass sie denkt, er meine eigentlich jemand anderen.
Den ganzen Abend steht Tom immer wieder auf und geht wegen Kleinigkeiten an die Buffet-Stände. In Wirklichkeit hält sie nach dem traurigen Mann Ausschau. Sie will wissen, was mit seiner Schwester geschehen ist. Wenn ihr etwas unheimlich ist, verlangt es sie nach Erklärungen. Erklärungen sind für sie wie der Strahl einer Taschenlampe in einem dunklen Gruselschloss. Bei Martins Einäscherung sprach sein Arzt – ein Freund der Familie – und teilte mit, wo der Krebs seinen Ausgang genommen hatte. Warum er viel zu spät entdeckt worden war. Wie selten diese Kombination war, der Krebs selbst und sein besonders ungewöhnlicher Ausbruchsort. Während sie an den Bilderbuch-Marktständen vorbeistreift – Fischskelette, schmelzende Eisberge, rauchende Gasherde, auf denen nicht mehr gekocht wird, geplünderte Platten, nur am Dessertstand herrscht noch insofern Ordnung, als die Lücken sofort geschlossen werden – malt sie sich das Gegenteil aus: Ein Begräbnis, wo einer darüber spricht, wie normal und gewöhnlich dieser Tod war, ein Tod, den wir alle sterben könnten und wahrscheinlich sterben werden. Am Ende ein kleiner statistischer Abriss, veranschaulicht an der Zahl der Anwesenden – heute sind wir an die hundert Trauergäste, die sich zum Abschied von unserem Freund Martin versammelt haben. Die Hälfte, also jeder zweite, wird an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sterben, ein Drittel, wie Martin, an Krebs. Danach kommen in unseren Breiten schon die Lebererkrankungen, aber darüber können wir ja anschließend beim Leichenschmaus witzeln, wenn wir endlich wieder ein kühles Glas in der Hand haben. Oder er spräche über die Wahrscheinlichkeit der spontanen Zellmutation, die, wie es immer häufiger heißt, die Hauptursache für Krebs sein soll. Dass die bisherige Krebs-Vererbungslehre, dieses Forschen nach familiärer Vorbelastung, derzeit an Bedeutung verliert. Es ist viel zufälliger: In einer Zelle macht es hops, zwei Jahre später kämpft man, und dann liegt man im Eisfach. Und die alten Freunde fahren in einen Türkeiurlaub mit Wasserrutschen.
Tom weiß, dass sie sich hineinsteigert. Aber das Hineinsteigern ist das einzige, was man überhaupt tun kann. Ein bisschen hineinsteigern, bis zum Weinen. Seit Martin gestorben ist, vor zwei Monaten, hat sich ein Loch aufgetan, das Martins wahrer Rolle in ihrem Leben gar nicht entspricht. Das Loch wandert, manchmal hat sie es im Hals, manchmal im Magen, es war auch schon im Kopf. Jedenfalls ist es zu groß. Früher, ja. Als sie noch Kinder waren, dann Jugendliche. Als sie mit dem Stehlen begannen, in den Kaufhäusern der Innenstadt. Als sie mit dem Stehlen bald wieder aufhörten, weil Judith ihnen zeigte, wo der Hammer hängt. Denn während Martin und sie zitternd Kleinigkeiten in die Taschen gleiten ließen – eine rot-weiß gestreifte Füllfeder hat sie lange besessen, obwohl sie das Ding geradezu fürchtete, als Beweisstück, das noch Jahre später zu ihrer Überführung herangezogen werden könnte –, nahm Judith einfach einen großen Karton von einem Stapel und spazierte damit vor aller Augen hinaus. So selbstverständlich, als hätte sie ihn auch bezahlt. Tom versucht sich zu erinnern, was darin war. Ein Teeset, eine Kanne mit Gläsern und Stövchen. Und danach wollten Martin und sie nicht mehr mitmachen, weil sie ahnten, dass es sich um einen ungleichen, für alle gefährlichen Wettbewerb handelte. Judiths Gesichtsausdruck, wenn sie in den Monaten danach zum Tee lud, in ihrem schwarz eingerichteten Jugendzimmer. Klobige alte Möbel vom Flohmarkt oder vom Sperrmüll, Hauptsache schwarz, an den Wänden Poster von Boeckls aufgeschnittenen Leichnamen. Dazu aromatisierter Tee und Judiths beunruhigendes Grinsen. Einmal gingen sie von einer solchen Tea Time nach Hause, Martin und sie. Tom kommt es vor, als wäre in ihrer Jugend immer November gewesen, Regen, rote Ampeln, die kaum durch den feuchten grauen Nebel drangen mit ihrem Haltebefehl. An der Kreuzung richtete Martin, der bisher zu Boden geschaut hatte, den Blick auf sie wie einen düsteren Scheinwerfer. In letzter Zeit, sagte er, mag ich sie viel weniger und dich viel mehr. Nach dieser Verlautbarung küsste er sie, und merkwürdigerweise war das ein sehr, sehr guter Kuss. Deshalb machten sie damit noch eine Weile weiter, ein paar Wochen vielleicht, und möglicherweise kam es sogar zu Gefummel. Diese Fußnote der Geschichte ist Tom seither peinlich. Obwohl sie doch erst sechzehn waren, sie sich beim besten Willen nicht erinnern kann, wie und warum das Ganze später geendet hat, und auch nie wieder darüber gesprochen wurde.
Tom findet den alten Mann nirgends, auch keine anderen Russen. Die Tische leeren sich langsam, Georg bringt gerade die Kinder ins Bett. Nicht einmal die Schwedin und ihr Freund sind zu sehen, der Tisch, an dem sie meistens essen, ist mit anderen zu einer Tafel zusammengeschoben, an der eine Gruppe junger Engländer lärmt. Wenn sie zumindest die Schwedin und ihren Boyfriend wiederfände, redet sich Tom ein, dann hätte sie nicht zunehmend das Gefühl, dass in diesem Club Menschen verschwinden und andere an den falschen Orten auftauchen. Dieser alte Mann von vorhin sah aus wie jemand aus ihrer Kindheit. Da haben die alten Leute manchmal geweint, so, dass es die Kinder nicht sehen sollten. Deshalb waren sie so unheimlich.
Tom kehrt zu ihrem Tisch zurück und wartet auf Georg. In der Zwischenzeit trinkt sie Gin Tonic. Dafür muss man extra zahlen, jedes Mal wird eine Rechnung gebracht, jedes Mal fragt derselbe Kellner sie nach der Zimmernummer. Plötzlich erscheint er ihr weniger nett. Sein Lächeln ist seifig. Ist er wirklich so dumm, dass er sich die Zimmernummer nicht merken kann, oder ist das seine Art, ihr mitzuteilen, dass er Alkoholkonsum missbilligt? Die Türken sind eigentlich keine religiösen Fundamentalisten. Entweder ist er im Gegenteil intelligent und spult seinen langweiligen Job auf die erträglichste Weise ab, indem er sich vollkommen in sich zurückzieht und jeden Gast, der etwas bei ihm bestellt, in gewisser Weise wieder zum allerersten Mal sieht. Dann fällt es ihm leichter zu lächeln. Oder es liegt an ihr, und sie verwechselt diese jungen Burschen in ihren braunen Uniformen, so wie wir ja auch die Chinesen dauernd verwechseln und die Chinesen uns. Ölige schwarze Haare und ein strahlendweißes Lächeln. Und dann schnippt die Zeit oder das Schicksal oder wer auch immer mit dem Finger, und mit einem Mal haben sie alle Schnurrbärte, Goldzähne und ledrige graue Haut. Dann werden sie Busfahrer. Tom muss lachen. Wir werden von den kaum wahrnehmbaren Zwischenstufen eingelullt. Sie ermöglichen uns, das Leben zu ertragen, das Vergehen der Zeit, das Wenigerwerden von allem, unseren Verfall. Und jetzt versteht sie auch, warum sie immer noch, bei jeder Mahlzeit, die Wege der Nahrung beobachtet, hier in dieser Freizeitfabrik. Das Aufladen durch die Köche, das Wegtragen durch die Urlauber, das Wegkippen durch die flinken Gummihandschuhe. Weil es so schnell geht, dass man ihn endlich einmal deutlich sieht, den Gang der Dinge. Und deshalb fasziniert sie auch – jetzt ist Georg wieder da, er bringt seinen Gin Tonic schon mit. Hat er ihn an der Bar geholt?
Georg, sagt sie, ich weiß endlich, warum mich das dicke schwedische Rapunzel so fasziniert – wegen dem Zeitsprung, den sie schon eingebaut hat! Weißt du? In ihrer Beziehung? Sie ist noch so jung, aber schon so genervt, als wäre sie seit Jahrzehnten verheiratet, und genau das bekommt man selten zu sehen. So, als würden einfach die Jahre dazwischen fehlen!
Verstehe, sagt Georg und lächelt sie vage an. Ich glaube, wir sollten lieber ins Zimmer gehen. Karo hat lange nicht einschlafen können, und ich bin mir nicht sicher, ob sie in Ordnung ist.
Georg, ruft Tom und beugt sich vor, sie haben dir ein schmutziges Glas gegeben, schau doch, da ist noch Lippenstift dran!
In dieser Nacht ist Tom den drei Gin Tonics einzeln und pro Milliliter dankbar. Dabei fühlt sie sich, als Karo um drei Uhr morgens beginnt, sich so schwallartig zu erbrechen wie das verhexte Mädchen im Exorzisten-Film, ziemlich nüchtern. Die kleine Restbetrunkenheit ist hilfreich, ein dämpfender Schleier über den Empfindungen, als auch Georg zu würgen beginnt und sich die Hand vor den Mund presst. Ihn ekelt es vor Erbrochenem so sehr, dass er Tom nicht helfen kann, deshalb sitzt er jetzt, seine gewaschene und halb getröstete Tochter auf dem Schoß, im Bad und summt ihr lustige Lieder ins Ohr. Tom hat keinen Eimer und kein Putzmittel, zur Rezeption möchte sie um diese Zeit nicht gehen, sie benutzt daher das Sandeimerchen ihres Sohnes, den Weinkühler, den sie in einem Schrank gefunden hat, sowie die Shampoofläschchen, die im Bad stehen. Sie hat schon früher bemerkt, dass ihr stupide Arbeiten leichter fallen, wenn sie angetrunken ist. Sie hat dann mehr Geduld, sie ergibt sich dem Rhythmus des Monotonen. Das Bett, in dem Karo geschlafen hat, ist fest mit dem dunkelbraunen Wandpaneel verschraubt, aber dazwischen ist eine wenige Millimeter schmale Ritze, aus der man die Bescherung nur mit einer Zahnbürste herauskratzen kann. Ohne Gin Tonic wäre sie wahrscheinlich verzweifelt, dank Gin Tonic greift sie beherzt nach ihrer eigenen Zahnbürste und verschiebt die Frage ihrer zukünftigen Zahnpflege auf den nächsten Morgen. Auch eine Zeitung ist von unermesslicher Hilfe, das schöne, weiche Zeitungspapier der deutschen Intellektuellen, es saugt so gut. Man ist sich gar nicht bewusst, wie glänzend unsere moderne Welt funktioniert, sogar, wenn die Umstände einmal nicht ganz perfekt sind. Auch improvisierte Hilfsmittel sind von erster Qualität, alles wird wieder sauber, es gibt für alles eine Lösung. Ein Mann, der vor Ekel nicht putzen kann, tröstet stattdessen das Kind. Man nennt das Arbeitsteilung. Aber was Georg eigentlich gegen Martin gehabt hat, versteht sie noch immer nicht. Als sie sich kennenlernten und sie Georg den alten Freunden vorstellte, hatte sie den Eindruck, dass Martin zum ersten Mal zufrieden mit ihr war. Er erkannte Georg an, er hielt ihn nicht für einen Idioten wie all die anderen, mit denen Tom davor zusammen gewesen war. Was Georg wirklich dachte, hat sie damals nicht interessiert, sie nahm an, dass er ihre alten Freunde zumindest mochte.
Karos Laken liegen unter einer eindrucksvollen Schaumkrone in der Badewanne. Tom bereitet das Bett mit Hand- und Badetüchern neu. Die anderen beiden Kinder schlafen fest, das ist wie ein unhörbarer Applaus für Toms praktische Fähigkeiten. Mit einem Waschlappen wischt sie noch einmal alles feucht ab und versprüht ein wenig von Georgs Rasierwasser. Als sie den Weinkühler zum letzten Mal leert, fragt Karo, die auf Georgs Schoß schon fast eingeschlafen ist, warum sie weint. Und dann beginnt das Kind selbst zu weinen und verlangt, Mama anzurufen, auf der Stelle. Tom und Georg müssen noch einmal alle Kräfte zusammennehmen, eine gute Fee gibt ihnen Geduld und Ausdauer. Sie beschwören die Wichtigkeit von Mamas ungestörtem und unbesorgtem Schlaf, sie rühmen des Kindes grandiose Tapferkeit, und während Georg langsam bestimmter wird, versucht es Tom mit klebrigem Verständnis, um einem Wutanfall vorzubeugen. Am Ende erzählt Georg ein Märchen, Tom massiert dem Kind die Füße, und irgendwann schleichen sie sich wie Verschwörer auf Zehenspitzen in ihr eigenes Bett, während draußen die Sonne aus ihrem Nachtquartier steigt und dünne Ärmchen nach dem Horizont zu strecken beginnt. Aber wer gedacht hat, dass nichts so verbindet wie eine gemeisterte Herausforderung, der verkennt, dass die Entscheidung, eine Familie und mehrere Kinder zu haben, leider bedeutet, sich selbst für Jahre um Ressourcen, Reserven und manchmal um den Verstand zu bringen. Georg möchte jetzt Sex, Tom hingegen über Martin und den Tod sprechen, und deshalb wehrt Tom Georgs herüberwandernde Hände mit dem Hinweis ab, dass sie gerade ganz allein, wie eine Putzfrau, die Kotze aufgewischt habe, etwas später sagt Georg, Judith und sie sollten endlich aufhören, sich wie die unmittelbaren Witwen zu benehmen, dann drehen sie sich voneinander weg und hoffen auf eine gnädige Traum- und Vergessensbarriere vor dem Wiedersehen am nächsten Morgen.
Nach ein paar Tagen weicht die Anfangsfremdheit schlagartig einer dumpfen Routine. Aufstehen, frühstücken, Kakao am Automaten, Espresso kostenpflichtig an der Bar, die Kinder vom Nutella-Missbrauch abhalten und versuchen, ihren unvernünftigen Systemen gelegentlich Käse und Rohkost einzuspeisen. Bevor es zum Strand geht, sollen sie zumindest ihre Badesachen von der Wäscheleine holen und in die Tasche packen. Das klappt an keinem einzigen Morgen. Georg brüllt, Tom stopft mit der Miene einer gefolterten Heiligen das Zeug in die Badetasche, bevor sie sie heftig Jonas hinwirft: Wenigstens tragen, Euer Gnaden?
Umso engagierter beginnen sich die Kinder darüber zu beklagen, dass sie jeden Tag das Gleiche essen müssen, dabei nehmen sie bloß das Gleiche vom Buffet. Auch Tom hat in Wahrheit Tomaten, Schafskäse, Lammgulasch und Baklava satt, hält aber Vorträge darüber, dass man hier eine Woche lang täglich etwas anderes essen könnte, wenn man sich pro Mahlzeit auf eine Vor- und eine Hauptspeise beschränke. Ihr fällt auf, dass sie die von ihren Smartphones und iPads hypnotisierten Familien kaum mehr beachtet, und sie beginnt, die normative Kraft dieses Anblicks zu fürchten. Lenny meistert die kleineren Wasserrutschen inzwischen allein und verkündet, es sei der coolste Urlaub aller Zeiten. Im Gegensatz zu den beiden Großen wird seine Erregungskurve am Ende dieser Woche nicht abgeflacht sein, denn für die steilsten Wasserrutschen im Aquapark ist er noch zu jung. Er wird also, zumindest was die Rutschen betrifft, bis zum Ende hungrig bleiben und sich unter dem »Schwarzen Loch« etwas geradezu Übernatürliches vorstellen, wie Fliegen. Tom hat das »Schwarze Loch« am ersten Tag mit Karo ausprobiert und sich durchaus ein wenig gegruselt. Die Plastikröhre, in der man dahinrast, ist schwarz, zum Schluss fällt man überraschend durch einen Trichter in den Pool. Man wird nicht horizontal herausgeschossen, sondern man fällt. Es ist perfekt getimt. Dieser Moment, in dem man begreift, dass sich die Leere unter einem öffnet, ist gerade lang genug. Gleich nachdem einem der Schreck die Luft nimmt, versinkt man schon im lauwarmen Wasser. Und ist wieder sicher. Ein winziges Triezen ist das, nicht mehr. Sieh dich vor, wir könnten auch anders. Von einem Vater, der mit ihr am Beckenrand steht und seine Kinder im Auge behält, erfährt sie, dass diese Wasserrutschen von einer schwäbischen Firma entwickelt werden. Die herrlichen Attraktionen auch noch alle vom TÜV geprüft. Stellen Sie sich das einmal vor, sagt Tom zu dem Mann in seinen knielangen, neongrünen, tropfenden Badeshorts: Tag für Tag an seinem Schreibtisch Wasserrutschen zu entwerfen. Doch der Mann, der wahrscheinlich zwei Liter Wasser in seiner Hose speichert, hält nach seinen Kindern Ausschau und nickt nur höflich, nicht einmal amüsiert.
Die Kinder sind so gut erholt, dass sie schon wieder streiten wie zu Hause. Einmal kommt es zu einer hässlichen Szene zwischen Karo und Lenny. Normalerweise sind sie ein Herz und eine Seele und verbünden sich oft genug gegen Jonas. Aber nachdem sie sich um ein Spielzeug, eine Taucherbrille oder den im Dunkeln leuchtenden Ball, den Tom einem Strandhändler abgekauft hat, gestritten haben, nachdem Karo Siegerin in diesem Streit geworden und mit dem begehrten Gegenstand ein paar Meter weggerannt ist, wo sie ihn mit triumphaler Geste in die Luft reckt, als wäre ihr kleiner Bruder ein Zirkuslöwe, der nun danach springen müsste, da erstarrt Lenny plötzlich wie Lots Frau. Man sieht geradezu, wie es Klick macht in ihm, wie er die Affekte unter Kontrolle bringt, die ihm wahrscheinlich befehlen, zu beißen und zu kratzen, zu schreien und zu treten. Nimms und geh, sagt er mit fremder, tiefer Stimme: Das ist meine Familie!
Aus welchem Köcher es wohl diesen Pfeil geholt hat, das unschuldige jüngste Kind? Und man sieht ihn treffen. Karo lässt das Spielzeug fallen, als hätte es ihr die Hand verbrannt, wie bei den Peanuts scheinen die Tränen horizontal zu spritzen, dann wendet sie sich um und ist mit langen Sprüngen über den Strand verschwunden. Georg wirft Tom einen Blick zu und rennt hinterher. Tom ist so entsetzt, dass sie im ersten Moment nicht weiß, was sie tun soll. Ihre heile Familie. Ihr Vorzeige-Patchwork. Und dann holt so ein Fünfjähriger aus und sticht mitten hinein in die empfindlichen, unübersichtlichen Weichteile der Konstruktion, über die man sich seit Jahren hinwegschwindelt: dass die Beziehungen eben nicht gleich sind, sondern dass es feine Abstufungen gibt, mehr verwandt, weniger verwandt, gar nicht verwandt, letzteres dafür doppelt bemüht.