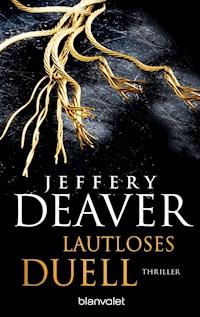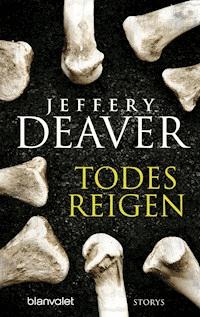
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
16 packende Stories vom Meister der intelligenten Thriller-Spannung!
Perfide Spannung aus der Hand des Meisters: Schlimme Zeiten hat Marissa hinter sich gebracht, nun sieht sie fieberhaft der ersten Verabredung seit dem Tod ihres Mannes entgegen. Doch Dale scheint zu spät zu kommen, denn er ist noch mit der Beseitigung seines neuesten Opfers beschäftigt. Ob Marissa weiß, dass sie ein Rendezvous mit einem Mörder hat? Ausgerechnet am Weihnachtsabend erleben auch Lincoln Rhyme und Amelia Sachs böse Überraschungen. Ein Mann entführt seine Ehefrau, denn er hat sich ein ganz besonderes Geschenk für sie ausgedacht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Ähnliche
Buch
Perfide Spannung in sechzehn Kurzgeschichten aus der Hand des Meisters: Schlimme Zeiten hat Marissa hinter sich gebracht, nun sieht sie fieberhaft der ersten Verabredung seit dem Tod ihres Mannes entgegen. Doch Dale scheint zu spät zu kommen, denn er ist noch mit der Beseitigung seines neuesten Opfers beschäftigt. Ob Marissa weiß, dass sie ein Rendezvous mit einem Mörder hat? Ausgerechnet am Weihnachtsabend erleben auch Lincoln Rhyme und Amelia Sachs böse Überraschungen. Ein Mann entführt seine Ehefrau, denn er hat sich ein ganz besonderes Geschenk für sie ausgedacht …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffrey Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Jeffery Deaver
Todesreigen
Storys
Deutsch von Stefan Lux
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Twisted« bei Simon & Schuster, Inc., New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
E-Book-Ausgabe 2016
Copyright der Originalausgabe © 2003 by Jeffery Deaver
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2005 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright dieser Ausgabe © 2016 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © plainpicture/Anja Weber-Decker
ISBN 978-3-641-19620-2
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Meine Erfahrungen mit der Form der Kurzgeschichte reichen weit zurück in die Vergangenheit.
Ich war ein schwerfälliger, pummeliger, im Umgang mit anderen unbeholfener Junge ohne jede sportliche Begabung. Wie es zu solch einem Kind passt, fühlte ich mich zum Lesen und Schreiben hingezogen, vor allem zu Kurzgeschichtenautoren wie Poe, O. Henry, A. Conan Doyle und Ray Bradbury, und nicht zuletzt auch zu einem der großartigsten Foren für kurze Erzählungen mit überraschenden Schlüssen, die es in den letzten fünfzig Jahren gab: The Twilight Zone. (Kein Fan dieser Fernsehserie soll versuchen, mir zu erzählen, er würde keine Gänsehaut bekommen, wenn er sich an das berühmte Rezeptbuch für den mitmenschlichen Umgang erinnert, To Serve Man.)
Wann immer ich mich auf der Junior High School mit der Aufgabe konfrontiert sah, selbst einen Text zu schreiben, versuchte ich es unweigerlich mit einer Kurzgeschichte. Damals schrieb ich allerdings keine Detektiv- oder Science-Fiction-Storys, sondern schuf voll jugendlicher Anmaßung mein eigenes Subgenre: Fast alle Geschichten handelten von schwerfälligen, pummeligen, im Umgang mit anderen unbeholfenen Jungen, die Cheerleader und Pompom-Girls aus gleichermaßen spektakulären wie unwahrscheinlichen Gefahren retteten, zum Beispiel bei den gewagten Bergsteigerabenteuern meiner Helden (die sich peinlicherweise in unmittelbarer Nähe meines Heimatortes Chicago abspielten, wo Berge bekanntermaßen durch Abwesenheit glänzen).
Diese Erzählungen riefen bei meinen Lehrern genau jenes Maß an Verzweiflung hervor, das man von Menschen erwarten durfte, die Stunden um Stunden damit verbracht hatten, uns den gesamten Pantheon literarischer Superstars als Vorbilder nahe zu bringen. (»Lass uns etwas Besonderes schaffen, Jeffery« – das Sechzigerjahre-Pendant zum heutigen: »Denk außerhalb der Kategorien.«) Zum Glück für ihre geistige Gesundheit und meine Autorenkarriere blieben diese von Unsicherheit geprägten Ergüsse eine Episode, die ich relativ schnell hinter mich brachte, um mich ehrgeizigeren schriftstellerischen Ambitionen zuzuwenden; dieser Weg hat mich zur Poesie, zum Songschreiben, zum Journalismus und schließlich zu Romanen geführt.
Obwohl ich weiterhin mit großem Vergnügen Kurzgeschichten las – in Ellery Queen, Alfred Hitchcock, Playboy (einer Publikation, die angeblich auch Fotos enthält), dem New Yorker und in Anthologien –, schien ich keine Zeit mehr zu haben, selbst welche zu schreiben. Erst einige Jahre später, als ich meinen Brotberuf aufgab, um ausschließlich als Schriftsteller zu arbeiten, bat mich ein Autorenkollege, der gerade eine Anthologie mit unveröffentlichten Geschichten zusammenstellte, zu diesem Band einen Text beizutragen.
Warum nicht?, sagte ich mir und legte los.
Zu meiner Überraschung entpuppte sich die Arbeit als absolut erfreuliche Erfahrung – und zwar aus einem Grund, mit dem ich nicht gerechnet hatte. In meinen Romanen nämlich halte ich mich strikt an die Konventionen; auch wenn ich es liebe, das Böse zunächst als gut erscheinen zu lassen (und umgekehrt) und gegenüber meinen Lesern mit der Möglichkeit eines katastrophalen Ausgangs zu spielen, bleibt am Ende das Gute doch gut und das Böse böse. Und mehr oder weniger konsequent setzt sich das Gute durch. Schriftsteller haben einen Vertrag mit ihren Lesern, und ich würde es mir nicht erlauben, sie ihre Zeit, ihr Geld und ihre Gefühle in einen langen Roman investieren zu lassen, um sie am Ende mit einem trostlosen, zynischen Schluss zu enttäuschen.
Bei einer dreißigseitigen Kurzgeschichte dagegen gelten keine Regeln.
Die Leser investieren nicht im gleichen Maße ihre Gefühle wie bei einem Roman. Der Witz bei einer Kurzgeschichte liegt nicht in einer Achterbahnfahrt voller überraschender Wendungen, in die Figuren verwickelt werden, über die der Leser mit der Zeit einiges erfahren hat und die er liebt oder hasst; es geht auch nicht um spezielle Schauplätze mit sorgfältig beschriebener Atmosphäre. Kurzgeschichten sind wie die Kugeln eines Heckenschützen. Schnell und vernichtend. In solch einer Geschichte kann man aus dem Guten Böses und aus dem Bösen noch Böseres machen, und was am meisten Spaß macht: aus wirklich Gutem wirklich Böses.
Unter handwerklichen Gesichtspunkten schätze ich die Disziplin, die Kurzgeschichten erfordern. Wie ich vor Studenten in Schreibkursen immer wieder betone, ist es viel leichter, lange Texte zu schreiben als kurze. Aber natürlich geht es hier nicht darum, was leicht für den Autor ist; es geht immer darum, was am besten für den Leser ist, und bei Kurzgeschichten können wir uns nicht die geringste Nachlässigkeit leisten.
Schließlich ein Wort des Dankes an alle, die mich ermutigt haben, diese Erzählungen zu schreiben, allen voran Janet Hutchings und ihr unschätzbares Ellery Queen Mistery Magazine, dessen Schwesterpublikation Alfred Hitchcock, Marty Greenberg und das Team von Teknobooks, Otto Penzler und Evan Hunter.
Die nachfolgenden Erzählungen sind ziemlich unterschiedlich. Die auftretenden Figuren reichen von William Shakespeare über brillante Anwälte bis hin zu raffinierten Betrügern, verachtenswerten Mördern und Familien, die man bestenfalls als gestört bezeichnen kann. Eine Story mit Lincoln Rhyme und Amelia Sachs, »Das Weihnachtsgeschenk«, habe ich eigens für diesen Band geschrieben. Und vielleicht fällt Ihnen ja die Geschichte der Rache eines Sonderlings auf, eine – wenn ich das sagen darf – verdrehte Reminiszenz an meine Anfänge als pubertierender Schreiber. Leider kann ich, wie bei den meisten meiner Werke, nicht viel mehr sagen, weil ich fürchte, sonst Hinweise zu geben, die manche Überraschung verderben. Vielleicht ist es am besten, einfach zu sagen: Lesen Sie, genießen Sie … und denken Sie immer daran, dass nicht alles so ist, wie es zu sein scheint.
J. W. D.
Ein Leben ohne Jonathan
Marissa Cooper bog auf die Route 232, die sie von Portsmouth ins dreißig Kilometer entfernte Green Harbor führen sollte.
Sie dachte daran, dass dies genau die Straße war, die sie und Jonathan tausendmal zum Einkaufszentrum und zurück benutzt hatten, beladen mit notwendigen Dingen, albernem Luxus und gelegentlichen Schätzen.
Die Straße, in deren Nähe sie ihr Traumhaus gefunden hatten, als sie vor sieben Jahren nach Maine gezogen waren.
Die Straße, die sie im letzten Mai auf dem Weg zur Feier ihres Hochzeitstags genommen hatten.
Heute allerdings führten all diese Erinnerungen nur zu einem einzigen Punkt: einem Leben ohne Jonathan.
Die Sonne im Rücken, steuerte sie den Wagen durch die trägen Kurven und hoffte, diese schwer zu ertragenden – aber hartnäckigen – Gedanken loszuwerden.
Denk nicht darüber nach!
Schau dich um, sagte sie sich. Schau dir die wilde Umgebung an: die purpurfarbenen Wolkenscheiben über den – teils goldenen, teils blutroten – Ahorn- und Eichenblättern.
Schau dir das Sonnenlicht an, ein leuchtendes, über den dunklen Pelz aus Schierling und Kiefern drapiertes Band. Und die absurde Reihe von Kühen, die sich wie Pendler im Feierabendverkehr auf den Weg zur Scheune gemacht hatten.
Und die würdevollen weißen Türmchen eines kleinen Dorfes fünf Meilen abseits der Landstraße.
Und schau dich selbst an: eine dreiundvierzigjährige Frau in einem kraftvollen silbernen Toyota, die mit hoher Geschwindigkeit einem neuen Leben entgegenfährt.
Einem Leben ohne Jonathan.
Zwanzig Minuten später erreichte sie Dannerville und musste an der ersten der beiden Ampeln der Stadt bremsen. Den Wagen im Leerlauf und die Kupplung durchgetreten, schaute sie nach rechts. Bei dem Anblick, der sich ihr bot, machte ihr Herz einen kleinen Satz.
Es war ein Laden, der Boots- und Angelzubehör verkaufte. Sie hatte im Schaufenster eine Anzeige bemerkt, die Hilfe bei der Wartung von Schiffsmotoren versprach. In diesem küstennahen Teil von Maine hatte man ständig mit Booten zu tun. Sie zierten Touristenzeichnungen und Fotos, Kaffeebecher, T-Shirts und Schlüsselanhänger. Und natürlich gab es sie tausendfach in der Realität: Schiffe auf dem Wasser, auf Autoanhängern und Trockendocks oder in Vorgärten – die Neuengland-Variante der aufgebockten Pickups im ländlichen Süden.
Was sie allerdings heftig getroffen hatte, war der Umstand, dass auf der Anzeige ausgerechnet ein Chris-Craft abgebildet war. Ein großes Boot, vielleicht elf oder zwölf Meter lang.
Genau wie Jonathans Boot. Sogar fast identisch: die gleichen Farben, der gleiche Aufbau.
Er hatte es vor fünf Jahren gekauft. Und obgleich Marissa gedacht hatte, sein Interesse daran würde abflauen (wie bei allen Jungen, die ein neues Spielzeug bekommen), hatte er ihr genau das Gegenteil bewiesen und beinahe jedes Wochenende auf dem Meer verbracht. Er war die Küste auf und ab gefahren und hatte geangelt wie ein alter Deckshelfer auf einem Dorschkutter. Seinen stolzesten Fang brachte ihr Ehemann dann jedes Mal mit nach Hause, wo sie ihn reinigte und kochte.
Ah, Jonathan …
Sie schluckte heftig und atmete langsam ein, um ihr hämmerndes Herz zu beruhigen. Sie …
Ein Hupen hinter ihr. Die Ampel hatte auf Grün umgeschaltet. Sie fuhr weiter und versuchte verzweifelt, ihre Gedanken von den Umständen seines Todes abzulenken: Das Chris-Craft, das unsicher im turbulenten Grau des Atlantiks schaukelte. Jonathan über Bord. Mit seinen Armen möglicherweise verzweifelt winkend, seine panische Stimme vielleicht um Hilfe rufend.
Oh, Jonathan …
Marissa passierte Dannervilles zweite Verkehrsampel und setzte ihren Weg Richtung Küste fort. Im letzten Sonnenlicht konnte sie vor sich den Saum des Atlantiks erkennen, all das kalte, mörderische Wasser.
Das Wasser, das verantwortlich war für ihr Leben ohne Jonathan.
Dann sagte sie sich: Nein. Denk lieber an Dale.
Dale O’Bannion, der Mann, den sie in Green Harbor zum Abendessen treffen würde. Das erste Mal nach langer Zeit, dass sie sich mit einem Mann verabredet hatte.
Kennen gelernt hatte sie ihn durch eine Anzeige in einer Zeitschrift. Sie hatten einige Male telefoniert, und nach einigem Hin und Her auf beiden Seiten hatte sie sich sicher genug gefühlt, um ihm persönlich zu begegnen. Sie hatten sich aufs Fishery geeinigt, ein beliebtes Restaurant am Kai.
Dale hatte das Oceanside Café erwähnt, das tatsächlich die bessere Küche bot, doch das war Jonathans Lieblingsrestaurant; dort konnte sie Dale einfach nicht treffen.
Also das Fishery.
Sie dachte an ihr Gespräch vom letzten Abend zurück. Dale hatte gesagt: »Ich bin groß, ziemlich kräftig gebaut und ein bisschen kahl auf dem Schädel.«
»Also gut«, hatte sie nervös erwidert. »Ich bin einsfünfundsechzig, blond und werde ein purpurfarbenes Kleid tragen.«
Sie dachte nun über diese Worte nach. Wie typisch dieser simple Austausch doch für ein Leben als Single war, wie leicht man Menschen traf, die man nur vom Telefon kannte.
Sie hatte kein Problem damit, sich zu verabreden. Im Gegenteil, irgendwie freute sie sich darauf. Sie hatte ihren Mann kennen gelernt, als er kurz davor stand, sein Medizinstudium abzuschließen, und sie selbst erst einundzwanzig war. Sie hatten sich beinahe auf der Stelle verlobt; das war das Ende ihres sozialen Lebens als allein stehende Frau gewesen. Jetzt konnte sie ein bisschen Spaß gebrauchen. Sie wollte interessante Männer kennen lernen und wieder anfangen, den Sex zu genießen.
Auch wenn es zuerst anstrengend sein würde, wollte sie sich so gut es ging entspannen. Sie würde versuchen, keine Bitterkeit zu empfinden, nicht allzu witwenhaft zu wirken.
Aber noch während sie so dachte, gingen ihre Gedanken in eine ganz andere Richtung: Würde sie sich wirklich jemals wieder verlieben?
So ganz und gar, wie sie sich in Jonathan verliebt hatte?
Und würde irgendjemand sie ganz und gar lieben?
Als sie abermals an einer roten Ampel halten musste, griff Marissa nach dem Rückspiegel, drehte ihn in ihre Richtung und schaute hinein. Die Sonne war inzwischen hinter dem Horizont verschwunden, und das Licht war dämmrig. Trotzdem glaubte sie, den Rückspiegel-Test mit Bravour bestanden zu haben: volle Lippen, ein faltenloses Gesicht, das an Michelle Pfeiffer erinnerte (in einem schlecht beleuchteten Toyota-Spiegel zumindest), eine zierliche Nase.
Und schließlich war auch ihr Körper immer noch schlank und fest. Obwohl ihr klar war, dass ihre Titten sie nicht aufs Cover des neuesten Victoria’s-Secret-Katalogs bringen würden, hatte sie doch das Gefühl, dass ihr Hintern in einer hübschen, engen Jeans einige Blicke auf sich ziehen würde.
Jedenfalls in Portsmouth, Maine.
Ja, verdammt, sagte sie sich, sie würde schon einen Mann finden, der zu ihr passte.
Jemanden, der das Cowgirl in ihr zu schätzen wüsste, das Mädchen, das von seinem texanischen Großvater das Reiten und Schießen gelernt hatte.
Vielleicht würde sie auch jemanden finden, der ihre akademische Seite liebte – das Schreiben, ihre Poesie und ihre Liebe zum Unterrichten, was nach dem College eine Zeit lang ihr Job gewesen war.
Oder jemanden, der mit ihr lachen konnte – über Filme, über Szenen auf der Straße, über lustige Witze und über dumme. Wie sie das Lachen liebte (und wie wenig sie es in letzter Zeit getan hatte).
Dann dachte Marissa Cooper: Nein, warte, warte … Sie würde einen Mann finden, der alles an ihr liebte.
Aber sofort begannen die Tränen über ihr Gesicht zu laufen, und sie hielt schnell am Straßenrand, um das Schluchzen in den Griff zu bekommen.
»Nein, nein, nein …«
Gewaltsam verdrängte sie das Bild ihres Mannes aus ihrer Vorstellung.
Das kalte Wasser, das graue Wasser …
Fünf Minuten später hatte sie sich beruhigt. Ihre Augen getrocknet, Make-up und Lippenstift erneuert.
Sie fuhr ins Zentrum von Green Harbor und hielt auf einem Parkplatz in der Nähe der Geschäfte und Restaurants, einen halben Block vom Kai entfernt.
Ein Blick auf die Uhr. Es war gerade halb sieben. Dale O’Bannion hatte erklärt, er müsse bis gegen sieben Uhr arbeiten und würde sie dann um halb acht treffen.
Sie war früher in die Stadt gekommen, um noch Einkäufe zu erledigen – eine kleine Shopping-Therapie. Danach würde sie das Restaurant aufsuchen und auf Dale O’Bannion warten. Plötzlich überkamen sie Zweifel, ob es angemessen war, sich allein an die Bar zu setzen und ein Glas Wein zu trinken.
Schließlich wies sie sich energisch zurecht: Was, zum Teufel, denkst du eigentlich? Natürlich ist es in Ordnung. Sie konnte tun, was sie wollte. Es war ihre Nacht.
Los, Mädchen, raus mit dir. Fang dein neues Leben an!
Im Gegensatz zum gehobeneren Green Harbor ist das fünfundzwanzig Kilometer südlich gelegene Yarmouth in Maine vor allem eine Fischerei- und Verpackungsstadt. Als solche besteht sie überwiegend aus Hütten und Bungalows, deren Bewohner Fahrzeuge wie F-150er und japanische Halbtonner bevorzugen. Natürlich auch SUVs.
Direkt außerhalb der Stadt allerdings findet sich eine Gruppe hübscher Häuser auf einem bewaldeten Hügel, von dem aus man die Bucht überblickt. Bei den Autos in diesen Einfahrten handelt es sich bevorzugt um Lexus- und Acura-Modelle. Die SUVs hier sind mit Ledersitzen und Navigationssystemen ausgestattet, nicht mit primitiven Aufklebern und Jesus-Fischen wie ihre Nachbarn im Stadtzentrum.
Dieses Viertel hat sogar einen Namen: Cedar Estates.
In einem hellbraunen Overall schritt Joseph Bingham die Auffahrt zu einem der Häuser hinauf, wobei er auf die Uhr schaute. Er hatte die Adresse zweimal überprüft, um ganz sicherzugehen, dass er das richtige Haus gefunden hatte. Dann drückte er auf die Klingel. Kurz darauf öffnete eine hübsche Frau Ende dreißig die Tür. Sie war dünn, hatte leicht krause Haare, und sogar durch die Fliegengittertür hindurch roch sie nach Alkohol. Sie trug hautenge Jeans und einen weißen Pullover.
»Ja?«
»Ich komme von der Kabelgesellschaft.« Er zeigte ihr den Ausweis. »Ich muss Ihre Konverterboxen umstellen.«
Sie blinzelte. »Der Fernseher?«
»Ganz genau.«
»Gestern hat er noch funktioniert.« Sie drehte sich um und warf einen unsteten Blick auf das glänzende graue Rechteck des großen Apparates in ihrem Wohnzimmer. »Warten Sie, ich habe eben noch CNN gesehen. Es hat funktioniert.«
»Sie bekommen nur die Hälfte der Kanäle, die Sie eigentlich empfangen sollten. Das gilt für dieses ganze Viertel. Wir müssen es per Hand neu einstellen. Ich kann natürlich einen neuen Termin machen, wenn …«
»Nee, ist schon in Ordnung. Will COPS nicht verpassen. Kommen Sie rein.«
Joseph trat ein und spürte ihre Blicke auf sich. So etwas passierte ihm häufiger. Seine Karriere verlief nicht unbedingt großartig, und er sah auch nicht im klassischen Sinn gut aus. Doch er war in exzellenter körperlicher Verfassung – schließlich trainierte er jeden Tag – und hatte schon oft gehört, dass er eine besondere maskuline Energie »ausschwitze«. Dazu konnte er nichts sagen. Er betrachtete sich am liebsten einfach als jemanden mit einer Menge Selbstvertrauen.
»Wollen Sie einen Drink?«, fragte sie.
»Geht nicht bei der Arbeit.«
»Sicher?«
»Ja.«
In Wirklichkeit hätte Joseph nichts gegen einen Drink einzuwenden gehabt. Aber dies war nicht der Ort dafür. Davon abgesehen freute er sich auf ein hübsches Glas würzigen Pinot Noir, wenn er hier fertig wäre. Viele Leute waren überrascht, dass jemand mit seinem Beruf Wein mochte – und etwas davon verstand.
»Ich heiße Barbara.«
»Hi, Barbara.«
Sie führte ihn ins Haus zu den Kabelboxen und nippte beim Gehen an ihrem Drink. Es sah so aus, als tränke sie unverdünnten Bourbon.
»Sie haben Kinder«, sagte Joseph und deutete mit dem Kopf auf ein Bild zweier kleiner Kinder auf einem Tisch im Wohnzimmer. »Kinder sind großartig, nicht wahr?«
»Wenn man auf Landplagen steht«, murrte sie.
Er drückte Knöpfe an der Kabelbox und erhob sich. »Gibt’s noch andere?«
»Die letzte Box steht im Schlafzimmer. Oben. Ich zeige es Ihnen. Warten Sie …« Sie ging aus dem Zimmer und füllte ihr Glas auf. Dann kehrte sie zu ihm zurück. Barbara führte ihn die Treppe hinauf und blieb oben stehen. Wieder musterte sie ihn von oben bis unten.
»Wo sind Ihre Kinder heute Abend?«
»Die Landplagen sind beim Saftsack«, erklärte sie und lachte verdrießlich über ihren eigenen Witz. »Mein Ex und ich, wir haben getrenntes Sorgerecht.«
»Dann sind Sie also ganz allein in diesem großen Haus?«
»Ja. Schade, was?«
Joseph wusste nicht, ob es schade war oder nicht. Sie wirkte jedenfalls nicht besonders Mitleid erregend.
»Also«, sagte er, »in welchem Zimmer ist die Box?« Sie standen beide im Flur.
»Ja, klar. Folgen Sie mir«, sagte sie mit tiefer, verführerischer Stimme.
Sie ging ins Schlafzimmer voran, setzte sich auf das ungemachte Bett und nippte an ihrem Drink. Er fand die Kabelbox und drückte auf den »On«-Schalter des Fernsehers.
Knisternd erwachte er zum Leben und zeigte CNN.
»Könnten Sie die Fernbedienung ausprobieren?«, sagte er und schaute sich im Zimmer um.
»Klar«, erwiderte Barbara träge. Sie drehte sich um. Im selben Augenblick trat Joseph mit dem Strick, den er gerade aus seiner Tasche gezogen hatte, hinter sie. Er legte ihn um ihren Hals und drehte ihn immer enger, wobei er einen Bleistift als Hebel benutzte. Als ihre Kehle zusammengepresst wurde, war ein erstickter Schrei zu hören. Verzweifelt versuchte sie, zu fliehen, sich umzudrehen, ihn mit den Fingernägeln zu kratzen. Ihr Glas fiel auf den Teppich und rollte gegen die Wand, die Flüssigkeit ergoss sich über die Tagesdecke.
In wenigen Minuten war sie tot.
Joseph saß neben der Leiche und versuchte, zu Atem zu kommen. Barbara hatte überraschend heftig gekämpft. Er hatte seine ganze Kraft aufwenden müssen, um sie niederzuhalten und die Garrotte ihre Arbeit tun zu lassen.
Er streifte sich Latexhandschuhe über und wischte sämtliche Fingerabdrücke ab, die er im Zimmer hinterlassen hatte. Dann zerrte er Barbaras Leiche vom Bett herunter in die Mitte des Zimmers. Er zog ihr den Pullover aus und öffnete die Knöpfe ihrer Jeans.
Dann hielt er inne. Moment. Wie sollte sein Name gleich sein?
Er legte die Stirn in Falten und versuchte, sich an das Gespräch vom gestrigen Abend zu erinnern.
Wie hatte er sich genannt?
Schließlich nickte er. Richtig. Er hatte Marissa Cooper gegenüber behauptet, er heiße Dale O’Bannion. Ein Blick auf die Uhr. Noch nicht einmal sieben. Genug Zeit, um hier fertig zu werden und nach Green Harbor zu fahren, wo sie wartete und wo die Bar einen anständigen Pinot Noir anbot.
Er öffnete den Reißverschluss von Barbaras Jeans und zog sie bis zu den Knöcheln herunter.
Zusammengekauert, um sich vor dem kalten Wind zu schützen, der über den Kai von Green Harbor wehte, saß Marissa Cooper auf einer Bank in einem kleinen, menschenleeren Park. Durch die immergrünen Büsche, die im Wind schwankten, beobachtete sie das Paar, das es sich im Heck eines großen Bootes bequem gemacht hatte, das am nahe gelegenen Dock festgemacht war.
Wie so viele Bootsnamen war auch dieser ein Wortspiel: Maine Street.
Sie hatte ihre Einkaufstour beendet, bei der sie ausgefallene Unterwäsche erstanden hatte (und sich, ein wenig mutlos, gefragt hatte, ob sie jemals irgendwer darin sehen würde), und sich auf den Weg zum Restaurant gemacht, als die Lichter des Hafens – und die sanft wiegende Bewegung dieses eleganten Bootes – ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten.
Durch die Plastikfenster des Achterdecks der Maine Street sah sie das Paar Champagner nippen und dicht beieinander sitzen. Ein hübsches Paar – er war groß und sehr gut gebaut und hatte kräftiges grau meliertes Haar, sie war blond und hübsch. Sie lachten und redeten. Flirteten wie verrückt. Dann hatten sie den Champagner ausgetrunken und verschwanden in der Kabine. Die Teakholztür wurde zugeschlagen.
Marissa dachte an die Unterwäsche in der Einkaufstasche, die sie bei sich trug, dachte an künftige Verabredungen und stellte sich noch einmal Dale O’Bannion vor. Sie versuchte, sich auszumalen, wie der Abend wohl verlaufen würde. Ein Frösteln überfiel sie. Sie stand auf und machte sich auf den Weg zum Restaurant.
Über einem Glas gutem Chardonnay (kühn hatte sie ganz allein an der Bar Platz genommen – na also, Mädchen!) ließ Marissa ihre Gedanken zu der Frage schweifen, was sie beruflich tun würde. Sie hatte es nicht besonders eilig. Es gab schließlich das Geld von der Versicherung. Und die Sparkonten. Das Haus war beinahe abbezahlt. Aber es ging ja nicht darum, dass sie arbeiten musste. Es ging darum, dass sie arbeiten wollte. Unterrichten. Oder Schreiben. Vielleicht würde sie einen Job bei einer der lokalen Tageszeitungen bekommen.
Sie könnte sogar Medizin studieren. Sie erinnerte sich daran, wie Jonathan ihr manchmal von seiner Arbeit im Krankenhaus erzählt und sie alles problemlos verstanden hatte. Marissa hatte einen logischen Verstand und war eine brillante Studentin gewesen. Hätte sie damals die Graduate School besucht, dann hätte sie ein volles Stipendium für ihren Magisterabschluss erhalten können.
Noch ein Glas Wein.
Sie war traurig, dann wieder euphorisch. Ihre Stimmungen tanzten hin und her wie die orangefarbenen Bojen, mit denen man die auf dem Boden des grauen Ozeans liegenden Hummerfallen markierte.
Der mörderische Ozean.
Wieder dachte sie an den Mann, auf den sie in diesem romantischen, mit Kerzen beleuchteten Restaurant wartete.
Ein Augenblick der Panik. Sollte sie Dale anrufen und ihm sagen, dass sie noch nicht dazu bereit wäre?
Fahr nach Hause, trink noch ein Glas Wein, leg Mozart auf, zünde ein Kaminfeuer an. Sei zufrieden mit deiner eigenen Gesellschaft.
Sie wollte schon die Hand heben, um den Barkeeper um die Rechnung zu bitten.
Dann plötzlich kam ihr eine andere Erinnerung. Eine Erinnerung aus dem Leben vor Jonathan. Sie erinnerte sich daran, wie sie als kleines Mädchen auf einem Pony neben ihrem Großvater hergeritten war, der auf seinem großen Appaloosa saß. Sie hatte den hageren alten Mann beobachtet, wie er ruhig einen Revolver zog und auf eine Klapperschlange richtete, die sich zusammengeringelt hatte, um Marissas Shetland-Pony anzugreifen. Der plötzliche Schuss verwandelte die Schlange in ein blutiges Häufchen im Sand.
Er hatte sich Sorgen gemacht, dass das Mädchen, das Zeugin des Todes geworden war, verstört reagieren würde. Als sie das Ende des Weges erreicht hatten, waren sie abgestiegen. Er hatte sich neben sie gehockt und ihr erklärt, sie solle nicht traurig sein – er habe die Schlange erschießen müssen. »Aber mach dir keine Sorgen, Schatz. Ihre Seele ist auf dem Weg in den Himmel.«
Sie hatte die Stirn gerunzelt.
»Was ist los?«, hatte ihr Großvater gefragt.
»Das ist blöd. Ich will, dass sie in die Hölle kommt.«
Marissa vermisste dieses robuste kleine Mädchen. Und ihr war klar, dass, wenn sie jetzt Dale anriefe und ihm absagte, sie bei einer wichtigen Prüfung versagt hätte. Es wäre genauso, als ließe sie zu, dass die Schlange ihr Pony biss.
Nein. Dale war der erste Schritt, ein absolut notwendiger Schritt, um mit ihrem Leben ohne Jonathan voranzukommen.
Und dann stand er vor ihr – ein gut aussehender Mann mit beginnender Glatze. Gut gebaut, wie sie bemerkte, in einem dunklen Anzug. Darunter trug er ein schwarzes T-Shirt, nicht das weiße Polyesterhemd und die fade Krawatte, denen man in dieser Gegend so häufig begegnete.
Sie winkte, und er antwortete mit einem charmanten Lächeln.
Er trat auf sie zu. »Marissa? Ich bin Dale.«
Ein fester Händedruck. Den sie ebenso fest erwiderte.
Er setzte sich zu ihr an die Bar und bestellte ein Glas Pinot Noir, schnüffelte genussvoll daran und stieß mit ihr an.
Sie nippten an ihrem Wein.
»Ich war mir nicht sicher, ob Sie es rechtzeitig schaffen würden«, sagte sie. »Manchmal ist es schwierig, die Arbeit dann zu verlassen, wenn man will.«
Noch einmal sog er den Duft des Weines ein. »Ich bin im Prinzip mein eigener Herr, was die Arbeitszeiten betrifft«, erklärte er.
Sie plauderten einige Minuten und gingen dann zum Pult der Hostess. Die Frau führte sie zu dem Tisch, den er reserviert hatte, und sie nahmen einander gegenüber am Fenster Platz. Von der Außenwand des Restaurants leuchteten Scheinwerfer auf das Grau des Wassers; zuerst beunruhigte sie der Anblick, ließ sie an Jonathan in dem mörderischen Ozean denken, doch sie schob diese Gedanken beiseite und konzentrierte sich auf Dale.
Sie unterhielten sich. Er war geschieden und hatte keine Kinder, obwohl er sich immer welche gewünscht hatte. Sie und Jonathan hatten ebenfalls keine Kinder bekommen, erklärte sie. Sie redeten über das Wetter in Maine und über Politik.
»Waren Sie einkaufen?«, fragte er lächelnd. Mit dem Kopf deutete er auf die rosa und weiß gestreifte Einkaufstasche, die sie neben ihrem Stuhl deponiert hatte.
»Lange Unterwäsche«, lachte sie. »Der Winter soll kalt werden.«
Sie redeten noch eine Weile, tranken zusammen eine Flasche Wein, dann jeweils noch ein Glas, obwohl sie den Eindruck nicht loswurde, sie tränke mehr als er.
Sie wurde langsam beschwipst. Vorsicht jetzt, Mädchen, behalt einen klaren Kopf.
Dann aber dachte sie an Jonathan und leerte ihr Glas in einem Zug.
Gegen zehn schaute er sich in dem leerer werdenden Restaurant um. Er fixierte sie mit seinem Blick und sagte: »Wie wäre es, wenn wir nach draußen gingen?«
Marissa zögerte. Okay, jetzt kommt’s, dachte sie. Du kannst dich verabschieden, oder du kannst mit ihm nach draußen gehen.
Sie erinnerte sich an ihre Vorsätze, sie erinnerte sich an Jonathan.
Sie sagte: »Ja, gehen wir.«
Draußen schlenderten sie Seite an Seite zurück zu dem verlassenen Park, in dem sie vor ein paar Stunden gesessen hatte.
Sie kamen an der Bank von vorhin an. Sie nickte, und beide nahmen Platz, Dale dicht neben ihr. Sie spürte seine Gegenwart – die Nähe eines starken Mannes, die sie schon eine Weile nicht mehr gespürt hatte. Es war erregend, gleichzeitig beruhigend und beunruhigend.
Sie schauten zu dem Boot hinüber, der Maine Street, die durch die Bäume hindurch gerade noch zu erkennen war.
Einige Minuten saßen sie schweigend da, in der Kälte zusammengekauert.
Dale streckte sich. Sein Arm wanderte zur Rückseite der Bank, nicht direkt um ihre Schultern, aber sie spürte seine Muskeln.
Wie stark er doch war, dachte sie.
In diesem Augenblick sah sie nach unten und bemerkte das verdrehte Ende eines weißen Stricks, der aus seiner Tasche hervorschaute und beinahe herausfiel.
Sie deutete mit dem Kopf darauf. »Sie verlieren gleich etwas.«
Er blickte hinab. Griff nach dem Strick, ließ ihn durch seine Finger gleiten. Zog ihn auseinander. »Arbeitsmaterial«, erklärte er und betrachtete ihr zweifelndes Stirnrunzeln.
Dann steckte er ihn wieder in die Tasche zurück.
Dale wandte seinen Blick erneut der Maine Street zu, die durch die Bäume gerade noch zu sehen war. Beobachtete das Paar, das inzwischen den Schlafraum verlassen hatte und auf dem Achterdeck wieder Champagner trank.
»Das ist er dort drüben, der gut aussehende Typ?«, fragte er.
»Ja«, bestätigte Marissa. »Das ist mein Mann. Das ist Jonathan.« Sie zitterte abermals vor Kälte – und vor Abscheu –, als sie beobachtete, wie er die zierliche Blondine küsste.
Sie wollte Dale gerade fragen, ob er es heute tun würde – ihren Mann umbringen. Dann aber kam ihr der Gedanke, dass er, wahrscheinlich wie die meisten professionellen Mörder, sich wohl lieber in Euphemismen ausdrückte. Sie fragte einfach: »Wann wird es passieren?«
Langsam entfernten sie sich vom Kai; er hatte gesehen, was er sehen musste.
»Wann?«, fragte Dale. »Das kommt darauf an. Diese Frau bei ihm auf dem Boot, wer ist sie?«
»Eine seiner kleinen Krankenschwester-Schlampen. Ich weiß es nicht. Karen vielleicht.«
»Bleibt sie über Nacht?«
»Nein. Ich habe ihm einen Monat lang nachspioniert. Gegen Mitternacht wird er sie hinauswerfen. Klammernde Geliebte kann er nicht ausstehen. Morgen wird die Nächste dort sein. Aber nicht vor Mittag.«
Dale nickte. »Dann mache ich es heute Nacht. Wenn sie gegangen ist.«
Er betrachtete Marissa. »Ich werde so vorgehen, wie ich es Ihnen erklärt habe. Wenn er schläft, gehe ich an Bord, fessle ihn und bringe das Boot ein paar Meilen nach draußen. Dann lasse ich es so aussehen, als hätte er sich im Ankertau verfangen und wäre über Bord gegangen. Meinen Sie, er hat viel getrunken?«
»Gibt’s im Ozean Wasser?«, fragte sie ironisch.
»Gut, das wird die Sache erleichtern. Nachher steuere ich das Boot in die Nähe von Huntington und benutze eine aufblasbare Rettungsinsel für den Rückweg. Ich lasse sie einfach treiben.« Er nickte in Richtung der Maine Street.
»Lassen Sie es jedes Mal nach einem Unfall aussehen?«, fragte Marissa und war neugierig, ob eine solche Frage irgendwelche Killer-Spielregeln verletzte.
»Sooft ich kann. Habe ich diesen Job erwähnt, den ich heute Abend erledigt habe? Ich musste mich um eine Frau in Yarmouth kümmern. Sie hatte ihre eigenen Kinder misshandelt. Geprügelt, meine ich. ›Landplagen‹ hat sie sie genannt. Ekelhaft. Sie hörte einfach nicht auf, und der Ehemann konnte die Kinder nicht dazu überreden, zur Polizei zu gehen. Sie wollten ihre Mutter nicht in Schwierigkeiten bringen.«
»Gott, wie schrecklich.«
Dale nickte. »Das kann man wohl sagen. Deshalb hat der Ehemann mich engagiert. Ich habe es so arrangiert, dass es so aussieht, als wäre der Vergewaltiger von Upper Falls eingebrochen und hätte sie getötet.«
Marissa dachte nach; dann fragte sie: »Haben Sie …? Ich meine, Sie wollten so tun, als wären Sie ein Vergewaltiger …«
»Nein, um Gottes willen«, protestierte Dale und runzelte die Stirn. »Das würde ich niemals tun. Ich habe es bloß so aussehen lassen. Glauben Sie mir, es war einigermaßen unangenehm, hinter diesem Massagesalon in der Knightsbridge Street nach einem benutzten Kondom zu suchen.«
Also haben Killer doch ihre Moralvorstellungen, dachte sie. Manche wenigstens.
Sie musterte ihn. »Haben Sie keine Angst, dass ich Polizistin oder so etwas sein könnte? Und versuche, Sie zu überführen? Ich meine, ich habe Ihren Namen einfach in diesem Magazin gefunden, Worldwide Soldier.«
»Wenn man es lange genug macht, bekommt man ein Gefühl dafür, wer ein echter Kunde ist und wer nicht. Abgesehen davon habe ich die letzte Woche damit verbracht, Sie zu überprüfen. Sie sind sauber.«
Wenn man eine Frau, die jemandem fünfundzwanzigtausend Dollar für den Mord an ihrem Ehemann bezahlt, als sauber bezeichnen kann.
A propos …
Sie zog einen dicken Umschlag aus der Tasche und reichte ihn Dale. Er ließ ihn in der Tasche mit dem weißen Strick verschwinden.
»Dale … warten Sie, das ist nicht Ihr richtiger Name, oder?«
»Nein, aber ich benutze ihn für diesen Job.«
»Okay, also Dale, er wird doch nichts spüren? Keine Schmerzen?«
»Überhaupt nichts. Selbst wenn er bei Bewusstsein wäre, ist das Wasser so kalt, dass er wahrscheinlich in Ohnmacht fällt und am Schock stirbt, bevor er ertrinkt.«
Sie hatten das Ende des Parks erreicht. Dale fragte: »Und Sie sind sich wirklich sicher?«
Und Marissa fragte sich: Bin ich wirklich sicher, dass ich Jonathans Tod will?
Jonathan – der Mann, der mir erzählt, dass er jedes Wochenende mit seinen Kumpels zum Angeln hinausfährt und in Wirklichkeit seine Krankenschwestern für ein kleines Stelldichein aufs Boot mitnimmt. Der einige Jahre nach der Heirat verkündet hatte, er habe sich sterilisieren lassen und könne die Kinder nicht zeugen, von denen er versprochen hatte, dass wir sie bekommen würden.
Der über seinen Beruf oder aktuelle Ereignisse mit mir wie mit einer Zehnjährigen spricht, ohne es jemals zu registrieren, wenn ich sage: »Ich verstehe es, Schatz. Ich bin eine kluge Frau.« Der so lange herumgenörgelt hat, bis ich den Job aufgab, den ich gern gemacht hatte. Der jedes Mal mit einem Wutanfall reagiert, wenn ich wieder arbeiten möchte. Der sich jedes Mal beschwert, wenn ich mich in der Öffentlichkeit sexy kleide, aber seit Jahren nicht mehr mit mir schläft. Der jähzornig reagiert, sobald ich das Thema Scheidung anspreche, weil ein Arzt an einem Lehrkrankenhaus eine Ehefrau braucht, um Karriere zu machen … und weil er ein kranker Kontrollfanatiker ist.
Plötzlich sah Marissa Cooper den zerfetzten Leib einer Klapperschlange vor sich, der vor vielen Jahren blutend auf einem heißen gelben Fleck texanischen Sandes gelegen hatte.
Das ist blöd. Ich will, dass sie in die Hölle kommt.
»Ich bin mir sicher«, erklärte sie.
Dale schüttelte ihre Hand und sagte: »Dann werde ich mich von jetzt ab um die Angelegenheit kümmern. Fahren Sie nach Hause. Sie sollten üben, die trauernde Witwe zu spielen.«
»Das werde ich schon hinkriegen«, erwiderte Marissa. »Ich war jahrelang eine trauernde Ehefrau.«
Sie zog ihren Mantelkragen hoch und machte sich auf den Weg zum Parkplatz, ohne sich noch einmal nach ihrem Mann oder dem, der ihn umbringen würde, umzusehen. Sie stieg in ihren Toyota, fand Rockmusik im Radio, drehte die Lautstärke hoch und verließ Green Harbor.
Marissa kurbelte die Fenster herunter und ließ kalte Herbstluft ins Auto, die mit den Gerüchen von verbranntem Holz und faulenden Blättern angefüllt war. Sie fuhr schnell durch die Nacht und stellte sich ihre Zukunft vor, ihr Leben ohne Jonathan.
Das Ferienhaus
An diesem Abend lief es schon bald in die falsche Richtung.
Ich schaute in den Rückspiegel und konnte keine Lichter erkennen, aber ich wusste, dass sie hinter uns waren und dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ich die Blaulichter sehen würde.
Toth fing an zu reden, aber ich sagte, er solle den Mund halten, und jagte den Buick auf hundertzwanzig hoch. Die Straße war leer, kilometerweit war nichts zu sehen außer Kiefern.
»Oh, Junge«, brummte Toth. Ich spürte, dass seine Augen auf mich gerichtet waren. Aber ich war so wütend, dass ich ihn nicht mal ansehen wollte.
Drugstores waren niemals einfach.
Weil nämlich – beobachten Sie es einfach mal! – Cops, die ihre Runden machen, häufiger an Drugstores vorbeifahren als irgendwo sonst. Wegen all dem Percodan und Valium und den anderen Medikamenten. Sie wissen schon.
Man sollte meinen, sie überwachen Lebensmittelläden. Aber die sind ein Witz, und außerdem wird man von diesen Überwachungskameras automatisch gefilmt. Keine Chance. Deshalb wird niemand, der sein Geschäft versteht – ich meine: wirklich versteht –, solche Läden überfallen. Und Banken, vergessen Sie’s! Sogar Geldautomaten. Ich meine, wie viel kann man da rausholen? Drei-, vierhundert maximal. Und hier in der Gegend spuckt einem der »Fast Cash«-Knopf gerade mal zwanzig aus. Was eigentlich schon bezeichnend ist. Wozu also die Mühe?
Nein. Wir wollten Bares, und dafür kam nur ein Drugstore in Frage, auch wenn das kniffliger ist. Ardmore Drugs. Ein großer Laden in einer kleinen Stadt. Liggett Falls. Neunzig Kilometer entfernt von Albany und etwa hundertfünfzig von dort, wo Toth und ich lebten, weiter westlich in den Bergen. Man sollte denken, es wäre sinnlos, in dieser Gegend einen Laden zu überfallen. Aber genau darum geht es ja: Die Leute dort brauchen ihre Medikamente und ihr Haarspray und Make-up wie überall sonst. Allerdings können sie nicht mit Kreditkarten zahlen. Höchstens bei Sears oder Penney. Also zahlt man bar.
»Oh, Junge«, flüsterte Toth wieder. »Schau mal!«
Dass er so was sagte, machte mich noch wütender. Ich wollte schon losbrüllen: Was soll ich denn anschauen, du Arsch? Aber dann konnte ich sehen, was er meinte, und hielt den Mund. Direkt vor uns. Es sah aus wie kurz vor der Morgendämmerung, wenn es am Horizont hell wird. Bloß war das Licht hier rot und außerdem gleichmäßig. Es schien zu pulsieren, und mir war klar, dass sie bereits eine Straßensperre errichtet hatten. Dies war die einzige Verbindungsstraße zwischen Liggett Falls und dem Interstate Highway. Damit hätte ich rechnen müssen.
»Ich hab eine Idee«, sagte Toth. Die ich nicht hören wollte. Andererseits wollte ich nicht noch mal in eine Schießerei geraten. Und sicher nicht an der Straßensperre, wo man schon auf uns wartete.
»Was?«, bellte ich.
»Da drüben gibt es eine Stadt. Siehst du die Lichter? Ich kenn eine Straße, die dorthin führt.«
Toth ist ein riesiger Kerl und wirkt ziemlich ruhig. Was allerdings täuscht. Er gerät leicht aus der Fassung, und jetzt drehte er sich ständig nervös um und schaute auf den Rücksitz. Am liebsten hätte ich ihm eine gescheuert und ihm gesagt, er solle sich beruhigen.
»Wo ist sie?«, fragte ich. »Diese Stadt?«
»Sechs, sieben Kilometer entfernt. Die Abzweigung ist nicht ausgeschildert, aber ich kenn sie.«
Wir befanden uns im beschissenen Norden des Staates, wo alles grün ist. Aber dieses schmutzige Grün, verstehen Sie? Und alle Gebäude sind grau. Diese billigen kleinen Hütten. Und aufgebockte Pickups. Kleinstädte, in denen es nicht mal einen 7-Eleven gibt. Dafür eine Menge Hügel, die man hier Berge nennt.
Toth kurbelte das Fenster herunter, ließ kalte Luft herein und schaute zum Himmel. »Sie können uns mit diesen, äh, Satellitendingern aufspüren.«
»Wovon redest du eigentlich?«
»Weißt du, die können dich kilometerweit von oben erkennen. Ich hab’s in einem Film gesehen.«
»Und du meinst, die Staatspolizei ist dazu in der Lage? Hast du den Verstand verloren?«
Dieser Typ, ich weiß ehrlich nicht, warum ich mit ihm arbeite. Nach dem, was im Drugstore passiert ist, werde ich es auch nicht wieder tun.
Er zeigte mir die Abzweigung, und ich bog ab. Er sagte, die Stadt läge am Fuß des Wächters. Nun, ich erinnerte mich, dass wir nachmittags auf dem Weg nach Liggett Falls daran vorbeigekommen waren. Es war ein riesiger, vielleicht sechzig Meter hoher Felsen. Der, wenn man ihn von der richtigen Stelle anschaute, wie der Kopf eines blinzelnden Menschen im Profil aussah. Er war eine große Sache für die Indianer in dieser Gegend gewesen. Bla, bla, bla. Toth erklärte es mir, aber ich hörte nicht zu. Dieses eigenartige Gesicht war unheimlich. Ich schaute kurz hin und fuhr lieber weiter. Es gefiel mir nicht. Eigentlich bin ich nicht abergläubisch, aber manchmal gibt es eben Ausnahmen.
»Winchester«, sagte er gerade, was der Name der Stadt war. Fünf-, sechstausend Einwohner. Wir würden ein leer stehendes Haus suchen, das Auto in der Garage verschwinden lassen und die Suchaktion aussitzen. Bis morgen – Sonntag – Nachmittag warten, wenn all die Wochenendurlauber zurück nach Boston und New York führen und wir in der Menge untertauchen könnten.
Ich konnte den Wächter jetzt vor uns erkennen, nicht direkt seine Umrisse, eher diese Schwärze, wo keine Sterne waren. Und dann fing der Typ auf dem Rücksitz plötzlich an zu grunzen, so dass ich fast einen Herzinfarkt bekommen hätte.
»Hey! Ruhe da hinten!« Ich schlug auf den Sitz, und der Typ hinten gab Ruhe.
Was für ein Abend …
Wir hatten den Drugstore eine Viertelstunde vor Ladenschluss erreicht. Genau wie es sein muss. Dann sind die meisten Kunden und einige der Angestellten weg. Die anderen sind müde, und wenn man ihnen eine Glock oder Smitty ins Gesicht drückt, tun sie so ziemlich alles, worum man sie bittet.
Außer heute Abend.
Wir hatten die Masken runtergezogen und gingen langsam hinein. Toth holte den Manager aus seinem kleinen Büro, einen fetten Kerl, der zu heulen anfing, was mich wütend machte. Schließlich war er ein erwachsener Mann. Toth hielt mit seiner Waffe die Kunden und Angestellten in Schach, während ich dem Kassierer, diesem Knaben, riet, die Kassen zu öffnen. Mein Gott, spielte der sich auf. Als ob er sämtliche Steven-Seagal-Filme gesehen hätte oder so was. Ein kleiner Kuss mit der Smitty auf seine Wange änderte seine Einstellung, und er bewegte sich endlich. Verfluchte mich ständig, aber immerhin bewegte er sich. Wir gingen von einer Kasse zur anderen, und ich zählte die Dollar. Wir waren locker bei ungefähr dreitausend, als ich plötzlich diesen Lärm hörte. Ich drehte mich um und sah, wie Toth einen Ständer mit Chips umwarf. Mein Gott, was soll ich sagen, er holt sich eine Tüte Doritos!
Ich lasse diesen Knaben eine Sekunde aus den Augen, und was tut er? Er wirft diese Flasche. Allerdings nicht auf mich. Sondern durchs Fenster. Wumm, und schon zerbricht es in tausend Stücke. Ich höre zwar keine Alarmanlage, aber es gibt viele stumme Alarmsysteme, und ich bin jetzt echt wütend. Ich hätte ihn umbringen können. Auf der Stelle.
Bloß, dass ich es nicht getan hab. Toth hat es getan.
Er schießt auf den Jungen, peng, peng … Scheiße. Sofort rennen alle anderen durcheinander, und er schießt auf einen anderen Angestellten und auf einen Kunden, einfach so, ohne nachzudenken. Ohne jeden Grund. Er traf eine junge Angestellte ins Bein, aber dieser Typ, dieser Kunde, war tot. Man sah es gleich. Und ich brülle: »Was machst du? Was machst du?« Und er: »Halt’s Maul, halt’s Maul, halt’s Maul …« Und wir beschimpfen uns gegenseitig, bis uns klar wurde, dass wir verschwinden mussten.
Also hauten wir ab. Und was passiert? Draußen ist ein Cop. Deswegen hatte der Junge die Flasche geworfen: um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Jetzt steht er neben seinem Wagen. Also schnappen wir uns einen Kunden, diesen Kerl an der Tür, benutzen ihn als Schutzschild und gehen raus. Und da steht dieser Cop, hält seine Waffe hoch und sieht den Kunden, den wir bei uns haben. Und der Cop sagt: »In Ordnung, in Ordnung, immer mit der Ruhe.«
Ich konnte es nicht glauben: Toth schoss auch auf ihn. Ich weiß nicht, ob er ihn getötet hat. Jedenfalls war da Blut, was wohl bedeutete, dass der Cop keine Weste getragen hat. Ich hätte Toth auf der Stelle umbringen können. Warum hatte er das getan? Es war überhaupt nicht nötig gewesen.
Wir warfen den Typen, den Kunden, auf den Rücksitz und fesselten ihn mit Klebeband. Ich trat die Rücklichter kaputt und raste los. Wir schafften es, aus Liggett Falls zu entkommen.
Das alles war erst eine halbe Stunde her, auch wenn es mir wie Wochen vorkam.
Und jetzt fuhren wir diesen Highway entlang und durch eine Million Kiefern hindurch. Direkt auf den Wächter zu.
Winchester war dunkel.
Ich verstehe nicht, warum Wochenendurlauber an Orte wie diesen kommen. Ich meine, mein alter Herr hat mich vor langer Zeit mit auf die Jagd genommen. Einige Male, es gefiel mir. Aber an solche Orte zu fahren, bloß um sich Blätter anzusehen und Möbel zu kaufen, die als Antiquitäten bezeichnet werden, auch wenn sie nur kaputter Schrott sind … ich weiß nicht.
Einen Block von der Main Street entfernt fanden wir ein Haus mit einem Haufen Zeitungen vor der Tür. Ich fuhr die Auffahrt rauf und stellte den Buick gerade rechtzeitig hinter das Haus. Zwei Wagen der Staatspolizei schossen vorbei. Sie waren keine halbe Meile hinter uns gewesen, ohne Blaulicht. Wegen der kaputten Rücklichter hatten sie uns allerdings nicht gesehen. Sie huschten wie der Blitz vorbei, Richtung Stadtmitte.
Toth drang ins Haus ein, wobei er nicht besonders sorgfältig vorging, sondern auf der Rückseite einfach ein Fenster einschlug. Es war ein Ferienhaus, ziemlich leer. Kühlschrank und Telefon waren abgestellt, was ein gutes Zeichen war – so bald würde hier niemand auftauchen. Außerdem roch es einigermaßen muffig, und Stapel alter Bücher und Zeitschriften aus dem Sommer lagen herum.
Wir brachten den Typen nach drinnen. Toth wollte ihm gerade die Maske vom Kopf ziehen, aber ich sagte: »Verdammt noch mal, was hast du vor?«
»Er hat überhaupt nichts gesagt. Vielleicht bekommt er keine Luft.«
Hier redete ein Mann, der gerade auf drei Menschen geschossen hatte und sich jetzt Sorgen machte, ob dieser Typ Luft bekam? Oh, Mann. Ich konnte nur noch lachen. Angeekelt lachen, meine ich.
»Vielleicht wollen wir ja nicht, dass er uns sieht«, sagte ich. »Hast du darüber nachgedacht?« Verstehen Sie, wir trugen unsere Skimasken nicht mehr.
Es ist beängstigend, wenn man Leute an solche Dinge erinnern muss. Ich hätte Toth mehr Verstand zugetraut. Aber man weiß eben nie.
Ich ging zum Fenster und sah wieder einen Streifenwagen vorbeifahren. Dieser fuhr langsamer. So arbeiten sie. Nach dem ersten Schock, nach der Jagd, werden sie klüger und fangen an, langsam zu fahren und wirklich darauf zu achten, was ihnen eigenartig vorkommt – was anders ist, verstehen Sie? Deswegen hatte ich die Zeitungen vor der Haustür liegen lassen. Sonst hätte der Vorgarten anders ausgesehen als am Morgen. Cops arbeiten wirklich mit diesem Colombo-Kram. Ich könnte ein Buch über Cops schreiben.
»Warum haben Sie das getan?«
Es war der Typ, den wir mitgebracht hatten.
»Warum?«, flüsterte er wieder.
Der Kunde. Er hatte eine leise Stimme und klang ziemlich ruhig, angesichts der Umstände, meine ich. Ich sage Ihnen, nach der ersten Schießerei, in die ich geraten bin, war ich den kompletten nächsten Tag vollkommen fertig, und dabei hatte ich eine Waffe getragen.
Ich musterte ihn von oben bis unten. Er trug ein kariertes Hemd und Jeans. Aber er stammte nicht aus der Gegend. Das konnte ich an den Schuhen erkennen. Es waren Reiche-Jungs-Schuhe, genau die Art, wie Yuppies sie tragen. Wegen der Maske sah ich sein Gesicht nicht, doch ich konnte mich ziemlich gut daran erinnern. Er war nicht mehr jung. In den Vierzigern vielleicht. Leicht faltige Haut. Und dünn war er. Dünner als ich, dabei gehöre ich zu den Leuten, die essen können, was sie wollen, ohne dick zu werden. Ich weiß nicht, warum. So ist es einfach.
»Ruhe«, sagte ich. Wieder fuhr ein Wagen vorbei.
Er lachte. Leise. Als wollte er sagen: Was? Glauben Sie, man kann mich bis nach draußen hören?
Irgendwie lachte er über mich, verstehen Sie? Das mag ich überhaupt nicht. Und, klar, wahrscheinlich konnte man draußen nichts hören. Trotzdem sollte er mir nicht mit irgendwelcher Scheiße kommen. »Halten Sie einfach den Mund. Ich will Ihre Stimme nicht hören.«
Eine Minute lang war er ruhig und lehnte sich auf dem Stuhl zurück, auf den Toth ihn gesetzt hatte. Dann aber fragte er wieder: »Warum haben Sie auf die Leute geschossen? Das war doch nicht nötig.«
»Schnauze!«
»Sagen Sie mir nur, warum.«
Ich nahm mein Messer, ließ es aufschnappen und warf es durch die Luft, so dass die Klinge mit einer Art Dong! in einer Tischplatte stecken blieb. »Haben Sie das gehört? Das war ein zwanzig Zentimeter langes Buck-Messer aus gehärtetem Stahl. Mit feststellbarer Klinge. Damit kann ich problemlos einen Metallbolzen durchtrennen. Also halten Sie den Mund, damit ich es nicht an Ihnen ausprobiere.«
Und wieder ließ er dieses Lachen hören. Vielleicht. Vielleicht war es auch bloß ein Schnaufen. Aber mir kam es wie ein Lachen vor. Ich wollte ihn schon fragen, was es bedeuten sollte, ließ es aber bleiben.
»Haben Sie irgendwelches Geld dabei?«, fragte Toth und zog dem Typen das Portemonnaie aus der hinteren Tasche.
»Na, schau an.« Er zog fünf- oder sechshundert Dollar heraus. Mann.
Wieder fuhr ein Streifenwagen vorbei, ganz langsam. Er hatte einen Scheinwerfer, den der Cop auf die Einfahrt richtete. Aber sie fuhren weiter. Ich hörte eine Sirene irgendwo in der Stadt. Und noch eine. Es war ein unheimliches Gefühl, zu wissen, dass diese Leute da draußen auf der Jagd nach uns waren.
Ich nahm Toth die Geldbörse ab und durchsuchte sie.
Randall C. Weller jr., er lebte in Connecticut. Ein Wochenendurlauber. Genau wie ich gedacht hatte. Er besaß einen Haufen Visitenkarten, aus denen hervorging, dass er stellvertretender Geschäftsführer dieser großen Computerfirma war. Eine, die in den Nachrichten auftauchte, weil sie IBM übernehmen wollte oder so was. Plötzlich kam mir ein Gedanke. Wir könnten Lösegeld für ihn verlangen. Ich meine, warum denn nicht? Eine halbe Million rausholen. Vielleicht sogar mehr.
»Meine Frau und meine Kinder werden krank vor Sorge sein«, sagte Weller. Seine Worte jagten mir einen Schreck ein, denn genau in diesem Moment blickte ich auf ein Foto in seiner Geldbörse. Und wer war darauf zu sehen? Seine Frau und seine Kinder.
»Ich lasse Sie nicht laufen. Also halten Sie jetzt den Mund. Vielleicht brauche ich Sie ja noch.«
»Als Geisel, meinen Sie? Das gibt’s nur in Filmen. Man wird auf Sie schießen, sobald Sie durch die Tür treten, und auf mich wird man auch schießen, wenn es nötig ist. So arbeiten die Cops im wahren Leben. Am besten geben Sie einfach auf. So können Sie wenigstens Ihr Leben retten.«
»Maul halten!«, brüllte ich.
»Lassen Sie mich gehen, und ich werde aussagen, dass Sie mich gut behandelt haben. Dass die Schießerei ein Irrtum war. Es war nicht Ihre Schuld.«
Ich beugte mich vor und drückte das Messer gegen seine Kehle, nicht die Schneide, denn die ist wirklich scharf, sondern die stumpfe Seite. Ich sagte, er sollte still sein.
Wieder fuhr ein Wagen vorbei, ohne Lichter diesmal. Er fuhr langsamer, und plötzlich schoss mir durch den Kopf: Was ist, wenn sie Haus für Haus durchsuchen?
»Warum hat er das getan? Warum hat er sie umgebracht?«
Und es war sonderbar, so wie er das er betonte, fühlte ich mich ein bisschen besser, denn es schien mir, als würde er mich nicht dafür verantwortlich machen. Ich meine, es war schließlich Toths Schuld, nicht meine.
Weller redete weiter. »Ich versteh’s nicht. Ich meine, dieser Mann an der Ladentheke, der Große. Er stand einfach da und hat überhaupt nichts gemacht. Und er hat ihn einfach niedergeschossen.«
Keiner von uns sagte etwas. Toth wahrscheinlich deswegen, weil er nicht wusste, warum er geschossen hatte. Und ich, weil ich dem Typen keine Antwort schuldete. Ich hatte ihn in der Hand. Komplett, und das wollte ich ihn spüren lassen. Ich musste nicht mit ihm reden.
Aber der Typ, Weller, sprach nicht weiter. Und ich bekam dieses merkwürdige Gefühl. Wie ein Druck, der sich aufbaut. Denn niemand beantwortete seine verdammte, dumme Frage, verstehen Sie? Ich spürte diesen Drang, etwas zu sagen. Irgendwas. Aber gleichzeitig war es das Letzte, was ich tun wollte. Also erklärte ich: »Ich fahre den Wagen in die Garage.« Und ging nach draußen.
Ich schaute mir die Garage genauer an, um festzustellen, ob es dort etwas Wertvolles zum Mitnehmen gab. Doch es gab nichts außer einem Snapper-Rasenmäher, und wo hätte ich den wieder loswerden können? Also fuhr ich den Buick hinein, schloss das Tor und ging zurück ins Haus.
Ich konnte nicht glauben, was inzwischen passiert war. Gott, als ich ins Wohnzimmer trat, hörte ich als Erstes, wie Toth sagte: »Keine Chance, Mann. Ich werde Jack Prescot niemals verraten.«
Ich stand einfach da. Und Sie hätten den Ausdruck auf seinem Gesicht sehen sollen. Er wusste, dass er es richtig versaut hatte.
Jetzt kannte dieser Weller meinen Namen.
Ich sagte nichts. Das war nicht nötig. Toth redete plötzlich ziemlich schnell und nervös. »Er sagte, er würde mir richtig viel Kohle zahlen, wenn ich ihn laufen lasse.«
Er versuchte, die Sache umzudrehen, Weller die Schuld zuzuschieben. »Ich meine, das würde ich auf keinen Fall tun. Ich hab nicht mal drüber nachgedacht, Mann. Ich hab ihm gesagt er soll’s vergessen.«
»Aber warum hast du ihm meinen Namen gesagt?«
»Ich weiß nicht, Mann. Er hat mich durcheinander gebracht. Ich hab nicht nachgedacht.«
Das kann man wohl sagen. Er hatte den ganzen Abend über nicht nachgedacht.
Ich seufzte, um ihm zu verstehen zu geben, dass ich nicht glücklich war. Dann aber schlug ich ihm auf die Schulter. »Okay, es war ein langer Abend. Solche Sachen passieren.«
»Tut mir echt Leid, Mann. Wirklich.«
»Ja. Vielleicht verbringst du die Nacht besser in der Garage. Oder oben. Ich möchte dich eine Weile nicht hier sehen.«
»Klar.«
Und das Komische war, dass Weller genau in diesem Augenblick eine Art leises Kichern von sich gab. Als wüsste er schon, was käme. Ich fragte mich nur, woher er es wissen konnte.
Toth suchte ein paar Magazine zusammen und griff nach dem Beutel mit seiner Waffe und der Reservemunition.
Normalerweise ist es ziemlich schwer, jemanden mit einem Messer zu töten. Ich sage normalerweise, obwohl ich es nur ein einziges anderes Mal getan habe. Aber daran kann ich mich erinnern; es war eine Schweinerei und harte Arbeit. Aber heute, ich weiß nicht, ich war erfüllt von diesem … Gefühl aus dem Drugstore. Wütend. Ich meine, richtig wütend. Und auch ein bisschen verrückt. Und sobald Toth mir den Rücken zuwandte, packte ich ihn am Hals und machte mich an die Arbeit. Keine drei Minuten später war alles vorbei. Ich zerrte seine Leiche hinter die Couch und zog dann – warum auch nicht? – Weller die Maske vom Gesicht. Er kannte ja bereits meinen Namen. Dann konnte er auch mein Gesicht sehen.
Er war ein toter Mann. Das wussten wir beide.
»Sie hatten daran gedacht, Lösegeld für mich zu verlangen, stimmt’s?«
Ich stand am Fenster und schaute hinaus. Wieder fuhr ein Polizeiwagen vorbei, und weitere Scheinwerferkegel waren gegen die tief hängenden Wolken und das Gesicht des Wächters zu erkennen, direkt über unseren Köpfen.
Weller hatte ein schmales Gesicht und kurzes, sehr ordentlich geschnittenes Haar. Er sah aus wie all die arschkriecherischen Geschäftsleute, die mir jemals begegnet waren. Seine Augen waren dunkel und wirkten so ruhig wie seine Stimme. Es machte mich noch wütender, dass der Anblick des großen Blutflecks auf dem Teppich und dem Fußboden ihn nicht aus der Ruhe zu bringen schien.
»Nein«, sagte ich.
Er schaute auf den Stapel mit den Gegenständen, die ich aus seinem Portemonnaie genommen hatte, und redete einfach weiter, als hätte ich nichts gesagt. »Es wird nicht funktionieren. Eine Entführung, meine ich. Ich habe nicht viel Geld. Und wenn Sie meine Visitenkarte gesehen haben und denken, ich bin ein hohes Tier in der Firma, dann muss ich Ihnen sagen, dass wir um die fünfhundert stellvertretende Geschäftsführer haben. Für mich würden die keinen Cent hinlegen. Und sehen Sie die Kinder auf dem Foto? Es wurde vor zwölf Jahren aufgenommen. Inzwischen sind beide im College. Ich bezahle eine Menge Studiengebühren.«
»Wo?«, fragte ich spöttisch. »Harvard?«
»Einer ist in Harvard.« Er schnauzte mich beinahe an. »Und einer auf der Northwestern. Das Haus ist also komplett mit Hypotheken belastet. Abgesehen davon, jemanden auf eigene Faust kidnappen? Nein, das würden Sie nicht hinkriegen.«
Er bemerkte, wie ich ihn anschaute, und sagte: »Ich meine nicht Sie persönlich, Jack. Ich meine eine einzelne Person. Man braucht Partner.«
Und ich musste ihm zustimmen.
Wieder diese Stille. Keiner sagte irgendetwas, und es schien mir, als würde der Raum sich mit kaltem Wasser füllen. Ich ging zum Fenster, wobei die Dielen unter meinen Schritten knackten, was die Sache nur schlimmer machte. Mir fiel ein, wie mein Dad einmal erklärt hatte, jedes Haus besäße eine eigene Stimme; manche Häuser lachten und andere seien einsam. Nun, das hier war ein einsames Haus. Klar, es war modern und sauber, und der National Geographic war ordentlich gestapelt; trotzdem war es einsam.
Als ich vor Anspannung hätte losschreien können, sagte Weller: »Ich will nicht, dass Sie mich töten.«
»Wer sagt, dass ich Sie töten will?«
Er schenkte mir sein eigenartiges kleines Lachen. »Ich bin fünfundzwanzig Jahre lang Verkäufer gewesen. Ich habe Haustiere und Cadillacs und Satzgeräte verkauft, und zuletzt Großrechner. Ich merke es, wenn ich mit Sprüchen abgespeist werde. Sie werden mich töten. Das war Ihr erster Gedanke, als Sie hörten, wie er« – er deutete mit dem Kopf ins Toths Richtung – »Ihren Namen nannte.«
Ich lachte ihm ins Gesicht. »Na, das ist ja eine verdammt nützliche Begabung. Sie sind wohl ein wandelnder Lügendetektor«, erklärte ich sarkastisch.
Er antwortete nur: »Verdammt nützlich.« Als wollte er mir zustimmen.
»Ich will Sie nicht töten.«
»Oh, ich weiß, dass Sie es nicht wollen. Sie wollten auch nicht, dass Ihr Freund irgendjemanden in diesem Laden tötet. Das konnte ich sehen. Aber es wurden Menschen getötet, und dadurch erhöht sich der Einsatz. Stimmt’s?«
Und diese Augen, sie bohrten sich in mich, und ich konnte einfach nichts sagen.
»Aber«, fuhr er fort, »ich werde es Ihnen ausreden.«
Er klang wirklich überzeugt, und dadurch fühlte ich mich besser. Denn ich bringe lieber einen großkotzigen Dreckskerl um als einen Mitleid erregenden. Also lachte ich. »Es mir ausreden?«
»Ich werde es versuchen.«
»Aha? Und wie wollen Sie das schaffen?«
Weller räusperte sich leise. »Erstens, lassen Sie uns alles auf den Tisch legen. Ich habe Ihr Gesicht gesehen und kenne Ihren Namen. Jack Prescot. Stimmt’s? Sie sind … was? Einsfünfundsiebzig groß, wiegen knapp siebzig Kilogramm und haben schwarze Haare. Also müssen Sie davon ausgehen, dass ich Sie identifizieren kann. Ich werde hier keine Spielchen spielen und behaupten, ich hätte Sie nicht deutlich gesehen oder Ihren Namen nicht verstanden. Oder irgendwas in dieser Richtung. So weit stimmen wir überein, Jack?«
Ich nickte und verdrehte dabei meine Augen, als wäre das alles eine Menge Blödsinn. Aber ich muss zugeben, dass ich irgendwie neugierig war, was er zu sagen hatte.
»Mein Versprechen«, erklärte er, »besteht darin, dass ich Sie nicht verraten werde. Unter gar keinen Umständen. Von mir wird die Polizei niemals Ihren Namen hören. Oder Ihre Beschreibung. Ich werde niemals gegen Sie aussagen.«
Er klang so ernsthaft wie ein Priester. Ziemlich gewiefte Vorstellung. Na, er war ja schließlich Verkäufer. Aber ich würde es ihm nicht abkaufen. Obwohl er nicht wissen konnte, dass ich ihm auf die Schliche gekommen war. Sollte er seinen Sermon ruhig loswerden und glauben, ich würde mitspielen. Wenn es schließlich darauf ankäme, wenn wir erst aufgebrochen und irgendwo im Norden in den Wäldern wären, sollte er sich ruhig sicher fühlen. Kein Schreien, kein Theater. Einfach ein paar schnelle Schnitte oder Schüsse, sonst nichts.
»Verstehen Sie, was ich sage?«
Ich versuchte, ernst zu wirken, und sagte: »Klar. Sie glauben, Sie können mir ausreden, Sie zu töten. Haben Sie irgendwelche Gründe, warum ich es nicht tun sollte?«
»Oh, allerdings habe ich Gründe, darauf können Sie wetten. Vor allem einen. Einen, den Sie nicht wegdiskutieren können.«
»Aha. Nämlich?«
»Darauf komme ich sofort. Lassen Sie mich ein paar der praktischen Gründe nennen, aus denen Sie mich laufen lassen sollten. Erstens, Sie glauben, Sie müssen mich töten, weil ich weiß, wer Sie sind, richtig? Nun, was denken Sie, wie lange Ihre Identität ein Geheimnis bleiben wird? Ihr Kumpel hat gerade einen Cop erschossen. Ich weiß nicht mehr über Polizeiarbeit, als ich in Filmen sehe. Aber man wird sich die Reifenspuren vornehmen und Zeugen finden, die sich Nummernschilder und Fahrzeugtyp gemerkt haben, oder Tankstellen, an denen Sie auf dem Weg in diese Gegend gehalten haben.«
Er verbreitete nur heiße Luft. Der Buick war gestohlen. Ich meine, so dumm bin ich schließlich nicht.
Aber er redete einfach weiter und musterte mich dabei spöttisch. »Selbst wenn Ihr Wagen gestohlen wäre, würde jeder kleinste Hinweis überprüft werden. Jeder Fußabdruck dort, wo Sie oder Ihr Freund ihn gestohlen haben. Jeder, der sich in der Zeit, als der Wagen verschwand, in der Gegend aufgehalten hat, würde befragt werden.«