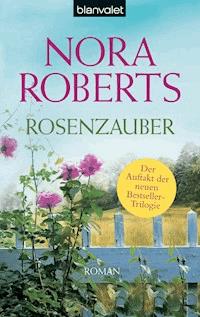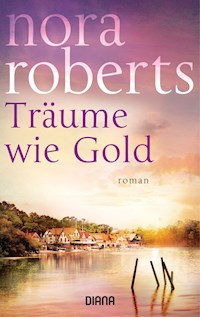
9,99 €
Mehr erfahren.
Liebe und dunkle Machenschaften
Dora Conroy besitzt einen Antiquitätenladen mit exklusiven Auktionsstücken in Philadelphia. Als sie eines Tages eine Lieferung geheimnisvoller Sammlerobjekte erhält, kommt es zu merkwürdigen Diebstählen und Todesfällen. Gemeinsam mit dem attraktiven Jed Skimmerhorn, einem ehemaligen Polizisten, stellt sie Nachforschungen an. Ein Unternehmen, mit dem sie ihr eigenes Leben höchster Gefahr aussetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 760
Ähnliche
Das Buch
Dora Conroy besitzt in Philadelphia ein Antiquitätengeschäft. Auf einer Auktion kauft sie eine Reihe von Objekten, die ihr gar nicht so besonders wichtig erscheinen. Doch sie gerät damit ins Blickfeld eines internationalen Schmugglerrings, der vor nichts zurückschreckt, wenn es um den Besitz ersehnter Antiquitäten geht. Dora und ihr Nachbar, der ehemalige Polizist Jed Skimmerhorn, beginnen, Diebstähle und Todesfälle im Umkreis der geheimnisvollen Lieferung zu untersuchen. Dabei entdecken sie Verbindungen zu einem skrupellosen Verbrecher. Dora und Jed befinden sich bald in ernster Gefahr.
»Besser kann man Romantik und Drama nicht verbinden.«
Publishers Weekly
Die Autorin
Nora Roberts wurde 1950 in Maryland geboren. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 1981, fünf Jahre später wurde sie in die Romance Writer’s Hall of Fame aufgenommen. Inzwischen zählt Roberts zu den meistgelesenen Autorinnen der Welt. Ihre Bücher wurden in knapp 30 Sprachen übersetzt und mehr als 280 Millionen Mal verkauft. Neben ihren Gesellschaftsromanen veröffentlicht sie unter dem Namen J.D. Robb ebenso erfolgreich Krimis. Sowohl die Romance Writers of America als auch die Romantic Times zeichneten sie mit zahlreichen Preisen, unter anderem für ihr Gesamtwerk, aus. Heute lebt die Bestsellerautorin mit ihrem Ehemann in Keedsville, Maryland und hat zwei erwachsene Söhne.
Inhaltsverzeichnis
Für Mom,die Trödel und ein gelungenesSchnäppchen über alles liebt.
PROLOG
Er wollte nicht hier sein. Nein, er hasste es geradezu, in dem eleganten alten Haus festzusitzen, wo ihn rastlose Geister quälten und alte Wunden aufrissen. Die Möbel mit weißen Laken abzudecken, die Haustür hinter sich zuzusperren und einfach davonzugehen, damit war es nicht getan. Er musste das Haus leerräumen und sich dadurch von einigen quälenden Albträumen befreien.
»Captain Skimmerhorn?«
Der Titel ließ Jed unwillkürlich zusammenzucken. Seit letzter Woche war er kein Captain mehr. Er hatte den Polizeidienst quittiert, seine Uniform an den sprichwörtlichen Nagel gehängt, empfand es aber als ausgesprochen lästig, seine Mitmenschen auf diese Veränderung aufmerksam zu machen. Er trat einen Schritt beiseite, um zwei Möbelpackern Platz zu machen, die einen Rosenholzschrank die Treppe hinunter, durch das große Foyer und hinaus in den frostigen Morgen schleppten.
»Ja?«
»Wollen Sie mal nach oben schauen und sich vergewissern, ob wir alles mitgenommen haben, was ins Lager soll? Ansonsten wären wir nämlich so weit fertig.«
»Fein.«
Er verspürte nicht die geringste Lust, diese Treppe hinaufzusteigen, durch die Räume zu gehen, die auch ohne Möbel keineswegs leer waren. Es war die quälende Erinnerung, die diese Räume immer noch beherrschte, überlegte er, ehe er widerwillig die Stufen emporstieg.
Wie von einem Magneten angezogen, trieb es ihn den Korridor entlang zu seinem alten Zimmer. Das Zimmer, in dem er groß geworden war, das Zimmer, das er auch wieder bewohnt hatte, als er allein in dem Haus lebte. Doch kurz vor der Türschwelle zögerte er. Die Hände zu Fäusten geballt und tief in den Taschen seines Jacketts vergraben, wartete er darauf, dass ihn die Erinnerungen wie Heckenschützen aus dem Hinterhalt überfielen.
Er hatte in diesem Zimmer geweint, heimlich natürlich, und sich deshalb geschämt. Kein männlicher Skimmerhorn zeigte jemals öffentlich eine Schwäche. Und dann, als die Tränen getrocknet waren, hatte er in diesem Zimmer Ränke geschmiedet, sich harmlose, kindische Rachepläne ausgedacht, die ihn stets selbst getroffen hatten wie ein ungeschickt geworfener Bumerang.
In diesem Zimmer hatte er gelernt zu hassen.
Und trotz allem war es nur ein gewöhnliches Zimmer. Ein Zimmer in einem ganz gewöhnlichen Haus. Diese Tatsache hatte er sich immer wieder ins Gedächtnis gerufen, vor vielen Jahren, als er als erwachsener Mann zurückgekommen war, um wieder in diesem Haus zu leben. Und war er dort nicht zufrieden gewesen?, fragte er sich jetzt. War es nicht ganz einfach gewesen?
Bis Elaine auftauchte.
»Jedidiah.«
Er fuhr zusammen. Ganz automatisch zog er die Hand aus der Jacketttasche, um nach der Waffe zu greifen, die er aber nicht mehr trug. Diese instinktive Reaktion und die Tatsache, dass er zu sehr mit seinen morbiden Gedanken beschäftigt gewesen war, um zu bemerken, dass jemand hinter ihm stand, erinnerten ihn daran, weshalb die Waffe nicht länger in dem Halfter an seiner Seite steckte.
Er atmete einmal tief durch, ehe er sich zu seiner Großmutter umwandte. Honoria Skimmerhorn Rodgers war in einen Nerz gehüllt, an ihren Ohren blitzte ein schlichtes Diamantgehänge, das schneeweiße Haar war perfekt frisiert. Sie verkörperte vom Scheitel bis zur Sohle die typische reiche, alte Lady, auf dem Weg zu einer Lunch-Verabredung in ihrem Lieblingsklub. Doch in ihren Augen, die ebenso blau und lebendig waren wie die ihres Enkels, stand ernste Besorgnis.
»Ich hatte gehofft, dich davon überzeugt zu haben, dass es klüger wäre zu warten«, begann sie ruhig, während sie eine Hand ausstreckte und auf seinen Arm legte.
Unwillkürlich wich er zurück. Berührungen dieser Art waren bei den Skimmerhorns nicht üblich. »Es gab keinen Grund, noch länger zu warten.«
»Und hierfür gab es einen?« Sie deutete in den leeren Raum. »Es gab einen Grund, dein Heim leer zu räumen, dich von deinem ganzen Besitz zu trennen?«
»In diesem Haus gehört mir nichts.«
»Das ist doch absurd«, empörte sie sich und verfiel dabei in ihren Bostoner Dialekt »Es ist deins.«
»Weil ich meine Pflicht versäumt habe? Weil ich zufällig noch am Leben bin? Nein, vielen Dank.«
Wäre sie nicht so besorgt um ihn gewesen, hätte ihm seine schroffe Antwort mit Sicherheit eine saftige Rüge eingetragen. »Mein Lieber, hier geht es nicht um Versäumnis oder um irgendeine Schuld.« Als sie merkte, wie er sich zusehends in sich zurückzog, seine Miene immer teilnahmsloser wurde, hätte sie ihn am liebsten geschüttelt, wenn sie sich davon etwas hätte versprechen können. Stattdessen strich sie ihm über die Wange. »Du brauchst nur etwas Zeit.«
Jeder Muskel in seinem Körper verkrampfte sich. Er musste seine ganze Beherrschung aufbringen, um der Berührung ihrer sanften Finger nicht auszuweichen. »Möglich, aber das ist meine Art, damit umzugehen.«
»Indem du das Haus deiner Familie aufgibst?«
»Familie?« Er lachte verbittert auf.
»Wir waren nie eine Familie. Weder hier noch sonst irgendwo.«
Ihr bisher weicher, mitleidsvoller Blick verhärtete sich. »Vorzugeben, dass die Vergangenheit nicht existiert, ist genauso verhängnisvoll, wie in ihr zu leben. Was tust du hier? Alles wegwerfen, was du dir erarbeitet, was du dir selbst aufgebaut hast? Möglich, dass ich mich nicht sonderlich begeistert über deine Berufswahl gezeigt habe, aber es war deine eigene Entscheidung, und du hast Erfolg gehabt. Mit deiner Beförderung zum Captain hast du, so meine ich, dem Namen Skimmerhorn mehr Ehre gemacht als all deine Vorfahren mit ihrem Geld und ihrem gesellschaftlichen Einfluss.«
»Ich bin nicht Cop geworden, um für meinen verdammten Namen die Werbetrommel zu rühren!«
»Nein«, entgegnete sie sanft. »Du hast es allein für dich getan, gegen den massiven Druck der Familie, wobei ich mich nicht ausnehmen will.« Sie trat einen Schritt zurück und schlenderte durch die Diele. Hier hatte sie einst gelebt, vor vielen Jahren, als junge Ehefrau. Als unglückliche Ehefrau. »Ich habe mit angesehen, wie du dein Leben umgekrempelt hast, und es hat mich beeindruckt. Weil ich wusste, dass du es nur für dich und niemanden sonst getan hast. Und ich habe mich oft gefragt, woher du die Kraft dazu genommen hast.«
Sie wandte sich ihm wieder zu, musterte ihn eindringlich, den Sohn ihres Sohnes. Er hatte das unverschämt gute Aussehen der Skimmerhorns geerbt. Bronzefarbenes, vom Wind zerzaustes Haar umrahmte sein schmales, prägnant geschnittenes Gesicht, in dem sich jetzt die innere Anspannung spiegelte, die ihn plagte. Und wie alle Mütter und Großmütter machte sie sich Sorgen, weil er abgenommen hatte, obgleich seine kraftvollen Züge dadurch noch besser zur Geltung kamen. Groß und breitschultrig, strahlte er eine Stärke aus, die die männliche Schönheit seines leicht gebräunten Teints und des sensiblen Mundes unterstrich und ihr gleichzeitig trotzte. Die leuchtenden tiefblauen Augen hatte er von ihr. Diese blickten sie jetzt rastlos und herausfordernd an und weckten Erinnerungen an den kleinen, verstörten Jungen von damals.
Aber er war kein kleiner Junge mehr, und sie fürchtete, dass sie nur wenig tun konnte, um dem jetzt erwachsenen Mann zu helfen.
»Ich möchte nicht mit ansehen, wie du dein Leben noch einmal völlig auf den Kopf stellst, und das ohne triftigen Grund.« Kopfschüttelnd trat sie vor ihn hin, ehe er noch etwas erwidern konnte. »Zugegeben, ich hatte meine Bedenken, als du nach dem Tod deiner Eltern wieder allein in dieses Haus gezogen bist, aber auch das war deine eigene Entscheidung. Und für eine Weile schien es auch, als hättest du wieder die richtige getroffen. Aber ist das die richtige Art, mit dieser Tragödie fertig zu werden, indem du dein Elternhaus verkaufst und deine Karriere wegwirfst?«
Er zögerte einen Augenblick. »Ja.«
»Du enttäuschst mich, Jedidiah.«
Das saß. Diesen Satz hatte er nur ganz selten von ihr gehört, und er traf ihn härter als all die Beleidigungen, die sein Vater ihm an den Kopf geworfen hatte. »Lieber enttäusche ich dich, als die Verantwortung für das Leben eines einzigen Cops auf mich zu laden. Ich bin nicht in der Verfassung, Befehle zu geben und Entscheidungen zu treffen. Vielleicht werde ich das nie mehr sein. Und was das Haus anbelangt, das hätte schon vor Jahren verkauft werden sollen. Nach dem Unfall. Wenn Elaine einverstanden gewesen wäre, hätte ich das längst getan. Jetzt ist sie tot, und die Entscheidung liegt bei mir.«
»Ja, das stimmt«, pflichtete sie ihm bei. »Aber du triffst die falsche.«
Die unterdrückte Wut brachte sein Blut zum Sieden. Er hatte das Bedürfnis, gegen irgendetwas zu treten, seine Fäuste gegen einen anderen zu erheben. Es war ein Bedürfnis, das ihn nur allzu oft überkam. Und genau aus diesem Grund war er nicht länger Captain J. T. Skimmerhorn vom Philadelphia Police Department, sondern Zivilist.
»Begreifst du denn nicht? Ich kann hier nicht mehr leben. Ich kann hier nicht schlafen. Ich muss hier raus, verdammt noch mal! Ich ersticke in diesem Haus!«
»Dann komm mit zu mir über die Feiertage, wenigstens bis Neujahr. Nimm dir noch etwas mehr Zeit, ehe du etwas Unwiderrufliches tust.« Ihre Stimme klang wieder ganz ruhig, als sie seine verkrampften Hände nahm. »Jedidiah, es sind schon Monate vergangen, seit Elaine – seit Elaine umgebracht wurde.«
»Ich weiß ganz genau, wie lange es her ist.« Er kannte den exakten Zeitpunkt des Todes seiner Schwester. Schließlich hatte er sie umgebracht. »Ich weiß deine Einladung zu schätzen, Großmutter, aber ich habe bereits etwas vor. Ich schaue mir heute Abend ein Apartment an, drüben an der South Street.«
»Ein Apartment.« Honorias Seufzer war der Ausdruck tiefster Missbilligung. »Also wirklich, Jedidiah, zu derartigem Unsinn besteht wirklich nicht der geringste Anlass. Kauf dir ein anderes Haus, wenn es schon sein muss. Nimm dir ein paar Wochen Urlaub, aber vergrab dich um Himmels willen nicht in irgendeinem finsteren Loch!«
Dass er ein Grinsen zu Stande brachte, überraschte ihn. »In der Anzeige war die Rede von einem ruhigen Luxusapartment in erstklassiger Lage. Nach finsterem Loch klingt das eigentlich nicht. Großmutter…«, er drückte ihre Hand, bevor sie noch weitere Argumente loswerden konnte, »lass es gut sein.«
Sie seufzte wieder, diesmal resigniert. »Ich will doch nur dein Bestes.«
»Das wolltest du immer.« Er unterdrückte ein Schaudern, spürte, wie die Wände ihn zu erdrücken drohten. »Lass uns gehen.«
1. Kapitel
Einem Theater ohne Publikum wohnt eine ganz besondere Magie inne. Die Magie der tausend Möglichkeiten. Die tragenden Stimmen der Schauspieler, die ihre Texte proben, die wandernden Lichtkegel der Scheinwerfer, die Kostüme, die spannungsgeladene Energie und die egozentrischen Schwingungen, die von der Bühne bis in die hintersten Sitzreihen dringen.
Isadora Conroy saugte diese magische Stimmung ein, gab sich ganz diesem Zauber hin, während sie in der Kulisse des Liberty Theaters stand, von wo aus sie die Proben zu ›A Christmas Carol‹ verfolgte. Wie immer genoss sie das Stück, nicht nur, weil sie Dickens liebte, sondern weil die Dramatik konzentrierter Arbeit, kreativer Beleuchtung und exzellent gesprochener Texte sie über alle Maßen faszinierte. In ihren Adern floss eben Theaterblut.
Selbst als sie jetzt ganz still dastand, war dies noch zu spüren. Ihre großen braunen Augen leuchteten vor Aufregung und beherrschten das von einer goldbraunen Haarflut eingerahmte Gesicht. Es war diese Ergriffenheit, die einen Hauch von Röte auf ihre elfenbeinfarbene Haut und ein Lächeln auf ihre vollen Lippen gezaubert hatte. Klare Konturen und weiche Linien beherrschten dieses Gesicht, das trotz seines starken Ausdrucks zugleich anmutig wirkte. Ihr kleiner, aber straffer Körper steckte voller Energie.
Sie war eine Frau, die an allem, was um sie herum vorging, großes Interesse zeigte, die aber auch Fantasie besaß und in dieser schwelgen konnte. Jetzt, da sie ihrem Vater zusah, wie er mit Marleys Ketten rasselte und dem verschreckten Scroge unheilvolle Voraussagen machte, glaubte sie fest an die Existenz von Geistern. Und weil sie daran glaubte, stand in diesem Augenblick nicht mehr ihr Vater vor ihr, sondern der zum Untergang verdammte und bis in alle Ewigkeit in den Ketten seiner Gier verstrickte Geizhals.
Dann verwandelte sich Marley wieder in Quentin Conroy, den routinierten Schauspieler, Regisseur und Theatermenschen, der jetzt von den Darstellern eine geringfügige Änderung ihrer Positionen verlangte.
»Dora.« Während sie den Gang entlangeilte, hörte sie Ophelia, ihre Schwester, aufgeregt rufen: »Wir haben unseren Zeitplan bereits zwanzig Minuten überzogen.«
»Wir haben keinen Zeitplan«, murmelte Dora, während sie zustimmend nickte, denn die von ihrem Vater gewünschte Änderung war ihrer Meinung nach perfekt. »Auf meinen Einkauftrips gibt es keinen Zeitplan. Ist er nicht fantastisch, Lea?«
Obgleich es ihrem Sinn für Pünktlichkeit und straffe Organisation widersprach, richtete Lea den Blick auf die Bühne und beobachtete ihren Vater. »Ja. Obwohl Gott allein weiß, wie er es durchsteht, jedes Jahr die gleiche Aufführung zu inszenieren.«
»Traditionsbewusstsein«, strahlte Dora. »Das ist die Wurzel des Theaters.« Dass sie die Bühne verlassen hatte, hatte ihre Liebe zum Theater und die Bewunderung für den Mann, der aus einem Text das Letzte herauszuholen vermochte, nicht im Geringsten geschmälert. Sie hatte ihn sich auf der Bühne in hundert verschiedene Personen verwandeln sehen. Macbeth, Willie Loman, Nathan Detroit. Sie hatte seine Triumphe miterlebt und seine Misserfolge. Aber er beeindruckte sie immer wieder aufs neue.
»Erinnerst du dich noch an Mom und Dad als Titania und Oberon?«
Lea verdrehte genervt die Augen, aber sie lächelte dabei. »Wer könnte das vergessen? Wochenlang ist Mutter aus ihrer Rolle nicht herausgeschlüpft. Es war weiß Gott nicht einfach, mit einer Feenkönigin zu leben. Und wenn wir nicht bald machen, dass wir hier rauskommen, dann steigt sie aus den Kulissen und hält uns einen Vortrag, was zwei allein nach Virginia reisenden Frauen alles zustoßen kann!«
Dora, die die Nervosität und Ungeduld ihrer Schwester spürte, legte Lea den Arm um die Schultern. »Ganz ruhig, Schätzchen. Ich halte sie schon in Schach, und Vater macht ohnehin gleich eine Pause.«
Was er wie auf ein stummes Stichwort hin auch tat. Während die Schauspieler sich in die Garderoben zurückzogen, trat Dora hinaus auf die Bühne. »Dad.« Einen langen Augenblick musterte sie ihn von Kopf bis Fuß. »Du warst großartig.«
»Danke, meine Liebe.« Er machte mit den Armen eine ausladende Geste, die sein zerrissenes Totenhemd gespenstisch flattern ließ. »Ich finde, die Maske ist diesmal sehr viel besser als letztes Jahr.«
»Absolut.« Die weiße Schminke und die kohlrabenschwarz umrahmten Augen wirkten in der Tat erschreckend echt. »Absolut schauerlich.« Sie hauchte ihm einen Kuss auf die Lippen, sorgsam darauf bedacht, das Make-up nicht zu verwischen. »Schade, dass wir die Premiere verpassen.«
»Da kann man nichts machen«, meinte er leichthin, zog dabei aber einen kleinen Flunsch. Er hatte zwar einen Sohn, der die Conroy-Tradition fortführte, seine beiden Töchter aber hatte er verloren – die eine war verheiratet, die andere selbstständige Geschäftsfrau. Was ihn freilich nicht daran hinderte, sie hin und wieder wie Kinder zu behandeln. »So, so, meine kleinen Mädchen machen sich zu einer großer Abenteuerfahrt auf.«
»Wir gehen auf Geschäftsreise, Dad, und nicht auf Expedition ins Amazonasgebiet.«
»Das ist doch Jacke wie Hose«, meinte er mit einem verschmitzten Augenzwinkern und gab Lea einen Kuss. »Hütet euch auf alle Fälle vor wilden Bestien.«
»Lea!« Trixie Conroy kam in voller Maske, komplett im Kostüm und Federhut, über die Bühne gerauscht. Die exzellente Akustik des Liberty Theaters trug ihre wohltönende Stimme ohne Schwierigkeiten bis zu den obersten Balkonen hinauf. »John ist am Telefon, Liebes. Er hat vergessen, ob Missy heute um fünf zu den Pfadfindern oder um sechs zur Klavierstunde muss«.
»Ich habe doch alles genau aufgeschrieben«, seufzte Lea. »Wie will er denn die Kinder drei Tage versorgen, wenn er nicht mal eine Liste lesen kann?«
»Ein Goldstück, dieser Mann«, kommentierte Trixie, während Lea davoneilte. »Der perfekte Schwiegersohn. Und Dora, du fährst doch vorsichtig, ja?«
»Aber sicher, Mom.«
»Natürlich. Du bist immer vorsichtig. Und Anhalter nimmst du doch auch keine mit, oder?«
»Nicht einmal, wenn sie mich auf Knien anflehen.«
»Und alle zwei Stunden machst du eine Pause, um deine Augen auszuruhen, ja?«
»Pünktlich wie ein Uhrwerk.«
Trixie, die unverbesserliche Mutter, nagte an der Unterlippe. »Trotzdem, es ist eine schrecklich lange Fahrt bis Virginia. Und es könnte Schnee geben.«
»Ich habe Winterreifen.« Um weiteren Ratschlägen vorzubeugen, gab Dora ihrer Mutter einen Kuss. »Ich habe ein Autotelefon, Mom. Jedes Mal, wenn wir eine Staatsgrenze passieren, rufe ich dich an.«
»Ja, das ist eine prima Idee.« Die Vorstellung heiterte Trixie zusehends auf. »Ach, und Quentin, Liebling, ich komme gerade von der Theaterkasse.« Sie versank vor ihrem Gatten in einen vollendeten Hofknicks. »Wir sind auf Wochen ausverkauft.«
»Selbstverständlich.« Quentin half seiner Frau auf und wirbelte sie in einer gekonnten Pirouette über die Bühne, die in einer tiefen Verbeugung endete. »Außer einer Hand voll freier Stehplätze erwartet ein Conroy stets ein volles Haus.«
»Hals- und Beinbruch.« Dora drückte ihrer Mutter einen Abschiedskuss auf die Wange. »Dir auch«, sagte sie zu Quentin. »Und Dad, vergiss nicht, dass du heute einem Interessenten das Apartment zeigen wolltest.«
»Ich vergesse nie einen Termin. Ausgangspositionen!«, rief er über die Bühne und zwinkerte seiner Tochter zu. »Gute Fahrt, mein Schatz.«
Dora hörte wieder die Ketten rasseln, als sie hinter der Bühne verschwand. Eine bessere Verabschiedung hätte sie sich nicht wünschen können.
Doras Auffassung nach war ein Auktionshaus einem Theater nicht so unähnlich. Auch dort gab es eine Bühne, Requisiten und Darsteller. Wie sie ihren verblüfften Eltern vor Jahren erklärt hatte, kehrte sie der Bühne nicht wirklich den Rücken. Sie veränderte nur für sich den Schauplatz. Und wann immer es an der Zeit war zu kaufen oder zu verkaufen, konnte man davon ausgehen, dass sie von dem Schauspielerblut, das in ihren Adern floss, vorteilhaft Gebrauch machte.
So hatte sie sich bewusst die Zeit genommen, die Arena der heutigen Aufführung aufs Genaueste zu inspizieren. Das Gebäude, in welchem Sherman Porter seine Auktionen durchführte und außerdem einen täglichen Flohmarkt unterhielt, war ursprünglich ein Schlachthof gewesen; und auch heute war es darin noch so zugig wie in einem Viehstall. Die zur Versteigerung angebotenen Objekte wurden auf demselben nackten, kalten Betonboden ausgestellt, über den einst Kühe und Schweine zur Schlachtbank gezerrt wurden. Jetzt gingen dort in dicke Wintermäntel und Wollschals gehüllte Menschen umher, klopften an Kristallgläser, grübelten vor Ölgemälden oder fachsimpelten über Anrichten und die Kopfbretter antiker Betten.
Zugegeben, das Ambiente ließ ein wenig zu wünschen übrig, aber andererseits hatte sie schon in weniger viel versprechenden Umgebungen gespielt.
Isadora Conroy war eine leidenschaftliche Händlerin und Verkäuferin. Sie hatte schon immer gern eingekauft und empfand das Tauschgeschäft Geld gegen Ware als höchst befriedigend. So befriedigend, dass sie gelegentlich Geld gegen Waren eingetauscht hatte, für die sie nicht die geringste Verwendung hatte. Und doch war es diese Leidenschaft fürs Handeln gewesen, die Dora dazu bewogen hatte, einen eigenen Laden aufzumachen. Ihr machte das Verkaufen ebenso viel Spaß wie das Einkaufen.
»Lea, sieh dir das an.« Dora drehte sich zu ihrer Schwester um und hielt ihr ein vergoldetes Sahnekännchen unter die Nase. Es hatte die Form eines Damenschuhs. »Ist das nicht entzückend?«
Ophelia Conroy Bradshaw warf einen kurzen, verwunderten Blick darauf. Abgesehen von ihrem märchenhaften Namen war sie eine realitätsbewusste und sehr bodenständige Person. »Du meinst wohl eher kitschig.«
»Ach komm, sieh doch mal über die vordergründige Ästhethik hinweg.« Strahlend ließ Dora einen Finger über den gewölbten Rist des Schuhs gleiten. »In unserer Welt muss es auch einen Platz für Kitsch geben.«
»Gewiss. Dein Laden, zum Beispiel.«
Dora kicherte, so etwas konnte sie nicht beleidigen. Sie stellte zwar das Sahnekännchen zurück ins Regal, hatte sich aber bereits dafür entschieden, mitzusteigern. Sie zückte ihr Notizbuch und notierte sich die Nummer des Loses. »Ich bin wirklich froh, dass du mich auf dieser Tour begleitest, Lea. Du hast die Gabe, mich immer wieder auf den Boden der Realität zurückzuholen.
»Irgendjemand muss das ja tun.« Leas Aufmerksamkeit war mittlerweile von einem farbenprächtigen Gläserset aus der Zeit der großen Depression gefesselt. Darunter waren mindestens zwei bernsteinfarbene Stücke, die sich in ihrer eigenen Sammlung recht hübsch ausnehmen würden. »Trotzdem habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich so kurz vor Weihnachten in der Weltgeschichte herumgondle und John mit den Kindern allein lasse.«
»Du hast dich doch danach gesehnt, mal für ein paar Tage von Küche und Kindern wegzukommen«, erinnerte sie Dora, die gerade einen zierlichen Toilettentisch aus Kirschholz bewunderte.
»Das stimmt. Deshalb plagen mich ja auch Schuldgefühle.«
»Schuldgefühle sind nie verkehrt.« Nachdem sie das eine Ende ihres roten Schals über die Schulter geworfen hatte, ging Dora in die Hocke, um sich die bronzenen Schubladengriffe aus der Nähe anzusehen. »Schätzchen, du warst gerade mal drei Tage von zu Hause weg, und wir befinden uns bereits auf dem Heimweg. Heute Abend bist du wieder mit deinen Lieben vereint, kannst deine Kinder an die Brust drücken, John verführen, und alle werden glücklich sein.«
Lea verdrehte die Augen und schenkte dem Ehepaar, das neben ihr stand, ein schwaches Lächeln. »Du hast aber auch ein Talent, die unterschiedlichsten Dinge auf den banalsten Nenner zu bringen.«
Mit einem zufriedenen Seufzer kam Dora aus der Hocke hoch, strich sich die kinnlange Mähne aus dem Gesicht und meinte nickend: »Ich glaube, fürs Erste habe ich genug gesehen.«
Nach einem kurzen Blick auf ihre Uhr stellte Dora fest, dass sich in diesem Augenblick der Vorhang für die Matinee im Liberty Theater heben musste. Tja, dachte sie im Stillen, Showbusiness ist eben Showbusiness. Sie hätte sich vor lauter Vorfreude auf die Auktion am liebsten die Hände gerieben.
»Wir suchen uns am besten bald einen Platz, bevor …, nein, warte!« Ihre braunen Augen leuchteten begeistert auf. »Sieh dir das an!«
Kaum hatte Lea sich umgedreht, da flitzte Dora schon los.
Ein Bild hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Es war ein relativ kleines Gemälde in einem eleganten Elfenbeinrahmen. Auf der Leinwand zeigte sich ein intensives Farbenspiel, gewagte Pinselstriche in Karmesinrot und Türkis, dazwischen ein Klecks Zitronengelb und ein smaragdblauer Wischer. Dora spürte die Kraft und das Feuer dieses Bildes, dem sie ebenso wenig widerstehen konnte wie einem Sonderangebot.
Sie lächelte den Jungen an, der das Bild gerade an die Wand lehnte. »Du hältst es verkehrt herum.«
»Was?« Der stämmige Bursche drehte sich um und wurde knallrot. Er war nicht älter als siebzehn, und Doras Lächeln brachte sein Blut in Wallung. »Äh, nein, Ma’am.« Sein Adamsapfel hüpfte vor Verlegenheit, als er das Bild umdrehte, um ihr den Haken zu zeigen.
»Mmmh.« Wenn es ihr gehörte – und das würde es mit Sicherheit am Ende des Nachmittags – würde sie das ändern.
»Die, äh, die Lieferung kam gerade erst herein.«
»Verstehe.« Sie trat einen Schritt näher. »Sind ein paar recht interessante Stücke dabei«, sagte sie und hob die Skulptur eines traurig dreinblickenden Bassets hoch, der in liegender Position dargestellt war. Die Skulptur war schwerer, als sie erwartet hatte, und sie presste die Lippen zusammen, als sie diese umdrehte, um sie genauer zu betrachten. Kein Name und kein Datum, stellte sie fest, wirklich eine ausgezeichnete Arbeit.
»Kitschig genug für deinen Geschmack?«, erkundigte sich Lea.
»Gerade eben. Gäbe einen tollen Türstopper ab.« Nachdem sie den Basset wieder zurückgestellt hatte, griff sie eifrig nach der Statuette eines Walzer tanzenden und im Stil der dreißiger Jahre gekleideten Paares. Doch stattdessen traf ihre Hand auf dicke, knotige Finger. »Verzeihung«, murmelte sie, als sie zu einem älteren Mann aufblickte, der eine Brille trug und sie eindringlich musterte.
»Hübsch, nicht?«, fragte er sie. »Meine Frau hatte fast die Gleiche. Ging bei einer Balgerei unserer Kinder aber leider zu Bruch.« Er grinste und entblößte dabei zwei etwas zu weiße und zu ebenmäßige Zahnreihen. Er trug eine rote Fliege und roch wie eine Pfefferminzstange. Dora erwiderte sein Lächeln.
»Sind Sie Sammler?«
»Könnte man so sagen.« Er stellte die Statuette ab, wobei er die übrigen Exponate mit einem raschen, erfahrenen Blick überflog, Preise abschätzte, sie katalogisierte, als uninteressant abstempelte. »Ich bin Tom Ashworth, habe einen Laden in Front Royal.« Er zog eine Visitenkarte aus der Brusttasche und reichte sie Dora. »Im Laufe der Jahre hatte sich bei uns so viel Krimskrams angesammelt, dass es nur zwei Möglichkeiten gab: einen Laden aufzumachen oder ein größeres Haus zu kaufen.«
»Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich bin Dora Conroy.« Sie streckte ihre Hand aus, die sogleich kräftig geschüttelt wurde. »Ich habe einen Laden in Philadelphia.«
»Dachte mir schon, dass Sie Profi sind.« Er blinzelte sie erfreut an. »Hab’ ich sofort gemerkt. Kann mich aber nicht erinnern, Sie schon einmal auf einer von Porters Auktionen gesehen zu haben.«
»Nein, ich bin zum ersten Mal hier. Es ist nicht der nächste Weg von Philadelphia, und die Fahrt hierher war eigentlich eine ganz spontane Entscheidung. Ich habe meine Schwester überredet mitzukommen. Lea, Tom Ashworth.«
»Freut mich, Sie kennen zu lernen.«
»Das Vergnügen ist ganz meinerseits.« Ashworth tätschelte Leas eiskalte Hand. »Zu dieser Jahreszeit wird es hier drinnen nie richtig warm. Schätze, Porter glaubt, dass die Versteigerung für eine etwas höhere Raumtemperatur sorgen wird.«
»Hoffentlich behält er Recht.« Leas Zehen in den dünnen Lederstiefeln fühlten sich an wie Eiszapfen. »Sind Sie schon lange im Geschäft, Mr. Ashworth?«
»Bald vierzig Jahre. Meine Frau hat damit angefangen, hat Puppen und Schals gehäkelt, und was weiß ich noch alles, und dann verkauft. Später kam dann noch Modeschmuck und so’n Firlefanz dazu, und unsere Garage wurde in einen Laden verwandelt.« Er zog eine Pfeife aus der Tasche und klemmte sie sich zwischen die Zähne. »Im Jahr dreiundsechzig hatten wir mehr Ware, als wir unterbringen konnten. So mieteten wir einen Laden in der Stadt. Haben jeden Tag gemeinsam hinter der Ladentheke gestanden, bis sie sechsundachtzig starb. Jetzt arbeitet mein Enkel im Geschäft mit. Hat eine Menge verrückter Ideen im Kopf, ist aber sonst ein ganz brauchbarer Junge.«
»Familienunternehmen sind die besten«, sagte Dora. »Lea hat gerade angefangen, halbtags bei mir im Laden mitzuarbeiten.«
»Der Herr im Himmel mag wissen warum.« Lea vergrub ihre kalten Hände in den Tiefen ihrer Manteltaschen. »Ich habe nicht die leiseste Ahnung von Antiquitäten oder Sammlerobjekten.«
»Sie müssen nur herausfinden, was die Leute wollen«, erklärte ihr Ashworth und schnippte mit dem Daumennagel über ein Streichholz, das sofort Feuer fing. »Und wie viel sie bereit sind, dafür auszugeben«, fügte er hinzu.
»Stimmt genau.« Begeistert hakte sich Dora bei ihm unter. »Sieht so aus, als ob es losgeht. Wir sollten uns besser einen Platz suchen.«
Ashworth bot Lea den anderen Arm an und geleitete sehr selbstbewusst die beiden Frauen zu einigen freien Stühlen in der zweiten Reihe.
Dora nahm ihr Notizbuch zur Hand und bereitete sich auf ihre Lieblingsrolle vor.
Anfangs wurde zwar niedrig, aber nichtsdestoweniger energisch geboten. Und es waren die Stimmen der Mitbieter, die Doras Blut in Wallung brachten. Hier standen echte Schnäppchen zum Verkauf, und sie war entschlossen, sich ihren Anteil davon zu sichern.
Sie überbot eine dünne, heruntergekommen aussehende Frau mit verkniffenen Mundwinkeln und erhielt den Zuschlag bei der Frisierkommode; sie schnappte sich für wenig Geld ein Sahnekännchen, das die Form eines Damenschuhs hatte, und wetteiferte hartnäckig mit Ashworth um ein Paar kristallene Salzstreuer.
»Damit haben Sie mich ausgeschaltet«, sagte er, als Dora ihn überbot. »Oben im Norden bekommen Sie wahrscheinlich ein bisschen mehr dafür.«
»Ich habe einen Kunden, der Salzfässchen sammelt«, erklärte Dora. Und der das Doppelte des Einkaufspreises dafür zu zahlen bereit ist, dachte sie.
»Tatsächlich?« Ashworth beugte sich näher zu ihr, als das nächste Los zur Versteigerung kam. »Ich habe ein Sechser-Set davon im Laden aus Kobalt und Silber.«
»Wirklich?«
»Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie doch nach der Auktion kurz bei mir herein und sehen sich die Dinger an.«
»Das könnte ich eigentlich tun. Lea, du steigerst bei den Gläsern mit, die aus der Zeit der Depression stammen.
»Ich?« Lea starrte ihre Schwester mit angstgeweiteten Augen an.
»Na klar. Sprung ins kalte Wasser nennt man das.« Lächelnd beugte sie sich zu Mr. Ashworth. »Passen Sie auf.«
Wie Dora erwartet hatte, hauchte Lea ihr Preisangebot anfangs so leise in den Raum, dass der Auktionator sie kaum verstand. Dann wurde sie aber zusehends mutiger und bekam schließlich den Zuschlag für das Los.
»Ist sie nicht großartig?« Stolz wie ein Schneekönigin legte Dora den Arm um Leas Schulter und drückte sie. »Sie war schon immer schnell von Begriff. Das macht das Conroy-Blut.«
»Ich habe alles gekauft.« Lea presste eine Hand auf ihr klopfendes Herz. »O Gott, ich habe die ganze Partie gekauft! Warum hast du mich denn nicht unterbrochen?«
»Weil es dir so viel Spaß gemacht hat.«
»Aber … aber.« Mit dem Sinken ihres Adrenalinspiegels sank auch Lea immer tiefer in ihren Stuhl zurück. »Das waren Hunderte von Dollar. Hunderte!«
»Aber gut angelegt. So, weiter im Takt.« Beim Anblick des abstrakten Gemäldes rieb sich Dora aufgeregt die Hände. »Das ist meins«, raunte sie leise.
Um drei Uhr nachmittags fügte Dora den Schätzen in ihrem Lieferwagen noch ein halbes Dutzend kobaltblaue Salzstreuer hinzu. Der kühle Wind hatte ihre Wangen gerötet, und sie schlug den Kragen ihres Mantels hoch.
»Riecht nach Schnee«, orakelte Ashworth. Er stand auf dem Gehsteig vor seinem Laden und schnüffelte, die Pfeife in die Hand geklemmt, in die Luft. »Kann gut sein, dass Sie noch eine dicke Ladung abbekommen, bevor Sie zu Hause sind.«
»Hoffentlich.« Sich das vom Wind zerzauste Haar aus der Stirn streichend, lächelte sie ihn an. »Was wäre denn Weihnachten ohne Schnee? Es hat mich sehr gefreut, Sie kennen zu lernen, Mr. Ashworth.« Sie streckte ihm nochmals die Hand hin. »Falls Sie einmal nach Philadelphia kommen, erwarte ich Ihren Gegenbesuch.«
»Darauf können Sie zählen.« Er klopfte gewichtig an die Brusttasche, in die er ihre Visitenkarte gesteckt hatte. »Also, meine Damen, passen Sie gut auf sich auf. Und fahren Sie vorsichtig.«
»Machen wir. Fröhliche Weihnachten!«
»Das wünsche ich Ihnen auch«, erwiderte Ashworth, als Dora in den Lieferwagen kletterte.
Dora winkte noch einmal, startete den Motor und fuhr an. Ihre Augen suchten den Rückspiegel, und als sie Ashworth mit der Pfeife im Mund, eine Hand zu einem zackigen Abschiedssalut erhoben, auf dem Gehsteig stehen sah, musste sie lächeln. »So ein Goldstück. Ich bin froh, dass er die Statuette bekommen hat.«
Lea zitterte vor Kälte und wartete ungeduldig, dass die Heizung warm wurde. »Ich hoffe, er hat dir nicht zu viel für diese Salzstreuer abgeknöpft.«
»Mmh. Er hat dabei bestimmt seinen Profit gemacht, ich werde meinen machen und Mrs. O’Malley vergrößert ihre Sammlung. Ein Geschäft, bei dem alle Beteiligten glücklich sein können.«
»Stimmt wohl. Aber ich kann immer noch nicht glauben, dass du tatsächlich dieses abscheuliche Bild gekauft hast. Das bringst du doch nie an den Mann.«
»Irgendwann bestimmt.«
»Wenigstens hast du nur fünfzig Dollar dafür bezahlt.«
»Zweiundfünfzig Dollar und fünfundsiebzig Cent«, berichtigte Dora.
»Umso schlimmer.« Lea drehte sich um und überflog die Kisten und Schachteln, die sich hinter ihnen auf der Ladefläche stapelten. »Du bist dir doch hoffentlich darüber im Klaren, dass für den ganzen Plunder gar nicht genug Platz in deinem Laden ist.«
»Keine Sorge, ich werde schon Platz dafür schaffen. Was meinst du, würde sich Missy über dieses Karussell freuen?«
Lea stellte sich das riesige mechanische Spielzeug im Kinderzimmer ihrer Tochter vor und erschauderte. »Bitte, nein!«
»Okay.« Dora zuckte die Schultern. Wenn sie dieses Karussell erst einmal geputzt hatte, würde sie es vielleicht für einige Zeit in ihrem eigenen Wohnzimmer aufstellen. »Aber trotzdem glaube ich, dass es ihr gefallen würde. Möchtest du nicht John anrufen und ihm sagen, dass wir auf dem Heimweg sind?«
»Ja, gleich.« Seufzend lehnte sich Lea in ihrem Sitz zurück. »Morgen um diese Zeit backe ich Weihnachtsplätzchen und rolle Teig für die Pies aus.«
»Genau das hast du doch gewollt«, erinnerte Dora ihre Schwester. »Du musstest auch heiraten, Kinder kriegen und ein Haus kaufen. Wo sollte unsere Familie sonst ihr Weihnachtsessen einnehmen?«
»Ich hätte ja nichts dagegen, wenn Mom nicht darauf bestehen würde, beim Kochen zu helfen. Ich meine, diese Frau hat in ihrem ganzen Leben noch keine richtige Mahlzeit gekocht, hab’ ich Recht?«
»Absolut.«
»Und jetzt rennt sie mir jedes Weihnachtsfest in der Küche vor den Füßen rum und wedelt mit irgendwelchen Rezepten, die Alfa-Alfa-Sprossen mit Roßkastaniendressing enthalten.«
»O ja, die waren besonders scheußlich«, entsann sich Dora. »Aber immer noch besser als ihre Currykartoffeln und dieser mexikanische Bohneneintopf.«
»Erinnere mich bloß nicht daran. Und Dad ist auch keine große Hilfe, wenn er mit seinem Santa-Claus-Bart die Eier für den Eierflip noch vor dem Mittagsläuten schlägt.«
»Vielleicht kann Will sie ja ein wenig ablenken. Kommt er allein oder mit einer seiner Süßen?«, erkundigte sich Dora und dachte an die vielen Freundinnen ihres Bruders.
»Allein, wie es zuletzt hieß. Dora, pass bitte auf den Lastwagen auf!«
»Wird gemacht.« Im Eifer des Gefechts ließ Dora den Motor aufheulen und überholte den Laster mit fingerbreitem Abstand. »Wann kommt denn Will?«
»Er nimmt Heiligabend den späten Zug von New York.«
»Spät genug, um sich einen großen Auftritt zu sichern«, prophezeite Dora. »Hör zu, wenn er dir auf die Nerven geht, kann ich jederzeit … oh, Scheiße.«
»Was ist denn?« Lea riss erschreckt die Augen auf.
»Mir fällt gerade ein, dass der neue Mieter, mit dem Dad den Vertrag gemacht hat, heute in mein Haus einziehen will.«
»Und?«
»Ich hoffe, Dad erinnert sich noch daran und ist pünktlich mit dem Schlüssel da. Dass Dad die Vermietung übernommen hat, dafür bin ich ihm wirklich dankbar. Aber du weißt ja, wie abwesend er immer während der Proben ist.«
»Ich weiß genau, wie er ist, und deshalb verstehe ich nicht, wie du ihn einen Mieter für dein Haus hast aussuchen lassen.«
»Ich hatte einfach keine Zeit«, murmelte Dora und überlegte, ob die Möglichkeit bestand, ihren Vater zwischen den Auftritten im Theater anzurufen. »Außerdem wollte es Dad gern übernehmen.«
»Dann wundere dich bloß nicht, wenn du demnächst Tür an Tür mit einem Psychopathen oder einer Mutter mit drei schreienden Kleinkindern und einem Trupp von tätowierten Liebhabern hausen wirst.«
Dora schürzte die Lippen. »Ich habe Dad ausdrücklich gesagt, dass Psychopathen und Tätowierte nicht in Frage kommen. Ich dachte vielmehr an jemanden, der gut kochen kann und seine Hausherrin damit bei Laune zu halten versucht, indem er ihr in regelmäßigen Abständen Selbstgebackenes auf den Fußabtreter stellt. Ach, weil wir gerade davon reden, hast du Hunger?«
»Ja. Ich könnte mich tatsächlich für ein letztes beschauliches Mahl erwärmen, bei dem ich niemandem das Fleisch klein schneiden muss.«
Ruckartig scherte Dora nach links aus, um abzubiegen, wobei sie einem heranbrausenden Chevy die Vorfahrt nahm. Das darauf folgende empörte Gehupe ignorierte sie lächelnd. In Gedanken war sie bereits mit dem Auspacken ihrer Errungenschaften beschäftigt. Und zuallererst würde sie einen perfekten Platz für das farbenfrohe Bild finden, beschloss sie erfreut.
Hoch oben im glitzernden Turm eines silbernen Wolkenkratzers, von wo aus er die überfüllten Straßen von Los Angeles überblicken konnte, genoss Edmund Finley seine allwöchentliche Maniküre. An der Wand gegenüber seines massiven Rosenholzschreibtische flimmerten ein gutes Dutzend Fernsehbildschirme. CNN-Headline News und einer der ›Home-shopping‹-Kanäle spulten schweigend ihr Programm ab. Die anderen Bildschirme waren mit Videokameras verbunden, die in diversen Büroräumen seiner Firma installiert waren, damit er seine Angestellten ständig überwachen konnte.
Da er sich momentan nicht für die Büros interessierte, bildeten die leisen Klänge einer Mozartoper sowie das beständige Kratzen der Nagelfeile der Kosmetikerin die einzige Geräuschkulisse in den ausgedehnten Fluchten seines Büros.
Finley liebte es zu beobachten.
Das oberste Stockwerk dieses Gebäudes hatte er sich deshalb ausgesucht, weil ihm hier Los Angeles zu Füßen lag. Dieser Standort gab ihm ein Gefühl von Macht, und er brachte so manche Stunde damit zu, vor dem großen Panoramafenster hinter seinem Schreibtisch zu stehen und einfach nur das Kommen und Gehen wildfremder Menschen weit unten auf den Straßen zu beobachten.
In seinem Haus in den Bergen, hoch über der Stadt, gab es in jedem Zimmer Fernseher und Monitore. Und Fenster, jede Menge Fenster, durch die er die Lichter der Bucht von L.A. betrachten konnte. Abend für Abend stand er auf dem Balkon vor seinem Schlafzimmer und träumte davon, all das zu besitzen, was sein Auge sah.
Er hungerte förmlich nach Besitz; wobei er eine Vorliebe für das Edle und Exklusive hatte, was in seinem Büro unübersehbar zum Ausdruck kam. Wände und Teppichböden waren in Weiß gehalten, einem reinen, ungebrochenem Weiß, um als jungfräulicher Hintergrund für seine Besitztümer zu dienen: Die Ming-Vase, zum Beispiel, die auf einen marmornen Sockel stand, die Skulpturen von Rodin und Denaecheau in den diversen Wandnischen; den goldgerahmten Renoir über der Louis-quatorze-Kommode, die samtbezogene Polsterbank, auf der angeblich schon Marie Antoinette gesessen hatte, und die von zwei auf Hochglanz polierten Mahagonitischchen aus dem viktorianischen England eingerahmt wurde.
Zwei hohe Glasvitrinen beherbergten eine beeindruckende Sammlung unterschiedlichster Kunstobjekte: fein ornamentierte Schnupftabakdosen aus Lapislazuli und Aquamarin, Dresdner Figuren, Schmuckdöschen aus der Porzellanmanufaktur von Limoges, ein Dolch mit edelsteinbesetztem Griff aus dem 15. Jahrhundert, afrikanische Masken.
Edmund Finley kaufte. Und was er kaufte, das hortete er.
Sein Import-Export-Unternehmen lief ausgesprochen erfolgreich, sein Nebenerwerb, das Schmuggeln, nicht minder. Letzteres stellte für ihn jedoch die größere Herausforderung dar. Es verlangte eine gewisse Finesse, skrupellose Erfindungsgabe und einen sicheren Geschmack.
Finley, ein großer, außergewöhnlich gut aussehender Mann in den frühen Fünfzigern, hatte mit dem ›Warenankauf‹ als junger Dockarbeiter in San Francisco begonnen. Es war ein Kinderspiel gewesen, eine Kiste am falschen Platz abzuladen, aufzubrechen und den Inhalt zu verschachern. Mit Dreißig hatte er ausreichend Kapital angehäuft, um eine eigene Firma zu gründen, verfügte über genügend Köpfchen, um sich in den Schattenseiten des Gewerbes zu bewegen und zu gewinnen, und über genügend Kontakte, um sich einen verlässlichen Warennachschub zu sichern.
Inzwischen war er ein wohlhabender Mann geworden, der italienische Maßanzüge, Französinnen und Schweizer Franken bevorzugte. Und nach jahrzehntelangen Transaktionen konnte er sich das leisten, was er am meisten schätzte: das Alte, das Unbezahlbare.
»Sie sind fertig, Mr. Finley.« Die Kosmetikerin legte Finleys Hand sanft auf der makellos weißen Unterlage seines Schreibtisches ab. Sie wusste, dass er ihre Arbeit sorgfältig nachprüfen würde, während sie ihre Scheren, Feilen und Lotionen einpackte. Einmal hatte er sie zehn Minuten lang angebrüllt, weil sie ein winziges Stück Nagelhaut an seinem Daumen übersehen hatte. Doch als sie jetzt zu ihm aufzublicken wagte, betrachtete er lächelnd seine polierten Nägel.
»Exzellente Arbeit.« Zufrieden rieb er seine Fingerspitzen aneinander. Dann zog er eine goldene Geldklammer aus der Gesäßtasche und zupfte einen Fünfziger heraus. Und mit einem seiner seltenen, entwaffnenden Lächeln legte er noch hundert Dollar drauf. »Frohe Weihnachten, meine Liebe.«
»Oh, ich danke Ihnen. Vielen, vielen Dank, Mr. Finley. Ich wünsche Ihnen ebenfalls ein frohes Fest.«
Immer noch lächelnd, entließ er sie mit einem Wink seiner polierten Fingerspitzen. Seine sporadischen Anfälle von Großzügigkeit waren für ihn so bezeichnend wie sein beständiger Geiz. Er fand an beidem Gefallen. Ehe die Tür noch hinter ihr ins Schloss gefallen war, hatte er sich in seinem Stuhl zurückgelehnt und die Hände über seiner seidenen Weste gefaltet. Und er ließ den Blick über das Panorama von Los Angeles wandern.
Weihnachten, dachte er. Was für eine wunderbare Zeit. Eine freundliche Gefälligkeit des Herrn an die Menschen. Glockengeläute und bunte Lichter. Freilich, es war auch die Zeit verzweifelter Einsamkeit, der Hoffnungslosigkeit, die Zeit der Selbstmorde. Doch solch kleine menschlichen Tragödien vermochten ihn kaum noch zu berühren. Sein Geld hatte ihn inzwischen über so heikle Bedürfnisse wie den Wunsch nach Freunden und Familie hinausgehoben. Freunde konnte er sich kaufen. Er hatte bewusst eine der reichsten Städte der Welt als Wohnsitz gewählt, wo man alles kaufen, verkaufen, besitzen konnte. Eine Stadt, in der Jugend, Reichtum und Macht mehr als alles andere zählten. Und in diesen schönsten Tagen des Jahres besaß er Reichtum, besaß Macht. Und was die Jugend anbelangte, so ließ sich diese äußerlich ebenfalls mit Geld kaufen.
Finley ließ seine hellgrünen Augen über die Gebäude und die in der Sonne glitzernden Fenster schweifen und stellte ein wenig überrascht fest, dass er glücklich war.
Auf das Klopfen an seiner Bürotür hin drehte er sich um, ehe er »Herein« rief.
»Sir.« Abel Winesap, ein kleiner, schmalschultriger Mann mit dem gewichtigen Titel ›Geschäftsführender Stellvertreter des Präsidenten‹ räusperte sich. »Mr. Finley.«
»Kennen Sie die wahre Bedeutung von Weihnachten, Abel?« Finleys Stimme war so weich wie heißer Whisky auf Sahne.
»Äh …« Winesap fingerte verlegen am Knoten seiner Krawatte. »Sir?«
»Kaufen. Ein wunderbares Wort, Abel. Und die wahre Bedeutung dieser großartigen Festtage, finden Sie nicht?«
»Doch, Sir.« Winesap spürte, wie ihm ein Schauer über den Rücken lief. Der Grund für sein Kommen war heikel genug. Und Finleys gute Laune machte seine Mission nur noch schwieriger und gefährlicher. »Ich fürchte, wir haben ein Problem, Mr. Finley.«
»Oh!« Finley lächelte noch, doch sein Blick erstarrte zu Eis. »Und das wäre?«
Winesap schluckte heftig gegen seine Angst an. Er wusste, dass Finleys unterkühlter Zorn tödlicher sein konnte als der ungezügelte Wutausbruch jedes anderen Menschen. Es war Winesap gewesen, der dazu ausgewählt worden war, der Entlassung eines Mitarbeiters beizuwohnen. Dieser hatte Geld unterschlagen. Und er erinnerte sich nur zu gut, mit welch eiskalter Gelassenheit Finley dem Mann mit einem edelsteinbesetzten Dolch aus dem 16. Jahrhundert die Kehle aufgeschlitzt hatte.
Betrug, so befand Finley, erforderte umgehende Bestrafung, die sollte aber mit angemessenem Zeremoniell ausgeführt werden.
Ferner erinnerte sich Winesap mit Verdruss, dass er die Leiche anschließend beseitigen musste.
Sichtlich nervös fuhr er fort: »Es geht um die Lieferung aus New York. Die Warensendung, die Sie erwarten.«
»Hat es Verzögerungen gegeben?«
»Nein – das heißt, in gewisser Weise doch. Die Lieferung traf heute termingerecht ein, aber der Inhalt …« Er befeuchtete seine schmalen Lippen. »Das Paket enthält nicht das, was Sie bestellt haben, Sir.«
Finley stützte seine manikürten Hände so fest auf die Schreibtischkante, dass die Knöchel hervortraten. »Würden Sie das bitte genauer erklären.«
»Die Ware, Sir. Die Lieferung stimmt nicht mit der Bestellung überein. Offenbar hat irgendwo eine Verwechslung stattgefunden.« Winesaps Stimme nahm einen weinerlichen Klang an. »Ich dachte, es ist am besten, Ihnen gleich Bescheid zu geben.«
»Wo sind die Sachen?«, Finleys Stimme hatte seine joviale Wärme verloren, sie klang jetzt eiskalt.
»In der Warenannahme, Sir. Ich dachte …«
»Bringen Sie das Paket rauf. Sofort!«
»Jawohl, Sir. Sofort.« Dankbar, entlassen zu werden, verließ Winesap beinahe fluchtartig das Büro.
Finley hatte eine Stange Geld für die Waren bezahlt und noch eine stattliche Summe drauflegen müssen, um sie tarnen und außer Landes schmuggeln zu lassen. Jedes einzelne Stück war gestohlen, getarnt und von den unterschiedlichsten Orten der Welt in seine New Yorker Fabrik transportiert worden. Allein die Bestechungsgelder beliefen sich auf eine sechsstellige Zahl.
Um sich zu beruhigen, schenkte sich Finley ein großes Glas Guavensaft ein.
Wenn bei der Transaktion etwas schief gelaufen war, dachte er, nun schon ein wenig ruhiger, dann musste es eben berichtigt werden. Wer immer einen Fehler gemacht hatte, würde dafür bezahlen.
Bedächtig stellte er das Glas ab und betrachtete sich in dem ovalen George-III.-Spiegel über der Bar. Er fuhr sich mit der Hand durch seine dicke schwarze Haarmähne und bewunderte den Glanz und den Schimmer der vereinzelten silbergrauen Strähnen. Sein letztes Face-lifting hatte die Tränensäcke unter seinen Augen verschwinden lassen, wie auch das beginnende Doppelkinn, es hatte die Falten geglättet, die sich tief um seine Mundpartie eingegraben hatten. Er wirkte keinen Tag älter als vierzig, stellte Finley befriedigt fest, nachdem er das Gesicht einige Male hin und hergedreht hatte, um sein Profil zu studieren. Welcher Idiot hatte gesagt, dass man Glück nicht mit Geld kaufen könne?
Das erneute Klopfen an der Tür vertrieb seine gute Laune. »Herein!«, bellte er und wartete, bis einer seiner Jungs aus der Annahme die Kiste hereingerollt hatte. »Stell sie hier ab!« Er deutete mit dem Finger in die Mitte des Raumes. »Und verschwinde! Abel, Sie bleiben. Die Tür«, setzte er hinzu, worauf Winesap auf dem Absatz herumwirbelte, um sie eiligst hinter dem jungen Burschen zu schließen.
Auf Finleys beharrliches Schweigen hin ging Winesap, aus dessen Gesicht alle Farbe gewichen war, langsam auf die Kiste zu. »Ich habe sie geöffnet, wie Sie es angeordnet haben, Mr. Finley. Und als ich die Ware prüfte, merkte ich, dass da ein Irrtum vorliegen muss.« Beherzt griff er in die mit Papierwolle gefüllte Kiste. Seine Finger zitterten, als er eine Porzellanteekanne zum Vorschein brachte, die ein Veilchenmuster zierte.
Schweigend nahm ihm Finley die Teekanne ab und drehte sie um. Sie stammte aus England. Ein hübsches Stück, gut seine zweihundert Dollar wert. Aber ein Massenprodukt. Auf der ganzen Welt wurden Tausende solcher Teekannen verkauft, für ihn also vollkommen uninteressant. Er schmetterte sie gegen die Kante seines Schreibtischs, dass die Scherben durch das halbe Büro flogen.
»Was sonst noch?«
Ängstlich steckte Winesap seine Hand ein weiteres Mal in die Kiste, um eine bunte Glasvase herauszuziehen.
Italienisch, stellte Finley nach rascher Prüfung fest. Handarbeit. Wert: hundert, höchstens hundertfünfzig Dollar. Die Vase flog knapp an Winesaps Kopf vorbei und zerschellte an der Wand.
»Dann … dann sind da noch Teetassen.« Winesaps Blick huschte zwischen der Kiste und dem versteinerten Gesicht seines Chefs hin und her. »Und etwas Silber … zwei Platten und eine Gebäckschale. Und z-zwei Sektkelche, auf die Hochzeitsglocken eingraviert sind.«
»Wo ist meine Ware?«, verlangte Finley mit scharfer Stimme zu wissen, wobei er jedes einzelne Wort betonte.
»Sir, ich weiß nicht … es ist so, ich glaube, da muss …«, seine Stimme wurde zu einem leisen Wispern, »ein Irrtum passiert sein.«
»Ein Irrtum.« Finleys Augen leuchteten wie Jade, als er die Fäuste in die Hüften stemmte. DiCarlo, dachte er und ließ das Bild von seinem Verbindungsmann in New York vor seinem inneren Augen erscheinen. Jung, intelligent, ehrgeizig. Und alles andere als dumm, ging es Finley durch den Kopf. Keinesfalls dumm genug, um ein falsches Spiel mit ihm zu versuchen. Dennoch würde er für diesen Irrtum bezahlen müssen, und das nicht zu knapp.
»Verbinden Sie mich mit DiCarlo.«
»Jawohl, Sir.« Erleichtert, dass Finleys Wut ein neues Ziel gefunden zu haben schien, eilte Winesap ans Telefon.
Während er die Nummer wählte, trat Finley wütend ein paar Porzellanscherben in den Teppich. Dann griff er in die Kiste und schlug auch noch den restlichen Inhalt kurz und klein.
2. Kapitel
Jed Skimmerhorn hatte Lust auf einen Drink. Irgendeinen Drink. Auf einen Whisky, der ihm in der Kehle brennen würde, auf die sanfte Wärme eines Brandys oder auf ein frisches kaltes Bier. Doch damit würde er warten müssen, bis er alle Kisten die wackelige Hintertreppe hinauf in sein neues Apartment geschleppt hatte.
Nicht, dass ihre Anzahl unüberschaubar gewesen wäre. Sein alter Kollege Brent hatte ihm bereits geholfen, das Sofa, die Matratze und die schwereren Möbelstücke hinaufzutragen. Übrig geblieben waren einige Bücherkisten sowie Kartons mit Küchenutensilien und anderem Kleinkram. Er wusste eigentlich nicht genau, warum er das alles mitgenommen hatte. Es wäre doch so viel einfacher gewesen, diese Dinge ebenfalls einzulagern.
Doch das war nicht das Einzige, worüber er sich in diesen Tagen nicht im Klaren war. Er konnte es weder Brent noch sich selbst erklären, warum er ans andere Ende der Stadt ziehen wollte, raus aus dem großen alten Haus in ein kleines Apartment. Es musste irgendetwas mit einem Neubeginn zu tun haben. Und man konnte nichts Neues beginnen, solange man das Alte nicht beendet hatte.
Jed hatte in letzter Zeit etliches beendet.
Seinen Abschied einzureichen, war der erste Schritt gewesen – und wahrscheinlich der schwerste. Der Polizeichef hatte endlose Gegenargumente vorgebracht, sein Abschiedsgesuch nicht akzeptiert und ihn schließlich auf unbefristete Zeit beurlaubt. Was auf dasselbe hinauslief, fand Jed. Jedenfalls war er kein Cop mehr, konnte nie wieder einer sein. Welcher Teil von ihm auch immer hatte dienen und beschützen wollen, er war ausgebrannt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!