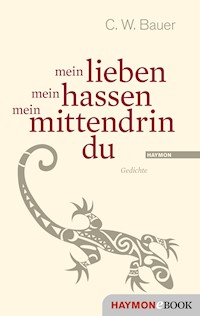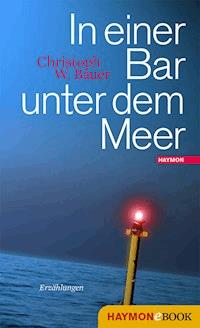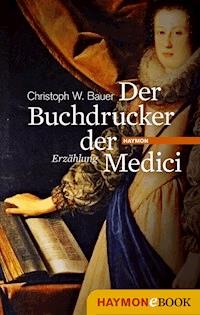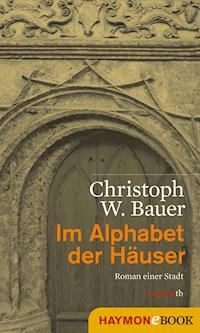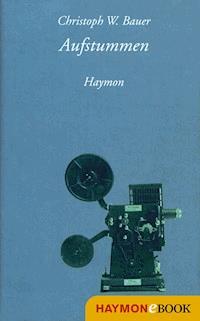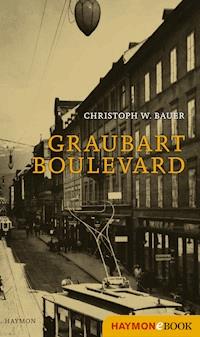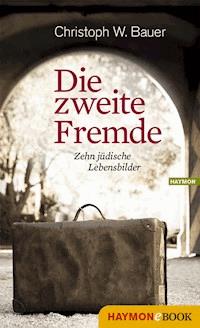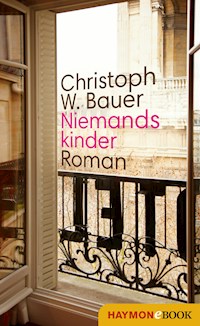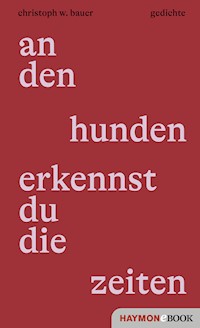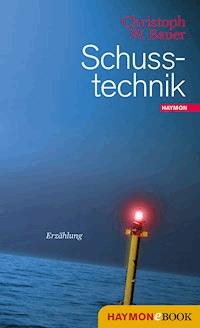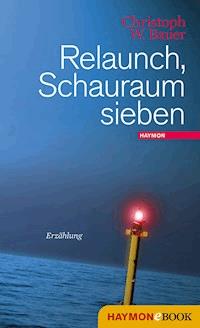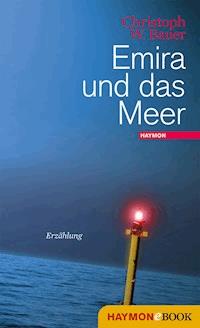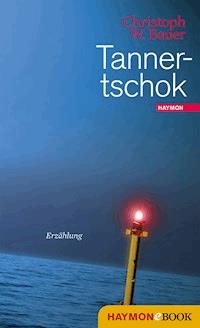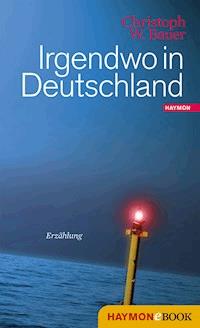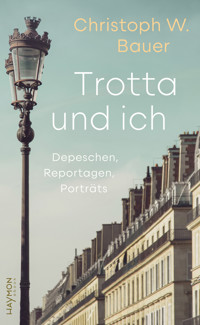
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
"Je suis en route …" So beginnt Christoph W. Bauer jeden seiner Texte, anhand derer wir gemeinsam mit ihm Pariser Straßen durchwandeln, in Cafés verweilen, über Promenaden flanieren und auf Friedhöfen nach vergessenen Namen suchen. Die Stadt der Lichter und Schriftsteller*innen: An kaum einem anderen Ort versammelten sich die großen Namen der Literaturszene so zahlreich. Christoph W. Bauer nimmt uns mit auf Spaziergänge; den Wegen entlang, die einst von ebendiesen Autor*innen begangen wurden; er sinniert über das Wirken, über die Literatur, die in Paris entstand, über das stetige Arbeiten, das Schreiben in dieser Stadt, über eine Ära und Tradition von Schriftsteller*innen. Der Autor erzählt u. a. von Samuel Beckett, Marguerite Duras, Heinrich Heine oder Jacques Prévert und verknüpft ihre Geschichten dort, wo sich Überschneidungen finden. Christoph W. Bauers Erkundung vergangener Welten und heutiger Szenerien Geschichten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, schlagen in Paris Wurzeln, fließen ineinander. Wie kein anderer erzählt der Autor von dieser Stadt, ihren Plätzen, den Leuten, schlichtweg: dem Leben. Im Prosaband erscheinen Christoph W. Bauers dichte, bildgewaltige Texte, die eine Hommage sind an Paris und seine Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Ähnliche
Inhalt
Im Blick versunkene Landschaften
I
Heute spaziert Trotta plötzlich wieder aus dem Bücherregal und baut sich vor mir auf. Ob ich mich immer so bitten lasse, schnauzt er mich an. Ich erinnere das Gespräch vor drei Wochen, druckse ein wenig herum, hätte momentan einfach unerwartet viel zu tun und … – Das interessiere ihn nicht, unterbricht er mich. Er wolle nun endlich vor seinen Schöpfer treten. Wir müssten erst die Flüge buchen, entgegne ich, außerdem … – Das habe er längst getan, erwidert Trotta knapp.
„Das Kennzeichen des Aristokraten ist vor allem anderen der Gleichmut“, dieser Satz fällt mir ein, während Trotta mich barsch auffordert, ihm zu folgen. Etwas zögerlich komme ich seiner Aufforderung nach, ahne zugleich, dass der Weg, auf den er mich schicken will, in die gleiche Richtung führt wie jener, auf dem ich mich seit mehr als einem halben Jahr befinde. In Trottas Blick spiegelt sich unversehens das Umherirrende und Strauchelnde, zwischen Auflehnung, Erstaunen, Demut und Bestürzung Pendelnde, das all jene Menschen eint, die ich in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren in England und Israel kennenlernen durfte. Ich war mit einem Projektteam unterwegs gewesen, um die letzten noch lebenden Zeitzeugen aufzusuchen, die 1938 aus Innsbruck vertrieben worden waren. Die Recherche hatte uns nach London, Manchester, Plymouth, Haifa, Tel Aviv und Netanja geführt, und stets hatte ich eines der Bücher von Joseph Roth in meinem Reisegepäck.
Heimat und deren Verlust, die Tage ausgefüllt mit Begegnungen, die Abende und Nächte mit Roth’schen Sätzen. Trotta zieht mich immer tiefer hinein in einen Blick, der zur Klammer meiner Gedanken wird, schon steige ich die Kapuzinergruft hinab und komme an im Paris des Jahres 1939.
*
Paris, 6. Arrondissement, auf dem Boulevard Saint-Germain, Trotta hat es eilig, ich kann ihm kaum folgen. Vorbei am Café de Flore, wo sich die Pariser Avantgarde des 20. Jahrhunderts getroffen hat. Charles Maurras soll in den 20er-Jahren über dem Café gewohnt und gearbeitet haben, keuche ich, Trotta rümpft entrüstet die Nase. Rasch will ich davon ablenken, gerade einen der aktivsten Anti-Dreyfusards und Vordenker des nationalistischen Frankreich genannt zu haben, und schaue deshalb auf die gegenüberliegende Straßenseite zum Les Deux Magots: Hier gingen Verlaine, Rimbaud und Mallarmé ein und aus, Breton, André Gide, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Auch Hemingway, Camus und Picasso seien oft in diesem Café zu Gast gewesen, füge ich hinzu. Trotta seufzt, er packt mich am Handgelenk, zieht mich weiter.
Rechts ab in die Rue de Seine, aus dem Maison Mulot tritt eine Gruppe von Touristen. The filling was wonderful and creamy, höre ich eine Dame sagen, und bedeutungsschwer fügt ein Herr mit Baseballmütze hinzu: I tried lots of flavored macarons in Paris – hands down, the best ones were at Maison Mulot.
Gerne würde ich mich auch davon überzeugen, doch Trotta – immer zielstrebiger wird sein Schritt, wir erreichen die Rue de Tournon, steuern geradewegs auf den Jardin du Luxembourg zu. Kurz vor dem Eingang zum ehemaligen Schlosspark bleibt Trotta unvermittelt stehen, er lässt meine Hand los und streckt den Arm aus. Mein Blick gleitet von seiner Schulter zum Ellbogen, dann den Unterarm entlang zur Fingerspitze: Sie zeigt auf das Café Le Tournon.
*
Ich betrachte die Fassade des Gebäudes, ein schmaler Bau, der aufgrund der geringeren Anzahl an Etagen im Häuserensemble auffällt. Auf Höhe des ersten Stockwerks eine Gedenktafel: ICI A RÉSIDÉ JOSEPH ROTH, lese ich, HOMMAGE DE SES AMIS AUTRICHIENS.
Über dem Tournon befanden sich einst die Räumlichkeiten des Hôtel de la Poste, das zwölf Zimmer und ein einziges Bad zählte. Das Haus wurde von Madame Alazard geführt, a darkly handsome French-woman who runs things like a tough but affectionate drill sergeant, so wird sie in einer Ausgabe der Zeitschrift Ebony beschrieben. Der Artikel handelt von den Pariser Jahren des Schriftstellers Richard Wright, der mit seinem 1954 erschienenen Buch Black Power das Schlagwort der 60er-Jahre prägte. Ein weiterer Satz aus dem Artikel ist mir in Erinnerung geblieben: Madame Alazard is aware of all the romances and the scandals, the hopes and blasted hopes.
An Hoffnungen, und noch so verdammten, litt Roth keinen Mangel und für einen Skandal war er immer zu haben. Einmal geriet er bei der Lektüre eines Manuskripts wohl derart in Rage, dass er mit dem Text des Kollegen auf der Toilette verschwand, um ihn dort zu zerreißen und hinunterzuspülen. Doch das Unterfangen misslang, ein Handwerker musste geholt werden, der das verstopfte Klo schnellstmöglich wieder funktionstüchtig machte, damit der Bistrobetrieb aufrechterhalten werden konnte. Dennoch wurde Roth von Alazard geliebt und bemuttert, während ihr Mann, der Patron, den Emigranten hasste, ihn jedoch als großen Konsumenten sowie Zugkraft für weitere Flüchtlinge tolerierte, bescherten sie dem Hotel und Bistro doch Umsätze.
Roths Tisch im Bistro soll ein offenes Haus gewesen sein, hier traf er Freunde, Bekannte und Verhandlungspartner, in seiner ‚Republik Tournon‘, wie er diesen Teil des Quartier Latin nannte.
Vor dem Café ein paar Tische und Stühle.
*
„Ich saß neben ihm draußen vor dem Bistro und sah zu, wie sie drüben an der anderen Seite der Terrasse die letzten Reste des Hôtel Foyot demolierten. Als er mit dem Schreiben fertig war, las er mir den Aufsatz vor“, hält Soma Morgenstern in seinen Erinnerungen fest. Ein Kind der Habsburger Monarchie, aus dem Königreich Galizien und Lodomerien stammend, Journalist und Schriftsteller und aufgrund der jüdischen Herkunft in die Emigration getrieben, verband ihn mit Roth eine fast dreißigjährige, sehr wechselvolle Freundschaft, die vor allem durch Roths Trunksucht in den letzten Monaten seines Pariser Exils auf harte Proben gestellt wurde.
Ich versuche, mir die beiden vorzustellen, und wie Roth seinem Freund nun die Zeilen vorliest:
„Gegenüber dem Bistro, in dem ich den ganzen Tag sitze, wird jetzt ein altes Haus abgerissen, ein Hotel, in dem ich sechzehn Jahre gewohnt habe.“ Ich schaue kurz auf. „Vorgestern abend stand noch eine Mauer da, die rückwärtige, und erwartete ihre letzte Nacht.“ Hier also stand es, das Foyot. „Jetzt sitze ich gegenüber dem leeren Platz und höre die Stunden rinnen. Man verliert eine Heimat nach der anderen, sage ich mir. Hier sitze ich am Wanderstab. Die Füße sind wund, das Herz ist müde, die Augen sind trocken. Das Elend hockt sich neben mich, wird immer sanfter und größer, der Schmerz bleibt stehen, wird gewaltig und gütig, der Schrecken schmettert heran und kann nicht mehr schrecken. Und dies ist eben das Trostlose.“
Der Platz ist jetzt asphaltiert, ein breites Trottoir angelegt. Ein paar Fahrräder lehnen an den Laternen, ein Zeitungskiosk, auch ein Wartehäuschen für den Bus sehe ich und Telefonzellen mit abgerissenen Hörern.
Gerade die letzte gemeinsame Zeit ist es, der Morgenstern in seinen Memoiren viel Raum widmet. Dabei schafft er es, die innere Zerrissenheit seines Freundes und zugleich die vieler Vertriebener in unaufgeregtem Ton darzustellen. Ihm selbst, der am Tag der Annexion Österreichs nach Paris floh, gelingt 1941 über Marseille, Casablanca und Lissabon die Flucht nach New York. Hier bleibt er bis zu seinem Tod 1976, weder von österreichischer Seite zur Heimkehr aufgefordert noch willens, in seine Heimat zurückzukehren.
Die Begegnungen in England und Israel kommen mir in den Sinn. Für die aus Innsbruck Vertriebenen gab es ebenfalls kein Zurück. Wohin auch? Ließ sich das Genommene denn überhaupt noch Heimat nennen?
*
Ziellos streune ich durch das 6. Arrondissement, das seinen Namen der ältesten Kirche von Paris verdankt, Saint-Germain-des-Prés. Mehr oder weniger als Fortsetzung des Quartier Latin und am Rive Gauche gelegen, zieht es sich von der Seine bis zum geschäftigen Boulevard de Montparnasse. Seit vielen Jahrzehnten gilt es als Viertel der Kunst, Politik und Wissenschaft; im Palais du Luxembourg tagt der französische Senat, der Jardin du Luxembourg ist beliebter Treffpunkt für Touristen, aber auch für Studenten, nicht zuletzt aufgrund der Nähe zur Sorbonne.
Durch die Rue de Condé, die Rue Racine, kurz auf den Boulevard Saint-Michel, dann ab in die Rue de l’Ecole de Médecine bis zur Pâtisserie Viennoise, depuis 1928 steht auf der Auslage, ich erblicke in der Vitrine Sachertorten, Apfelstrudel und Wiener Kipferl.
Straßenbezeichnungen lassen sich auswendig lernen, ganze Stadtviertel kann man in sich abspeichern, aber wird man deshalb in ihnen heimisch? Reicht es, vom Bäcker wiedererkannt zu werden, stellt sich ein Heimatgefühl ein, wenn einem die Kellnerin unaufgefordert das obligate Getränk serviert?
Zweifelsohne ist es möglich, einen Ort zu lieben, solange einem die Rückkehr an jenen, mit dem man ihn vergleicht, nicht verwehrt wird. Und so konnte Joseph Roth für mich durchaus nachvollziehbar in einem Brief 1925 aus Paris formulieren: „Wer noch nicht hier war, ist nur ein halber Mensch“ und „ich könnte weinen, wenn ich über die Seine-Brücke gehe, zum ersten Mal bin ich erschüttert von Häusern und Straßen, mit allem bin ich heimisch.“
Auch ich liebe Paris, London ist mir nicht nur eine Reise wert und an Tel Aviv schätze ich mehr als nur das Nachtleben. Blicke ich aufs Meer, werde ich geradezu euphorisch, egal, ob in Plymouth, Netanja oder Haifa, ich gerate ins Schwärmen, die Worte sprudeln aus mir, wohl fühle ich mich und mit allem –
Heimisch, das Wort geht einem leicht über die Lippen, wenn man die Heimat nicht verloren hat.
*
Trotta hat mich längst eingeholt. Um Haltung ist er bemüht, der Spartaner unter den Österreichern, schweigend läuft er neben mir her, unter seinem Arm eine Zeitung, er überlässt ihr die Worte:
„Ein grausamer Wille der Geschichte hat mein altes Vaterland, die österreichisch-ungarische Monarchie, zertrümmert. Ich habe es geliebt, dieses Vaterland, das mir erlaubte, ein Patriot und Weltbürger zugleich zu sein“, schreibt Joseph Roth im Vorwort zum Radetzkymarsch, dessen Vorabdruck 1932 in der Frankfurter Zeitung erschienen ist.
Fünf Jahre zuvor hat er mit Franz Tunda in Die Flucht ohne Ende eine Schlüsselfigur des vergangenen Jahrhunderts entworfen, den Typus jener Umherirrenden, Entwurzelten, die im Leben einfach nicht mehr Fuß fassen können, sich durch einen Menschenstrom schieben lassen in der Hoffnung auf eine Ankunft an einem Ort, von dem sie keine eigentliche Vorstellung haben. Nun gesellt sich Tunda zu Trotta und mir, gemeinsam gehen wir den Boulevard Saint-Germain entlang, vorbei an Cafés und Restaurants, die auch Roth gesehen hat.
Die namhaften Lokale ausgenommen, vor denen sich Touristen scharen, gleicht die Straße einer jener Einkaufsmeilen, wie man sie aus vielen Städten kennt. Früh hatte Roth erkannt, in großen Städten „sind Aktiengesellschaften imstande, die Vergnügungsbedürfnisse einiger sozialer Schichten gleichzeitig zu befriedigen, die ‚Mondänität‘ im Westen zu pflegen und im anderen Stadtteil die Freuden eines ‚gutbürgerlichen Mittelstands‘ zu schaffen und im dritten Teil das gehobene Proletariat mit ‚drittklassigen Etablissements‘ zu versorgen, der auch einmal eine Ahnung von der ‚großen Welt‘ bekommen möchte. Und wie in einem Warenhaus für jede soziale Schicht und selbst noch für die vielfach nuancierten Zwischenschichten Kleidung und Nahrung sorgfältig in Preisen wie in ‚Qualität‘ vorbereitet und abgestuft werden, so liefern die AGs der Freuden-Industrie jeder Klasse das Amüsement, das ihr gebührt und das sie verträgt, jede Art von Alkohol, die ihr bekommt und die sie bezahlen kann, vom Champagner und Cocktail zum Cognac, zum Kirschwasser, zum gezuckerten Likör, zum Bier“ –
Kaum zu glauben, dass dieser Text 80 Jahre alt ist.
*
Wir sind nach langem Fußmarsch am Quai d’Orsay angekommen, biegen rechts ab und überqueren die Seine, auf die Place de la Concorde zu, sie liegt im Zentrum der Stadt, im 8. Arrondissement. Schon von weitem erkennbar der Obelisk von Luxor, doch Tunda und Trotta haben keinen Blick dafür. Ihr Blick ist mir in den vergangenen Wochen immer wieder begegnet, ein Blick, der im Rücken der Augen nach Landschaften sucht, die nicht in Tel Aviv oder London zu finden sind, für meine beiden Begleiter aber auch nicht in Paris.
Das Treiben um uns nimmt zu, Gelächter, Stimmen, verschiedene Sprachen, Menschen eilen an uns vorbei und verschwinden in ihren eigenen Geschichten; Frauen in eleganten Kostümen, Männer in Anzügen, dazwischen immer wieder Touristen.
Tunda sieht mich an und durch mich hindurch. Während wir uns einer der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt nähern, zwingt mich sein verlorener Blick, in seinem Gesicht zu lesen:
„Am 27. August 1926, um vier Uhr nachmittags, die Läden waren voll, in den Warenhäusern drängten sich die Frauen, in den Modesalons drehten sich die Mannequins, in den Konditoreien plauderten die Nichtstuer, in den Fabriken sausten die Räder, an den Ufern der Seine lausten sich die Bettler, im Bois de Boulogne küßten sich die Liebespaare, in den Gärten fuhren die Kinder Karussell. Es war um diese Stunde, da stand mein Freund Tunda, 32 Jahre alt, gesund und frisch, ein junger, starker Mann von allerhand Talenten, auf dem Platz vor der Madeleine, inmitten der Hauptstadt der Welt und wußte nicht, was er machen sollte. Er hatte keinen Beruf, keine Liebe, keine Lust, keine Hoffnung, keinen Ehrgeiz und nicht einmal Egoismus. So überflüssig wie er war niemand in der Welt.“
Auch Joseph Roth war 32 Jahre alt, als er diese Zeilen schrieb. Doch musste er sich überflüssig fühlen in der Welt? Freilich, er war noch nicht berühmt, hatte sich aber mittlerweile einen Namen gemacht, konnte sich aussuchen, für welche Zeitungen er schrieb. Bald würde er zum bestbezahlten Journalisten Deutschlands aufsteigen, mit seinen Romanen Hiob und Radetzkymarsch Erfolge beim Publikum feiern. Aber was zählte das? Seine Ehe ging in die Brüche, hielt dem Leben dieses Ruhelosen nicht stand, der nur noch in Hotelzimmern schlief, in Kaffeehäusern erwachte und in Sätzen durch die Tage lief. Seine Frau erkrankte, gab ihm die Schuld dafür, er nahm sie an, soff sie weg, hetzte weiter. Nein, sie trieb ihn nicht in den Suff, das Bild ist zu billig, seine Schritte machten ihn zum Säufer, weil sie ihn immer tiefer hineinrannten ins Ausweglose, das so viele Namen hatte. Und jeder Schritt trübte seinen Blick, schärfte zugleich seine Worte, die er wie ein Skalpell ansetzte, längst hatte er die Geschwüre erkannt.
„Mir und vielen meiner internationalen Landsleute, die gleich mir ein Vaterland und damit eine Welt verloren haben, ist ein ganz anderes Österreich bekannt und vertraut als jenes, das sich in seinen Export-Operetten zu Lebzeiten offenbart hat und das sich nach dem Tode nur noch in seinem billigsten Export bewahrt.“
*
Sechs Jahre nach dem Radetzkymarsch publizierte Roth im kleinen niederländischen Exilverlag De Gemeenschap die Kapuzinergruft. Roth war Mitte der 30er-Jahre mehrmals in Amsterdam gewesen, er hatte drei Verlage in den Niederlanden. Dem Verleger von De Gemeenschap war er im Mai 1935 anlässlich einer Präsentation der holländischen Ausgabe des Antichrist erstmals begegnet. Roth erhielt weiterhin Vorschüsse und Publikationsmöglichkeiten, was mitunter für Missmut bei anderen Autoren sorgte. Zwar erging es Roth besser als vielen seiner Kollegen, aber auch seine wirtschaftliche Situation verschlechterte sich zunehmend, wie einer seiner Briefe an Stefan Zweig verdeutlicht:
„Mit lechzender Zunge laufe ich herum, ein Schnorrer mit heraushängender Zunge und mit wedelndem Schwanz. Wie soll ich nicht neue Verträge eingehen, auf neue Bücher? Nicht einmal die Verträge bekomme ich. Was soll ich tun, jetzt, heute, nächste Woche.“
Von Amsterdam nach Ostende, wo Roth Zweig trifft. Es gibt ein Foto von dieser Zusammenkunft, und jedes Mal wenn ich es mir ansehe, fällt mir ein Satz ein, den Roth einmal an Zweig schrieb: „Das Krepieren dauert länger als das Leben.“ Genau diese Zeile kam mir kürzlich in Tel Aviv schmerzlich in den Sinn, als ich einem der aus Innsbruck Vertriebenen gegenübersaß, einem mittlerweile über 90-jährigen Mann. Ähnlich Roth hatte auch er die Augen etwas zusammengekniffen, sein Kopf, geduckt, wie in Abwehr, zwischen den Schultern.
Das Bild dieses Mannes und das Foto Joseph Roths. Beides Dokumente des Getriebenseins und des panischen Erschreckens darüber. Ich hatte in Tel Aviv das Gefühl, „einen Menschen zu sehen, der einfach vor Traurigkeit in den nächsten Stunden stirbt.“ Seine Augen „starrten beinahe blicklos vor Verzweiflung, und seine Stimme klang wie verschüttet unter Lasten vor Gram.“ So beschrieb Irmgard Keun ihr erstes Zusammentreffen mit Joseph Roth in Ostende 1936. Ihre Worte klangen mir in Tel Aviv im Ohr, in Haifa und London bei Begegnungen mit Menschen, die längst in neuen Ländern Fuß gefasst hatten. Dort seit Jahrzehnten lebten, arbeiteten, mit ihren Enkelkindern Ausflüge machten – und doch in Gedanken immer wieder in jene Jahre der Flucht zurückkippten, mich dabei anstarrten: blicklos vor Verzweiflung, verschüttet unter Lasten vor Gram.
Alles Einzelschicksale, mag sein, und doch haben sie einen gemeinsamen Nenner, den keine Konfession determiniert und auch nicht die Frage – ob Jude oder Tiroler, völlig egal, er habe verdammt noch mal nur Schmerz empfunden, „die Rührung kommt immer wieder zurück, immer wieder. Immer wieder, immer wieder habe ich mich zurückerinnert an den Tag, an dem ich Innsbruck 1938 verlassen habe und nicht erwarten konnte, dass ich jemals im Leben wieder dorthin – der letzte Blick auf die Nordkette, auf das Brandjoch, kurz bevor der Zug im Bergiseltunnel verschwunden ist.“
*
Den Bucheinband der Originalausgabe der Kapuzinergruft ziert die Landkarte eines Österreich, das es schon lange nicht mehr gibt. Thematisch schließt der Roman an den Radetzkymarsch an, wieder ist es die Familie Trotta, anhand derer Roth seinen Heimatbegriff definiert und den Verlust des Vaterlandes vor Augen führt. Franz Ferdinand Trotta, dessen Großvater der Bruder jenes Leutnant Joseph Trotta war, „der dem Kaiser Franz Joseph in der Schlacht bei Solferino das Leben“ gerettet hatte, spricht aus, woran sich Joseph Roth geistig klammert:
„Mein Vater träumte von einer Monarchie der Österreicher, Ungarn und Slawen.“
So lernte ich Joseph Roth kennen, als Monarchisten, der er wahrscheinlich nie war, dann als roten Joseph, später als Franzosen aus dem Osten, als Mittelmeermenschen, „wenn Sie wollen, ein Römer und Katholik, ein Humanist und Renaissance-Mensch.“
Ich las mich durch seine Werke, studierte Biografien, die ihn mir als Dichter des Austroslawismus vorstellten, denn das Milieu, in denen er seine Romane ansiedelt, ist oft slawisch und von ostjüdischen Elementen geprägt. Auch ist Roths Österreich eher eines der slawischen Kronländer, nicht vergleichbar der heutigen Alpenrepublik. In einem Brief an Ernst Křenek schreibt Roth 1934: „Gewiss weiß ich, dass der Kaiser von Österreich, bliebe er nur ein Kaiser der Alpentrottel, nicht der Kaiser wäre, den wir meinen.“ Er nahm des Kaisers Habitus an, den federleichten Schritt, pflegte das Image des k.u.k. Leutnants, ließ sich den Schnurrbart „slowakisch“ über den Mund wachsen, unterschrieb seine Briefe mit „Ihr alter Roth“, bekräftigte in ihnen: „Ich will die Monarchie haben und ich will es sagen.“
Nein, Roth hatte sich nicht um den Verstand gesoffen, er projizierte lediglich seine geistige Heimat auf die Landkarten einer versunkenen Welt, weil ihm die „Scheißer in der Monarchie lieber waren als die Kacker in der Republik!“ Er war genauso wenig blind wie die Menschen, denen ich in Israel und England begegnete. Ihnen waren eben die Kacker des Austrofaschismus lieber als die Scheißer des Nationalsozialismus. Für sie waren Schuschnigg, ja selbst Dollfuß Konstanten einer Welt, die in Scherben gegangen war. In ihren Erinnerungen wurde laut, was Roth in der Kapuzinergruft vollzog, indem er den alten Monarchen selbst ansprach:
„Aber dich, mein Kaiser Franz Joseph, suche ich auf, weil du meine Kindheit und meine Jugend bist.“
Als die Kapuzinergruft 1938 erscheint, wird jede Nostalgie von aktuellen Ereignissen überrannt. Österreich hat durch den Anschluss an das Deutsche Reich als Staat zu existieren aufgehört. Der letzte Satz aus der Kapuzinergruft fällt mir ein:
„Wohin soll ich, ich jetzt, ein Trotta?“
II
Die Suche nach dem, was es noch nicht gibt, ist für Ernst Bloch gleichbedeutend mit der Suche nach Heimat als Ort. Ob ich mich nicht beim Beamten am Schalter nach einem Ticket an diesen Ort erkundigen soll? Ich unterlasse es und frage nach dem nächstbesten Zug von Paris nach Lyon.
Ich blicke mich um in der Gare de Lyon, die heute zu den Pariser Sehenswürdigkeiten gehört. Anlässlich der Weltausstellung 1900 wurde sie neu errichtet. 37 Jahre später fand erneut eine Weltausstellung in Paris statt, sie stand im Schatten der totalitäreren Regime Europas, die mit pathetischen Architekturen auftraten. In starrer Monumentalität bekämpften sich das nationalsozialistische Deutschland und die Sowjetunion auf dem Ausstellungsgelände, von den Pavillons, die einander direkt gegenüber standen, prangten ins Überdimensionale vergrößert, hier der Reichsadler mit Hakenkreuz, dort Hammer und Sichel. Für das „Deutsche Haus“ zeichnete Albert Speer verantwortlich, der seinen wuchtigen und fensterlosen Quader „eine in schwere Pfeiler gegliederte kubische Masse“ nannte und als reine Abwehrgeste gegenüber dem sowjetischen Pendant verstehen wollte. In Erinnerung geblieben ist von dieser Weltausstellung der spanische Pavillon vor allem wegen eines Exponats – Pablo Picassos Guernica.
Roth wusste um die Vorkommnisse in Spanien, wo seit 1936 der Bürgerkrieg tobte, und gewiss erkannte er im spanischen Pavillon die Werbung für die Volksfront und zugleich den erhobenen Zeigefinger vor den Gefahren des Faschismus. Letzterer war ihm auch aus Frankreich nicht unbekannt. Die in der Konfrontation der Dreyfus-Affäre gegründete Action Française unter Charles Maurras vertrat betont nationalistische und antiparlamentarische Positionen und machte in den Protestanten, Juden und Freimaurern die Sündenböcke für die negative wirtschaftliche Entwicklung aus. Anfang der 30er-Jahre konnten die Action Française und weitere faschistische Parteien und ‚Bünde‘ im Windschatten der schweren wirtschaftliche Krise einen nicht unerheblichen politischen Einfluss gewinnen. Im Februar 1934 versuchten bewaffnete Faschisten, die französische Nationalversammlung zu stürmen. Édouard Daladier, Mitglied der Radikalsozialisten und gerade mal neun Tage im Amt, trat als Premier zurück und machte Gaston Doumergue Platz. Der holte sich einen Mann als Kriegsminister ins Kabinett, dessen Name bis heute die französische Öffentlichkeit spaltet: Philippe Pétain.
*
Von Ende Jänner bis Mitte März 1934 erfolgt im deutschsprachigen antifaschistischen Pariser Tageblatt der Vorabdruck von Roths Roman Tarabas, ein Gast auf dieser Erde. Es ist dies sein erstes Buch aus dem Exil, die Geschichte eines Irregehenden und wieder Heimkehrenden. Im selben Jahr schreibt Roth Der Korallenhändler, ab Juni 1934 hält er sich in Südfrankreich auf. 1935 wieder in Paris. 1936 mehrere Monate in Amsterdam und Ostende. Anfang 1937 eine Vortragsreise durch Polen. Ein Aufenthalt in Wien. Dann wieder zurück nach Paris.