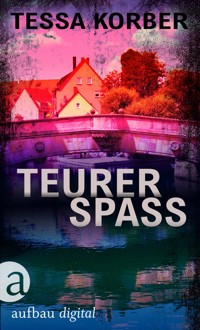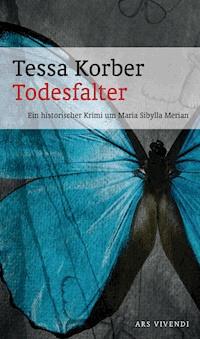Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wahre Kriminalfälle In True Crime Franken erzählen Tessa Korber und Elmar Tannertzehn wahre Kriminalfälle der fränkischen Geschichte nach und erwecken das jeweilige Lokal- und Zeitkolorit zum Leben. Sie widmen sich unter anderem dem Tod eines Rothenburger Ratsherrn 1408, dem Gefängnisausbruch in der Fronfeste Nürnberg 1830, dem Bamberger Fenstersturz 1858, dem Doppelmord in der Fürther Spiegelstraße 1920, dem Madonnenraub in Volkach 1962, dem Tod eines RAF-Mitglieds in Nürnberg 1979 und der Geiselnahme auf dem Gelände der Würzburger Leighton Barracks 1980. True Crime aus Franken: 10 historische Verbrechen, literarisch nacherzählt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TESSA KORBER · ELMAR TANNERT
TRUE CRIMETATORT FRANKEN
ars vivendi
Originalausgabe
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen
Originalausgabe (Erste Auflage 2023)
© 2023 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1,90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
eISBN 978-3-7472-0534-1
TRUE CRIMETATORT FRANKEN
INHALT
ZWISCHEN KRIEGEN
Der Doppelmord in der Fürther Spiegelstraße 1920
EINE FRÄNKISCHE WINTERREISE
Die Flucht aus der Nürnberger Fronfeste 1830
LADYKILLERS. EINE FILMKOMÖDIE
Der Raub der Rosenkranzmadonna aus der Kirche Maria im Weingarten, Volkach 1962
GESPRÄCH DURCH DIE ZELLENTÜR
Der ungeklärte Tod des Bürgermeisters Heinrich Toppler, Rothenburg o.d.T. 1408
MÜLLER, MEIER, SCHMIDT
Die Erschießung der Terroristin Elisabeth von Dyck in Nürnberg 1979
DIE RICHTSTÄTTE
Fund eines Skeletts unter dem Galgen von Roßtal, datiert auf um 1700
RADFAHREN
Der Mordfall Flosky, Kahl am Main 1963
WER SCHREIBT, DER BLEIBT
Ein ganz gewöhnlicher Raubmord in Kirchenlamitz in Oberfranken 1888
ABFLUG
Bankraub mit Geiselnahme auf dem Gelände der Leighton Barracks, Würzburg 1980
FENSTERSTURZ
Der Tod des napoleonischen Marschalls Louis-Alexandre Berthier in Bamberg 1815
NACHBEMERKUNGEN
QUELLENVERZEICHNIS
ZWISCHEN KRIEGEN
DER DOPPELMORD IN DER FÜRTHER SPIEGELSTRAßE 1920
In den Geschichtsbüchern schreiben sie, der Krieg sei 1918 zu Ende gewesen. Ich sage, jetzt im Jahr 1939: Er war nie vorbei.
Ganz sicher war er es nicht damals, 1920, als sich alles noch in Bewegung befand. Es war das Jahr, in dem die Grenzen weiterhin bröckelten, als würde noch immer um sie gekämpft, und die fernen Frontlinien verschoben sich weiterhin über Nacht, wovon man nur aus den Zeitungen erfuhr. Die Franzosen hielten das Rheinland besetzt und hofften, es zu behalten; der Norden Schleswigs ging nach einer Volksabstimmung an Dänemark; die Abstimmung im Süden stand noch aus. Danzig lag in einem anderen Land, und um den Korridor dorthin wurde gestritten.
Die Höhe der Reparationszahlungen war noch nicht festgelegt, nur dass es um Milliarden gehen würde, das hörte man, um unvorstellbare Summen für unsereinen, Zahlen, schwer wie Kohlenflöze und lastend wie Gewitterwolken, die den Horizont der Zukunft verdüsterten, und niemand wusste, wie klein genau denn nun dieses neue Deutschland werden sollte und wie arm.
Es vermochte auch niemand zu sagen, wer sie künftig regieren würde, diese eilig geschaffene Republik, die so idyllisch vertraut nach Goethe klang: Weimar. Und die sich als so fabrikneu und ohrensausend modern erweisen sollte, dass man kaum nachkam.
Wer hatte darin eigentlich die Macht, jetzt, da es keinen Kaiser mehr gab: Ministerpräsident Ebert von der SPD und seine bürgerlichen Minister oder die rechten Verbände aus ehemaligen Frontkämpfern, die diese Minister einen nach dem anderen erschossen, ohne von einem Gericht dafür ernsthaft verurteilt zu werden? Oder würden die Linken Revolution machen, schon wieder eine Revolution oder immer noch dieselbe Revolution, die angeblich schon den Krieg beendet und den Kaiserthron gestürzt hatte, wenn es nicht andersherum gewesen war, eine Revolution also, nach der dann, sagten die Leute, alles sein würde wie in Russland? Wo alles ein einziges Chaos schien – oder war das die Zukunftsmusik, wie mein Freund Renner meinte, der bis zuletzt lieber Brüder, zur Sonne, zur Freiheit pfiff als Veronika, der Lenz ist da?
1920 wusste kein Mensch, wohin das alles führen würde.
Der Krieg war vorbei und war es nicht. Wir hatten ein neues Land, wir saßen auf den Trümmern unserer Existenz. Es herrschte Demokratie, es herrschte Chaos, und die Feinde der neuen Republik behaupteten, das wäre das Gleiche. Wir hatten noch die Reichsmark, die aber stündlich weniger wert wurde. Wir litten vielleicht keinen Hunger, waren aber nicht weit davon entfernt. Wir strickten unsere Unterwäsche selbst und verkauften Silberlöffel; und goldene Ringe, mit Brillanten oder ohne, verkörperten eine Alltagswährung. Im Kino lief Lubitschs Kohlhiesels Töchter; die Hälfte der Bevölkerung schien aus Schwarzmarkthändlern und Schiebern zu bestehen; Fürth verlor das Endspiel, und Nürnberg wurde Deutscher Meister; die Kriegsgefangenen kehrten eben erst zurück. In den Cafés ging es hoch her.
Und in der Spiegelstraße 1 in Fürth wurden am 29. April, irgendwann zwischen elf Uhr abends und Mitternacht, zwei Menschen erstochen.
Das war der Beginn meines eigenen kleinen, fast zwanzig Jahre währenden Krieges.
Der neue große Krieg wird alles das jetzt beenden. Nicht, weil ich noch eingezogen werden würde; dafür zähle ich mittlerweile zu viele Jahre. Ich kann jedes einzelne spüren, als dauernden, dumpfen Schmerz in den Knochen und in der Seele. Die Ermittlung ist ein maroder, morscher alter Kahn, der umstandslos versinken wird in den neuen Strudeln der Geschichte. Wer wird danach fragen.
Fast alle sind wir inzwischen Greise: die zuständigen Beamten, die Gutachter, die Zeugen, das Zeitalter, in dem eine einzelne Mordtat noch ein Skandalon war, das es zu untersuchen und zu sühnen galt. Selbst die Nutten, von denen ich damals eine Menge verhört habe, sind tot und begraben oder nicht wiederzuerkennen. Die Zeiten waren erst golden, dann schwarz, jetzt sind sie braun. Bekommen ist uns das alles nicht gut.
Auch der Mörder mag zu alt sein, um noch Gerechtigkeit erfahren zu können, sollte sie ihn jetzt noch ereilen. Wie sollte so eine Gerechtigkeit auch aussehen: Fast zwanzig Jahre hat er herumspazieren und unerkannt fröhlich leben können, während seine Opfer begraben waren und vermoderten. Er hat zwei Menschen mit dem Messer abgeschlachtet auf eine Art … noch nie habe ich so viel Blut gesehen. Noch nie außerhalb der Schützengräben. Noch nie in Fürth, will ich sagen. In meinen Straßen. Wo ich all die Jahre als kleiner Fußsoldat der Ordnung patrouillierte. So habe ich jedenfalls versucht, es zu sehen. Viel hab ich da mitbekommen, bin immer brav marschiert, nie aus dem Tritt gekommen, nie desertiert. Aber so etwas: nein.
Am Ende ist er auch schon tot, der Mörder? 1935 sind wir dem letzten Verdacht nachgegangen, ohne viel Hoffnung und ohne Ergebnis. Schnell stellte sich heraus, dass Michael Hofmann zur Tatzeit im Gefängnis gesessen hatte; wir ließen ihn laufen, wie wir alle am Ende laufen lassen mussten, all die kleinen und großen Diebe, Betrüger, Schieber, Verbrecher, Schmierenkomödianten. Seither ist es still. In meinem Krieg, in meinem Kopf, nicht in der Welt. Die ist noch viel lauter geworden. Bald wird sie alles übertönt haben.
In den letzten Jahren sind kaum noch Reaktionen auf die alte Fahndung gekommen, eine war ein Denunziationsschreiben, wann ist das nur gewesen, 1928 schon? Es war eine jener Verleumdungen, wie sie in unserer schönen neuen Zeit große Mode geworden sind. Einen ganzen Staat hat man darauf aufgebaut. Neben dem alten System von Polizei, Justiz und Gefängnis wurde ein florierendes neues eröffnet von SA, Partei und KZ, das nach Hörensagen und Behagen verhaftet, verurteilt und tötet. Alte Rechnungen werden beglichen, alte Feinde erledigt, neue Gewinne gemacht.
Oder wo landet der Besitz all der Enteigneten, Entrechteten, Umgesiedelten? Wo werden sie selbst bald bleiben? Wenn man erst einmal gesehen hat, dass ein Polizeibeamter sich nicht zu fein ist, bei einer Verhaftung einen Besteckkasten zu stehlen, ein Bürgermeister sich ohne mit der Wimper zu zucken ein Haus überschreibt und der Beamte vom Finanzamt sich nichts dabei denkt, für seine Frau eine schöne silberne Vorlegeplatte mitgehen zu lassen – und warum auch nicht, wo doch sein Vorgesetzter dafür sorgt, dass der ganze Juwelierladen für wenig Geld an einen guten Geschäftsfreund geht –, dann weiß man, was für einen Staat all diese sich vergoldenden Pappnasen bald machen werden. Mit einer Rückkehr der Besitzer rechnen die doch bestimmt nicht, auch wenn’s keiner zugeben will.
Aber was rede ich. Ich klinge ja schon wie der Renner. Wo war ich? Es ist besser, ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Am Ende spiegelt so ein einzelner Fall ja doch die ganze Welt.
In dem Brief, der 1928 an die Polizei ging, stand drin, der Mörder sei verstorben, aber er, der Schreiber, kenne ihn gut. Der Hass ging also über das Grab hinaus. Und auch das, will mir scheinen, ist eine Mode dieser Zeit: das Hassen im großen Stil.
Der Mörder, hieß es in dem Brief, sei ein gewisser Fritz Blankenbach gewesen. Ich gebe zu, der Name traf mich wie ein Geschoss. Blankenbach – das war just der Mann, der mir damals, am 30. April 1920, als Erster begegnete, mit dem überhaupt alles begann.
Er betrat frühmorgens die Stube der Polizeiwache 1 in der Jakobinenstraße, wo ich an jenem Tag Dienst tat, und sagte: »Der Marie muss etwas zugestoßen sein.«
Er meinte damit, wie sich nach näherer Befragung herausstellte, seine Bekannte, Frau Marie Gring, die etwa fünfzigjährige Witwe eines Rechtsanwaltes, die in der Spiegelstraße 1, Ecke Nürnberger Straße wohnte. »Sie besucht mich sonst jeden Morgen, zuverlässig, aber heute nicht. Und außerdem haben die Nachbarn Schreie gehört in der Nacht.«
Als der Brief eintraf, acht Jahre danach, ich weiß noch, da kamen mir die Fragen wieder in den Sinn, die ich mir damals im Stillen gestellt habe: Es war doch noch nicht mal acht in der Früh gewesen, als der Blankenbach zu uns hereinkam. Ist das wirklich die Zeit, um die man sich schon Sorgen über einen ausbleibenden Besuch macht? Um welche Zeit pflegten die beiden sich denn bitte schön zu treffen?
Und diese Hilfeschreie, von denen der Blankenbach sprach: Die Nachbarn müssen ihm davon berichet haben, das heißt, er muss sie danach gefragt, muss an Türen geklingelt und mit ihnen gesprochen haben, und all das um kurz nach sieben Uhr in der Früh? Wenn man es so überdenkt, war der Blankenbach ein sehr früher Vogel mit seinem Verdacht. Wie viele hätten, selbst wenn sie in der Früh einen Besuch vermissten, gleich die Nachbarn inquisiert und hernach die Polizei aufgesucht? Hätten die meisten es nicht eher mit einem zweiten Besuch zu einer christlicheren Zeit versucht?
Mein Kollege August Schildknecht ist dann zu der Adresse gegangen, dazu mein guter Freund, der Schlossermeister Renner, der immer gebraucht wird, wenn es darum geht, eine Tür aufzumachen. Ich hab ihm die Arbeit verschafft seinerzeit, unter der Bedingung, dass er seine nicht beamtentauglichen Ansichten ein wenig für sich behielt, vor den anderen jedenfalls.
Laut Protokoll haben die beiden das Schloss der Gring’schen Wohnung, nachdem sie vergeblich geklingelt und sich umgetan hatten, mit dem Dietrich geöffnet – um genau acht Uhr morgens. Acht Uhr, das steht dort Schwarz auf Weiß.
Damals stand Fritz Blankenbach nicht unter Verdacht. Er hatte ja auch nur allzu recht gehabt: Es war etwas geschehen mit der Marie Gring. Sie lag in der Küche ihrer Wohnung. Getötet mit mehreren Messerstichen, von vorne und von hinten gegen den Brustkorb geführt, wie sich bei der Obduktion zeigen sollte.
Noch übler sah es aus, als man das Zimmer ihres Untermieters betrat. Damals hatten viele in Fürth Untermieter, auch ehemals gutgestellte Leute. Ehemals, das war vor dem Krieg gewesen und vor der Inflation. Jetzt drängten sich in den früher gutbürgerlichen Stuben die Menschen, waren Salons zu Kammern aufgeteilt, Schlafplätze noch in Küchen geschaffen; manche lebten und schliefen in Schichten. Bei Marie Gring ging es noch einigermaßen zu. Sie hatte das größte Zimmer der Wohnung, vielleicht das ehemalige Wohnzimmer, vermietet an einen gewissen Andreas Endres, 56, Schmiedmeister.
Der war ebenfalls tot, wie sich herausstellte. Aber bei ihm war es schlimmer. Das Blut bildete ganze Lachen auf dem Boden. Sein Gesicht, die Hände, die Kleider, alles war verschmiert, das Porzellan des Waschbeckens mehr rot als weiß.
Als der Professor Dr. Molitoris und der Medizinalrat Dr. Baumann ihn anderntags im Sezierzimmer des Fürther Leichenhauses begutachteten, konnten sie die Schnitte kaum zählen: in der Kopfhaut, an den Ohren, im Gesicht, den Händen – vor allem der linken –, am Hals. In seinem Schädeldach steckte eine abgebrochene Messerspitze. Zudem waren Sachen umgeworfen worden, blutige Abdrücke zu sehen: Hier hatte eindeutig ein Kampf stattgefunden. So rasch und still die Frau Gring in ihrer engen Küche gestorben sein musste, so sehr musste es zugegangen sein im Zimmer vom Andreas Endres. Als man die Leiche fand, lag sie in einem verschlossenen Zimmer – fast schien es, der Angreifer, aufgebracht von der Rauferei auf Leben und Tod, sei in Panik gewesen und hätte noch den Niedergemetzelten gefürchtet.
Der Renner ist später bei uns gesessen für das Protokoll, da hab ich ihm einen Ersatzkaffee gebracht und ihm auf die Schulter geklopft. Er hat mich angesehen, und in seinem Blick war noch all das Blut. Er war ja dabei gewesen in Frankreich, wie ich. »Weißt«, setzte er an. Und ich wusste es ja: So auf einem Perserteppich, so zwischen Anrichte und Sofa, so auf den Paradekissen, da wirkte es schlimmer.
»Des hätt’s net braucht«, sagte er.
»Und weißt, was noch«, meinte er ein wenig später. Und ich wusste auch das. Die drei abgebrannten Streichhölzer – keine Ahnung, was die dort am Boden bei der Leiche zu suchen hatten. Keine Ahnung auch, warum sie uns so beeindruckten. Aber so war es. Wie ein böses Omen, wie ein Zeichen lagen sie dort, das sich nicht deuten ließ. Fast so beunruhigend wie das Blut.
Einer fertigte die Skizze an, die heute noch bei den Akten liegt, neben den ganzen Fotos, einen Grundriss der Wohnung, genau und doch wie eine Kinderzeichnung, alle Möbel sorgsam mit der Feder in geübter Kanzleischrift beschriftet, nur das Eisbärenfell-Imitat hat man ausgelassen. Aber die Marie Gring und der Endres waren nur als ungelenke dunkle Umrisspuppen zu sehen, umgeben jeweils von einem unregelmäßigen roten Buntstiftfleck, der das Blut andeuten sollte. Puppenstubenmorde, von hier aus betrachtet.
»Sei Gsichd«, hatte der Renner gesagt und die rote Maske aus geronnenem Blut geschildert. »Und überall die Abdrücke von Fingern, von Füßen, wie in einem Gruselkabinett.« Er schaute mich an: »Große Füß, und einer hatte keine Zehen!«
»Monster gar. Wie beim Dr. Caligari«, sagte einer und lachte. Aber kein anderer hatte den Film gesehen. Der Renner ging heim.
Vielleicht lag es ja daran, an der spektakulären, filmreifen Kulisse von Endres’ Tod, an den rätselhaften Spuren um ihn herum und an den vielen Fragen, die sie im Lauf der Zeit aufwarfen, dass meine Kollegen von Anfang an vom »Mordfall Endres« ausgingen.
Er hatte ja auch im Leben viel mehr Raum eingenommen als die Frau Gring, die still gewesen war, fleißig und allenfalls ein wenig verschroben. Ängstlich war sie gewesen, das sagten die Nachbarn, stets die Kette vor und nicht mal ein Dienstmädchen, weil es ja stehlen könnte. Sogar ihr Bruder hatte ein Klopfzeichen verwenden müssen, sagte er, bei seinen Besuchen, damit sie ihm überhaupt aufmachte. So ein furchtsamer Vogel war das, der da jetzt ganz still lag.
Der Endres dagegen war schon im Leben raumgreifend gewesen, zwar nur eins dreiundsiebzig groß, aber dick und laut war er, hatte getrunken und gefeiert, renommiert und geredet, Geschäfte gemacht von hier nach da. Allein um all seine Kontakte zu erfassen, all die Cafés und Gasthäuser, in denen er sich herumtrieb, all die Schieber und Hehler und Huren, die er kannte, brauchten wir zehnmal so viel Aktenpapier wie für die Frau Gring. Er war auch derjenige, der Geld gehabt haben soll, Scheine, Münzen, Uhren, Krawattennadeln und Ringe, das ganze Arsenal des Schwarzmarkthändlers. Einige von diesen Wertsachen fehlten, wie sich bald herausstellte.
Es war leicht anzunehmen, er sei das Ziel gewesen und die Frau nur im Weg, eine mundtot gemachte Zeugin. Auch mir schien damals, dass viel dafür sprach.
Das waren zwei sehr verschiedene Welten, die da in einer Wohnung beisammengelebt hatten und gemeinsam gestorben waren. Die Welt vom Endres, die kannten wir gut, in der bewegten wir uns regelmäßig, sie war, sozusagen, unser täglich Brot. Ihretwegen existierten wir, die Polizei, wie der Schatten zu einem Körper.
Im Umkreis der Marie Gring gab es nur respektable Leute. Das hielten auch die Akten fest. Und es galt nun mal als ausgemacht, dass respektable Leute grundsätzlich nicht verdächtig wären. Verwunderlich ist das nicht; so ist es doch immer: Deutschland gut, Frankreich böse, Generäle gut, Kommunisten böse. Man kann es auch andersherum denken, kann die Begriffe tauschen – die Hauptsache ist die Grenzlinie, denke ich mir, sie macht die Welt übersichtlich und die Arbeit einfacher. Unsere Grenzlinie war: Respektable Bürger gut, Gesindel ist zu verhaften. Es klang plausibel.
Inzwischen habe ich so viele Menschen über die Grenze gehen, so viele vermeintlich Respektable Undenkbares tun sehen. Vielleicht hab ich mir damals schon gedacht, dass die Moral nicht vom Geldbeutel abhängt. Geredet hab ich mit keinem darüber, allenfalls mit dem Renner, abends daheim beim Bier – mit dem Renner konnte man gut über so was reden –, aber sicher nicht auf dem Amt.
Die Grenzlinie half uns, das zu tun, womit wir vertraut waren. Und ehrlich, es machte mehr Laune, »Na, Freundchen« zu schnauzen und »Raus mit der Sprache«, als dienernd zu sagen: »Ja, Herr Oberkommerzienrat. Sicherlich, gnä’ Frau.«
So viele Gründe gab es, den Endres umzubringen, bei all den Geschäftchen, die er am Laufen hatte, und all den zwielichtigen Menschen, die er kannte, so vielen Spuren war nachzugehen, dass sich keiner groß die Mühe machte, nach Gründen dafür zu suchen, warum jemand die Marie Gring vielleicht nicht mehr am Leben sehen wollte. Auch mir fiel keiner ein. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke: Nicht mal ihr Schlafzimmer haben wir damals untersucht. Wir hatten auch so alle Hände voll zu tun.
»Der Endres ist bis 17 Uhr in Nürnberg in der Arabischen Teestubebeim Kartenspielen gesessen, später ist er dann ins Deutsche Haus am Kornmarkt gewechselt. Dann hat er die Ludwigsbahn genommen, vom Plärrer ab um 23.30 Uhr. Ein Zeuge, der ihn kannte, hat ihn am Bahnhof Fürth-Ost aussteigen sehen. Als er gegen Mitternacht sein Zimmer betrat, wurde er von zwei Männern überfallen, die vermutlich schon auf ihn gewartet haben.«
So skizzierte unser Ermittlungsleiter, der Polizei-Obersekretär Dotzauer, den Ablauf vom Mordabend. Aus Nürnberg waren Kollegen da, weil sich rasch herausgestellt hatte, dass der Endres fast nur in der Nachbarstadt verkehrte, im Nassauer Keller, im Moselblümchen, in der Arabischen Teestube und im Café Königshof. Hugo Schneidig hatte er sich dort genannt, als wäre er wirklich ein Held in einem dummen Film. Bei uns in Fürth hat er sich nicht herumgetrieben. Mir machte das das Leben leichter. Es ersparte mir die Gassenlauferei. Stattdessen kümmerte ich mich um die materiellen Spuren, sorgte für die Aufrufe an die Presse, an die Amtsblätter, die Kollegen in Nürnberg und im Umland.
Der verschwundene Schmuck musste nämlich gefunden, Pfandleiher und Juweliere mussten alarmiert werden, falls einer ihn zum Kauf anbot. So ganz genau wussten wir nicht, was wir alles suchten. Der Bruder des Toten und seine Ehefrau waren sich da beileibe nicht einig, der Bruder wollte von mehr wissen als die Gattin. Aber die lebte ja auch im fernen München und hielt den Andreas Endres für einen respektablen Mann. Immerhin war von mehreren Brillantringen, zwei goldenen Uhren und zwei Brillantanstecknadeln die Rede. Und von vierzigtausend Mark in großen Scheinen, was nach mehr klang, als es war. Die Mark hatte damals schon fast drei Viertel ihres Wertes verloren.
Überhaupt die Geldscheine: Der Endres hatte die Börse links an der Brust getragen, genau dort, wo einer der vielen Messerstiche durchging. Die Börse war fort, und wir nahmen an – was nahmen wir nicht alles an –, dass sie samt Inhalt durchstochen worden sein mochte und es also irgendwo dort draußen blutbesudelte Scheine gab mit einem Loch in der Mitte. Stadtkasse, Sparkasse, Staatsbank, Postamt, städtisches Gebührenamt, Wirtschaftsamt und Rentamt – alle mussten ermahnt werden, danach die Augen offen zu halten.
Auch blutverschmierte Kleider konnten auftauchen; bei so viel Blut konnte der Täter nicht anders, als über und über damit bedeckt zu sein. Da musste man den Reinigungen und Schneidereien Bescheid geben. Das leitete ich ebenfalls in die Wege.
Und schließlich hatte man bei der Obduktion im Schädel vom Endres diese abgebrochene Messerspitze gefunden. Die Waffe dazu mochte gut jemand zur Reparatur bringen. Also waren auch die Messerschleifer zu warnen.
»Der Endres kam erst kurz vor der Tat überhaupt nach Hause in die Spiegelstraße«, sagte der Dotzauer damals in der Besprechung Anfang Mai. »Die beiden Tage zuvor ist er, nach allem, was wir zusammengetragen haben, gar nicht daheim gewesen. Ausgehend von der Annahme, dass Endres und das, was er bei sich trug, das Ziel des Raubüberfalles waren, muss der Täter, wenn er nicht einfach Glück gehabt hat, genau gewusst haben, wo der Endres sich so herumtrieb und wann.«
Er schaute uns an. Wir nickten. Zu diesem Schluss kam der Polizei-Obersekretär. Zu diesem Schluss kam die Ermittlung. Den Endres hatte einer auf dem Kieker. Es war ein Grund mehr, gründlich im Bekanntenkreis vom Endres zu suchen. Und wir wurden fündig.
Gäste im Arabischen Café sagten aus: »Der Endres hat immer große Mengen Geld und Sachen gehabt und damit geprotzt.«
Ein Kellner im Café Königshof gab an, dass sich zwei Männer im Lokal öfter nach dem Endres umgeschaut hätten. Sei er nicht da gewesen, seien sie wieder gegangen, ohne etwas zu bestellen. »Die haben ihn gewiss beschattet.«
Eine Wirtin meinte, der Endres habe sich verfolgt gefühlt. »Einmal hat er zu mir gesagt: ›Sie werden noch mal in der Zeitung lesen, den Hugo Schneidig haben sie umgebracht.‹« Sie rotzte in ihr Taschentuch. »Und jetzt ist es so weit.«
Sie sehen das Bild? Wir sahen es auch. Und wir fanden die Verdächtigen dazu. Niemand darf glauben, dass wir es uns leicht gemacht hätten durch unsere Konzentration auf das Milieu. Wir liefen viele Kilometer, befragten Hunderte von Menschen, gingen noch den kleinsten Hinweisen nach. Wir waren gewissenhaft und gründlich. Alle Spuren verfolgten wir bis zum Ende, auch die Sackgassen.
Davon gab es viele, manche waren viele Wochen lang und unendliche Überstunden tief. Als wir zum Beispiel in den Taschen des Toten eine Visitenkarte fanden, vom Schatzmeister des Hilfsbundes für Elsass-Lothringen – was nicht so seltsam war, da Endres aus Metz stammte und als Obmann für den Bund tätig war –, da wurden wir bei diesem Schatzmeister vorstellig. Er bestätigte, gemeinsam mit Endres in das Auto eines Unbekannten gestiegen zu sein für eine Fahrt, die, wie er mit Nebenblick auf seine Frau fast im Flüsterton aussagte, eine »edle Einrichtung« zum Ziel hatte. Es war ein Bordell, wie sich herausstellte, in Zerzabelshof, Villa Kührt, Metthingstraße. Man hatte dort zu mehreren gezecht, der Endres hatte um die fünfhundert Mark ausgegeben und war von einem fremden Auto wieder abgeholt worden. Wir ermittelten den Autofahrer, indem wir alle privaten Fahrzeughalter der Stadt Nürnberg befragten; das waren damals, das Nachkriegsfahrverbot für Privatleute war erst im Herbst 1919 wieder aufgehoben worden, ganze vierundvierzig.
Heraus kam dabei nichts. Es war ein Abend im Bordell gewesen, typisch für den Endres, der sich oft in derartigen Etablissements herumtrieb. Was den Schatzmeister anging – der war samt Gattin respektabel. Ob auch er es mochte, den nackten Hintern versohlt zu bekommen, wie die Gewerbliche Alice Kiefer es für den Endres aussagte, das wurde nicht ermittelt. Aber man hätte etwas lernen können von der Alice. Dass das nicht schockierend war, sondern im Gegenteil recht üblich. Allerdings kostete es gut hundert Mark. Und wer hatte die schon übrig? Der Renner und ich, wir hatten sie nicht.
Einen Mörder hatten wir ebenso wenig. Zwar fanden sich blutige Kleider, doch sie stammten von einem Selbstmörder, dessen Witwe sie in die Reinigung gegeben hatte.
Zwei abgebrochene Messer wurden eingesandt, aus Schweinfurt und aus Deggendorf, doch sie passten nicht. Und die durchstochenen Geldscheine voller Blut fanden sich ebenfalls nicht.
Ein Ring wurde uns gemeldet, der dem Toten gehört haben sollte. Er war durch viele Hände gewandert. Und als wir den allerersten Käufer aufgespürt hatten, gab der an, ihn von Endres zu Lebzeiten erworben zu haben, vier Wochen vor dem Mord.
Wir waren nicht untätig. Falls wir schuldig geworden sind, die Wahrheit schuldig geblieben sind, diesen Krieg verloren haben, dann gewiss nicht aus Trägheit. Wir waren fleißige Soldaten.
Sogar zur Beerdigung gingen wir und hielten die Augen offen, wie es sich gehörte. Auch ich schaute mich dort um. Es fiel uns auf, dass die Ehefrau spät erschien und früh ging. Dass sie nicht dicht hinter dem Sarg lief, wie es sich für die nächsten Angehörigen gehörte, und auch am Grab keine Beileidsbekundungen entgegennahm. Wie eine Fremde benahm sie sich, und vielleicht war ihr Ehemann ihr fremd geworden. Sie lebten ja getrennt, auch wenn das nicht viel besagte in jenen Tagen.
Ein jeder folgte der Arbeit, wo er eine fand, viele Familien waren zerrissen, zerstreut, waren Umgesiedelte, Flüchtlinge, die sich neu orientieren mussten, zu Wanderarbeitern wurden und das Sich-Verwurzeln mehrmals erprobten, ehe sie wieder zur Ruhe kamen. Auch meine Frau hatten die Zeit und die Not hinausgezogen. Sie lebte in Frankfurt, wo sie eine Anstellung gefunden hatte in der Pension von Verwandten. Sie schlief dort in einer Dachkammer und schrieb manchmal und schickte Geld, das meine gekürzten Bezüge aufbessern half. Ich machte mir Sorgen um sie damals im Mai, weil gerade die Franzosen Frankfurt besetzt hatten, aus Rache für den Einmarsch der Reichswehr ins Ruhrgebiet. Und ein wenig, weil ich mir nach der Beerdigung vom Endres vorzustellen begann, auch im Gesicht meiner Frau könnte sich einmal so eine Kälte einnisten, wenn sie an mich dächte.
»Mach dir keine Sorgen«, meinte der Renner, der abends mit der Zeitung bei mir vorbeikam. Es gab Kartoffeln, die konnte ich gut kochen, dazu Brühe von Bratheringen, die der Händler um so viel billiger aus dem Fass schöpfte als die Fische dazu.
Er packte die mitgebrachten Bierflaschen aus. »Da, trink eins, und keine Angst, ihr passiert schon nichts.«
Der Renner und ich, wir saßen oft so beisammen in der Nacht und redeten, damals laut, später leiser. Als er 1933 von Dachau zurückkam, der Renner, redete er gar nichts mehr. Seither sitzt er stumm bei mir in der Stube. Er kommt erst, wenn es dunkel ist, aus Rücksicht auf mich, den Beamten. Ich setz ihm heut meist Schnitzel vor, was nicht heißt, dass die Zeiten besser geworden sind. Meine Frau ist jetzt schon vier Jahre tot. Damals war ihr nichts passiert, genau wie es der Renner gesagt hatte.
Der Frau vom Endres konnten wir nichts nachweisen.
Genauso wenig wie dem halben Dutzend Männer, die sich laut irgendwelcher redseligen Zeugen auffällig benommen hätten und entweder »rot« oder »blass« geworden seien, »nach unten« oder »zur Seite« oder »triumphierend« oder »unsäglich verschlagen« geblickt hätten, als sie vom Mord hörten.
Dieser sei »ein ganz roher und brutaler Mensch«, jener »ein großer Lump und Schwarzhändler«. Der Nächste habe »schon seine Frau mit dem Messer zusammengestochen«. Ein anderer »verfügte plötzlich über jede Menge Geld, ohne dass man sehen kann, woher es kommt«. Mal war es »ein vielfach vorbestrafter und gewalttätiger Mensch, mir persönlich bekannt«, dann wieder »ein Fremder, den ich vor einem Bordell traf. Er gab eine Flasche Wein aus und sagte, er habe es aus Wut getan.«
So ging das Lied, mehr als ein Jahr, eine Symphonie der menschlichen Verkommenheit.
Allein das Haus in der Spiegelstraße, wo wir von Tür zu Tür gingen: zwei Liebesverhältnisse, ein Fall von Ehebruch; ich nenne die Namen nicht, weil nichts davon zu einer Anzeige führte. Aber der Adolf Montag aus dem zweiten Stock war wegen Bettelei und Diebstahls vorbestraft. Und die Anna Seidel war verurteilt wegen der Tötung ihres unehelichen Kindes. Und das war nur, was die Mordtat zufällig ans Licht brachte. Danach geht man mit anderen Augen an Hausfassaden entlang, selbst an den respektablen.
Zeitweise, das schrieb ich sogar meiner Frau, glaubte ich nicht mehr daran, dass es auch nur einen unschuldigen Menschen gäbe auf der Welt.
Meine Frau, die religiös war, empfahl mir Gebete. Der Renner empfahl die Komintern. Ihn freute der Stimmenzuwachs der USPD bei der ersten Reichstagswahl am 6. Juni mehr, als ihn die Niederlage der Spielvereinigung gegen den Club im Endspiel der Deutschen Meisterschaft ärgerte; aber nicht viel mehr. In einigen Städten gab es Hungerunruhen; sie plünderten Geschäfte und warfen Fenster ein. In Fürth blieb alles ruhig. Wir kümmerten uns um jeden Verdächtigen.
Am 21. Mai nahmen wir auf den Tipp einer Prostituierten hin den Andreas Lindner fest und brachten ihn zum Verhör auf die Wache im Rathaus. Er war ein Bekannter des Toten, ein Schwarzhändler. Seine Geliebte widerrief das Alibi, das sie ihm zunächst gegeben hatte, als wir eine weitere Geliebte auftrieben. Dennoch kam am Ende nicht viel dabei heraus.
Da war dann der Ulrich Lottes, genannt »Bulmes«, Reisender und Händler, schon ein anderes Format. Gleich drei Zeugen hatten ihn als verdächtig angegeben, einer davon behauptete, der Bulmes habe sich über den Mord in der Spiegelstraße geäußert. Eine ganz raffinierte Tat sei das gewesen und der Mörder viel zu intelligent, als dass man ihn jemals erwischen würde. Am 24. Juni hatten wir ihn. Die Kollegen in Hamburg nahmen den zur Fahndung Ausgeschriebenen hoch. Wie sich herausstellte, hatte er für ein anderes Vergehen noch ein Jahr abzusitzen und kein Alibi, dafür eine Browning.
Da saß er nun, Rundkopf, Oberlippenbärtchen, das rechte Auge müde und das Kinn unter der Lippe seltsam zurückspringend, ehe es sich im letzten, vorspringenden Punkt wieder fing. Im Profil sah er fast so aus wie einer der Kameraden, deren Gesichter im Krieg von einer Granate zerstört worden waren. Von vorne sah er einfach aus wie ein Galgenstrick mit billiger Krawatte und zu kleinem Hut. Als die Kollegen ihm einheizten, blinzelte er müde und sagte: »Wenn Sie mir eine Zigarette schenken, dann lege ich ein volles Geständnis ab.«
»Der war es nicht«, sagte der Renner am Abend zu mir. »Diebstahl ja. Mord nein.«
Und tatsächlich gestand er am nächsten Tag gar nichts. Also überprüften wir die Fußabdrücke.
Diese Fußabdrücke! Was haben die uns beschäftigt. Blutige Fußabdrücke, die durch das halbe Zimmer führten. Einige waren mit Socken entstanden, und wir haben uns sogar bemüht, herauszufinden, ob das Seiden- oder Trikotsocken waren. Alles war gründlich vermessen, fotografiert, analysiert worden. Vor allem dieser eine rätselhafte Abdruck, der keine Zehen aufwies und weder nackt war noch Spuren von einer Socke oder einem Schuh zeigte. Es sei denkbar, hieß es, dass der Mörder keine Zehen am linken Fuß habe und deshalb eine besonders konstruierte Ledersocke trage. Ein Facharzt für Orthopädie dagegen, der Doktor Rosenfelder, meinte, die für eine Amputation typischen Merkmale am vorderen Rand des Abdrucks fehlten. Er denke, der Mann habe beim Laufen durch das Blut einfach die Zehen angehoben, aus Ekel vielleicht.
Ein Amputierter wäre leicht zu finden gewesen, nur leider ist uns nie einer begegnet. Wie es aussah, war die Auswahl an Tätern größer, wenn man von einem Mann mit einem Ekel vor blutigen Fußböden und zwei gesunden Füßen ausging, Größe 42.
Ulrich Lottes, der Bulmes, hatte Schuhgröße 42. Für die Untersuchung wurde er in die Wohnung des Gefängnisverwalters in Fürth gebracht, weil es dort Parkettboden gab, wie in der Mordwohnung. Ich war nicht dabei, als der Professor Molitoris, begleitet von zwei Wachtmeistern und einem Nürnberger Oberwachtmeister, den Bulmes anwies, die nackten Füße in Wasser zu tauchen, und dann mit verbundenen Augen herumzulaufen.
»Wieso verbunden?«, hatte mich der Renner am Abend gefragt, als ich es erzählte. Und ich konnte es ihm nicht sagen. Irgendwie hatte man wohl nicht gewollt, dass die Ergebnisse verfälscht würden. Der Bulmes musste mal langsam gehen, mal schnell, mal mit kleinen, mal mit großen Schritten. Mal sollte er die Zehen heben, dann mit dem ganzen Fuß auftreten. Am Ende wurde alles in Socken wiederholt.
»In Socken ins Wasser?« Der Renner musste lachen. Er lachte nicht mehr, als ich ihm erzählte, dass die ganze Prozedur kurz darauf am Tatort wiederholt wurde. Mit Blut.
»Wo hatten die das Blut her?«, wollte mein Freund wissen.
»Vom Schächter Jakob Adler. Der hatte drei lebende Hühner dabei.«
»Jakob Adler«, wiederholte der Renner. Beschämend, aber ich weiß nicht, wo der Jakob Adler heute ist. Ob er weiter in Fürth lebte und letzten November unter denen war, die nachts aus den