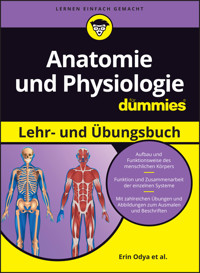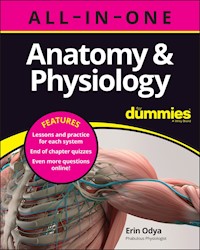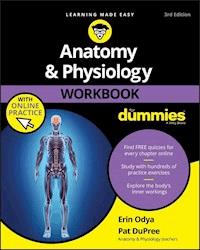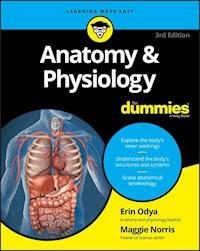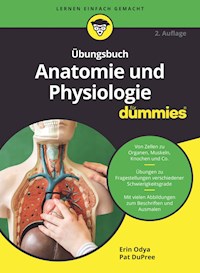
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Anatomie und Physiologie sind zwei sehr lernintensive Fächer, und der Schlüssel zum Erfolg heißt: Erst verstehen und dann üben, üben, üben. Nur durch das häufige Wiederholen des Lernstoffs wird das Wissen gefestigt. Erin Odya und Pat Dupree haben in diesem Buch grundlegende Erklärungen und zahlreiche Übungen und farbige Abbildungen zusammengestellt. So erfahren Sie das Wichtigste über Zellen, Muskeln, Knochen, Organe, das Nahrungs- und Nervensystem sowie die Fortpflanzungsorgane. Mit Abbildungen zum Beschriften und Ausmalen sowie über 800 Aufgaben gerüstet, können Sie dann unbesorgt in die nächste Prüfung gehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Ähnliche
Übungsbuch Anatomie und Physiologie für Dummies
Schummelseite
Für jeden Bereich des Körpers gibt es eine Bezeichnung, die die Lage oder Position exakt beschreibt. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auflistung der wichtigsten Bezeichnungen.
Begriff
betrifft
Begriff
betrifft
antebrachial
Unterarm
mental
Kinn
antekubital
Ellenbeuge
orbital
Augenhöhle
axillär
Achselhöhle
oticus
Ohr
brachial
Oberarm
parietal
wandständig
bukkal
Wange, Backe
pektoral (pectoral)
Brust
karpal (carpal)
Handwurzel
pedal
Fuß
coxal
Becken
pelvin
Becken
dorsal
Rücken
plantar
Fußsohle
femoral
Oberschenkel
popliteal
Kniekehle
frontal
von vorn, nach vorn gerichtet
perikardial
Herzbeutel
genikulär
Knie
spinal
Wirbelsäule, Rückenmark
inguinal
Leiste
sural
Wade
kephal (cephal)
Kopf/Haupt
tarsal
Fußwurzel (oder Lidknorpel)
kranial (cranial)
Schädel, kopfwärts
ventral
Bauch, Vorderseite
krural
(Unter-)Schenkel
vertebral
Wirbelsäule
kubital
Ellenbogen
zephal (cephal)
Kopf
lumbal
Lendenwirbel
zervikal (cervical)
Gebärmutterhals
STRUKTURELLE BESONDERHEITEN VON KNOCHEN
Processus: häufig breiter KnochenfortsatzSpina: stachel- oder grätenförmiger KnochenvorsprungTrochanter: Rollhügel, ein großer, in der Regel stumpfer KnochenvorsprungTuberkel: ein kleinerer, abgerundeter VorsprungTuberositas: eine größere, raue, vorstehende StelleCrista: ein hervorstehender KammCaput: das große, runde Gelenkende eines Knochens, der Kopf, häufig über einen Hals mit dem Schaft verbundenCondylus: ein ovaler Gelenkfortsatz oder Gelenkkopf eines KnochensFacette: eine glatte, flache oder beinahe flache GelenkflächeFossa: eine größere GrubeSulcus: eine Furche oder RinneForamen: ein LochMeatus: ein Kanal oder die Öffnung zu einem KanalMIT KÖPFCHEN ANS GEHIRN — DIE HIRNNERVEN
Name
Art
Funktion
I
Riechnerv, Nervus olfactorius
sensorisch
Geruch
II
Sehnerv, Nervus opticus
Übungsbuch Anatomie und Physiologie für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2. Auflage 2020
© 2020 Wiley-VCH GmbH, Weinheim
Original English language edition Anatomy & Physiology Workbook for Dummies © 2018 by Wiley Publishing, Inc All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Copyright der englischsprachigen Originalausgabe Anatomy & Physiology Workbook for Dummies © 2018 by Wiley Publishing, Inc. Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: andreaobzerovaKorrektur: Claudia Lötschert
Print ISBN: 978-3-527-71808-5ePub ISBN: 978-3-527-82977-4
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Einleitung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Törichte Annahmen über den Leser
Symbole in diesem Buch
Wie es jetzt weitergeht
Teil I: Die Bausteine des Körpers
Kapitel 1: Die Sprache der Anatomie und Physiologie
Wie der Körper aufgebaut ist
Beziehen wir mal Position!
Antworten zu den Fragen zur Terminologie
Kapitel 2: Die Chemie des Lebens
Am Anfang waren Atome und Elemente
Chemische Reaktionen
Organische Verbindungen
Ein ewiger Kreislauf: Der Stoffwechsel
Antworten zu den Fragen zur Biochemie
Kapitel 3: Die Zelle: Baustein des Lebens
Leben und Sterben einer Zelle
Ein Bollwerk zur Sicherheit: die Zellmembran
Der Informationsspeicher: Zellkern
Ein Blick ins Innerste: Organellen und ihre Funktion
Der Proteinbaukasten
Antworten zu den Fragen zur Zellbiologie
Kapitel 4: Teile und herrsche: Die Mitose der Zelle
Schritt für Schritt: der Zellzyklus
Was bei der Zellteilung schiefgehen kann
Antworten zu den Fragen zur Mitose
Kapitel 5: Die Lehre der Gewebe: Histologie
Epitheliale Gewebe
Sehr verbindlich: Das Bindegewebe
Lass mal spielen: Muskelgewebe
Signalübertragung: Das Nervengewebe
Antworten zu den Fragen zur Histologie
Teil II: Gemeinsam stark: Knochen, Muskeln und Haut
Kapitel 6: Es geht unter die Haut
Dermatologie: tiefgehende Einsichten
Ab in die Tiefe: die Dermis
Den Nerv treffen
Die Antworten zu den Fragen zur Haut
Kapitel 7: Umbau ist vorprogrammiert: Das Skelett
Die Funktion der Knochen verstehen
Knochentrocken: Klassifikation und Strukturen
Wie Knochen entsteht: die Ossifikation
Immer schön aufrecht bleiben: das Achsenskelett
Die Knochen des Rückens
Reich mir die Hand (und gern mehr): Das Extremitätenskelett
Arthrologie: So heißen die Verbindungen
Antworten zu den Fragen zum Skelett
Kapitel 8: Immer in Bewegung: Die Muskeln
Was Sie schon immer über Muskeln wissen wollten
Die Klassifizierung: glatte, Herz- und Skelettmuskulatur
Jobbeschreibung: Kontraktion
Konzertierte Aktion: Der Muskel als Organ
Maßhalten: Der richtige Muskeltonus
Muskelkraft ist Hebelwirkung
Was steckt im Namen? Die Muskeln erkennen
Antworten zu den Fragen zur Muskulatur
Teil III: Regelsysteme: Die Kommunikation im Körper
Kapitel 9: Immer unter Strom: Das Nervensystem
Befehle von oben
Die Basics: Neuron, Nerv und Gliazelle
Sind Sie impulsiv?
Das zentrale Nervensystem
Ab auf die Nebenstraßen: Das periphere Nervensystem
Erst mal atmen: Das autonome Nervensystem
Jetzt mal was Sinnvolles …! – Die Wahrnehmung
Antworten zu den Fragen zum zentralen Nervensystem
Kapitel 10: Hormone, Hormone … das endokrine System
Nicht schlecht, diese Drüsen
Die Chefs im Ring der Drüsen
Die Nebendarsteller: weitere Hormondrüsen
(Kein) Stress – die Homöostase im Körper
Antworten zu den Fragen zum endokrinen System
Teil IV: Versorgung und Transport
Kapitel 11: Das Herz-Kreislauf-System
Im Rhythmus der Pumpe
Der Schlüssel zur Herzkammer
Das Herz in Takt bringen
Im Netzwerk der Blutgefäße
Antworten zu den Fragen zum Kreislauf
Kapitel 12: Drainage und Abwehr: Das lymphatische System
Den Weg für die Lymphe bahnen
Die Lymphknoten
Noch mehr lymphatische Organe
Immunsystem und Immunität
Antworten zu den Fragen zum Lymphsystem
Kapitel 13: Gib Gas! – Das respiratorische System
Luft rein, Luft raus
Was noch so mit der Luft geschieht
Antworten zu den Fragen zum Atmungsapparat
Kapitel 14: Treibstoff für alles: Das Verdauungssystem
Nicht schwer zu schlucken: die Grundlagen
Zum Mund und weiter runter
Die Nahrung einsacken
Das Abbruchunternehmen: die Verdauungsenzyme
Bevor es dann nach draußen geht …
Antworten zu den Fragen zum Verdauungssystem
Kapitel 15: Den Abfall rausspülen: Das Urogenitalsystem
Die Nieren: Filter für das Blut
Erlösendes Ereignis: Wasser lassen
Antworten zu den Fragen zu Niere und Blase
Teil V: Das Überleben der Art sichern
Kapitel 16: Das männliche Reproduktionssystem
Das männliche Reproduktionsorgan
Chromosomen für den Nachwuchs verpacken
Antworten zu den Fragen zur männlichen Fortpflanzung
Kapitel 17: Leben weitergeben: Die weibliche Fortpflanzung
Die weiblichen Fortpflanzungsorgane
Die Produktion der Eizellen
Wie Babys entstehen: Eine Einführung in die Embryologie
Vom Fetus zum Baby
Die Geburt
Wachstum, Veränderung und Alter
Antworten zu den Fragen zur Fortpflanzung bei der Frau
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 18: Zehn Lerntipps
Mit eigenen Worten aufschreiben
Besseres Wissen durch Merktraining
Lernstil
Böhmische Dörfer
Querverbindungen markieren
Lerngruppen
Vor- und Nachbereiten
Üben, üben, üben
Hinweisen nachgehen
Aus Fehlern lernen
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 1
Tabelle 1.1: Die Körperregionen
Kapitel 8
Tabelle 8.1: Die Strukturen eines Sarkomers
Tabelle 8.2: Die Muskeln des Körpers
Kapitel 9
Tabelle 9.1: Arten von Gliazellen und ihre Aufgaben
Tabelle 9.2: Die Hirnnerven
Tabelle 9.3: Sensorische Rezeptoren
Kapitel 16
Tabelle 16.1: Begriffe zur Reproduktion, die Sie kennen sollten
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Die Körperhöhlen
Abbildung 1.2: Die Körperebenen
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Elektronen auf den Elektronenschalen oder Orbitalen
Abbildung 2.2: Ionenbindung
Abbildung 2.3: Kovalente Bindung
Abbildung 2.4: Polare Bindung und Wasserstoffbrückenbindung
Abbildung 2.5: Monosaccharide oder Einfachzucker
Abbildung 2.6: Fettsäuren
Abbildung 2.7: Aminosäuren und Peptidbindung
Abbildung 2.8: Die DNA-Doppelhelix
Abbildung 2.9: Die Struktur von ATP und ADP
Abbildung 2.10: Wie Proteine, Fette und Kohlenhydrate metabolisiert werden
Abbildung 2.11: Wie Zellen ATP erzeugen: eine Übersicht
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Die Zellmembran
Abbildung 3.2: Schnitt durch ein Mitochondrium
Abbildung 3.3: Das Innere einer tierischen Zelle mit ihren Zellorganellen
Abbildung 3.4: Die Proteinbiosynthese
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Zellstrukturen und die verschiedenen Phasen der Mitose
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Epitheliale Gewebe
Abbildung 5.2: Lockeres und straffes Bindegewebe
Abbildung 5.3: Glatte Muskulatur, Myokard und Skelettmuskulatur
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Die Haut
Abbildung 6.2: Der Fingernagel
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Die Struktur kompakter Knochen
Abbildung 7.2: Der lange Röhrenknochen
Abbildung 7.3: Seitliche Ansicht des Schädels
Abbildung 7.4: Ansicht eines Schädels von unten
Abbildung 7.5: Ansicht der Nasennebenhöhlen
Abbildung 7.6: Die Wirbelsäule
Abbildung 7.7: Das Extremitätenskelett
Abbildung 7.8: Synovialgelenk
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Arten von Muskelgewebe
Abbildung 8.2: Aufbau einer Skelettmuskelfaser
Abbildung 8.3: Das Sarkomer. (a) Sarkomer vor der Kontraktion; (b) Kraftschlag; (...
Abbildung 8.4: Das Sarkomer
Abbildung 8.5: Aufbau eines Skelettmuskels
Abbildung 8.6: Die drei Klassen von Muskelhebeln
Abbildung 8.7: Einige der wichtigsten Muskeln des Körpers
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Zellstruktur und Reizleitung im Motorneuron (links) und sensorisch...
Abbildung 9.2: Querschnitt durch das Rückenmark mit Spinalnerven
Abbildung 9.3: Längsschnitt durch das Gehirn
Abbildung 9.4: Spinalnerven und Plexus
Abbildung 9.5: Reflexbogen bei Schmerz
Abbildung 9.6: Sympathisches und parasympathisches Nervensystem
Abbildung 9.7: Die inneren Strukturen des Auges
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Die Interaktion von Hypothalamus und Hypophyse
Abbildung 10.2: Das endokrine System
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Das cardiovaskuläre System aus zwei geschlossenen Kreisläufen
Abbildung 11.2: Das Herz und seine Hauptgefäße
Abbildung 11.3: Die Herzklappen
Abbildung 11.4: Das Erregungsleitungssystem des Herzens
Abbildung 11.5: Ein typisches EKG
Abbildung 11.6: Der Kapillaraustausch
Abbildung 11.7: Der Aufbau einer Arterie
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Das lymphatische System
Abbildung 12.2: Ein Lymphknoten
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Der respiratorische Trakt
Abbildung 13.2: Frontansicht (a) und Seitenansicht (b) des Larynx
Abbildung 13.3: Sauerstoff-Kohlenstoffdioxid-Austausch in den Lungen
Abbildung 13.4: Die Bronchiole
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Die Organe und Drüsen des Verdauungstrakts
Abbildung 14.2: Die wichtigsten Strukturen von Mund und Pharynx
Abbildung 14.3: Die Strukturen eines Zahns
Abbildung 14.4: Die Strukturen des Magens
Abbildung 14.5: Die Leber
Kapitel 15
Abbildung 15.1: Der Aufbau der Niere
Abbildung 15.2: Die Struktur eines Nephrons
Abbildung 15.3: Glomeruläre Filtration
Abbildung 15.4: Die Aufgaben eines Nephrons
Kapitel 16
Abbildung 16.1: Die männlichen Geschlechtsorgane
Abbildung 16.2: Der Hoden
Abbildung 16.3: Die Stadien der Meiose
Kapitel 17
Abbildung 17.1: Das Ovar
Abbildung 17.2: Das weibliche Fortpflanzungssystem
Abbildung 17.3: Die Aufteilung der Chromosomen in der Meiose
Abbildung 17.4: Die Embryonalentwicklung
Orientierungspunkte
Cover
Inhaltsverzeichnis
Fangen Sie an zu lesen
Seitenliste
1
2
5
6
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
Einleitung
Egal, ob Sie Physiotherapeut, Apotheker, Arzt oder Akupunkteur, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer, Gesundheits- oder Krankenpfleger, Alternativmediziner, Vater oder Mutter oder einfach nur ein gesunder Mensch werden wollen – für all diese Bereiche brauchen Sie fundierte Kenntnisse der Anatomie und der Physiologie. Aber das Wissen darüber, dass das Knie am Oberschenkelknochen hängt (das tut es doch, oder?), ist nur die Spitze des Eisbergs. Im Arbeitsbuch Anatomie und Physiologie für Dummies (2. Auflage) werden Sie verzwickte Zusammenhänge entdecken, die Sie neugierig machen werden auf mehr. Der menschliche Körper ist eine wundervolle Bio-Maschine, die wachsen und mit der Welt kommunizieren kann und sich – trotz aller Widerstände – sogar noch vermehrt. Um zu verstehen, wie das genau funktioniert, bedarf es eines sehr genauen Blicks auf jede Kleinigkeit, von der Chemie bis hin zur Mechanik des Körpers.
Die frühen Anatomen mussten den Körper zerteilen, um ihn zu verstehen. Das Wort »Anatomie« kommt aus dem Griechischen und bedeutet »aufschneiden«. Die ersten Hinweise auf anatomische Untersuchungen stammen aus dem alten Ägypten um 1600 vor Christus, aber erst die Griechen (hier ist Hippokrates an erster Stelle zu nennen) um 420 vor Christus sezierten Tote für wissenschaftliche Zwecke – deswegen verwenden wir noch heute griechische und lateinische Ausdrücke für anatomische Strukturen. Und das ist auch der Grund, warum sich Anatomieunterricht für Sie manchmal anfühlen mag wie ein Fremdsprachenstudium. Sie lernen auch eine fremde Sprache, aber es ist die Sprache Ihres eigenen Körpers!
Über dieses Buch
Dieses Buch soll kein Lehrbuch ersetzen und erst recht keinen Anatomie- oder Physiologieunterricht. Es eignet sich aber sehr gut als Ergänzung des Unterrichts und zur Prüfungsvorbereitung. Wir möchten Ihnen ein tiefes Verständnis von den Inhalten geben, auf die es ankommt, während Sie sich langsam von Organsystem zu Organsystem vorarbeiten.
Ihr Lehrer im Unterricht wird wahrscheinlich eine andere Reihenfolge der Themen wählen, als wir es in diesem Buch tun. Von daher sollten Sie das Inhaltsverzeichnis und das Schlagwortregister nutzen, um Ihr aktuelles Unterrichtsthema wiederzufinden. Egal, wie Sie vorgehen – Sie müssen auf keinen Fall ein Kapitel nach dem anderen durcharbeiten. Aber arbeiten Sie am Ende eines jeden Kapitels die Fragen und die dazugehörigen Antworten durch. So erfahren Sie nicht nur, welche Antwort richtig ist, sondern auch, warum genau diese die richtige ist und nicht die anderen. Außerdem versuchen wir Ihnen so viele Gedächtnisstützen, Eselsbrücken und andere Tipps zu geben, wie uns eingefallen sind.
An vielen Stellen werden Ihnen lateinische Fachbegriffe begegnen, die dort, wo es notwendig ist, auch im Plural stehen. Falls Sie nicht ganz so fit in der lateinischen Grammatik sind, mag das mitunter verwirren – sehen Sie einfach im Stichwortverzeichnis nach, dort sind alle Begriffe im Singular aufgeführt.
Konventionen in diesem Buch
Um in die Anatomie und Physiologie einzutauchen, müssen Sie sich mit der Fachsprache vertraut machen. Damit Sie sich in diesem Buch zurechtfinden, hier die Erklärung für die unterschiedlichen Schreibweisen:
Alles, was besonders betont werden soll, und neue Fachbegriffe werden
kursiv
dargestellt.
Schlüsselbegriffe in Aufzählungen oder Vorgängen, die nacheinander ablaufen, sind
fett
gedruckt.
Dieser Schrifttyp wird bei Webadressen verwendet.
Sie werden feststellen, dass sich einige Webadressen über zwei Textzeilen erstrecken. Wenn Sie eine dieser Webseiten besuchen möchten, geben Sie einfach die Webadresse ohne Zeilenumbruch in den Internetbrowser ein. Einfacher ist es natürlich, wenn Sie dieses Buch als E-Book lesen – da klicken Sie einfach auf die Webadresse, die Sie übernehmen möchten.
Törichte Annahmen über den Leser
Beim Verfassen des Arbeitsbuchs Anatomie und Physiologie für Dummies sind wir von einigen Annahmen über unsere Leser ausgegangen. Wenn einer der folgenden Punkte auch auf Sie zutrifft, ist das Ihr Buch:
Sie sind ein Oberstufenschüler oder ein Student, der sich zum ersten Mal im Leben mit Anatomie und Physiologie herumschlagen muss.
Sie studieren bereits in einem höheren Semester und wollen Ihre Kenntnisse der Anatomie und Physiologie noch einmal auffrischen.
Sie lernen für eine Anatomie- und Physiologieprüfung und wollen einfach sichergehen, dass Sie den Stoff wirklich verstanden haben.
Da dies ein Arbeitsbuch ist, müssen wir unsere Erläuterungen zu den einzelnen Themen kurz halten, sodass genug Raum für praxisbezogene Fragen bleibt und Sie mitdenken müssen. (Glauben Sie uns, wir könnten stundenlang über Anatomie und Physiologie reden!) Wir setzen voraus, dass Sie die Möglichkeit haben, zusätzlich in Fachbücher zu schauen und wir daher in diesem Arbeitsbuch die Anatomie und Physiologie nicht komplett abdecken müssen.
Symbole in diesem Buch
Im Buch finden Sie am Rand immer wieder Symbole, die Abschnitte mit besonderen Informationen markieren. Diese Symbole bedeuten Folgendes:
Dieses Symbol weist auf einen Tipp hin, wie Sie sich einen Zusammenhang mit einer Eselsbrücke leichter merken können. Außerdem finden Sie hier Lernstrategien, die Ihnen das Erfassen des Stoffs erleichtern.
Hier finden Sie Beispielfragen, mit denen Sie üben können. Die Antworten finden Sie direkt darunter, sozusagen zum Warmwerden für die Testfragen.
Hier finden Sie wichtige Schlüsselinformationen knackig-knapp verpackt. Das sollten Sie sich merken, damit Sie sich nicht im Dschungel der Anatomie und Physiologie verlaufen.
Das Warnsymbol weist Sie auf Stellen hin, an denen Sie leicht in die Irre gehen könnten.
Durch Ausmalen kann man sich die anatomischen Strukturen besser merken, also ran an die Stifte. Oft sind die Abbildungen zum Ausmalen anders (mehr oder weniger detailliert) als die, in denen alles erklärt wurde. Das ist Absicht, so setzen Sie sich genauer mit den Strukturen auseinander und sind eher in der Lage, das eigene Wissen auf unbekannte Abbildungen zu übertragen.
Wie es jetzt weitergeht
Wenn Sie bereits einen Teil Ihres Anatomie- und Physiologieunterrichts hinter sich gebracht haben, werfen Sie einen Blick in das Inhaltsverzeichnis und beginnen gleich mit dem Teil oder Kapitel, das gerade im Unterricht behandelt wird. Wenn Sie noch etwas mehr Zeit investieren können, schadet ein kurzer Blick in die Themen, die bereits behandelt wurden, sicher nicht, denn so können Sie sich sehr gut auf die Prüfung vorbereiten.
Falls Sie noch gar nicht mit dem Anatomie- und Physiologieunterricht angefangen haben, können Sie natürlich beginnen, wo Sie möchten (wir empfehlen dann allerdings Kapitel 1). So können Sie Schritt für Schritt, Kapitel für Kapitel, den ganzen Körper erobern … und das hoffentlich mit Spaß an der Sache!
Teil I
Die Bausteine des Körpers
IN DIESEM TEIL …
Lernen Sie ganz viel, zunächst die Sprache der Anatomie und Physiologie (ja, das muss leider sein) und ein paar Grundlagen zur Chemie der Atome, Moleküle und ihrer Reaktionen.
Dann wird es endlich praktisch, wir werfen einen Blick auf die Bestandteile und die Arbeitsweise einer Zelle …
… und erklären die Abläufe bei der Zellteilung (Mitose und Meiose), wenn Zellen das Gefühl haben, sich vermehren zu müssen.
Zum Schluss geht es von der Zelle zum Gewebe: Ein kleiner Ausflug in die Histologie wird Sie mit den wichtigsten Grundstrukturen, aus denen alle Organe in Ihrem Körper aufgebaut sind, vertraut machen.
Kapitel 1
Die Sprache der Anatomie und Physiologie
IN DIESEM KAPITEL
Ein kleiner Sprachkurs
Höhlenforschung
Navigation durch den Körper
Die Anatomie ist das Studium der Strukturen des Körpers, während es bei der Physiologie um die Funktionsweise geht. Es ist daher sinnvoll, beides auch gemeinsam zu lernen! Doch bevor wir uns die komplizierten Strukturen und Systeme des Körpers genauer ansehen, müssen Sie einige wissenschaftliche Begriffe kennen, mit denen Anatomen die Lage und die Richtung im Körper bezeichnen. Es gibt also einen kleinen Sprachkurs, sozusagen.
Wie der Körper aufgebaut ist
Der menschliche Körper ist in Organsystemen organisiert, in denen Organe mit gleicher Funktion zusammengefasst sind – so zum Beispiel das Verdauungssystem oder das Blutsystem. Diese Systeme sind in zwei großen Hohlräumen des Körpers untergebracht: die dorsale Körperhöhle mit Rückenmark und Gehirn, und die ventrale Körperhöhle, die alle anderen Organe enthält.
Die dorsale Körperhöhle teilt sich weiter auf in die kraniale Höhle (Schädelhöhle), die das Gehirn enthält, und die spinale Höhle (Rückenmarkshöhle), in der die Nervenfasern des Rückenmarks verlaufen.
In der ventralen Höhle liegen die anderen Organe Ihres Körpers. Ein großes Muskelband, das Zwerchfell oder Diaphragma, teilt die ventrale Höhle in einen oberen und einen unteren Teil: die Brusthöhle (Thorakalhöhle) mit Herz und Lungen, und die Bauch- und Beckenhöhle (abdominopelvine Höhle) mit Verdauungs- und Sexualorganen.
Die Brusthöhle ist weiter unterteilt in die rechte und linke Pleurahöhle, in denen sich je ein Lungenflügel befindet, und den Mittelfellraum (Mediastinum) dazwischen. Im Mediastinum liegt die Perikardhöhle, die das Herz umschließt. Innerhalb der abdominopelvinen Höhle wird die Bauchhöhle mit Magen, Leber und Darm von der Beckenhöhle (mit der Blase und den Fortpflanzungsorganen) abgegrenzt, obwohl es hier eigentlich keine klare anatomische Trennung gibt.
Alle Oberflächen im Körperinneren sind von Häuten oder Blättern überzogen. Die viszeralen Blätter umschließen die Organe in direkter Verbindung mit diesen. So wird zum Beispiel die dem Herzen eng aufliegende Schicht als viszerales Perikard (Herzbeutel oder auch Epikard) bezeichnet, und die der Lunge eng aufliegende Schicht ist das viszerale Pleura (Lungenfell).
Die parietalen Blätter kleiden hingegen den Hohlraum von innen aus. Die Bauchhöhle wird beispielsweise von dem parietalen Peritoneum ausgekleidet (eigentlich müsste diese Schicht ja abdominopelvines Peritoneum heißen, aber das klingt wohl doch zu sehr nach Zungenbrecher), und beim Herzen liegt über dem viszeralen Perikard das parietale Perikard als äußere Begrenzungsschicht.
Die anderen Körperteile werden in axiale und appendikuläre Bereiche unterteilt. Axiale Teile des Körpers sind – nicht schwer zu erraten – die in der Körperachse, also Kopf, Brust und Bauch. Die appendikulären Teile sind unsere Gliedmaßen – Arme und Beine.
Für jeden Bereich des Körpers gibt es eine Bezeichnung, die die Lage oder Position exakt beschreibt. Einige dieser Begriffe, die Ihnen auch in diesem Buch begegnen werden, sind in Tabelle 1.1 aufgeführt. Mitunter werden Sie auch die lateinische Schreibweise (c anstatt k) finden; in einigen Fällen, in denen Ihnen das besonders oft begegnen dürfte, ist dies in Klammern vermerkt.
Tabelle 1.1: Die Körperregionen
Begriff
betrifft
Begriff
betrifft
antebrachial
Unterarm
mental
Kinn
antekubital
Ellenbeuge
orbital
Augenhöhle
axillär
Achselhöhle
oticus
Ohr
brachial
Oberarm
parietal
wandständig
bukkal
Wange, Backe
pektoral (pectoral)
Brust
karpal (carpal)
Handwurzel
pedal
Fuß
coxal
Becken
pelvin
Becken
dorsal
Rücken
plantar
Fußsohle
femoral
Oberschenkel
popliteal
Kniekehle
frontal
von vorn, nach vorn gerichtet
perikardial
Herzbeutel
genikulär
Knie
spinal
Wirbelsäule, Rückenmark
inguinal
Leiste
sural
Wade
kephal (cephal)
Kopf/Haupt
tarsal
Fußwurzel (oder Lidknorpel)
kranial (cranial)
Schädel, kopfwärts
ventral
Bauch, Vorderseite
krural
(Unter-)Schenkel
vertebral
Wirbelsäule
kubital
Ellenbogen
zephal (cephal)
Kopf
lumbal
Lendenwirbel
zervikal (cervical)
Gebärmutterhals
Ziemlich viele neue Vokabeln für das erste Kapitel! Mal sehen, was bei Ihnen hängen geblieben ist!
Frage: Welche der folgenden Organe befinden sich im Mediastinum?
a. nur 1
b. nur 2
c. nur 3
d. 1 und 2
e. alle drei
HerzLeberAntwort: Die richtige Antwort ist b. nur das Herz. Das Mediastinum ist der Bereich zwischen Lunge und Leber.
1. Beschriften Sie Abbildung 1.1 mit folgenden Begriffen:
a. abdominal
b. abdominopelvin
c. kranial
d. dorsal
e. pelvin
f. perikardial
g. pleural
h. spinal
i. thorakal
j. ventral
2. bis 6. Ordnen Sie die Begriffe korrekt zu:
2. __________ Die äußerste Schicht des Herzens
3. __________ Die Schicht, die direkt der Leber aufliegt
4. __________ Die direkt dem Herzen aufliegende Hülle
5. __________ Die Auskleidung der Thoraxhöhle
6. __________ Die Auskleidung der abdominopelvinen Höhle
Abbildung 1.1: Die Körperhöhlen
a. parietales Perikard
b. parietales Peritoneum
c. parietale Pleura
d. viszerales Perikard
e. viszerales Peritoneum
7. Wahr oder falsch?
Kephale Strukturen zählen zum appendikulären Teil des Körpers.
8. Was tut Ihnen weh, wenn bei Ihnen eine Verletzung in der Tarsalregion diagnostiziert wird?
a. Knie
b. Handgelenk
c. Knöchel
d. Schulter
e. Hüfte
9. Wenn Sie sich beim Rasieren in das Kinn geschnitten haben, ist die Verletzung …
a. kubital.
b. zervikal.
c. bukkal.
d. mental.
e. frontal.
10. Welche Zuordnung ist korrekt?
a. popliteal – innerer Ellenbogen
b. lumbal – Nacken
c. antekubital – Oberarm
d. coxal – Schulter
e. sural – Wade
Beziehen wir mal Position!
In der Anatomie und der Physiologie geht es oft um die Lage eines Körperteils im Vergleich zu einem anderen. »Das liegt irgendwo schräg dahinter, also eigentlich oben halb rechts, aber mehr so im Hintergrund« ist da keine präzise Angabe – daher sind eindeutige, anatomische Bezeichnungen gefragt, die auch jeder andere Anatom zur Orientierung verstehen kann.
In der anatomischen Grundposition steht der Körper aufrecht mit seitlich herabhängenden Armen, die Handflächen zeigen nach vorn, die Daumen zeigen vom Körper weg. Die Füße stehen parallel zueinander, und die Zehen sind nach vorn orientiert.
Um Lagebeziehungen im Körper zu beschreiben, werden verschiedene Arten von Schnitten durch den Körper gemacht. Es gibt drei Richtungen oder Schnittebenen:
frontal:
trennt vorn von hinten
sagittal:
trennt rechts und links
transversal:
trennt oben und unten
Mit lateinischen Begriffen ist es natürlich alles ein bisschen verwirrender, daher hier die wichtigsten Bezeichnungen für die relative Lage einer Struktur in Bezug zu einer anderen. Diese sollten Sie unbedingt kennen!
anterior
/posterior:
vor/hinter
superior
/inferior:
darüber/darunter
medial/lateral:
mittig/weiter von der Mitte weg (auch bei Bewegungen gebraucht)
superfiziell/profund
(tief):
oberflächlich/ in der Tiefe des Körpers
proximal
/distal:
nahe/weiter weg von einem Ansatzpunkt (wird oft bei der Beschreibung von Gelenken gebraucht)
Warum wird nicht einfach »rechts« und »links« verwendet, um eine Lagebeziehung von Körperteilen zu beschreiben? Weil das nur Verwirrung stiften würde, denn der Bezugspunkt ist zweideutig. Was der Patient als rechte und linke Hand bezeichnet, ist von Ihrer Position (gegenüber) nämlich genau andersherum!
Alles klar? Dann einen kleinen Test dazu!
11. Ordnen Sie die Schnittebenen in Abbildung 1.2 korrekt zu.
a. sagittal
b. transversal
c. frontal
12. Setzen Sie die korrekten Bezeichnungen ein.
a. Der Hals liegt __________ der Hüfte.
b. Die Lungen befinden sich __________ des Brustkorbs.
c. Die Nase liegt __________ der Ohren.
d. Das Handgelenk liegt __________ der Schulter.
e. Der Po liegt __________ vom Bauchnabel.
Abbildung 1.2: Die Körperebenen
Antworten zu den Fragen zur Terminologie
1. Abbildung 1.1 sollte so beschriftet werden:
1. j. ventral; 2. d. dorsal, 3. i. thorakal; 4. b. abdominopelvin; 5. c. kranial; 6. h. spinal; 7. g. pleural; 8. f. perikardial; 9. a. abdominal; 10. e. pelvin
2. bis 6. So sollten Sie die Begriffe korrekt zuordnen:
2. a. Das parietale Perikard ist die äußere Schicht des Herzens. 3. e. Das viszerale Peritoneum liegt direkt auf der Leber. 4. d. Das viszerale Perikard liegt direkt auf dem Herzen. 5. c. Die Thorakalhöhle wird von der parietalen Pleura ausgekleidet. 6. b. Die abdominopelvine Höhle wird vom parietalen Peritoneum ausgekleidet.