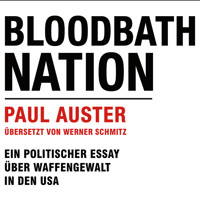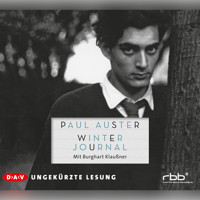9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
New York, 1967: Der gutaussehende, hochsensible Adam Walker will Dichter werden. Da bietet ihm auf einer Party ein reicher Franzose namens Rudolf Born das Geld zur Gründung einer Literaturzeitschrift an. Adam hält den Vorschlag zunächst für eine Schnapsidee, aber als Born ihn ein paar Tage später zum Essen einlädt, bekommt er die glaubhafte Bestätigung in Gestalt eines Schecks. Allerdings zeigt sich bei diesem Essen auch ein sinistrer Born, ein Mann voll verhaltenem Jähzorn, der Adam betrunken empfängt und ihn zu dem Eingeständnis nötigen will, er begehre seine Freundin. Das tut Adam in der Tat; und Margot sitzt ihm gegenüber und wirft ihm verschattete Blicke zu. Kurz darauf reist Born für ein paar Tage nach Paris, Margot ruft Adam an, und eine Amour fou beginnt. Doch Born ist zu fürchten, er geht, wie sich bald erweisen wird, über Leichen. AUSTER hat noch kein intensiveres und drastischeres Buch über die Liebe und das Schicksal geschrieben. In «Unsichtbar» ist er auf der Höhe seines Schaffens – erfindungsreich, abgründig und direkt am Puls des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Ähnliche
Paul Auster
Unsichtbar
Roman
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
Inhaltsverzeichnis
I
II
III
IV
I
Im Frühjahr 1967 gab ich ihm zum ersten Mal die Hand. Ich war damals im zweiten Jahr an der Columbia, ein ahnungsloser junger Student mit Lust auf Bücher, und gab mich dem Glauben (oder der Einbildung) hin, eines Tages würde ich gut genug sein, mich einen Dichter nennen zu können, und da ich Gedichte las, hatte ich seinen Namensvetter in Dantes Hölle bereits kennengelernt, einen Toten, der durch die letzten Zeilen des achtundzwanzigsten Gesangs des Inferno geistert. Bertran de Born, der provenzalische Dichter aus dem zwölften Jahrhundert, der sein abgeschnittenes Haupt an den Haaren trägt – es schwankt hin und her wie eine Laterne–, gewiss eines der groteskesten Bilder in diesem buchlangen Katalog von Halluzinationen und Folterqualen. Dante war ein treuer Verteidiger von de Borns Schriften, verurteilte ihn jedoch zu ewiger Verdammnis, weil er Prinz Heinrich geraten hatte, sich gegen seinen Vater, König Heinrich den Zweiten, zu erheben, und weil de Born Vater und Sohn entzweit und zu Feinden gemacht hatte, bestand Dantes sinnreiche Strafe darin, de Born mit sich selbst zu entzweien. Daher der enthauptete Körper in der Unterwelt, der den Reisenden aus Florenz klagend fragt, ob er sich eine grausamere Qual als diese vorstellen könne.
Als er seinen Namen nannte, Rudolf Born, musste ich sofort an den Dichter denken. Irgendeine Verwandtschaft mit Bertran?, fragte ich.
Ah, erwiderte er, der arme Kerl, der seinen Kopf verloren hat. Möglich, aber wohl leider nicht wahrscheinlich. Mir fehlt das de. Dazu muss man von Adel sein, und die traurige Wahrheit ist, dass ich alles andere als ein Adliger bin.
Ich kann mich nicht erinnern, warum ich dort war. Jemand muss mich gebeten haben mitzukommen, aber wer das war, ist meinem Gedächtnis längst entschwunden. Ich erinnere mich nicht einmal mehr, wo die Party stattfand – uptown oder downtown, in einer Wohnung oder in einem Loft–, oder aus welchen Gründen ich die Einladung überhaupt angenommen hatte, denn damals pflegte ich größere Menschenansammlungen zu meiden, abgestoßen vom Lärm der schwatzenden Menge, verlegen ob der Schüchternheit, die mich in Gegenwart von Leuten überkam, die ich nicht kannte. An diesem Abend aber sagte ich unerklärlicherweise ja und begleitete meinen vergessenen Freund, wohin auch immer er mich führte.
Woran ich mich erinnere: Einmal an diesem Abend stand ich allein in einer Ecke des Zimmers. Ich rauchte eine Zigarette und sah mir die Leute an, etliche Dutzend junge Leiber, die sich in dem engen Raum drängten, lauschte dem Brausen aus Worten und Gelächter, fragte mich, was um alles in der Welt ich eigentlich hier zu suchen hatte, und dachte, dass ich jetzt vielleicht gehen sollte. Auf einem Heizkörper links neben mir stand ein Aschenbecher, und als ich mich umdrehte, um meine Zigarette darin auszudrücken, sah ich das mit Kippen gefüllte Behältnis in der Handfläche eines Mannes zu mir hochschweben. Von mir unbemerkt hatten sich zwei Leute auf die Heizung gesetzt, ein Mann und eine Frau, beide älter als ich, zweifellos älter als alle anderen im Raum – er etwa fünfunddreißig, sie Ende zwanzig oder Anfang dreißig.
Die beiden schienen mir nicht zueinander zu passen, Born in einem zerknitterten, etwas angeschmutzten weißen Leinenanzug mit einem ebenso zerknitterten weißen Hemd unterm Jackett, während die Frau (deren Name Margot war, wie sich herausstellte) ganz in Schwarz gekleidet war. Als ich ihm für den Aschenbecher dankte, nickte er mir knapp und höflich zu und sagte Gern geschehen. Er sprach mit einem hauchzarten ausländischen Akzent, ob französisch oder deutsch, konnte ich nicht erkennen, da sein Englisch nahezu makellos war. Was habe ich in diesem ersten Augenblick sonst noch bemerkt? Blasse Haut, zerzaustes rotes Haar (kürzer geschnitten als bei den meisten Männern in diesen Jahren), ein breites, ansehnliches Gesicht ohne besondere Kennzeichen (ein exemplarisches Gesicht, sozusagen, ein Gesicht, das in der Menge unsichtbar bliebe) und ruhige braune Augen, die forschenden Augen eines Mannes, der sich vor nichts zu fürchten schien. Weder schlank noch beleibt, weder groß noch klein, vermittelte er dennoch den Eindruck von physischer Stärke, was an seinen dicken Händen liegen mochte. Margot saß da, ohne einen Muskel zu bewegen, und starrte ins Leere, als bestünde die Hauptaufgabe ihres Lebens darin, gelangweilt dreinzuschauen. Freilich wirkte sie attraktiv, äußerst attraktiv auf einen Zwanzigjährigen wie mich, mit ihren schwarzen Haaren, dem schwarzen Rollkragenpullover, dem schwarzen Minirock, den schwarzen Lederstiefeln und dem dicken schwarzen Make-up um ihre großen grünen Augen. Keine Schönheit, mag sein, aber ein Abbild von Schönheit, als verkörperten der Stil und die Raffinesse ihrer Erscheinung das weibliche Ideal jener Epoche.
Born sagte, er und Margot hätten gerade gehen wollen, aber dann hätten sie mich allein in der Ecke stehen sehen, und da ich so unglücklich gewirkt habe, seien sie gekommen, um mich aufzuheitern – nur um sicherzugehen, dass ich mir nicht vor dem Ende des Abends die Kehle aufschlitzte. Ich hatte keine Ahnung, wie ich diese Bemerkung deuten sollte. Wollte dieser Mann mich beleidigen, fragte ich mich, oder versuchte er wirklich, einem einsamen jungen Fremden eine Freundlichkeit zu erweisen? Die Worte selbst hatten etwas Verspieltes, Entwaffnendes, aber sein Blick dabei war kalt und distanziert, und ich hatte unwillkürlich das Gefühl, dass er mich auf die Probe stellte, mich verhöhnte – nur warum, das war mir unbegreiflich.
Ich zuckte die Achseln, lächelte matt zurück und sagte: Ob Sie’s glauben oder nicht, aber ich amüsiere mich köstlich.
Nun stand er auf, gab mir die Hand und nannte seinen Namen. Nach meiner Erkundigung wegen Bertran de Born stellte er mir Margot vor, die mich schweigend anlächelte und sich dann wieder ihrer Aufgabe zuwandte, ausdruckslos ins Leere zu starren.
Ihrem Alter, sagte Born, und Ihrer Kenntnis obskurer Dichter nach zu urteilen, möchte ich Sie für einen Studenten halten. Sie studieren Literatur, richtig? NYU oder Columbia?
Columbia.
Columbia, seufzte er. So ein langweiliger Laden.
Sie kennen sich da aus?
Ich lehre seit September dort an der School of International Affairs. Gastprofessur für ein Jahr. Zum Glück haben wir schon April, und in zwei Monaten gehe ich nach Paris zurück.
Sie sind also Franzose.
Nach Umständen, Neigung und Pass. Von Geburt jedoch Schweizer.
Französische Schweiz oder deutsche Schweiz? Ich höre ein wenig von beidem in Ihrer Stimme.
Born schnalzte leise mit der Zunge und sah mir neugierig in die Augen. Sie haben ein feines Gehör, sagte er. Tatsächlich trifft beides zu – ich bin das hybride Produkt einer Deutsch sprechenden Mutter und eines Französisch sprechenden Vaters. Ich bin zweisprachig aufgewachsen.
Unsicher, was ich darauf sagen sollte, schwieg ich kurz und stellte dann eine harmlose Frage: Und was genau lehren Sie an Ihrer tristen Universität?
Katastrophen.
Ist das nicht ein ziemlich weites Feld?
Um es einzugrenzen: die Katastrophen der französischen Kolonialherrschaft. Ich halte eine Vorlesung über den Verlust Algeriens und eine weitere über den Verlust Indochinas.
Der reizende Krieg, den wir von Ihnen geerbt haben.
Unterschätzen Sie die Bedeutung von Kriegen nicht. Krieg ist die reinste, klarste Äußerung der menschlichen Seele.
Allmählich hören Sie sich an wie unser kopfloser Dichter.
Ach?
Ich nehme an, Sie haben ihn nicht gelesen?
Kein Wort. Ich kenne seinen Namen nur von dieser Stelle bei Dante.
De Born war ein guter Dichter, vielleicht sogar ein ausgezeichneter Dichter – aber ein zutiefst beunruhigender. Er schrieb ein paar entzückende Liebesgedichte und ein bewegendes Klagelied auf den Tod Prinz Heinrichs, aber sein eigentliches Thema, das einzige, für das er sich mit echter Leidenschaft interessierte, war der Krieg. Er schwärmte geradezu davon.
Ich verstehe, sagte Born und schenkte mir ein ironisches Lächeln. Ein Mann ganz nach meinem Geschmack.
Ich rede von der Freude daran, Männern zuzusehen, die sich gegenseitig den Schädel einschlagen, Schlösser einstürzen und brennen zu sehen, Tote zu sehen, deren Leiber von Lanzen durchbohrt sind. Blutrünstiges Zeug, glauben Sie mir, und de Born zuckt mit keiner Wimper. Schon der bloße Gedanke an ein Schlachtfeld erfüllt ihn mit Glück.
Ich nehme an, Sie haben kein Interesse daran, Soldat zu werden.
Nicht im geringsten. Eher gehe ich ins Gefängnis, als dass ich in Vietnam kämpfe.
Angenommen, es gelingt Ihnen, sowohl dem Gefängnis als auch der Armee zu entgehen – haben Sie Pläne?
Keine Pläne. Nur weitermachen mit dem, was ich gerade tue, und hoffen, dass was draus wird.
Und das wäre?
Schriftsteller werden. Mich der schönen Kunst des Kritzelns widmen.
Das dachte ich mir. Als Margot Sie vorhin entdeckte, sagte sie zu mir: Sieh mal, der Junge mit den traurigen Augen und dem nachdenklichen Gesicht – ich wette, das ist ein Dichter. Und? Sind Sie das? Ein Dichter?
Ich schreibe Gedichte, ja. Und ab und zu Buchbesprechungen für den Spectator.
Das Studentenblättchen.
Jeder muss irgendwo anfangen.
Interessant…
Nicht so sehr. Die Hälfte meiner Bekannten will Schriftsteller werden.
Warum sagen Sie will? Wenn Sie es bereits tun, ist es kein Plan für die Zukunft. Dann existiert es bereits in der Gegenwart.
Weil es zu früh ist. Ich kann noch nicht wissen, ob ich gut genug bin.
Werden Sie für Ihre Artikel bezahlt?
Natürlich nicht. Das ist eine Collegezeitung.
Wenn man anfängt, Sie für Ihre Arbeit zu bezahlen, werden Sie wissen, dass Sie gut genug sind.
Bevor ich antworten konnte, wandte Born sich plötzlich Margot zu und erklärte: Du hattest recht, mein Engel. Dein junger Mann ist ein Dichter.
Margot hob die Augen, bedachte mich mit einem neutralen, abschätzenden Blick, und als sie nun zum ersten Mal etwas sagte, tat sie dies mit einem ausländischen Akzent, der wesentlich stärker war als der ihres Begleiters – unverkennbar französisch gefärbt. Ich habe immer recht, sagte sie. Das solltest du inzwischen wissen, Rudolf.
Ein Dichter, fuhr Born fort, noch immer an Margot gewandt, der auch ab und zu Bücher bespricht, ein Student an der tristen Festung Columbia, was bedeutet, dass er wahrscheinlich unser Nachbar ist. Aber er hat keinen Namen. Zumindest nicht, dass ich wüsste.
Walker, sagte ich, als mir klar wurde, dass ich mich nicht vorgestellt hatte, als wir uns die Hand gaben. Adam Walker.
Adam Walker, wiederholte Born, wandte sich von Margot ab und wieder mir zu, um mich wiederum mit seinem rätselhaften Lächeln zu bedenken. Ein guter, solider amerikanischer Name. So kräftig, so neutral, so zuverlässig. Adam Walker. Der einsame Kopfgeldjäger in einem Breitwandwestern, der mit Flinte und Revolver auf seinem kastanienbraunen Wallach durch die Wüste stromert. Oder aber der gutmütige, anständige Chirurg in einer Daily Soap, der tragischerweise in zwei Frauen gleichzeitig verliebt ist.
Der Name klingt solide, erwiderte ich, aber nichts in Amerika ist solide. Er wurde meinem Großvater verpasst, als er im Jahr neunzehnhundert nach Ellis Island kam. Anscheinend war Walshinksky den Einwanderungsbeamten zu kompliziert, also nannten sie ihn kurzerhand Walker.
Was für ein Land, sagte Born. Analphabetische Beamte berauben einen Mann mit einem schlichten Federstrich seiner Identität.
Nicht seiner Identität, sagte ich. Nur seines Namens. Er hat dreißig Jahre lang als koscherer Metzger auf der Lower East Side gearbeitet.
Danach kam noch mehr, sehr viel mehr, ein Gespräch von gut einer Stunde, das ziellos von einem Gegenstand zum nächsten sprang. Vietnam und die wachsende Opposition gegen den Krieg. Die Unterschiede zwischen New York und Paris. Der Mord an Kennedy. Das amerikanische Handelsembargo gegen Kuba. Unpersönliche Themen, gewiss, aber Born hatte zu allem eine entschiedene Meinung, oftmals eine wilde, unorthodoxe Meinung, und da er seine Worte in einem halb spöttischen, verschlagen herablassenden Tonfall vorbrachte, konnte ich nicht erkennen, ob er es ernst meinte oder nicht. Manchmal klang er wie ein militaristischer Rechtsaußen, dann wieder äußerte er Vorstellungen, die man eher aus dem Mund eines bombenwerfenden Anarchisten erwarten würde. Versucht er mich zu provozieren, fragte ich mich, oder ist das seine gewöhnliche Art, sich an einem Samstagabend ein wenig zu amüsieren? Unterdessen war die unergründliche Margot von der Heizung geklettert, um sich von mir eine Zigarette zu schnorren; danach blieb sie stehen, trug aber nur wenig zur Unterhaltung bei, eigentlich so gut wie nichts, außer dass sie mich jedes Mal aufmerksam beobachtete, wenn ich etwas sagte, wie ein neugieriges Kind, das einen unverwandt anblickt. Ich muss gestehen, es gefiel mir, so von ihr angesehen zu werden, auch wenn es mich ein wenig nervös machte. Ich empfand ihre Blicke als vage erotisch, war aber damals noch nicht erfahren genug, um zu unterscheiden, ob sie mir etwas zu signalisieren versuchte oder einfach nur schaute um des Schauens willen. Die Wahrheit war, dass ich noch niemals Menschen wie die beiden kennengelernt hatte, und da sie mir so fremd waren, so unvertraut in ihrem Gebaren, schienen sie mir, je länger ich mit ihnen sprach, desto unwirklicher zu werden – wie imaginäre Figuren eines Romans, der sich in meinem Kopf abspielte.
Ich weiß nicht mehr, ob wir getrunken haben, aber wenn die Party so war wie all die anderen, die ich seit meiner Ankunft in New York besucht hatte, muss es dort billigen Rotwein in Strömen und unerschöpfliche Vorräte an Pappbechern gegeben haben, was bedeutet, dass wir im Lauf unseres Gesprächs immer betrunkener geworden sein dürften. Ich wünschte, ich könnte noch mehr von dem ausgraben, worüber wir sprachen, aber 1967 ist lange her, und meine Bemühungen, die Worte, Gesten und flüchtigen Andeutungen dieser ersten Begegnung mit Born ans Licht zu holen, laufen meist ins Leere. Gleichwohl sehe ich noch ein paar Dinge deutlich vor mir. Born, wie er in die Innentasche seines Leinenjacketts greift, zum Beispiel, und den Stummel einer halbgerauchten Zigarre hervorzieht, und während er sie mit einem Streichholz entzündet, teilt er mir mit, es handele sich um eine Montecristo, die beste aller kubanischen Zigarren – in Amerika damals wie heute noch verboten–, und nur dank seiner persönlichen Beziehung zu jemandem, der an der französischen Botschaft in Washington arbeite, habe er dieses Exemplar ergattern können. Daran schlossen sich einige freundliche Worte über Castro an – dabei hatte er nur Minuten zuvor Leute wie Johnson, McNamara und Westmoreland für ihr heldenhaftes Wirken beim Kampf gegen die kommunistische Bedrohung in Vietnam gepriesen. Ich erinnere mich an meine Belustigung über den zerzausten Politologen, als er sich diese halbgerauchte Zigarre ansteckte, und daran, dass ich zu ihm sagte, er gleiche dem Besitzer einer südamerikanischen Kaffeeplantage, der nach zu vielen Jahren im Dschungel wahnsinnig geworden sei. Born lachte über die Bemerkung und gab zurück, so weit sei das gar nicht von der Wahrheit entfernt, denn er habe den größten Teil seiner Kindheit in Guatemala verbracht. Aber als ich ihn bat, mehr davon zu erzählen, winkte er ab und sagte ein andermal.
Ich werde Ihnen die ganze Geschichte erzählen, sagte er, aber in einer ruhigeren Umgebung. Die ganze Geschichte meines unglaublichen Lebens. Sie werden sehen, Mr.Walker. Eines Tages schreiben Sie meine Biographie. Garantiert.
Borns Zigarre und meine Rolle als sein zukünftiger Boswell, aber auch ein Bild von Margot, die mit ihrer rechten Hand mein Gesicht berührt und flüstert: Passen Sie auf sich auf. Das muss gegen Ende gewesen sein, als wir aufbrachen oder schon nach unten gegangen waren, aber ich habe keine Erinnerung an einen Aufbruch, keine Erinnerung daran, dass wir uns verabschiedet haben. Das alles ist weg, ausgelöscht von vierzig Jahren. Die beiden waren Fremde, die ich an einem Frühlingsabend im New York meiner Jugend, in einem New York, das nicht mehr existiert, auf einer lärmenden Party kennengelernt hatte, und das war’s. Ich könnte mich irren, bin mir aber ziemlich sicher, dass wir uns nicht einmal die Mühe machten, unsere Telefonnummern auszutauschen.
Ich ging davon aus, dass ich sie nie wiedersehen würde. Born hatte seit sieben Monaten an der Columbia gelesen, und da ich ihm in dieser ganzen Zeit nicht über den Weg gelaufen war, schien es unwahrscheinlich, dass ich ihm nun auf einmal begegnen würde. Aber Wahrscheinlichkeiten zählen nicht, wenn es um reale Ereignisse geht, und nur weil der Eintritt eines Ereignisses unwahrscheinlich ist, heißt das noch lange nicht, dass es nicht doch eintritt. Zwei Tage nach der Party ging ich nach der letzten Vorlesung des Nachmittags in die West End Bar, um dort vielleicht einen meiner Freunde zu treffen. Die West End Bar war ein schmuddliges, höhlenartiges Loch mit einem Dutzend Tische, einer riesigen ovalen Theke in der Mitte des vorderen Raums und einem Bereich in der Nähe des Eingangs, wo man sich mittags und abends mit schlechten Snacks verköstigen konnte – mein Stammlokal, frequentiert von Studenten, Säufern und Leuten aus der Nachbarschaft. Es war zufällig ein warmer Nachmittag, die Sonne schien, und folglich waren zu dieser Stunde nur wenige Gäste da. Als ich auf der Suche nach einem vertrauten Gesicht durch die Bar schlenderte, sah ich Born allein an einem Tisch im hinteren Teil sitzen. Er las ein deutsches Nachrichtenmagazin (Der Spiegel, glaube ich), rauchte eine seiner kubanischen Zigarren und ignorierte das halbgeleerte Glas Bier, das links vor ihm auf dem Tisch stand. Wieder trug er seinen weißen Anzug – vielleicht auch einen anderen, denn das Jackett sah sauberer aus und war weniger zerknittert als das, das er an jenem Samstagabend getragen hatte–, aber das weiße Hemd war weg, das jetzige war rot – dunkelrot, zwischen backsteinrot und karmesin.
Seltsamerweise hätte ich mich am liebsten einfach umgedreht und das Lokal verlassen, ohne ihn zu begrüßen. Diese Reaktion bietet viel Stoff zum Nachdenken, nehme ich an, denn sie scheint darauf hinzudeuten, dass mir da bereits klar war, dass ich besser täte, mich von Born fernzuhalten, dass ein näherer Umgang mit ihm mich in Schwierigkeiten bringen könnte. Wie konnte ich das wissen? Bisher hatte ich kaum mehr als eine Stunde in seiner Gesellschaft verbracht, doch schon in dieser kurzen Zeit hatte ich etwas Unangenehmes, leicht Abstoßendes an ihm wahrgenommen. Damit will ich seine anderen Qualitäten gar nicht bestreiten – seinen Charme, seine Intelligenz, seinen Humor–, doch unterhalb all dessen hatten sich eine Düsternis und ein Zynismus bemerkbar gemacht, die mich aus dem Gleichgewicht gebracht und mir das Gefühl vermittelt hatten, er sei kein Mensch, dem man trauen könne. Wäre mein Eindruck von ihm ein anderer gewesen, wenn seine politischen Ansichten mir nicht so zuwider gewesen wären? Unmöglich zu sagen. Mein Vater und ich waren uns in fast jeder tagespolitischen Frage uneins, aber das hielt mich nicht davon ab, ihn für einen von Grund auf guten Menschen zu halten – oder jedenfalls nicht für einen schlechten Menschen. Born aber war nicht gut. Er war geistreich, exzentrisch und unberechenbar, aber wer behauptet, der Krieg sei die reinste Äußerung der menschlichen Seele, verbannt sich aus dem Reich des Guten. Und falls er das im Scherz gesagt haben sollte, falls er damit einen antimilitaristischen Studenten dazu bringen wollte, Gegenargumente zu liefern und seine Position in Frage zu stellen, dann war es einfach nur geschmacklos.
Mr.Walker, sagte er, indem er von seiner Zeitschrift aufblickte und mich an seinen Tisch heranwinkte. Genau der Mann, auf den ich gewartet habe.
Ich hätte einen Vorwand erfinden und ihm sagen können, ich müsse noch zu einer Verabredung, ließ es aber sein. Das war die andere Hälfte der komplizierten Gleichung, die mein Verhältnis zu Born definierte. So misstrauisch ich gewesen sein mag, war ich doch auch fasziniert von diesem eigenartigen, undurchschaubaren Menschen, und dass ihn die zufällige Wiederbegegnung mit mir aufrichtig zu freuen schien, schürte das Feuer meiner Eitelkeit – jenes unsichtbare Gemisch aus Eigennutz und Ehrgeiz, das in jedem von uns köchelt. Meine Vorbehalte gegen ihn, meine Skepsis gegenüber seinem fragwürdigen Charakter hinderten mich nicht daran, mir zu wünschen, dass ich ihm sympathisch sei, dass er in mir etwas mehr sehen möge als einen strebsamen amerikanischen Feld-, Wald- und Wiesenstudenten und dass er nicht blind sein möge für die guten Ansätze, die ich zwar in mir zu haben glaubte, an denen ich jedoch von früh bis spät in neun von zehn Minuten Zweifel hegte.
Als ich mich zu ihm gesetzt hatte, sah Born mich über den Tisch hinweg an, stieß eine dicke Rauchwolke aus seiner Zigarre und lächelte. Sie haben neulich Abend auf Margot einen vorteilhaften Eindruck gemacht, sagte er.
Auch ich war von ihr beeindruckt, antwortete ich.
Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass sie nicht sehr gesprächig ist.
Ihr Englisch ist nicht sonderlich gut. In einer Sprache, mit der man Schwierigkeiten hat, kann man sich nur schwer verständlich machen.
Sie spricht fließend Französisch, aber auch in Französisch ist sie nicht sehr gesprächig.
Nun, Worte sind nicht alles.
Eine seltsame Bemerkung von einem Mann, der sich als Schriftsteller sieht.
Ich spreche von Margot –
Ja, Margot. Ganz recht. Das bringt mich zu meinem Anliegen. Die Frau schweigt oft und lange, aber als wir von der Party am Samstagabend nach Hause gingen, redete sie wie ein Wasserfall.
Interessant, sagte ich, nicht sicher, wohin die Unterhaltung führen sollte. Und was hat ihr die Zunge gelöst?
Sie, mein Junge. Sie hat wirklich Gefallen an Ihnen gefunden, aber Sie sollten auch wissen, dass sie sich große Sorgen macht.
Sorgen? Warum sollte sie sich Sorgen machen? Sie kennt mich doch gar nicht.
Mag sein, aber sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass Ihre Zukunft gefährdet ist.
Die Zukunft jedes Menschen ist gefährdet. Das gilt besonders für amerikanische Männer um die zwanzig, wie Sie sicher wissen. Aber solange ich nicht von der Uni fliege, kommt die Armee nicht an mich ran, beziehungsweise erst, wenn ich das Studium abgeschlossen habe. Nicht dass ich darauf wetten würde, aber ich halte es für möglich, dass der Krieg bis dahin beendet ist.
Wetten Sie lieber nicht darauf, Mr.Walker. Dieses kleine Scharmützel wird sich noch jahrelang hinziehen.
Ich steckte mir eine Chesterfield an und nickte. Da bin ich ausnahmsweise mal Ihrer Meinung, sagte ich.
Wie auch immer, Margot hat nicht von Vietnam gesprochen. Ja, Sie könnten im Gefängnis landen – oder in zwei, drei Jahren im Sarg nach Hause kommen–, aber sie hat nicht an den Krieg gedacht. Sie meint, Sie seien zu gut für diese Welt, und daher werde die Welt Sie eines Tages erdrücken.
Ich kann ihr nicht ganz folgen.
Sie meint, dass Sie Hilfe brauchen. Margot mag nicht das hellste Köpfchen der westlichen Welt besitzen, aber da lernt sie einen Jungen kennen, der sich als Dichter bezeichnet, und das erste Wort, das ihr dazu einfällt, ist Hunger.
Das ist doch absurd. Sie hat keine Ahnung, wovon sie redet.
Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen widerspreche, aber als ich Sie auf der Party nach Ihren Plänen fragte, sagten Sie, Sie hätten keine. Abgesehen natürlich von Ihrem nebulösen Bestreben, Gedichte zu schreiben. Was verdienen Dichter denn so, Mr.Walker?
Meistens gar nichts. Wenn man Glück hat, bekommt man ab und zu ein bisschen Kleingeld hingeworfen.
Hört sich für mich nach Hungerleiden an.
Ich habe nie gesagt, ich hätte vor, meinen Lebensunterhalt als Schriftsteller zu verdienen. Ich werde mir einen Job suchen müssen.
Zum Beispiel?
Schwer zu sagen. Ich könnte für einen Verlag arbeiten oder für eine Zeitschrift. Ich könnte Bücher übersetzen. Ich könnte Artikel und Rezensionen schreiben. Eins davon, oder mehreres gleichzeitig. Es ist zu früh, und solange ich noch nicht in die Welt hinausgetreten bin, hat es keinen Sinn, mir deswegen schlaflose Nächte zu machen, oder?
Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie sind schon längst in die Welt hinausgetreten, und je früher Sie lernen, für sich selbst zu sorgen, desto besser für Sie.
Woher plötzlich diese Anteilnahme? Wir kennen uns noch kaum. Warum also interessiert Sie, was aus mir wird?
Weil Margot mich gebeten hat, Ihnen zu helfen, und weil sie mich selten um etwas bittet, fühle ich mich moralisch verpflichtet, ihren Wünschen nachzukommen.
Danken Sie ihr in meinem Namen, aber Sie brauchen sich meinetwegen keine Umstände zu machen. Ich komme auch gut allein zurecht.
Ziemlich halsstarrig, wie?, sagte Born, legte seine fast aufgerauchte Zigarre auf den Rand des Aschenbechers und beugte sich vor, bis sein Gesicht nur noch Zentimeter von meinem entfernt war. Angenommen, ich biete Ihnen einen Job an – wollen Sie mir sagen, den würden Sie ablehnen?
Kommt drauf an, was für ein Job das wäre.
Das bleibt abzuwarten. Ich habe verschiedene Ideen, bin aber noch zu keinem Entschluss gekommen. Vielleicht können Sie mir helfen.
Ich glaube, ich kann Ihnen nicht folgen.
Vor zehn Monaten ist mein Vater gestorben, und wie es aussieht, habe ich eine beträchtliche Menge Geld geerbt. Nicht genug, um ein Château oder eine Fluggesellschaft zu kaufen, aber genug, die Welt ein wenig anders aussehen zu lassen. Ich könnte Sie engagieren, meine Biographie zu schreiben, selbstverständlich, aber dafür ist es mir noch etwas zu früh. Ich bin erst sechsunddreißig und halte es für ungebührlich, über das Leben eines Mannes zu reden, bevor er nicht mindestens fünfzig ist. Also was dann? Ich habe daran gedacht, einen Verlag zu gründen, bin mir aber nicht sicher, ob ich mich bei den langfristigen Planungen, die dergleichen erfordert, sonderlich wohl fühlen würde. Eine Zeitschrift hingegen könnte mich schon eher reizen. Sie könnte monatlich, vielleicht auch vierteljährlich erscheinen, ich stelle mir etwas Frisches und Wagemutiges vor, eine Publikation, die die Leute aufrüttelt und mit jeder Ausgabe für Kontroversen sorgt. Was halten Sie davon, Mr.Walker? Hätten Sie Interesse, an einer solchen Zeitschrift mitzuarbeiten?
Auf jeden Fall. Die Frage ist nur: Warum ich? Sie gehen in wenigen Monaten nach Frankreich zurück, also vermute ich, dass Sie von einer französischen Zeitschrift sprechen. Mein Französisch ist nicht schlecht, aber auch nicht gut genug für das, was Sie brauchen. Und davon abgesehen, studiere ich hier in New York. Ich kann das nicht einfach abbrechen und woanders hinziehen.
Wer hat was von Umziehen gesagt? Wer hat was von einer französischen Zeitschrift gesagt? Wenn ich eine gute amerikanische Mannschaft hätte, die den Laden hier schmeißt, könnte ich ab und zu mal vorbeikommen und ihnen auf die Finger sehen; im Wesentlichen aber würde ich mich raushalten. Für so etwas habe ich keine Zeit, ich muss mich um meine eigene Arbeit kümmern. Ich sähe meine Pflicht einzig darin, das Geld bereitzustellen – in der Hoffnung, dass es Gewinn abwirft.
Sie sind Politologe, ich bin Literaturstudent. Wenn Sie vorhaben, eine politische Zeitschrift zu machen, dann bitte ohne mich. Wir stehen auf verschiedenen Seiten, und es kann nur mit einem Fiasko enden, wenn ich für Sie arbeiten würde. Falls Sie aber an eine literarische Zeitschrift denken, dann ja, dann wäre ich sehr interessiert.
Nur, weil ich Vorlesungen über internationale Beziehungen halte und Artikel über Politik und das Verhalten von Regierungen schreibe, bin ich noch lange kein Spießer. Kunst ist mir genauso wichtig wie Ihnen, Mr.Walker, und ich würde Sie niemals bitten, an einer Zeitschrift mitzuarbeiten, die keine literarische Zeitschrift wäre.
Woher wollen Sie wissen, ob ich das überhaupt kann?
Das weiß ich nicht. Aber ich ahne es.
Das kommt mir nicht sehr logisch vor. Sie bieten mir einen Job an und haben noch kein Wort von mir gelesen.
Nicht doch. Erst heute Morgen habe ich vier Ihrer Gedichte in der letzten Ausgabe der Columbia Review gelesen und sechs Artikel von Ihnen in der Studentenzeitung. Den über Melville fand ich besonders gut, und ihr kleines Gedicht über den Friedhof hat mich durchaus bewegt. Wie viele Himmel noch über mir/Bis auch dieser eine verschwindet? Beeindruckend.
Das freut mich. Und noch mehr beeindruckt mich, dass Sie so rasch gehandelt haben.
So bin ich nun mal. Das Leben ist zu kurz für Trödeleien.
Im dritten Schuljahr hat der Lehrer uns das Gleiche gesagt – mit exakt denselben Worten.
Ein wunderbares Land, Ihr Amerika. Sie haben eine ausgezeichnete Erziehung genossen, Mr.Walker.
Born lachte über die Albernheit seiner Bemerkung, trank einen Schluck Bier und lehnte sich zurück, um über die Idee nachzudenken, die er geboren hatte.
Ich möchte, sagte er schließlich, dass Sie einen Plan entwerfen, eine Vorschau. Schreiben Sie auf, was Sie in der Zeitschrift bringen würden: Umfang der einzelnen Ausgaben, Umschlagsgestaltung, Design, Rhythmus des Erscheinens, wie Sie die Zeitschrift nennen möchten und so weiter. Bringen Sie mir das ins Büro, wenn Sie fertig sind. Ich sehe es mir an, und wenn Ihre Vorstellungen mir gefallen, sind wir im Geschäft.
So jung ich gewesen sein mag, wusste ich doch schon genug von der Welt, um zu erkennen, dass Born mich womöglich zum Narren hielt. Wie oft spaziert man in eine Bar, trifft dort einen Mann, den man zuvor nur ein einziges Mal gesehen hat, und kommt mit der Chance heraus, eine Zeitschrift zu gründen – zumal, wenn der Betreffende ein zwanzigjähriger Niemand ist, der sich noch auf keinem Feld bewiesen hat? Das war einfach zu bizarr. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte Born diese Hoffnungen nur in mir geweckt, um sie zu vernichten, und ich war vollkommen davon überzeugt, er werde meinen Entwurf in den Papierkorb werfen und mir sagen, er habe kein Interesse daran. Da aber auch nicht ganz auszuschließen war, dass er es ernst meinte, dass er aufrichtig vorhatte, sein Wort zu halten, beschloss ich, es wenigstens zu versuchen. Was hatte ich zu verlieren? Schlimmstenfalls einen Tag Nachdenken und Schreiben, und wenn Born meinen Vorschlag dann ablehnte – auch gut.
Innerlich gegen jede Enttäuschung gewappnet, machte ich mich noch am selben Abend an die Arbeit. Jedoch von einer Liste mit einem halben Dutzend möglicher Beiträger abgesehen, kam ich nicht sehr weit. Nicht, weil ich verwirrt war, und nicht, weil ich nicht jede Menge Ideen hatte, sondern aus dem simplen Grund, dass ich versäumt hatte, Born zu fragen, wie viel Geld er in das Projekt zu investieren gedachte. Alles hing von der Größe seines Engagements ab, und wie konnte ich, solange mir seine Absichten verborgen waren, etwas über die zahllosen Punkte aussagen, die er an diesem Nachmittag aufgezählt hatte: die Qualität des Papiers, Umfang und Erscheinungshäufigkeit der einzelnen Hefte, die Art der Bindung, die Aufnahme von Abbildungen, und wie viel er (falls überhaupt etwas) den Beiträgern zu zahlen bereit war? Literarische Zeitschriften gab es schließlich in allen möglichen Formaten und Ausstattungen, von hektographierten, gehefteten Untergrundpublikationen, herausgegeben von jungen Dichtern im East Village, über behäbige akademische Vierteljahresschriften und eher kommerzielle Erzeugnisse wie den Evergreen Review bis hin zu luxuriösen objets, finanziert von betuchten Hintermännern, die mit jeder Nummer ein paar tausend Dollar in den Sand setzten. Ich würde noch einmal mit Born reden müssen, erkannte ich, und statt meinen Plan auszuarbeiten, schrieb ich ihm einen Brief, in dem ich mein Problem erklärte. Das Ergebnis war so kläglich – Wir müssen über Geld reden –, dass ich beschloss, noch etwas anderes in den Umschlag zu tun, nur damit er mich nicht für ganz so einfältig hielt, wie dieser Brief es nahelegen mochte. Nach unserem kurzen Gespräch über Bertran de Born am Samstagabend dachte ich, es könnte ihn amüsieren, eines der wüsteren Werke dieses Dichters aus dem zwölften Jahrhundert kennenzulernen. Zufällig besaß ich eine Anthologie der Troubadoure – eine Taschenbuchausgabe, und nur auf Englisch–, und zunächst hatte ich die Idee, einfach eines der Gedichte aus dem Buch abzutippen. Als ich mir die Übersetzung dann jedoch genauer ansah, fand ich sie plump und unbeholfen; sie wurde der eigentümlichen, abstoßenden Kraft des Gedichts einfach nicht gerecht, und obwohl ich kein Wort Provenzalisch konnte, nahm ich an, mit Hilfe einer französischen Übersetzung etwas Besseres zustandebringen zu können. Am nächsten Morgen fand ich in der Butler Library, was ich suchte: eine Gesamtausgabe von de Born, mit dem provenzalischen Originaltext auf der linken und einer wörtlichen Prosaübersetzung ins Französische auf der rechten Seite. Ich brauchte einige Stunden, bis ich mit der Arbeit fertig war (wenn ich nicht irre, habe ich deswegen eine Vorlesung versäumt), und das Folgende kam dabei heraus:
Ich liebe das Frohlocken des Frühlings,
Wenn Blätter und Blüten sich entfalten,
Und ich jauchze über den Sang der Vögel,
Der laut durch alle Wälder schallt;
Ich schwelge im Anblick der Wiesen,
Auf denen Zelte und Pavillons stehen;
Und groß ist mein Glück, wenn auf den Feldern
Es wimmelt von gewappneten Rittern
Und ihren Pferden.
Mich begeistert der Anblick der Kundschafter,
Die Mann und Weib zur Flucht zwingen mit all ihrer Habe;
Und Freude erfüllt mich, wenn sie gejagt werden
Von einer dichten Schar bewaffneter Männer;
Und mein Herz schlägt hoch,
Wenn mächt’ge Burgen belagert werden
Und ihre Wälle bröckeln und brechen,
Wenn Kämpen in Masse über den Graben setzen
Und unbezwingliche Schranken das Ziel
Von allen Seiten einschließen.
Ebenso erfreut’s mich über die Maßen,
Wenn ein Baron den Angriff führt,
Hoch zu Ross, gewappnet und unerschrocken,
Den Seinen Kraft verleiht
Als Muster von Mut und Tapferkeit.
Und wenn die Schlacht begonnen,
Sollten sie alle gerüstet sein,
Ihm kampfbereit zu folgen,
Denn zum Mann wird ein Mann erst dann,
Wenn er Schlag auf Schlag ausgeteilt
Nicht minder denn empfangen.
Im dichten Kampfgetümmel sehen wir
Streitkolben, Schwerter, Schilde und Helme
Splittern und zerspringen,
Und Vasallen ohne Zahl nach allen Seiten schlagen
Und die Pferde der Toten und Verletzten
Ziellos über den Kampfplatz irren.
Sobald die Schlacht beginnt,
Soll ein Edelmann nur daran denken,
Köpf’ und Arme zu zerschmettern, denn besser
Tot sein, als am Leben und bezwungen.
Ich sag euch, essen, trinken und schlafen
Erfreun mich weniger als der Ruf «Attacke!»
Auf beiden Seiten, und die Hilferufe allenthalben,
Und der Anblick großer und nicht so großer Männer,
Wenn sie gemeinsam sinken in Gras und Gräben,
Der Anblick von Toten, aus deren Flanken
Gebroch’ne, mit Bändern geschmückte Lanzen ragen.
Barone, ihr könnt all eure
Schlösser, Dörfer und Städte versetzen,
Doch hört niemals auf, Krieg zu führen.
Am Nachmittag schob ich den Umschlag mit Brief und Gedicht unter die Tür von Borns Büro in der School of International Affairs. Ich rechnete mit einer umgehenden Antwort, aber es vergingen mehrere Tage, ehe er sich bei mir meldete, und angesichts seines Säumens fragte ich mich, ob dieses Zeitschriftenprojekt tatsächlich bloß ein spontaner Einfall gewesen war, der sich längst verflüchtigt hatte – oder, noch schlimmer, ob er sich von dem Gedicht beleidigt fühlte, weil er meinte, ich setzte ihn mit Bertran de Born gleich und ziehe ihn indirekt der Kriegshetzerei. Wie sich herausstellte, waren meine Sorgen unbegründet. Als am Freitag das Telefon klingelte, bat er für sein Schweigen um Entschuldigung; er habe, erklärte er, am Mittwoch in Cambridge einen Vortrag halten müssen und sei erst vor zwanzig Minuten wieder in sein Büro gekommen.
Sie haben vollkommen recht, fuhr er fort, und es war sehr dumm von mir, bei unserem Gespräch neulich die finanzielle Seite ganz außer Acht zu lassen. Wie sollen Sie ohne Etat ein Projekt entwickeln können? Sie müssen mich ja für schwachsinnig halten.
Durchaus nicht, sagte ich. Ich bin es, der sich dumm vorkommt – weil ich Sie nicht danach gefragt habe. Aber mir war nicht klar, wie ernst es Ihnen damit war, und ich wollte Sie nicht drängen.
Es ist mir ernst, Mr.Walker. Ich gebe zu, ich mache gern Witze, aber nur über kleine, belanglose Dinge. In einer Angelegenheit wie dieser würde ich Sie niemals an der Nase herumführen.
Das freut mich zu hören.
Um also Ihre Frage nach dem Geld zu beantworten… Natürlich hoffe ich, dass wir Erfolg haben werden, aber solche Unternehmungen sind immer mit einem hohen Risiko behaftet, und daher muss ich realistischerweise darauf vorbereitet sein, jeden Penny meiner Investition zu verlieren. Demnach stellt sich die Frage: Wie viel Verlust kann ich mir leisten? Wie viel von meiner Erbschaft kann ich verschleudern, ohne mich in Schwierigkeiten zu bringen? Ich habe seit unserem Gespräch am Montag gründlich darüber nachgedacht, und die Antwort ist: fünfundzwanzigtausend Dollar. Das ist mein Limit. Die Zeitschrift erscheint viermal im Jahr, ich stelle fünftausend pro Ausgabe zur Verfügung, weitere fünftausend als Jahresgehalt für Sie. Kommen wir am Ende des Jahres mit plus/minus null heraus, finanziere ich ein weiteres Jahr. Schreiben wir schwarze Zahlen, stecke ich den Gewinn in die Zeitschrift, und damit kommen wir zumindest teilweise durch das dritte Jahr. Sollten wir jedoch Geld verlieren, wird das zweite Jahr problematisch. Angenommen, wir machen zehntausend minus. Dann investiere ich fünfzehntausend, nicht mehr. Verstehen Sie das Prinzip? Ich habe fünfundzwanzigtausend Dollar zu verpulvern, aber nicht einen einzigen Dollar darüber hinaus. Was meinen Sie? Ist das ein fairer Vorschlag oder nicht?
Außerordentlich fair und außerordentlich großzügig. Mit fünftausend Dollar pro Ausgabe könnten wir eine erstklassige Zeitschrift herausbringen, etwas, worauf man stolz sein kann.
Ich könnte Ihnen das ganze Geld schon morgen in den Schoß legen, aber das würde Ihnen nicht wirklich helfen, richtig? Margot sorgt sich um Ihre Zukunft, und wenn Sie aus dieser Zeitschrift etwas machen, ist Ihre Zukunft gesichert. Dann haben Sie einen anständigen Job mit einem anständigen Einkommen und können in Ihren Mußestunden so viele Gedichte schreiben, wie Sie wollen, ellenlange Epen über die Rätsel des menschlichen Herzens, kurze lyrische Ergüsse über Gänseblümchen und Butterblumen, feurige Traktate gegen Grausamkeit und Ungerechtigkeit. Falls Sie nicht im Gefängnis landen oder Ihnen jemand eine Kugel in den Kopf schießt, aber mit solchen schrecklichen Möglichkeiten wollen wir uns jetzt nicht aufhalten.
Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll…
Danken Sie nicht mir. Danken Sie Margot, Ihrem Schutzengel.
Ich hoffe, ich sehe sie bald einmal wieder.
Ganz bestimmt. Wenn ich mit Ihren Plänen zufrieden bin, werden Sie sie so oft sehen können, wie Sie wollen.
Ich werde mein Bestes tun. Aber falls Sie eine Zeitschrift haben wollen, die für Kontroversen sorgt und die Leute aufrüttelt, dürfte ein literarisches Journal nicht ganz das Richtige sein. Ich hoffe, das ist Ihnen klar.
Natürlich, Mr.Walker. Mir geht es um Qualität… um schöne, exklusive Dinge. Kunst für Kenner.
Oder wie Stendhal gesagt haben würde: Künst für Kennähr.
Stendhal und Maurice Chevalier. Apropos Kavalier… vielen Dank für das Gedicht.
Das Gedicht. Das hatte ich schon ganz vergessen –
Das Gedicht, das Sie für mich übersetzt haben.
Was halten Sie davon?
Ich fand es empörend und großartig zugleich. Mein falscher Vorfahre war ein echter Samurai-Verrückter, oder? Aber immerhin hatte er den Mut, zu seinen Überzeugungen zu stehen. Immerhin wusste er, wofür er stand. Wie wenig sich die Welt seit elfhundertachtundsechzig geändert hat, so sehr wir uns auch etwas anderes einbilden wollen. Falls die Zeitschrift zustande kommt, sollten wir de Borns Gedicht in der ersten Ausgabe bringen.
Ich war ermutigt, aber auch verwirrt. Trotz meiner trübsinnigen Prophezeiungen hatte Born von dem Projekt gesprochen, als stünde seine Verwirklichung bereits unmittelbar bevor, und zu dem Zeitpunkt erschien mir die Ausarbeitung der Vorschau allenfalls noch als eine banale Formalität. Ganz gleich, wie mein Plan am Ende aussah, war Born offenbar bereit, ihn gutzuheißen. Und doch, so sehr ich mich darauf freute, die Verantwortung für eine gut finanzierte Zeitschrift zu übernehmen, die mir überdies ein mehr als reichliches Einkommen bescheren würde, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, was Born damit eigentlich bezweckte. War wirklich Margot die treibende Kraft hinter diesem unverhofften Ausbruch von Altruismus, die Ursache für dieses blinde Vertrauen zu einem jungen Mann, der keinerlei Erfahrung als Herausgeber, Verleger oder Geschäftsmann besaß und ihm noch eine Woche zuvor vollkommen unbekannt gewesen war? Und selbst wenn das der Fall war – was konnte ihr an meiner Zukunft liegen? Auf der Party hatten wir kaum miteinander gesprochen, und obwohl sie mich sehr aufmerksam betrachtet und mir sogar die Wange getätschelt hatte, war sie für mich ein leeres Blatt geblieben, ein Nichts, eine Null. Ich vermochte mir nicht vorzustellen, womit sie Born dazu bewogen haben könnte, meinetwegen fünfundzwanzigtausend Dollar zu riskieren. Nach meinem Eindruck lag ihm selbst nichts daran, eine Zeitschrift herauszugeben, und eben weil es ihm gleichgültig war, überließ er die ganze Sache mir. Als ich unser Gespräch im West End am Montag noch einmal Revue passieren ließ, schien es mir sogar so, als hätte ich ihn überhaupt erst auf die Idee gebracht. Ich hatte erwähnt, dass ich nach Abschluss meines Studiums vielleicht bei einem Verlag oder einer Zeitschrift arbeiten könnte, und eine Minute später kam er mit seiner Erbschaft an und behauptete, er trage sich mit dem Gedanken, mit seinem neuen Geld einen Verlag oder eine Zeitschrift aufzumachen. Was, wenn ich gesagt hätte, ich würde am liebsten Toaster herstellen? Hätte er geantwortet, er überlege, ob er in eine Toasterfabrik investieren solle?
Für die Vorschau brauchte ich dann länger, als ich gedacht hatte – vier oder fünf Tage waren es wohl, aber nur, weil ich so gründlich zu Werke ging. Ich wollte Born mit meiner Sorgfalt beeindrucken und arbeitete daher nicht nur Programme für den Inhalt jeder einzelnen Nummer aus (Gedichte, Prosa, Essays, Interviews, Übersetzungen und dazu jeweils am Ende eine Abteilung für Besprechungen von Büchern, Filmen, Musik und bildender Kunst), sondern stellte auch einen detaillierten Finanzplan auf: Druckkosten, Papierkosten, Bindekosten, Fragen des Vertriebs, Auflagenhöhe, Honorare der Beiträger, Einzelhandelspreis, Abonnementspreis sowie Pro und Kontra Aufnahme von Anzeigen. Das alles erforderte Zeit und Recherchen, Anrufe bei Druckern und Bindern, Gespräche mit Herausgebern anderer Zeitschriften und von mir selbst eine neue Art zu denken, da ich mich bis dahin noch nie mit kommerziellen Dingen beschäftigt hatte. Was den Namen der Zeitschrift betraf, notierte ich eine Reihe verschiedener Titel und gedachte die Entscheidung Born zu überlassen, aber mir selbst gefiel am besten Stylus – zu Ehren Poes, der nicht lange vor seinem Tod eine Zeitschrift mit diesem Namen einzuführen versucht hatte.
Diesmal reagierte Born binnen vierundzwanzig Stunden. Als ich den Hörer abnahm und seine Stimme erkannte, fasste ich das als ermutigendes Zeichen auf, aber typisch für ihn rückte er nicht sogleich damit heraus, was er von meinem Plan hielt. Das wäre zu einfach gewesen, nehme ich an, zu langweilig, zu unkompliziert für einen Mann wie ihn, und so spielte er, um die Spannung zu erhöhen, zunächst einmal ein paar Minuten mit mir und stellte eine Reihe irrelevanter und zusammenhangloser Fragen, die mich davon überzeugten, dass er mich hinhielt, weil er mich nicht verletzen wollte, wenn er meinen Vorschlag ablehnte.
Ich hoffe, Sie sind bei guter Gesundheit, Mr.Walker, sagte er.
Ich glaube schon, antwortete ich. Es sei denn, ich habe mir eine Krankheit zugezogen, von der ich nichts weiß.
Aber noch keine Symptome.
Nein, ich fühle mich gut.
Was ist mit Ihrem Magen? Keine Beschwerden?
Zurzeit nicht.
Sie haben also normalen Appetit.
Ja, vollkommen normal.
Wenn ich mich recht erinnere, war Ihr Großvater ein koscherer Metzger. Halten Sie sich noch an diese alten Vorschriften, oder haben Sie das aufgegeben?
Ich habe mich überhaupt noch nie daran gehalten.
Also keine Einschränkungen, was Ihre Ernährung betrifft.
Nein. Ich esse alles, was ich will.
Fisch oder Geflügel? Rind oder Schwein? Lamm oder Kalb?
Was soll damit sein?
Was davon essen Sie am liebsten?
Ich mag das alles gern.
Mit anderen Worten, Sie sind nicht wählerisch.
Nicht, wenn es ums Essen geht. Bei anderen Dingen schon, aber nicht beim Essen.
Sie sind also offen für alles, was Margot und ich Ihnen vorsetzen.
Ich weiß nicht, ob ich Sie verstehe.
Morgen Abend um sieben Uhr. Haben Sie viel zu tun?
Nein.
Gut. Dann kommen Sie zum Abendessen zu uns. Wir sollten das feiern, meinen Sie nicht?
Ich weiß nicht. Was sollten wir feiern?
Den Stylus, mein Freund. Den Beginn von etwas, das sich hoffentlich zu einer langen und fruchtbaren Partnerschaft entwickelt.
Sie wollen das also machen?
Muss ich mich wiederholen?
Sie wollen sagen, mein Plan gefällt Ihnen?
Seien Sie nicht so begriffsstutzig, Junge. Warum sollte ich feiern wollen, wenn er mir nicht gefallen hätte?
Ich weiß noch, wie ich hin und her geschwankt bin, was ich ihnen schenken sollte – Blumen oder eine Flasche Wein–, und mich am Ende für Blumen entschieden habe. Vernünftigen Wein, mit dem ich sie hätte beeindrucken können, konnte ich mir nicht leisten, und bei genauerem Nachdenken erschien es mir geradezu als Anmaßung, ausgerechnet Franzosen mit Wein beglücken zu wollen. Hätte ich die falsche Wahl getroffen – und dafür sprach einiges–, hätte ich nur meine Ahnungslosigkeit unter Beweis gestellt, und mir lag nichts daran, mich gleich zu Beginn des Abends in Verlegenheit zu bringen. Blumen hingegen gaben mir die Möglichkeit, meinen Dank direkt an Margot zu richten, da Blumen ja immer der Dame des Hauses überreicht werden, und falls Margot Blumen mochte (was keineswegs ausgemacht war), würde sie verstehen, dass ich ihr meinen Dank dafür bekunden wollte, dass sie Born bewegt hatte, sich für mich einzusetzen. Unser Telefongespräch am Nachmittag zuvor hatte mich in eine Art Schockstarre versetzt, und als ich zur verabredeten Zeit zu ihrer Wohnung ging, war ich immer noch überwältigt von dem unwahrscheinlichen Glück, das über mich hereingebrochen war. Ich erinnere mich, dass ich zu diesem Anlass Jackett und Krawatte anzog. Es war das erste Mal seit Monaten, dass ich mich feinmachte, und so schritt ich dann, Mr.Wichtig persönlich, mit einem riesigen Blumenstrauß in der Rechten über den Campus der Columbia, um mit meinem Verleger zu speisen und über Geschäfte zu reden.
Er hatte die Wohnung von einem Professor gemietet, der für ein Jahr auf Forschungsurlaub war, mehrere geräumige, aber mit viel zu vielen Möbeln vollgestopfte Zimmer in einem Gebäude am Morningside Drive nicht weit von der 116th Street. Ich glaube, die Wohnung lag im zweiten Stock, und die großen Fenster an der Ostseite des Wohnzimmers boten Aussicht auf die weite abfallende Fläche des Morningside Parks und die Lichter von Spanish Harlem dahinter. Margot öffnete mir die Tür, als ich klopfte; ihr Gesicht und das Lächeln, das über ihre Lippen zuckte, als ich ihr den Strauß überreichte, sehe ich immer noch vor mir, aber was sie anhatte, weiß ich nicht mehr. Vielleicht wieder etwas Schwarzes, aber ich glaube, eher nicht, da ich mich undeutlich an ein Gefühl der Überraschung erinnere, was darauf hindeutet, dass sie mir anders gekleidet als bei unserer ersten Begegnung entgegentrat. Noch auf der Schwelle, bevor sie mich in die Wohnung bat, erklärte Margot mir mit leiser Stimme, Rudolf habe schlechte Laune. Bei ihm zu Hause sei etwas passiert, er werde morgen nach Paris fliegen und frühestens nächste Woche wieder zurückkommen. Er sei gerade im Schlafzimmer, fügte sie hinzu, und telefoniere mit Air France, um den Flug zu buchen, und das könnte noch ein paar Minuten dauern.
Als ich die Wohnung betrat, fiel mir sofort der Essensgeruch aus der Küche auf – ein wunderbarer, köstlicher Duft, so verführerisch und aromatisch, wie nur je etwas mir in die Nase gedrungen war. Die Küche war dann auch unser erstes Ziel – um eine Vase für die Blumen aufzustöbern–, und als ich einen Blick auf den Herd warf, sah ich den großen zugedeckten Topf, der die Quelle dieses außerordentlichen Wohlgeruchs war.
Ich habe keine Ahnung, was dadrin ist, sagte ich und wies auf den Topf, aber wenn meine Nase mich nicht täuscht, werden heute Abend drei Menschen sehr glücklich sein.
Rudolf meinte, Sie mögen Lamm, sagte sie, also habe ich mich für navarin entschieden – ein Ragout aus Lamm, Kartoffeln und navets.
Rüben.
Ich kann mir dieses Wort einfach nicht merken. Es klingt so hässlich, es tut mir richtig weh, das auszusprechen.
Also gut. Dann streichen wir es aus unserem Wortschatz.
Margot schien an meiner kleinen Bemerkung Freude zu haben – jedenfalls schenkte sie mir wieder einmal ein knappes Lächeln und wandte sich dann den Blumen zu: legte sie in die Spüle, entfernte das weiße Einwickelpapier, nahm eine Vase aus dem Schrank, beschnitt die Stiele mit einer Schere, stellte die Blumen in die Vase und füllte die Vase mit Wasser. Keiner von uns sagte ein Wort, während sie sich diesen kleinen Dingen widmete, aber ich sah ihr genau zu und staunte, wie bedächtig und methodisch sie zu Werke ging, als sei das Einstellen von Blumen in eine Vase eine höchst komplizierte Aufgabe, die nur mit äußerster Sorgfalt und Konzentration zu bewältigen war.