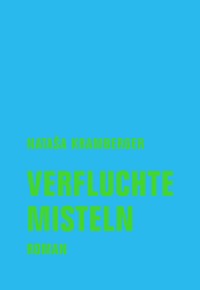
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Während Tausende junge Menschen auf der Suche nach neuen Möglichkeiten in Städte ziehen, kehrt die Erzählerin, die als Autorin und Journalistin arbeitet, aus dem Ausland in ihr Heimatdorf zurück. Von einem Tag auf den anderen entscheidet sie sich, den Hof ihrer Mutter zu übernehmen und diesen unter Nutzung althergebrachter Methoden des ökologischen Landbaus zu retten. Hin- und hergerissen zwischen der ach so kosmopolitischen Metropole Berlin und dem scheinbar altmodischen, traditionellen slowenischen Landleben beginnt die Erzählerin allmählich, ihre Annahmen und Vorstellungen zu hinterfragen. Im Dorf lachen alle über ihre neue Berufswahl. Selbst ihre Großmutter zweifelt daran, dass sie dem Job gewachsen ist. Doch mit der Zeit lernt die Erzählerin, mit allen möglichen Herausforderungen – die mitunter sprachlichen Untiefen der staatlichen Bürokratie, der Kauf von Landwirtschaftsmaschinen, Unwägbarkeiten des Wetters und der Natur und die Folgen des Klimawandels – auf ihre eigene Art und Weise umzugehen. Humorvoll und mit poetischer Raffinesse hinterfragt Nataša Kramberger in ihrem Roman die vermeintlichen Widersprüche – körperliche und geistige Arbeit, archaisches Land und die moderne Urbanität, nachhaltige und herkömmliche Landwirtschaft – und erforscht kritisch und selbstironisch die Rollenbilder, die beide Lebenswelten prägen, den Sexismus und die Skepsis, denen sich die Erzählerin ausgesetzt sieht, und nicht zuletzt die Beziehung zwischen Mensch und Natur. In Slowenien wurde der Roman auch von der Bewegung "Fridays for Future" sehr breit aufgenommen, die Autorin nahm aktiv an Klimastreiks teil und las im Rahmen dieser Auszüge aus ihrem Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Während Tausende junge Menschen in Städte ziehen, kehrt die Erzählerin, die als Autorin und Journalistin arbeitet, aus dem Ausland in ihr Heimatdorf zurück. Von einem Tag auf den anderen entscheidet sie sich, den Hof ihrer Mutter zu übernehmen und diesen unter Nutzung althergebrachter Methoden des ökologischen Landbaus zu retten. Im Dorf lachen alle über ihre neue Berufswahl. Selbst ihre Großmutter zweifelt daran, dass sie dem Job gewachsen ist. Doch mit der Zeit lernt die Erzählerin, mit allen möglichen Herausforderungen – die mitunter sprachlichen Untiefen der staatlichen Bürokratie, der Kauf von Landwirtschaftsmaschinen, Unwägbarkeiten des Wetters und der Natur und die Folgen des Klimawandels – auf ihre eigene Art und Weise umzugehen.
Humorvoll und mit poetischer Raffinesse hinterfragt Nataša Kramberger in ihrem Roman die vermeintlichen Widersprüche – körperliche und geistige Arbeit, archaisches Land und die moderne Urbanität, nachhaltige und herkömmliche Landwirtschaft – und erforscht kritisch und selbstironisch die Rollenbilder, die beide Lebenswelten prägen, den Sexismus und die Skepsis, denen sich die Erzählerin ausgesetzt sieht, und nicht zuletzt die Beziehung zwischen Mensch und Natur.
Nataša Kramberger, geboren 1983, ist Schriftstellerin, Kolumnistin und Öko-Landwirtin. Sie schreibt für Zeitungen und Zeitschriften Essays, Reportagen und Kommentare. Für ihren Romandebüt »Nebesa v robidah« (2007) erhielt sie 2010 den Preis der Europäischen Union für Literatur (EUPL). 2011 veröffentlichte sie »Kaki vojaki« (mit Jana Kocjan), 2014 einen Essayband »Brez zidu« und 2016 »Tujčice«. »Verfluchte Misteln« ist auf Slowenisch unter dem Titel »Primerljivi hektarji« 2018 erschienen. Im Sommer lebt sie in Jurovski Dol, Slowenien, und betreibt mit dem Öko-Kunstkollektiv Zelena Centrala einen kleinen biodynamischen Bauernhof. Im Winter lebt sie in Berlin, wo sie den slowenisch-deutschen Kulturverein Periskop leitet. Sie spricht Slowenisch, Englisch, Italienisch und Deutsch.
NATAŠA KRAMBERGER
VERFLUCHTEMISTELN
ROMAN
Aus dem Slowenischenvon Liza Linde
Diese Ausgabe wurde durch die
Slowenische Buchagentur ermöglicht.
Erste Auflage
Verbrecher Verlag Berlin 2021
www.verbrecherei.de
© Verbrecher Verlag 2021
Titel der slowenischen Originalausgabe »Primerljivi hektarji«
© Nataša Kramberger in LUD Literatura, 2017
Satz: Christian Walter
ISBN 978-3-95732-493-1eISBN 978-3-95732-507-5
Der Verlag dankt Antonia Lesch, Maria Müller,
Luisa Stühlmeyer und Johanna Seyfried.
Für Autodidaktinnen,
für Autodidakten,
für Landwirtinnen,
für Landwirte,
für Dichterinnen,
für Dichter,
für Rastlose,
für Engagierte,
für Vögel,
für den Untergrund,
für Geheimnisse,
für Zweifel,
für die Erde,
für die Hände,
für den Kampf,
für die Freiheit,
für das Brot,
für das Wasser,
für meine Mutter,
für meine Oma,
für Tante Vesna,
für Primož und Tomi,
für meinen Vater,
für Simona und Rado,
für den Wein,
für die Mädchen und Jungen von Zelena,
für gute Nachbarn,
für meine Armee,
für unser Feld,
für die Liebe,
für Nick und für Nina.
Inhalt
OKTOBER
Bauern müssen arbeiten
NOVEMBER
Anfängerglück
DEZEMBER
Sag’s dem Kind
JANUAR
Wie den Baum erklären
FEBRUAR
Du musst fallen
MÄRZ
Die Spur hinter dem Leben
APRIL
Windstille unter dem Mondschein
MAI
Die Frucht auf der Zunge
JUNI
Die Zeit hat keinen Raum
JULI
Auf wessen Seite die Hornisse ist
AUGUST
Betrug
SEPTEMBER
Das können wir nicht vergleichen
OKTOBER
Bauern müssen arbeiten
Mein Bruder und ich sind ein Bagger, mein Bruder und ich sind der Mannschaftsgeist.
»Buddeln! Schaufeln! Festdrücken!«
Mein Bruder buddelt, schaufelt, drückt fest.
»Buddeln! Schaufeln! Festdrücken!«
Ich buddle, schaufle, drücke fest.
Unsere Geschwisterlichkeit ist die Einheit und unsere Kameradschaft der Wahnsinn.
»Mensch, was für ein Lehm!«
Ich gebe Gas. Kann keinen klaren Gedanken fassen.
»Mehr Erde!«
Auch mein Bruder gibt Gas. Das ist das pure Glück.
»Mach!«
Viele Kämpfe wurden verloren, weil Menschen in ihrem Wahnsinn keine Gefährten hatten.
»Mach schon!«
Falsch. Viele Kämpfe wurden verloren, weil Menschen Gefährten von Wahnsinnigen waren.
»Du bist dran!«
Die Sonne droht hinterm Wald zu verschwinden, und auf uns warten noch acht Bäume.
»Ich spür den Arsch nicht mehr«, seufze ich.
»Du hast doch gar keinen«, lacht mein Bruder.
Wir buddeln, schaufeln, drücken fest und brechen in Lachen aus.
»Auch die Oberschenkel spüre ich nicht mehr.«
»Dafür spürst du sie morgen doppelt.«
Unsere Arme und Beine sind Teil der Mechanisierung, die Landschaft ist das Fließband. Das Verfahren optimiert und perfektioniert.
»Das ist schlimmer als arbeiten gehen!«
Wir laufen auf Hochtouren, und wir sind viele.
Erst das Loch. Buddeln. Dann die Steine. Schaufeln. Ein bisschen Erde. Festdrücken. Pflaume und Pfahl. Kompost. Die Schubkarre ist leer. Wie, leer? Tja, so halt: leer. Du bist dran! Mein Bruder holt Kompost, ich rein ins Loch. Wurzeln. Weiche Härchen. Ein bisschen Erde. Ein bisschen weißes Pulver. Was ist das, Pfeffer? Zeolith. Was? Vulkangestein. Muss das sein? Ja. Weil? Weil halt. Weil du spinnst? Das Universum spinnt. Haha, du spinnst! Da, der Kompost. Schaufeln! Ich schaufle, schütte zu, schütte auf, schnüre fest. Festdrücken! Ich drücke, drücke nieder, drücke durch, drücke fest. Buddeln! Ich scharre, verscharre, scharre zusammen, scharre zu. Mach! Kann keinen klaren Gedanken fassen. Mach schon! Blaukraut bleibt Blaukraut, Brautkleid bleibt Brautkleid, Bäumchen bekommen Bleiben. Wasser?! Die Gießkannen sind leer. Aaah! Ich hol Wasser, mein Bruder: »Das Universum spinnt, haha!« Bäumchen und Pfahl. Zwei Kreuzknoten. Ist das gerade? Nicht gerade. Jetzt schon? Wasser. Gegossen. Festgedrückt. Angebunden. Fertig!
Noch sieben.
»Scheiße, ich seh nichts mehr.«
»Wir haben doch Taschenlampen.«
»Hör auf! Wo denn?«
»So viel zur Mechanisierung, haha. Oben.«
»Oben heißt: oben beim Kompost?«
»Du kannst meine Gedanken lesen.«
Mein Bruder und ich sind der Mannschaftsgeist.
»Das sagst du mir jetzt?! Vor einer Minute erst war ich dort.«
»Ähm …«
Unsere Geschwisterlichkeit ist die Einheit.
»… vor einer Minute war es noch hell!«
Unsere Kameradschaft ist der Wahnsinn.
»Das ist nicht normal.«
»Hä?«
»Mit der Taschenlampe Pflaumen pflanzen! Das ist nicht normal.«
Mein Bruder schnaubt und faucht und verschwindet hinter dem Hügel, und ich weiß nicht, womit man das entschuldigen könnte. Es ist dunkel, und ich kann nicht nachdenken.
»Des pflichtbewussten Gutsherrn Regel Nummer eins!«, rufe ich, als mir endlich etwas einfällt.
»Häää?!«, tönt es von weit weg, von sehr, sehr, sehr weit weg, mein Bruder ist in der Dunkelheit versunken. Ich strenge meine Augen an, als würde das etwas bringen. Am Hang schürt jemand das Feuer. Wir werden Kastanien rösten, überlege ich.
»Des pflichtbewussten Gutsherrn Regel Nummer eins!«, rufe ich noch einmal aus Angst, der schwer erlangte Einfall wäre umsonst gewesen. »Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf mooooo …«
Vor Übermut vergesse ich das frisch ausgegrabene Loch, verliere das Gleichgewicht und lande majestätisch auf dem Hintern. Den Hintern gibt es nicht, also spüre ich ihn auch nicht. Es tut nicht weh. Ich bleibe liegen: halb in der Vertikalen, halb in der Horizontalen. Die Beine im Loch, der Oberkörper auf dem Hügel.
Auf einen Schlag kommt die Kälte das Tal heruntergekrochen. Die Dunkelheit schluckt alle Geräusche. Es gibt keine Landschaft. Keine Arme und Beine. Keine Pflaumen, geschweige denn Alleen. Nur mich und den Sternenhimmel, oh, kein Sternenhimmel: Stille. Der Herbst ist schon fast Winter. Ich strecke die Arme aus. Er ist da. Der Schmerz ist da. Hinterlistig kriecht er aus den schweren schlammigen Stiefeln in die ungelenken schlammigen Hüften, in die kraftlosen schlammigen Arme und von dort in die Strähnen, die am Morgen noch Haare waren, die jetzt nicht mehr von den schlammigen Grasbüscheln zu lösen sind. Im Oktober ist die Erde kalt, wenn man auf ihr liegt. Dann beißt der Wolf dir in den Po. Wer? Der Wolf. Dann bist du selbst schuld, wenn sich alles entzündet, mindestens die Eierstöcke und die Blase. Die Dunkelheit ist dicht. Der Mond ist schwach. Jimi! Jimi ist schwarz wie die Nacht. Jimi, oh, du Rumtreiber. Ich kann ihn in der Dunkelheit hören, wie er zwischen den jungen Pflaumen nach Mäusen sucht. Wo ist jetzt das Feuer? Wo ist mein Bruder? Der schwere, brennende Schmerz zieht aus den Waden in die Oberschenkel, durchs Becken in die Rippen, ach, komm, steh schon auf! Wenn wir fertig sind, essen wir Kastanien. Jimi! Jimi, der Arme, springt auf seinen Posten. Er legt sich mir in den Schoß und fängt sofort an zu schnurren.
»Ich kann nicht mehr!«, seufzt jemand, und in der Dunkelheit lässt sich nicht ausmachen, aus welcher Richtung das kam.
Aus der unsichtbaren Landschaft taucht eine Hand auf, mein Bruder: »Legt euch in die Riemen, Taugenichtse! Die Schaufel ruft!«
Noch sieben.
Als ich in jenem Mai von der Buchmesse in Turin kam und meiner Großmutter verkündete, ich würde den Bauernhof meiner Mutter übernehmen, musste sie sich am Stuhl festhalten. Dann drehte sie sich einmal um ihre eigene Achse und hielt sich am Küchenschrank fest. Sie stöberte ein bisschen in der Schublade herum, im Schrank, im Holzherd, sah nach, ob sie vielleicht anheizen sollte, drehte sich wieder um, hielt sich wieder am Stuhl fest, setzte sich, legte die Hände auf den Tisch, auf die neueste italienische Übersetzung meines ersten Romans, die ich wie eine Trophäe aus Turin mitgebracht hatte, blickte auf und durch mich hindurch und sagte: »Aber Bauern müssen doch arbeiten.«
Man müsste anständig erzählen können, was danach mit mir passierte. Nicht äußerlich. Innerlich. Ich schmeichle mich beim Gedächtnis ein, damit es die Ereignisse mit seiner Schicht aus Patina und Distanz zusammenlegt; ich nähe die Risse, falze die Ränder, bügle, würde meine Großmutter sagen, doch alles, was zum Vorschein kommt, ist Larifari.
Man müsste anständig erzählen können: Durch das Ausgesprochene hatte sich ein Klumpen gelöst und das Haus und den Schutzwall niedergewalzt. Nein. Noch anständiger: Er hatte alle Schutzwälle niedergewalzt.
Jemand brach in Lachen aus. Im unzugänglichen Winkel des Bildes sehe ich, wie ich die Hände vors Gesicht hebe und theatralisch mit den Fingern tanze, wie ich vor mich hinplappere, die ganze Zeit ausführlich plappere, wie ich die Augenbrauen runzle und mich zu einem ungläubigen, komischen, beschädigten Fragezeichen verbiege. Meine Großmutter fuchtelt drohend mit dem Zeigefinger und sagt nichts, sie sagt nicht: Lach du nur, ich meine das ernst. Aber sieh nur, schon geht mir die Puste aus, schon begreife ich die Lage, schon sehe ich ein, dass die Frau vor mir, meine Großmutter, meine einzig noch lebende Oma, präzise und schonungslos von Angesicht zu Angesicht ihre – und nicht meine – Jahre zählt, beginnend mit dem Jahr Null, immer alles vom Jahr Null aus, sie die Jahre auf ihre eigene unbeugsame Art und gar nicht verbittert deutet; sie legt die Jahre wie Karten fürs Schnapsen in ihrer sauberen Küche auf den Tisch.
In unserer Familie gab es eine Zeit, in der wir in dieser Küche, an diesem Tisch, in langen Wiederholungen Viererschnapsen spielten. Onkel und Tante und Großmutter und Großvater und manchmal Mutter und manchmal Vater und manchmal zur Reserve ein Spieler, der zufällig zu Besuch war, suchten Abend für Abend Geheimnisse einer Partie, die etwas wert wäre, und schlossen dafür bedingungslose Bündnisse, zwei gegen zwei, und zählten anschließend in spannenden Runden leidenschaftlich, fast manisch die gespielten und noch im Ärmel versteckten Trümpfe. Die ganze Küche, das ganze Haus, das Brennholz im Holzherd, der Tee auf dem Feuer, die Enkel, die Urenkel, die Bilder der Vorfahren und der Feuerwehrkalender: für ein gutes Spiel brauchte man einen guten Spielgenossen und mit ihm ein für immer geheimes Wörterbuch heimlicher Gesten. Darin war der Wortschatz erklärt, den die Spielverbündeten mit den Bewegungen ihrer Köpfe, Hände, Schultern, mit Tritten unter dem Tisch und mit Blicken in die Luft schrieben. Man musste in der Lage sein, jede unausgesprochene Silbe lesen zu können, jedes noch so kleine Augenzwinkern bemerken und dann alle Signale, die man aufschnappte, in das Blatt übersetzen, das man vor sich hielt.
»Aber Bauern müssen doch arbeiten.«
Schnapsen ist ein Spiel, bei dem an jeder Tischseite ein Spieler sitzt, weit voneinander entfernt, an jeder Flanke ein Spion, ein Gegner. Vor den Spionen muss man die Karten verstecken und noch mehr den Körper. Das Mundwerk ist dabei das beste Mittel zur Täuschung. Deshalb reden die Kartenspieler, sie reden viel, sie erzählen, die ganze Zeit erzählen sie was, am häufigsten witzige gemeinsame Erinnerungen, die wie Lava durch die Küche spritzen, wie Vulkangestein in den Ecken aushärten, als lebendige Erde, aus der beim nächsten Regen Stühle, Tisch, Herd und täglich Brot wachsen. So zaubern die Spieler, die Schurken für den Hausgebrauch, aus verstreuten Erinnerungen Wahrheit und formen aus wilder, chaotischer Materie, die sich jahrelang eigensinnig in der Küche angehäuft hat, vergangene Tapferkeit und zukünftigen Heldenmut. Denn alles Gesehene, alles Erlebte und alles Gehörte, alles Ausgesprochene sagt unumgänglich den Lebenslauf voraus: Die Spieler lavieren zwischen den Erzählungen und den günstigen Karten, und wenn im warmen Holzherd die Mitternacht auflodert, ist im heißen Tee Schnaps, der nach Pflaumen riecht, und in den Köpfen fruchtbarer Nebel, mythologischer Humus, der alle Geheimnisse mischt, alle Schicksale verbindet und jede noch so kleine Gewissheit in Dunst verwandelt. Das ist der Moment, in dem in stürmischen Sätzen Kinder gezeugt werden, in dem ihr Grundwesen in Worte gefasst wird, die Spieler sich durch lange Reden in Geburtsfeen in sterblichen Körpern verwandeln, beim Holzherd die wahrhaftigen Geschenke ablegen, eine unauslöschbare Spur. Was sein soll, wird zunächst als erlebte Erinnerung ausgesprochen. Dann wird es wiederholt und wiederholt, vermengt und geknetet, modelliert, abgekocht, abgekühlt und eingelegt, Runde für Runde, Abend für Abend, so lange, so lange, bis es eines Tages zur Wahrheit wird und aus der Wahrheit: Zukunft.
Und so geschah es, dass ein Kind geboren wurde und die Geburtsfeen am Spieltisch das Mädchen mit ihren wundersamen Prophezeiungsgeschenken bescherten. Die Erste mit der Wahrheit über das Wort, die Zweite mit der Wahrheit über das Lied, die Dritte mit der Wahrheit über das Fernglas, die Vierte …
»Aber Bauern müssen doch arbeiten.«
Da war dieses Ferkel, rosa und hilflos, so rosa und hilflos wie alle Ferkel, die gerade erst geboren sind. Die Muttersau, die dreizehn Ferkel zur Welt gebracht hatte, war dick und ungelenk, denn die Schweinchen, die kleinen rosa Wutzis, hingen Tag und Nacht an ihren Zitzen, nuckelten und wuchsen, bis sie schwer wie Kühe waren. »Oooh, du arme Sau, dreizehn Wutzis, schwer wie Kühe!«
Man müsste anständig erzählen können, aus wessen Lava diese Erde zusammengesetzt ist, aber es ist unmöglich; alles, was wir haben, ist unantastbares Sediment. Ich sehe: die graublaue Weidenallee unten bei der Quelle, die frische Wiese, die blauen Kirschpflaumen, deren runde Baumkronen, meine Großmutter, die in einem roten Rock mit einer Harke die Erde um die Kartoffeln auflockert. Ich sitze auf einer gestrickten Decke und trinke Lindenblütentee, viel Lindenblütentee, so viel, dass meine Großmutter ihn mir aus dem geheimen Vorrat im Flechtkorb nachgießen muss. Der geheime Vorrat ist in Bierflaschen, drei oder vier, und ich fordere mit dem wichtigsten Wort, aus dem meine kleine Welt besteht: Schnulli.
»Was so ein Lindenblütentee nicht alles schafft! Von der Geburt bis zur Einschulung nicht einmal krank!« Großmutter packt die Harke und die Decke und den Korb zusammen, und ich krabble ihr in immer größerer Entfernung hinterher, wir gehen und krabbeln vorbei an den niedrigen Kirschpflaumenbäumen, vorbei an deren runden Baumkronen, das süße Gras an dem langen Kartoffelfeld wird laufend gemäht, denn Oma füttert die Muttersau, die dreizehn Wutzis geworfen hat, die jetzt wie Kühe an ihren Zitzen hängen, die arme Sau, die oberknatschig ist. Großmutter trägt einen roten Rock und darüber eine gescheckte Schürze. Bevor sie in den Stall tritt, sieht sie sich zu mir um und sagt: »Kommst du?«
Dann passiert alles durcheinander. Der Hund Luka bellt, ich krabble, Großmutter verschwindet im Schweinestall, dort ist ein Krawall, ein entsetzlicher Krawall, ein Wesen quiekt, ein Wesen grunzt, meine Großmutter brüllt in ihrer geheimen Mischung aus Sorge und Wut, ich bin noch zu klein, überhaupt etwas auszusprechen, mir etwas einfallen zu lassen, aber jetzt geht es ums Überleben und um die dicke Muttersau, die vergessen hat, ihre Kinder durchzuzählen, so dass sie sich in ihrer Unachtsamkeit mit ihrem schweren Leib auf eins gelegt hat, oooh, »Sie hat sich auf ein Ferkel gelegt!«, das arme Ferkel, rosa und hilflos, sie hat ihm ein Kläuchen zerquetscht. Das verkrüppelte Wesen blieb mit herzerschütterndem Quieken liegen, »Schnulli, Schnulli, Schnulli!« Als ich endlich zu Großmutter gekrabbelt war, stellte sie schon eine Trennwand aus Holz auf und machte aus einem Schweinestall zwei.
Schnulli. Das kleine Wort aus der kindlichen Welt wurde zu Leben. Vier Monate musste das arme Ferkel im getrennten Stall genesen, und gewiss wäre es vor Traurigkeit und Einsamkeit gestorben, hätte ihm nicht das zweijährige, vielleicht gerade mal dreijährige Kind Gesellschaft geleistet, das ihm das Fläschchen mit Milch und Grieß brachte.
»Du hast auf dem Klee im Stall gesessen und das Ferkel hat auf deinem Rock gelegen und du hast mit ihm geschmust wie mit einem Püppchen. Wutzi Schnulli, hast du gesagt, Wutzi Schnulli.«
Das war die Wahrheit über das Wort, und sie machte mich zur Ferkelamme.
Doch da gab es noch mehr. Es gab Nachmittage voller Gesang. Vor dem Hauseingang Zierspargel, rote Kletterrosen und Katzen in der Sonne. Da waren Hühner, nickende und unüberlegte, so nickend und unüberlegt wie alle Hühner, die durch die Welt gackern; mal zum Maulwurfshaufen, mal zur Pergola, ein andermal auf den Misthaufen. Sie scharrten im Gras und in den Blumen und legten ihre Eier in den unzugänglichsten Vordächern und Ecken, so dass wir sie morgens wie blinde Mäuse suchten und immer eins übersahen. So reifte das unentdeckte Ei in aller Ruhe irgendwo unter vergessenem Stroh und wuchs zu einem unbefruchteten faulen Ei heran, das teuflisch stank und zu nichts zu gebrauchen war.
»Ooooh, ein faules Ei, stinkt teuflisch, ist zu nichts zu gebrauchen!«
Man müsste anständig erzählen können, welche Karten diese Erinnerung verdeckt, aber es ist unmöglich; alles, was wir hier haben, ist ein ausgereifter Mythos. Ich sehe: das Haus im Sommer, davor die schattigen Spillinge, groß und buschig, darunter der Tisch, in den Boden gerammt, und zwei niedrige Bänke ohne Rückenlehnen. Mein Großvater döst bei einem Gläschen, auf der Bank liegt seine Mütze, auf dem Gläschen spazieren seelenruhig ein paar Fliegen. Ich sitze auf der gestrickten Decke und singe leise ein gerade gelerntes Lied vor mich hin: »Guten Morgen, guten Morgen, Herr Bischof, und ausgerechnet am morgigen Tag noch.« »Einmal gehört und schon kann sie es singen! Eine geborene Solistin!« Großvater springt in die Luft, als hätte ihn eine Hornisse gestochen, und schreit auf und läuft los und ich ihm barfuß und zerzaust und klein hinterher, wir laufen und schreien, er vor, ich ihm hinterher, am Hauseingang mit dem Zierspargel vorbei, vorbei an den roten Kletterrosen, an den Katzen in der Sonne und an den Pflaumen – die spitzen Spillinge machen den Schnaps kräftiger, die runden blauen Kirschpflaumen geben ihm den Geschmack, wichtig sind die richtige Mischung und ein Kupferkessel, die dicken Pflaumen im Garten aber sind nicht für den Schnaps, sondern für die Marmelade. Großvater rennt mit der Leinenmütze und den Hornissen im Hintern zum Stall, zum Feld, mit einem Lächeln im Gesicht. Bevor er um die Ecke verschwindet, bleibt er stehen, sieht in meine Richtung und ruft: »Komm!«
Dort, wo letztes Jahr Kartoffeln wuchsen, wogt jetzt der Weizen. Was folgt, ist ein einziges Lied. Ja, meine Frau ist gestorben, Herr Bischof, sie muss begraben werden, Herr Bischof, auf dem Friedhof hinter der Mauer, Herr Bischof, und ausgerechnet am morgigen Tag noch. Mein Großvater ist der Bischof und dirigiert, ich bin der Witwer und singe, beide sind wir rot, denn wir geben alles für den Auftritt, was wir in den Lungen und im Hals finden, dazu klatschen wir und hüpfen und fuchteln und stampfen mit dem Fuß auf den Boden: für den Takt.
»Lauter! Dem Hahn hinterher! Noch lauter! Noch lebhafter!«
Wir spielten Fußball auf dem Friedhof in Celje, auf dem Friedhof in Celje, ein Totenschädel war der Ball, der Ball, das schönste Skelett der Schiedsrichter, der Schiedsrichter, im Tor stand sein älterer Bruder, sein älterer Bruder, der Torwaaaart!
Husch! Husch! Husch! Das gerade gelernte Lied wurde zur Vogelscheuche. Den ganzen Juli lang entwischten die Hühner zwischen die Weizenähren und gewiss wäre das Feld so verwüstet gewesen wie am Tag des Jüngsten Gerichts, hätte nicht ein dreijähriges, vielleicht gerade mal vierjähriges Kind es bewacht, das den diebischen Hühnern hinterherlief und sie mit einem Lied über Friedhöfe und Bischöfe verscheuchte, während Großvater, der Totengräber, dirigierte.
»Von einem Ende des Felds zum anderen bist du gelaufen und hast Lieder gesungen, und die Hühner haben beinahe fliegend Reißaus genommen. Aber was war erst los, als du den Walkman für deine Kassetten bekommen hast! Den Kassettenrekorder um die Hüfte, die Kopfhörer um den Hals, volle Lautstärke und marsch! Ticke ticke Tatzen, drei grüne Katzen, Metka, Metka, Knödel, ene, mene, meck und du bist weg.«
Das war die Wahrheit über das Lied, und sie machte mich zur Hühnerhirtin.
Würden wir jetzt jemandem erzählen, dass wir Herbste erlebt haben, in denen wir das Maisstroh fürs Kuhfutter und Einstreu mit bloßen Händen in aufrechte Diemen stellten, die an Indianerzelte aus Western-Filmen erinnerten, er würde uns anglotzen wie ein Auto. Sind wir Menschen oder nicht, wofür haben wir denn Maschinen? Vergleich das ruhig, Mensch, eins, zwei, drei, und die Maschine schneidet dir das ganze Maisfeld zur Silage, und jetzt vergleich das mal, eins, zwei, drei, von Hand ernten, von Hand bündeln, von Hand aufschichten, und dabei piekst das Maisstroh, dass man mit Pusteln übersät ist wie ein Leprakranker.
»Oooh, dieses Maisstroh! Ernten, bündeln, aufschichten, mit Pusteln übersät wie ein Leprakranker!«
Man müsste anständig erzählen können, wie viel Zucker und wie viel Schnaps in diesen Tee gegossen wurden, aber es ist unmöglich; alles, was wir hier haben, ist ein süßliches Sekret von Mund zu Mund. Ich sehe: den Frühherbst, nass und frisch, der Hügel beim Stall erinnert an eine Zeltsiedlung in der Prärie. Tante Vesnas Wangen glühen vor Kälte, im dicken Strickpulli hüpft sie vor dem Haus herum, in den Händen hält sie ein Kätzchen, das miaut. Mein Zelt knistert und raschelt, und ein bisschen piekst es auch. Ich sitze ganz in der Mitte, zwischen den Maisstängeln zusammengekauert. Niemand kann mich sehen. Niemand weiß, dass ich hier bin. Die trockenen Maisblätter flattern wie Siegesfahnen im Wind.
»Was für Puppen! Da waren keine Puppen! Ihr habt mit Katzen gespielt und mit dem Feldstecher!« Tante Vesna hüpft verschwörerisch und drückt das Kätzchen fest an sich, sie trägt rote Gummistiefel, und jedes Mal, wenn sie aufspringt, flattern zwei gelbe Zöpfe hinter ihr durch die Luft. Das Kätzchen miaut, der Mais raschelt, von der Pergola fallen orangefarbene Blätter, Oma hackt Holz, der Hund Luka pinkelt, von der Kapelle fährt ein Auto hoch, niemand weiß, dass ich hier bin, außer Tante Vesna, die verschwörerisch herumhüpft, und schon ist sie bei mir, in der Prärie. Ihr Gang ist ausgelassen, ihre Wangen glühen vor Kälte, die gelben Zöpfe flattern, im aufgeladenen Rhythmus ihres Hüpfens fällt ihr der verschwitzte kindliche Pony ins Gesicht. Das Kätzchen windet sich aus ihrem Griff und landet fauchend auf dem Boden. Breitbeinig bleibt Tante Vesna vor dem Eingang ihres Maisverstecks stehen. Bevor sie reinschlüpft, sieht sie in meine Richtung und sagt: »Kommst du?«
Dann passiert alles durcheinander. Ich laufe aus meinem Zelt in ihres, und wir quetschen uns ganz, ganz eng hinein in die geheime Stängelhöhle. Unter ihrem Strickpulli zieht Tante Vesna triumphierend ein großes Messingfernglas hervor, Großvaters Feldstecher, unter den Maishalmen wird es warm und gemütlich und stickig, und schon setzen wir uns den Feldstecher auf die Nase und machen ein Loch in die Maisstängel, um rausgucken zu können. Nichts. Warum ist es so neblig? Du musst die Schärfe einstellen! Hä?! Schärfe! Tante Vesna dreht an einem Rädchen am Feldstecher und schon kann man besser sehen, viel besser, von der Kapelle fährt ein Bus hoch, auf dem Platz spielen Čili und Štef und Črnčec und – wer ist das mit dem Schnurrbart? – in Trikots Fußball, über den Himmel fliegt ein Flugzeug aus Afrika nach Amerika, dicht über dem Hügel fliegt ein Bussard.
»Oh je! Die Kühe fliegen! Die Kühe fliegen!« Auf die Beine, auf, auf, raus aus dem Zelt. »Raus! Spring raus! Raaaaaus!«
Jetzt können wir sie auch mit dem bloßen Auge sehen, die Kühe rennen vom Hang am Haus vorbei Richtung Stall, zu uns, und Opa in weiter, weiter Entfernung ihnen hinterher, scheinbar hat der Bussard am Himmel sie erschreckt, oder es ist nur eine Marotte der Kühe, dass sie wie verrückt losrennen, gleich, gleich sind sie hier und hinter ihnen in weiter Entfernung Opa, der vergessen hat, den Draht über die Schotterstraße zu spannen, die am Stall vorbei zur Hauptstraße führt, »Schnapp dir den Draht! Schnapp dir den Draht! Die Kühe fliegen!«, Oma brüllt und winkt mit der Axt so, dass sie sie vor Übermut in die Luft schleudert, aber das ist wirklich unnötig, keine Panik, kein Problem, Tante Vesna und ich sind schon längst auf unserem Posten.
Der Feldstecher. Ein verbotenes Spielzeug wird zum Hauptdarsteller. Großvater schmollte den ganzen Abend vor Wut, und Großmutter wusste nicht, wem sie Recht geben sollte, die Kühe sind schließlich wie verrückt von der Weide zum Stall angeflogen gekommen und bestimmt hätte es sie direkt auf die Landstraße getrieben, hätte nicht ein vierjähriges, vielleicht gerade mal fünfjähriges Kind, das mit Großvaters Fernglas und Tante Vesna auf dem Grenzposten aus Maisstroh Wache gehalten hatte, sie rechtzeitig mit einem Draht über die Schotterstraße aufgehalten.
»Du bist auf dem Bett rumgehüpft und hast mit einem kleinen Plastikkamm rumgefuchtelt und Opa zog ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter, bis du sagtest, komm, Opa, ich mach dir eine Frisur, und dann war alles wieder gut und auch das entwendete Fernglas vergessen.«
Das war die Wahrheit über das Fernglas, und sie machte mich zur Kuhführerin.
»Aber Bauern müssen doch arbeiten.«
Oh Großmutter, die Schlange. Mein Oberkörper bog sich unter der plötzlichen und unbekannten Schwere, so dass ich mit einem kleinen Seufzer nach hinten glitt, irgendwo in die niedrige Rückenlehne der Eckbank, während meine Großmutter mit geradem Rücken auf ihrer Seite des Tisches saß. Mir wurde von den Unterarmen bis zu den Schulterblättern heiß und kalt. Wo ist der Schlüssel? Voller Eifer starrte ich die Frau vor mir an, ihre Hände, die mit schlichter Selbstverständlichkeit auf meinem neuen Buch lagen, ihre sanften Falten, die klare Stirn, die ernsten Augen, ich suchte nach einem Zeichen, das ihre Worte entschlüsseln würde, ich suchte nach den Kommata und den Punkten, die ihr Körper setzte, denn die Sprache muss bestimmt eine Täuschung sein, es muss eine Täuschung sein, denn was für ein Satz ist das, Bauern müssen …
»Oma, weißt du was …«
Das allmächtige Schicksal schwebte über dem Tisch und gestattete keine Widerworte. Aus allen Poren der alten Küche sickerten die Wahrheit über das Kind, die Vergangenheit des Kindes, die Zukunft des Kindes, und das Kind deutete machtlos den uralten Wortschatz, der ihn an diesen Raum band, und erahnte die Trümpfe, die ihm der Kartengeber für diese Partie zugedacht hatte.
»… ich bin ja nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Wenn ich dich erinnern darf, bin ich auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ich weiß, wie viel Arbeit man damit hat.«
Oh, Kind! Welch trügerisches, hohlbirniges, oberflächliches Getue. Ist das alles, was du vermagst?
»Du wirst es bereuen.«
»Wie bitte?«
»Du wirst es bereuen, merk dir das.«
Nein, das hatte ich nicht erwartet. Oma, die Schlange, verführte mich mit meinen eigenen Zweifeln, und mein Körper plusterte sich zu unbekanntem, kindischem Trotz auf, Sturheit.
(Gott, der Herr, sprach zu der Frau: »Was hast du getan?« Die Frau antwortete: »Die Schlange hat mich verführt. So habe ich gegessen.«)
»Du wirst es bereuen.«
(Zum Menschen sprach er: »Deinetwillen ist der Erdboden verflucht. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden wieder zurückkehrst; denn von ihm bist du genommen, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück.«)
»Wie bitte?«
(Da schickte Gott, der HERR, ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Kerubim wohnen und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten.)
»Du wirst es bereuen, merk dir das.«
Das war nicht mehr lustig. Ich lehnte meinen Unterarm gegen die Tischkante und zwang mich, tief einzuatmen. Oma, weißt du was, ich kapier’s nicht. Ich gehe doch nicht an die Front. Hey! Es ist kein Krieg. Ein paar Schulden, ja, und vielleicht ein Nachbarschaftsstreit, aber bei allem, was Recht ist … Ich wurde wütend und hätte schwören können, dass sich irgendwo Tränen anstauten. Was hatte ich erwartet? Dass sie am Holzherd auf die Knie fallen und den Herrn preisen würde? Dass sie vor Freude jubeln und vor Begeisterung in die Luft springen würde? Dort ist der Baum, hier die Schlüssel zum Paradies? Nein. Das nicht. Ich wollte, dass sie es wusste. Ich hatte mir vorgestellt, wie sie sagt: … Was? Was hätte sie sonst sagen sollen? Ihr Helden, bravo? Und Glückauf, Genossen? Sie, die das ganze Leben lang Felder bearbeitet, Wiesen gemäht, Laub gerecht und an der Quelle Wasser geholt hatte, die versteckt hatte, wen es zu verstecken galt, zu essen gegeben hatte, wem es zu essen zu geben galt, die Kinder, Enkel und Urenkel großgezogen hatte, meine Oma, die …
»Ich sage nur, was ich denke. Du kannst es halten, wie du willst.«
Halleluja.
Es dauerte Monate, bevor wir das Thema wieder ansprachen. Es war Oktober und wir hatten achtzig junge Pflaumen auf dem Bauernhof gepflanzt, blaue Kirschpflaumen und Spillinge und große, grüne Renekloden, Čačaks Beste und Bosnische Zwetschgen, gewöhnliche Hauszwetschgen und Mirabellen. Am Tag nach dem Pflanzen konnte ich vor Schmerzen im Hintern kaum stehen, doch es ging nicht anders, denn ich konnte nicht sitzen. Draußen tobte strömender Regen, der an die Apokalyptischen Reiter erinnerte. Während ich an die Regel Nummer eins des pflichtbewussten Gutsherrn und das Pflanzen mit der Taschenlampe dachte, kochte Oma auf dem Holzherd Tee. Während sie Lindenblüten in den Topf bröselte, sagte sie: »Das wird alles erfrieren.«
»Was?«
»Die Pflaumen. In diesem Tal werden sie keine Früchte tragen.«
Ich versuchte, den Kloß im Hals runterzuschlucken, aber die Tränen überwältigten mich. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Die Müdigkeit hatte sich in alle Poren gefressen. Ich drehte meiner Großmutter den Rücken zu und sah nach draußen, in den Regen. Vor dem Fenster hingen immer noch die alten Gardinen mit dem Blumenmuster. Diese Gardinen kannte ich wie meinen eigenen Körper. Hier hatte sich Großvater den Bart rasiert. Er saß am Küchenfenster, an den Fenstergriff hatte er sich einen runden Handspiegel gehängt. Dann schäumte er mit einem dicken Pinsel die Seife auf und bepinselte sich damit Wangen und Hals. Das Rasiermesser schärfte er mit einem Stein aus einer Metalldose. Die Gardinen waren während des Rasierens hinter das riesengroße Radio in der Ecke gesteckt. Wenn er fertig war, zog er sie wieder zu und das Licht in der Küche wurde wieder weiß.
Ich hielt mich am Stuhl fest und blickte zu meiner Großmutter.
In der linken Hand hielt sie das Brot, in der rechten das Messer: »Der Hunger wird kommen, hör zu, was ich dir sage. Man sieht es jetzt schon, Dürren werden noch schlimmere Dürren und Überschwemmungen werden noch schlimmere Überschwemmungen und Kälteeinbrüche werden noch schlimmere Kälteeinbrüche und Winde, oh weh, Winde werden noch schlimmere Winde und werden alles davontragen, was wir hatten, was wir haben, was wir haben werden, ich fürchte mich vor dem Wind, an einen solchen Wind kann ich mich nicht erinnern, er wird die Erde davontragen und die Felder werden aufplatzen und …«
Das war die Wahrheit über den Kampf und sie machte mich zur Geschichte, die man anständig erzählen können müsste.
NOVEMBER
Anfängerglück
Absteigende Mondbahn, abnehmender Mond, Säfte sammeln sich in den Wurzeln.
»Was siehst du, Opa?«
Das Leben wogt im Gewebe wie Ebbe und Flut. Seefahrer können für Jahre im Voraus die tägliche Uhrzeit vorhersagen, zu der die Gezeiten die Wasseroberfläche in Schwingung versetzen und ob die Uferfelsen, an denen sie ihre Boote vertäuen, im Ozean versinken oder bei Ebbe auf dem Trockenen bleiben – ihnen reicht der Mond und ein Kalender. Wasser, Flut, Lymphe, Ebbe, Plasma, Flut, Serum, Ebbe: Alles, was fließt, folgt der Kraft, die es beherrscht. Kommt es zu einer Umkehr, ein Zug, und der Saft versiegt, ein Sog, die fruchtbare Schicht sinkt ab, ein Schluck, das Leben gleitet in den Untergrund: »Schwarz.«
»Oh, Opa! Was noch?«
…
»Was siehst du noch, Opa?«
…
»Opa?«
…
Das Herz des Untergrunds, ein hohles sehniges Organ im Brustkorb, pulsiert warm in Intervallen, und da ist nicht nur ein Herz, es gibt viele Herzen im Untergrund. Die Herzklappen folgen einem Oberbefehl, und wenn der Lebenssaft, die süßliche Lymphe, bei abnehmendem Mond die Wurzeln hinunterfließt, öffnet sie in aller Stille eine hohe, endlose Tür. Wenn du den Untergrund betrittst, weißt du, wo du angefangen hast, aber du ahnst noch nicht einmal, wo es enden wird.
»Opa!«
Das Gefäßnetz des Untergrunds besteht aus Tavernen und Tracheen voller verbürgter Verbündeter, Agenten und Kuriere; Spionagenetzwerke spinnen sich um Fasern, Knollen und Gestein, buschige Härchen, die dringliche Nachrichten abfangen, sind in dichtem, schmierigem Schlamm verscharrt, so dass man nicht sagen kann, wo sich die letzte Spitze befindet, wo der sich festgesaugte Pilz und wo gar nichts mehr. In verflochtenen Wurzelgängen und geheimen Felsbetrieben funktionieren die Stationen: Maschinenräume, Küchen, Schriftsetzereien, Buchbindereien und Druckmaschinen. Telefonisten stellen Verbindungen her, Zentralen rufen Peripherien an. Gravurmeister des unterirdischen Propagandaministers setzen in kilometerlangen Kolonnen vertrauliche Buchstaben und hektographieren Tag und Nacht Agitprop-Flugblätter, schlagkräftige Parolen und Plakate für den Befreiungskampf, die lokale Mafia schert sich weder um Gott noch Herrn und schmuggelt auf denselben Wegen Waffen und Schnaps.
»Hörst du, Opa?«
Als Großvater gehen musste, gab ihm Großmutter das Messingfernglas mit auf den Weg. Tränen fielen auf den Dorffriedhof, während der Untergrund dankbar seinen neuen Agenten empfing, der schon mit irdischen Taten bewiesen hatte, dass er zum Stolz und guten Ruf des neuen Hauses beitragen und ihm vor allem von großem Nutzen sein würde. Großvater konnte Nachrichten überbringen.
»Aber du weißt schon, dass er neugierig ist wie ein Weib?!«
Als sie einen Telefonanschluss bekamen, entwickelten Oma und Opa jeder ihre Art der Kommunikation. Opa telefonierte stundenlang. Für jede Frage bestimmte er einen Informanten, und jeder Informant warf neue Fragen auf. Was er nicht aus dem Telefon herausholen konnte, fand er mit dem Feldstecher heraus. Er positionierte sich auf dem Stein unter dem Walnussbaum und blickte über das Tal, ein bisschen zur Schule, ein bisschen zur Gastwirtschaft, ein bisschen einfach so.
»Schlimmer als jedes Weib!« Oma war überzeugt davon, dass Geräte einem Zweck und nicht leerem Gefasel dienen, deshalb sagte sie am Telefon weder guten Tag noch auf Wiederhören, sondern nur: »Ich habe Käse gemacht«, tut-tut-tut.
Dann lässt du blitzschnell alles stehen und liegen und rennst auf schnellstem Weg zu ihr, zu frischer Sahne und Quark, den Oma Käse nennt. Die schnellste Abkürzung führt über den Marktplatz an der Kirche, über den alten Friedhof und an der verlassenen Totenkammer vorbei, in der Opa seinerzeit Schaufel und Hacke aufbewahrte.
Opa war in jungen Jahren Totengräber gewesen. Der alte Friedhof lag am Hang, deshalb rutschten die Gräber gerne bergab, besonders im Herbst, wenn es regnete. Manchmal musste er während dieser Verschiebungen einen neuen Platz ausheben, mit der Hacke öffnete er die erste Schicht und unten war alles durcheinander.
»Unten ist gerne alles durcheinander«, erklärte er und erzählte Einzelheiten, so dass dem Kind, dem dreijährigen, vierjährigen, fünfjährigen Mädchen beim Zuhören immer ein bisschen schlecht wurde. Großmutter war froh, dass der neue Friedhof im Flachen lag, trotzdem forderte sie stur – als würde sie einen Garten anlegen – für Großvater einen Platz, der ihrer Einschätzung nach nah genug an den guten und weit genug von den schlechten Nachbarn lag.
»Armer Pep«, sagte sie, »von dort aus kann er in Frieden zurück auf den Hang blicken.«
»Was siehst du, Opa?«
In der Hocke gekauert sprach ich mit dem Grab; mit Großvater, der die letzten drei Jahre darin lag. Wenn ich den Kopf hob, öffnete sich mein Sichtfeld wie ein Fächer. Geradeaus über das Tal Großmutters Bauernhof und dahinter der ansteigende Hang, darunter die ausgedünnte und alte Weidenallee, der Fußballplatz, die Kapelle, links hoch die Kirche und ganz links in der Ecke, fast hinter meinem Rücken, die Anhöhe mit der Schule und der Wohnblock, wohin ich während meiner sporadischen Besuche des Heimatortes schlafen ging; in das kleine Zimmer mit dem Pianino in der Mitte, das den Raum in zwei teilte, was die zwei verlassenen Kinderbetten jedes auf seiner Seite deutlich machten: mein blaues und das grüne meines Bruders. Rechts erstreckte sich das Blickfeld über den Bach, sein sanft sich erhebendes Tal, den Hochsitz, die Holzbrücke, eine weitere Kapelle mit schön gewachsener Linde sowie lange Wellen gepflügter sonnenseitiger Felder. Ganz rechts, knapp unterhalb des Waldes und ganz in der Nähe, kamen die schattige Anhöhe, der alte Stall, das zerfallende Lehmhaus und der verlassene Obstgarten ins Bild. Mutters neuer Bauernhof.
»Alles unter Kontrolle, was?«
Mein Blick blieb an dem Automaten für Grabkerzen hängen, und ich ertappte mich dabei, wie verblüffend elementar altmodisch ich dachte. Wie auch nicht? Es bestand kein Zweifel: Friedhöfe sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ringsum war alles mit poliertem Granit abgedeckt, lila oder orange oder dunkelgrün, nackte kleine Engel, die von vervielfachten glitzernden Omega-Buchstaben auf gerahmte Farbfotografien sprangen, aufgerüschte Namen und Nachnamen erinnerten an ausgeschmückte Kopien mit der Hand geschriebener Plakate für Dorffeste.
»Oh, Opa.«
Dorffriedhöfe hatten in meiner Vorstellung eine andere Eleganz, einen anderen Frieden. Sie hatten schöne aufrechte Kreuze aus Schmiedeeisen, auf denen ein weißer Christus weinte, alte Nachnamen und einfache Daten aus einer anderen Zeit. Die Idee, dass dort Urgroßväter und Urgroßmütter lagen, die wir von beim Kartenspielen erzählten Wahrheiten über die Hochzeitsklarinette und das Kohlebügeleisen kannten, war viel romantischer als die Idee, dass dort Opa lag.
»Du könntest was sagen, oder?«
Es war niemand da, der mich schief ansehen würde, weil ich mit der stummen Erde sprach. Und überhaupt, was für eine stumme Erde denn?! Großvater, der Telefonist, marschierte mit dem Feldstecher in der Hand durch die verflochtenen schwarzen Kanäle und goss Lebenssignale von oben nach unten, damit es für die unten heller wäre, und von unten nach oben, damit es für die oben …
»Wie es dir geht, zum Beispiel.«
Der Untergrund ist für Erkenntnisse gemacht. Ein paar Tage zuvor hatte Vater mich in Radovans Weinkeller zur Weinprobe mitgenommen und es geschah, dass ich zwanzig Meter unter der Erde vom Birnbaum fiel. Ich ging in die zehnte Klasse, als Großvater vom Birnbaum fiel. Er kletterte immer wie ein Affe im Baum herum, und auch dieses Mal wollte er hoch auf die Spitze. Alte Birnbäume, Salzburger oder Mostbirnen, sind so hoch wie Eichen, und Opa sah nicht, dass der Ast morsch war, der Wind hatte sich seltsam gedreht, der Haken hielt nicht. Der Sturzflug nahm ein schlimmes Ende, aber es hätte schlimmer kommen können. In Großvater verschob sich etwas. Er wurde weich, fast sanftmütig. Seine sture Strenge wich einer Rührseligkeit, die bei kleinsten Dingen zum Vorschein kam, manchmal konnte man sehen, dass er gottesfürchtige Gedanken und feuchte Augen hatte.
Radovans Keller roch nach saurer Feuchtigkeit. Auf die Holzfässer waren mit Bleistift römische Zahlen und kleine rundliche Markierungen geschrieben. Die Räume waren in gewölbte Tiefen verzweigt, hier und dort hingen leere Schläuche, an das höchste Fass war eine Leiter gelehnt, im Waschbecken lag ein Weinheber aus Glas. Nichts Besonderes, keine Erwartungen, einen Hügel kauf ich, Reben pflanz ich, Vater, Onkel, Tante, alle Freunde lad ich ein, auch ich werde ihn trinken, den Wein





























