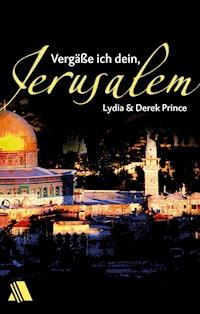
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ASAPH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die wahre Geschichte einer Frau des zwanzigsten Jahrhunderts, die es wagte, sich auf die Herausforderung der Bibel einzulassen. Dabei entdeckte sie, was viele suchen, ohne es je zu finden: Frieden, Freude, tiefe Geborgenheit - unabhängig von äußeren Umständen. Lydia Prince lebte zwanzig Jahre lang in Jerusalem, wo sie viele verlassene und verwaiste Kinder aufnahm und bemutterte - und wo sie die Geburt des modernen Israel miterlebte. Derek Prince, der die faszinierende Geschichte seiner ersten Frau niederschrieb, studierte am Eton College, der Universität Cambridge sowie an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Neben seiner Vortragstätigkeit wurde er vor allem durch sein umfangreiches schriftstellerisches Werk bekannt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eigentümerhinweis
<##benutzerinformation##>
Impressum
© Copyright der deutschen Ausgabe 2003 by Asaph-Verlag
9. Auflage 2012
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Appointment in Jerusalem
Aus dem Englischen übersetzt von Arnold Sperling-Botteron
Umschlaggestaltung: ideaal, Peter Karliczek, D-Uhingen
Satz/DTP: Jens Wirth
Druck: CPI Books
Printed in the EU
Print: ISBN 978-3-935703-18-5 (Best.-Nr. 147318)
eBook: ISBN 978-3-95459-505-1 (Best.-Nr. 148505)
Für kostenlose Informationen über unser umfangreiches Lieferprogramm an christlicher Literatur, Musik und vielem mehr wenden Sie sich bitte an:
Asaph, Postfach 2889, D-58478 Lüdenscheid
[email protected] – www.asaph.net
Widmung
In Liebe zu Jerusalem, der Stadt des großen Königs
Inhalt
Eigentümerhinweis
Impressum
Inhalt
Vorwort
Tikva
Søren
Die Begegnung
Das Begräbnis
Dr. Karlssons Botschaft
Die Reise
Jerusalem
Mein Platz
Die erste Aufgabe
Mahaneh Yehuda
Die Auslieferung
Die Belagerung
Wächter auf den Mauern
Ausklang: Drama in drei Akten
Vorwort
Dies ist die Geschichte dreier Jahre im Leben einer höchst bemerkenswerten Frau, die – wie es sich begibt – meine Frau ist. Es sind jene Jahre, die sie von einem Leben materiellen Komforts und beruflichen Erfolges zu einem Leben in Gefahr, Armut und Entfremdung von denen führten, die ihr einst viel bedeuteten. Sie, eine Lehrerin mit den verheißungsvollsten Berufsaussichten, verließ ihre Heimat Dänemark – dieses saubere und friedliche Land –, um alleine und ohne einen Pfennig an einen (für die damalige Zeit) verhältnismäßig primitiven und unruhigen Ort zu reisen. Dieser Ort war Jerusalem, das zu jener Zeit gerade am Anfang des langen Krieges zwischen Juden und Arabern stand, der bis heute noch kein Ende gefunden hat.
Dort ertrug Lydia die Härten des Hungers und des Durstes, die Gefahren der Straßenkämpfe und der Belagerung. Und dort entdeckte sie, was wir alle suchen und so wenige finden: Freude, Frieden, vollkommene Geborgenheit, ungeachtet unserer äußeren Lebensumstände.
Indem sie sich – eine Generation ihrer Zeit voraus – in den Bereich der Erfahrbarkeit des Heiligen Geistes begab, wurde sie eine Wegbereiterin für die charismatische Erweckung, die seit der Zeit ihrer Entstehung von vielen als der positivste und hoffnungsvollste Faktor in der Welt unserer Tage betrachtet wird. Angesichts zunehmender Probleme und Spannungen, denen wir heute alle ausgesetzt sind, weist uns ihre Geschichte den Weg zu Antworten, die ihre Probe vor dem Ende des zwanzigsten Jahrhunderts bestehen werden.
Ich weiß, dass dies auf mich zutrifft. Lydia und ich begegneten und verheirateten uns in Jerusalem gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Nach Abschluss meines Studiums am Eton College und an der Cambridge-Universität in England hatte ich zu jener Zeit einen sechsjährigen Lehrauftrag am King’s College, Cambridge. Aber eine vollständig neue Phase meiner Laufbahn begann an jenem Tage, als ich die Stufen zu einem grauen, aus Steinen errichteten Gebäude hinaufstieg und der blauäugigen Dänin begegnete, die von einem Hausvoll jüdischer und arabischer Kinder Mama genannt wurde.
In diesem Hause lernte ich den Heiligen Geist kennen – nicht als eine zu einem theologischen Dogma, Dreieinigkeit genannt, gehörende Person, sondern als eine täglich gegenwärtige, mächtige Wirklichkeit. Ich beobachtete Lydia beim Tischdecken, als nichts da war, womit sie die Teller füllen konnte. Dennoch war sie gewiss, dass Gott bis zu dem Moment, wo wir uns zu Tische setzten, für die Mahlzeit sorgen würde. Ich sah sie vollmächtig für kranke Kinder beten, und sie wurden gesund. Vor allem beobachtete ich, wie der Geist Gottes sie jeden Tag von morgens bis abends mit den Worten der Bibel nährte, leitete und ihr beistand. Ich hatte die Heilige Schrift in ihren Originalsprachen studiert, ihre historischen Komponenten analysiert, über ihre Exegese nachgesonnen. Lydia ließ sie zu ihrem Herzen sprechen. „Ich habe“, sagte sie einmal, „das Johannesevangelium wie einen Liebesbrief gelesen.“
In dreißig Ehejahren habe ich von Lydia gelernt, dass ein aus dieser engen Verbundenheit mit der Bibel entspringendes Gebet nicht eine subjektive Sache ist, sondern eine Kraft in dieser Welt – die größte, die es gibt. Vor einiger Zeit sagte unsere Tochter Johanne zu ihrem Sohn Jonathan, dass Lydia für eine bestimmte Sache betete. „Nun, wenn Großmutter für etwas betet“, kommentierte Jonathan, „dann wird die Sache schon in Ordnung kommen.“
Was mich bei alledem fasziniert, ist, dass Lydia in den ersten fünfunddreißig Jahren ihres Lebens in ihren eigenen Augen und auch nach Meinung anderer die letzte Person gewesen wäre, der Dinge dieser Art widerfahren könnten. Intelligent, wie sie war, ein bisschen Snob, eine gutsituierte junge Frau, die an neuen Kleidern, am Tanzen und an all den Vergnügen der kulturellen Welt, in die sie hineingeboren worden war, ihre Freude hatte – in der Bibel hatte sie vorher nur gelesen, als es von ihr im Lehrerseminar verlangt wurde.
Der Weg, auf welchem dieser Verstandesmensch des zwanzigsten Jahrhunderts die Realität Gottes entdeckte, ist für uns alle so voll von Leitlinien, so voll von praktischer Hilfe für alle, die heute auf der Suche nach demselben Ziel sind, dass ich Lydia von Anfang an bat, ihre Erlebnisse doch zu Papier zu bringen. Doch Lydia war viel mehr damit beschäftigt, das Leben zu leben, als darüber zu schreiben. Allmählich sah ich ein, dass mir die Aufgabe zufallen würde, ihre Geschichte zu erzählen, wenn sie je erzählt werden sollte. Inzwischen bin ich mit all diesen Plätzen wohl vertraut geworden, ebenso mit fast allen Personen, die in den geschilderten Ereignissen eine Rolle spielten. So ist es mir möglich geworden, durch mein Wissen aus erster Hand sowohl die Szenen als auch die Persönlichkeiten zu rekonstruieren.
Dies ist Lydias Geschichte. Ich habe versucht, so weit dies einem Manne gelingen kann, in ihren Sinn und in ihre Gefühlswelt einzudringen, um die Geschehnisse mit ihren eigenen, damals von ihr selbst verwendeten Worten zu schildern – ohne von Kämpfen und Schwachheiten wegzudeuten, sondern die wirkliche Frau für sich selbst sprechen zu lassen.
Das vorliegende Buch enthält jedoch noch ein anderes Charakterbild – in gewissem Sinne die eigentliche Heldin: die Stadt Jerusalem. In diesen Kapiteln beschreibt Lydia Jerusalem so, wie sie es in jenem Jahrzehnt, welches einer vierhundert Jahre langen türkischen Herrschaft folgte, kennenlernte – einen Ort, der sich sehr unterscheidet von dem, der sich heute den Touristen bietet. Am Schluss des Buches, im Nachwort, habe ich dann das Wort und versuche, den Schleier über der Zukunft zu lüften und ein Bild von dem zu entwerfen, was Jerusalem – und uns allen – bevorsteht. Denn der Schlüssel zur Weltgeschichte liegt in dieser einen Stadt.
Die Dinge, über die ich schreibe, mögen in den siebziger, achtziger oder neunziger Jahren unseres Jahrhunderts geschehen. Die Bibel sagt uns nicht, wann; sie versichert uns nur, dass alles genauso stattfinden wird, wie es die Prophetie zeigt. Es ist unser Gebet, dass Lydia und ich durch dieses Buch Ihnen, lieber Leser, etwas von unserm tiefen Eindruck, wie bedeutsam die kommenden Tage für diese Stadt sind, vermitteln mögen und auch etwas von der Liebe, die sie in jedem inspiriert, der Gottes Aufforderung ernst nimmt, für „den Frieden Jerusalems zu beten“.
Derek Prince
Anmerkung des Verfassers
Aus persönlichen Rücksichten sind die Namen einiger der in der Geschichte vorkommenden Personen geändert worden.
Tikva
Der letzte Schein der untergehenden Sonne war vom Himmel hinter mir geschwunden und ließ die Straßen Jerusalems dunkel und verlassen zurück. Die Stille wurde einzig von meinen auf den Steinen klappernden Schuhen durchbrochen. Die feuchte Winterluft streifte nicht sehr sanft meine Wangen. Unwillkürlich umklammerte ich das Bündel in meinen Armen fester.
Endlich, und mit einem Seufzer der Erleichterung, wandte ich mich einem steinernen Treppenaufgang zu, der zu einer Tür im Erdgeschoss führte. Das Bündel sorgsam mit dem linken Arm umfassend, griff ich mit der rechten Hand in die Tasche und zog einen schweren eisernen Schlüssel hervor. Der Schlüssel drehte sich mit einem solchen quietschenden Geräusch im Schloss, dass es durch den ganzen leeren Hof widerhallte. Hastig trat ich ein und bewegte den Schlüssel von der andern Seite, wobei mir dasselbe quietschende Geräusch verriet, dass die Türe wieder sicher verschlossen war. Ich tastete mich quer durch den Raum zu dem Bett an der gegenüberliegenden Wand und legte meine Last hier ab. Neben dem Bett stand eine Kommode. Suchend tastete ich darauf umher, nahm eine Zündholzschachtel herunter und entflammte ein Zündholz. Sein kleiner Schein zeigte mir die Petroleumlampe, die auf der Kommode stand. Ich gebrauchte ein zweites Zündholz und zündete damit die Lampe an.
Sie beleuchtete einen schmucklosen, mit Fliesen belegten Raum. Auch die Wände waren aus Stein und – mit Ausnahme eines Bildkalenders über dem Bett – ebenso kahl. Außer dem Bett und der Kommode befanden sich nur noch drei andere Einrichtungsgegenstände darin: ein Tisch und ein Stuhl an der Wand sowie ein Flechtkoffer unter dem Fenster. Das Fenster selber war mit einem schweren Eisengitter bewehrt – ein stummer Zeuge für die Furcht, die jeden Einwohner der Stadt aus seiner Wohnung eine Festung machen ließ.
Ich wandte mich wieder dem Bündel auf dem Bette zu. Eingewickelt in einem rauen schwarzen Schal lag ein kleines Baby, ein Mädchen. Sein winziger Körper war notdürftig mit einem schmuddeligen baumwollenen Unterhemd bekleidet. Die Gesichtshaut, zartgelbem Pergament gleich, spannte sich straff über die Wangenknochen und brannte unter meiner Hand wie Feuer. Die schwarzen Haare, nass vom Schweiß, klebten an den Schläfen. Aus ihren tiefen Höhlen starrten mich für einen kurzen Augenblick zwei dunkle Augen an – und schlossen sich wieder.
Ich schlug den Schal etwas zurück und zog eine Säuglingsflasche mit nur ein paar Deziliter lauwarmer Milch hervor. Dabei fiel ein zerknittertes Stück Papier heraus und glitt auf den Boden. Behutsam setzte ich die Flasche an den Mund des Babys und wartete auf eine Reaktion. Zuerst sah es so aus, als ob die körperliche Anstrengung zum Trinken für das Kind zu groß sei, doch nach einer Weile begann es am Nuckel zu saugen.
Ich hob den Papierfetzen vom Boden auf und strich ihn mit der Hand glatt. Er enthielt drei sorgfältig mit Großbuchstaben geschriebene Zeilen: TIKVA COHEN – GEBOREN IN JERUSALEM – 4. DEZEMBER 1927.
Automatisch blickte ich auf den Kalender über dem Bett. Es war Freitag, der 28. Dezember 1928. Ich konnte es kaum glauben – das Baby war bereits mehr als ein Jahr alt! Hätte ich sein Alter nach Gewicht und Größe geschätzt, würde ich es nur für halb so alt gehalten haben.
Als das Baby fortfuhr zu trinken, schaute ich mich im Zimmer um. Ich brauchte einen Platz, wo es vor der feuchten Luft und den kalten Steinen geschützt war. Was konnte da in Frage kommen? Mein Blick fiel auf den Flechtkoffer. Das würde gehen! Aber dazu brauchte es noch etwas anders. Schnell öffnete ich die Schubladen der Kommode und zog alle Unterwäsche und alle weitere weiche Kleidung, die ich darin finden konnte, heraus. Damit schlug ich, so gut es ging, den Koffer aus und machte ihn so bequem und einladend, wie ich nur konnte. Ich ließ den Deckel aufgeschlagen und lehnte ihn gegen die Eisenstäbe am Fenster.
Unterdessen hatte das Baby zu saugen aufgehört und schien eingeschlafen zu sein. Behutsam entledigte ich es seines baumwollenen Leibchens. Dann nahm ich den blauen Wollschal, den ich trug, und wickelte ihn zwei- oder dreimal um seinen Körper. Als ich das Mädchen in den Koffer legte, wimmerte es einen Augenblick, schwieg dann jedoch bald wieder. Sein Atem ging flach und stoßweise, und das Fieber sandte periodische Schauer durch seinen Körper.
Wohin sollte ich mich um Hilfe wenden? In Gedanken sah ich die dunklen, menschenleeren, von Furcht und Misstrauen verseuchten Straßen Jerusalems vor mir. Jede Tür war verriegelt, jeder Fensterladen geschlossen. Es gab kein Telefon im Hause, dass ich einen Krankenwagen oder einen Arzt hätte herbeirufen können. Ich war mit einem sterbenden Kinde in diesem nackten Raum eingeschlossen.
Mein Blick wurde von einem aufgeschlagenen Buch unter der Lampe auf der Kommode angezogen. Die Bibel – hatte sie für mich in diesem Moment eine Botschaft? Sie war beim Jakobusbrief geöffnet. Ich fing an zu lesen und wurde bei zwei grün unterstrichenen Versen festgehalten:
„Ist jemand unter euch krank, so lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, und sie sollen über ihm beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben! Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufstehen lassen …“ (Jakobus 5,14–15).
„Mit Öl salben …“ Ich wiederholte im Stillen langsam die Worte. Öl war etwas, was ich hatte. Natürlich war ich kein „Ältester“. Aber ich war ganz auf mich gestellt, ohne eine andere Hilfsquelle. Es war bestimmt besser zu tun, was ich konnte, als überhaupt nichts zu tun!
Ich öffnete einen Wandschrank, wo ich meinen sehr bescheidenen Lebensmittelvorrat aufbewahrte, nahm eine Flasche heraus und hielt sie gegen das Licht. Der Inhalt schimmerte träge, etwa zwischen grün und gold. Es war reines Olivenöl von den judäischen Bergen – von derselben Art, wie es in längst vergangenen Jahrhunderten bei der Salbung von Königen und Priestern in Israel verwendet wurde.
Die Flasche mit Öl in meiner Linken haltend, kniete ich mich auf dem Steinboden vor dem Flechtkoffer nieder. Das Atmen des Kindes wurde immer beschwerlicher. Die Luft um uns herum schien seltsam schwer geworden zu sein. Ein kaltes Frösteln durchlief mich. Ich stand von Angesicht zu Angesicht einer unsichtbaren Anwesenheit gegenüber – der Anwesenheit des Todes.
Im Bemühen, meinen Glauben zu stärken, wiederholte ich laut die Worte, die ich soeben in der Bibel gelesen hatte: „Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten … der Herr wird ihn aufstehen lassen …!“ Mit leicht zitternder Hand träufelte ich ein klein wenig Öl auf die Finger meiner rechten Hand und berührte damit sanft die Stirn des Kindes.
„In deinem Namen, Herr Jesus!“, flüsterte ich. „Sie ist deine kleine Schwester – eine von deinem eigenen Volk. Um deines Namens willen, Herr, bitte ich dich, sie zu heilen!“ Wieder legte ich meine Hand an die Wange des Kindes.
Nach einigen Minuten öffnete ich die Augen. Bildete ich es mir nur ein oder waren die Fieberschauer tatsächlich weniger intensiv? Wieder legte ich meine Hand an die Wange des Kindes. Sie brannte!
Ich schloss die Augen und betete noch einmal. „Herr, du hast mich doch hierhergebracht. Du warst es, der mich geheißen hat, meine Heimat zu verlassen und nach Jerusalem zu kommen. Herr, lass diese Menschen hier erfahren, dass Kraft in deinem Namen ist und du Gebete erhörst …“
Die Zeit stand still. Auf meinen Knien vor dem Koffer betete und beobachtete ich abwechselnd, ob eine Veränderung im Zustand des Babys eingetreten sei. Manchmal schien sein Atem leichter zu gehen, aber immer noch glühte die Haut vor Fieber. Ab und zu schaute ich in seine unnatürlich tief in ihre Höhlen versunkenen Augen, die mich ernst anblickten.
Allmählich wurden meine Knie vom harten Druck der Fliesen steif und kalt. Ich erhob mich und ging, immer noch still betend, auf und ab im Raum. Nach ein oder zwei Stunden sah ich ein, dass damit nichts gewonnen würde, wenn ich noch länger auf den Beinen blieb. Auch wenn ich nicht schlafen könnte, wäre es jedenfalls weiser, mich vor der Feuchtigkeit des Zimmers zu schützen, indem ich zu Bett ging.
Ehe ich die Lampe löschte, hielt ich sie über das Kind, um zu sehen, ob sich etwas verändert hatte. Für den Moment wenigstens hatte der Fieberfrost aufgehört. Es schien zu schlafen. Doch ihre Haut fühlte sich immer noch heiß vom Fieber an. Wie lange konnte der winzige Körper das wohl noch aushalten? Schließlich blies ich die Lampe aus, kroch ins Bett und zog die Decke bis unter das Kinn hinauf.
Während ich so im Dunkeln dalag, ging ich in Gedanken noch einmal die ganze Reihe seltsamer Ereignisse durch, welche mich nach Jerusalem gebracht hatten. Vor meinem inneren Auge konnte ich die Landkarte von Dänemark an der Wand des Klassenzimmers sehen, wo ich noch vor sechs Monaten Geografie unterrichtet hatte. Wie der schartige Kopf einer steinernen Pfeilspitze stößt der vorspringende Teil von Jütland nordwärts ins Skagerrak hinauf. Auf der Windschattenseite von Jütland, im Osten, schmiegen sich die beiden Inseln Fünen und Seeland an, nur durch einen schmalen Wasserstreifen, den Großen Belt, vom Festland getrennt.
An der Ostküste des Großen Belt, im Südwesten Seelands, liegt die Stadt Korsør. Nur zu gut ließ mich meine Sehnsucht alle Einzelheiten erkennen. Wie anders war dort alles als in Jerusalem! Die Straßen sauber und hell erleuchtet. Auf beiden Seiten der Straßen Reihen von herausgeputzten Backsteinhäusern mit roten Ziegeldächern und weißgestrichenen Dachrinnen. Und ich hörte wieder die hellen Kinderstimmen das Lied singen, das alle dänischen Kinder in der Schule lernen:
IDanmark er jeg født, Der har jeg hjemme …In Dänemark bin ich geboren Und hier ist meine Heimat …
Søren
Es war zwei Jahre zuvor gewesen – im Dezember 1926. Die schrägen Strahlen der nördlichen Sonne spiegelten sich mit tief orangefarbenem Schein in den Klassenzimmerfenstern wider. Ich sagte dem Hausmeister, der am eisernen Tor des Schulhofes wartete, um es abzuschließen, Auf Wiedersehen, schwang mich auf mein Fahrrad und fuhr die mir vertraute Straße entlang, die sich bis in das Zentrum von Korsør windet.
Fünf oder sechs Minuten energischen Radelns brachten mich zum westlichen Teil der Stadt, nur wenige Hundert Meter vom Ufer des Großen Belt entfernt. Ich stellte mein Fahrrad im Hofe eines großen, roten Backsteinbaues ab und stieg die Treppen zu meiner Wohnung im zweiten Stock empor. Auf dem kleinen offenen Vorplatz zur Wohnung stand Valborg, meine Hausangestellte, die sich die Hände an ihrer rot-weiß karierten Schürze abtrocknete, bereit, mich zu begrüßen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























