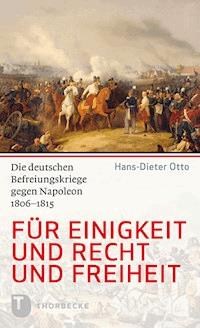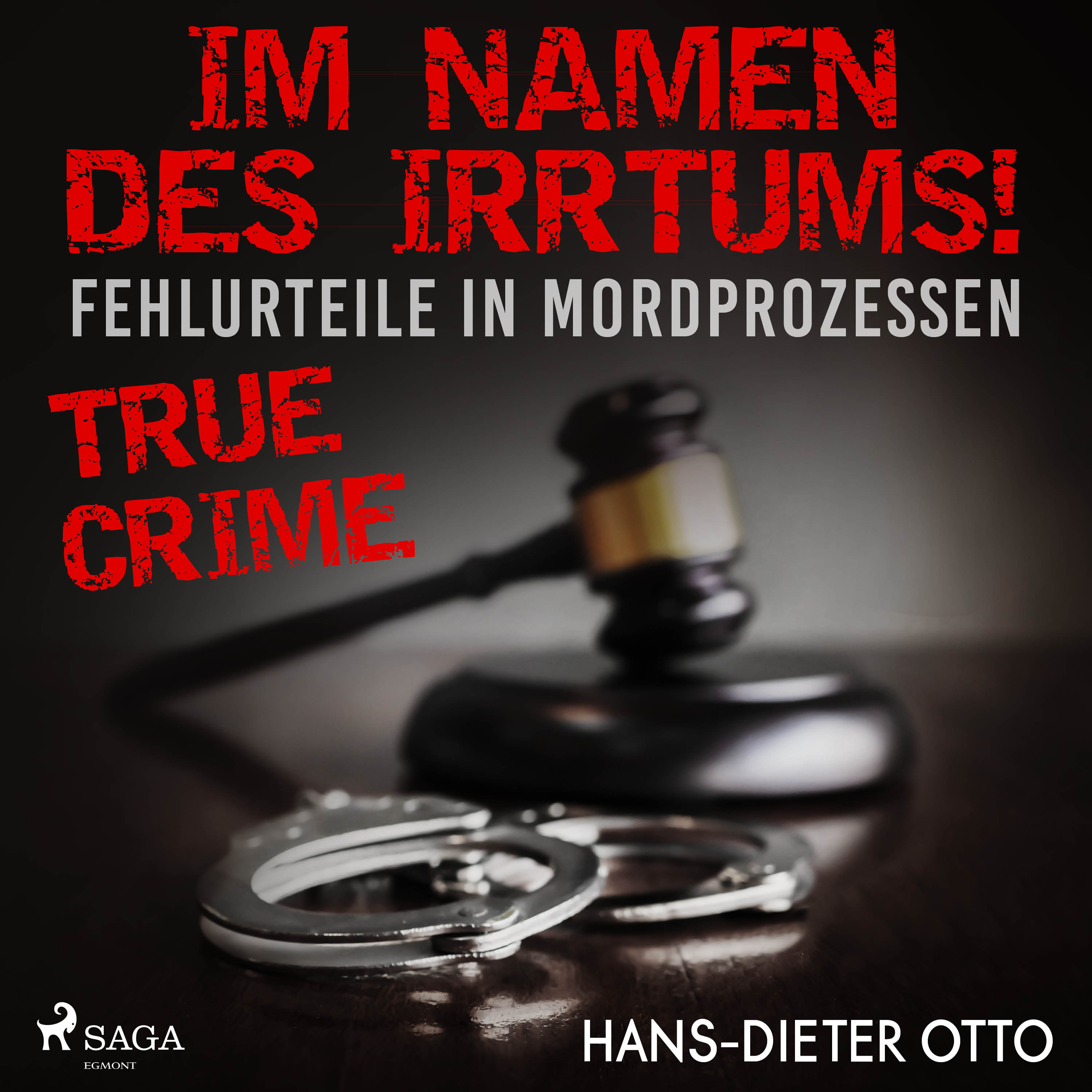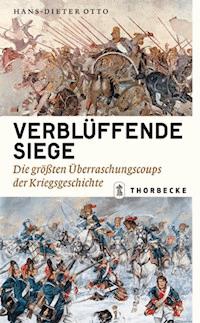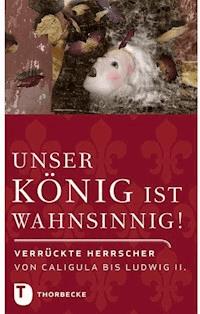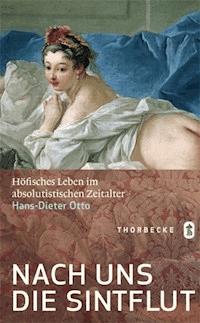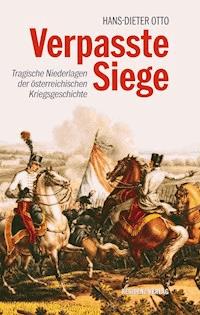
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Militärische Missgeschicke und kuriose Feldherrenfehler Als Weltmacht trug das Habsburger Reich nicht nur die Hauptlast der Verteidigung gegen die Türken im Osten, sondern wehrte über Jahrhunderte in wechselnden Allianzen auch Angriffe aus dem Westen ab. Lange Zeit galt die österreichische Armee als eine der besten der Welt und berühmte Feldherren wie Prinz Eugen und Leopold Graf Daun errangen auf dem Schlachtfeld glänzende Siege - aber sie erlitten auch verheerende Niederlagen. Den glorreichen Siegen unter österreichischen Farben stehen militärische Missgeschicke gegenüber, gravierende Fehlgriffe und eklatante Fehleinschätzungen, die eine Schlacht gewendet oder sogar einen Krieg entschieden haben, in dem man sich schon als Sieger wähnte. Von solchen verpassten Siegen handelt dieses Buch, von Kämpfen, die tragisch endeten, von Schlachten, die für die Österreicher schon gewonnen schienen und die dann doch noch unerwartet verloren gingen. In spannend und temporeich erzählten Fallstudien sucht Hans-Dieter Otto nach den Gründen. Bei seiner Spurensuche öffnet sich ein Panorama verschiedenster historischer Epochen und gibt den Blick frei auf Personen, die sie herausragend bestimmten. Es spannt sich ein faszinierender Bogen über mehrere Jahrhunderte der österreichischen Kriegsgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HANS-DIETER OTTO
VerpassteSiege
Tragische Niederlagender österreichischenMilitärgeschichte
Allen bedauernswerten, tapferen Soldaten gewidmet, die in den blutigen Schlachten der österreichischen Geschichte ihr Leben lassen mussten.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
©2012 Residenz Verlag
im Niederösterreichischen Pressehaus
Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
St. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:
978-3-7017-4315-5
ISBN Printausgabe:
978-3-7017-3244-9
Inhalt
»Wir sind nun alle gute Freunde!« Ein Vorwort
»Retta, Östreich, retta!« Sempach, 9. Juli 1386
Kuriose Feldherrnfehler Parma, 29. Juni 1734
»Schlesien geb’ ich nicht her!« Mollwitz, 10. April 1741
Überfall im Morgengrauen Hohenfriedeberg, 4. Juni 1745
»Die Leute paschen, man störe sie nicht!« Leuthen, 5. Dezember 1757
Blutbad an der Elbe Torgau, 3. November 1760
Am seidenen Faden Marengo, 14. Juni 1800
Angriff von hinten Hohenlinden, 3. Dezember 1800
Macks Malheur Ulm, 19. Oktober 1805
Der Schatten von Austerlitz Austerlitz, 2. Dezember 1805
Großes Unglück in Galizien Lemberg, 26. August - 11. September 1914
Quellen- und Literaturverzeichnis
Personenregister
Bildnachweis
»Im Kriege verlieren alle, auch die Sieger.«
Schwedisches Sprichwort
»Wir sind nun alle gute Freunde!«
Ein Vorwort
In den belebten Wiener Kaffeehäusern der Kärntnerstraße zeigt das Kalenderblatt den 12. November 1805 an. Fast alle Tische sind besetzt. Aufgeregt nippen die Wiener an ihrer Melange und stellen sich die bange Frage, was nun aus ihrer geliebten Metropole werden wird. Denn im 3. Koalitionskrieg mit Frankreich stehen die Truppen Napoleons unmittelbar vor der Stadt, bereit, sie einzunehmen. Viele Adlige und wohlhabende Bürger haben die Stadt bereits verlassen und am 8. November hat sich auch Kaiser Franz II. mit seinem Hofstaat nach Olmütz abgesetzt. Das verübeln ihm die Wiener sehr. Wien ist zwar zur »offenen Stadt« erklärt worden, aber dennoch befürchten die Bewohner, dass es Kämpfe um und in Wien geben wird. Denn eine Art Bürgerwehr, ein aus 17 Bataillonen und 30 Schwadronen bestehendes Reservekorps unter dem Kommando von Generalleutnant Fürst Karl von Auersperg, steht mit rund 13 000 Soldaten am nördlichen Donauufer Wiens bereit, um die Franzosen aufzuhalten.
Die Angriffsspitzen von Marschall Murats Kavallerie haben am 10. November bereits Sieghartskirchen erreicht. Wenn sie nach Wien hineinwollen, müssen sie erst einmal über die Donaubrücken, insbesondere über die Taborbrücke, eine wacklige Holzkonstruktion im Norden, auf der sich die Hauptstraße über einige verbindende Dämme und quer über ein paar dicht bewaldete Inseln und Kanäle lang hinzieht. Der letzte Brückenbogen überspannt von der großen Insel Wolfsau bis zum Nordufer bei Spitz nicht weniger als einen halben Kilometer. Auf der nördlichen Brückenausfahrt steht eine schwere Batterie. Der Wiener Magistrat schickt Abgeordnete mit der Bitte zu Murat, die Stadt zu schonen. Er werde Wien großzügig behandeln, lässt Murat antworten, wenn die Taborbrücke intakt bleibe. Am 12. November erreichen seine Truppen die noch unversehrte Brücke. Auersperg hat Befehl, sie sofort zu sprengen, wenn sich die Franzosen nähern, damit die österreichische Armee Zeit gewinnt, sich mit den verbündeten Russen im Raum Olmütz zu vereinen. Auf den Brückenplanken sind Pulverladungen, Brennholz und Stroh ausgebreitet. Aber der biedere, dem Kaiser treu ergebene hochbetagte Auersperg, der für die Verteidigung Wiens aus dem jahrelangen Ruhestand reaktiviert worden ist, zögert die Zerstörung hinaus, weil er die Lebensmittelversorgung aus dem Marchfeld möglichst lange aufrechterhalten möchte. Außerdem kursieren in der Stadt von französischen Geheimagenten verbreitete Gerüchte, ein Waffenstillstand stehe unmittelbar bevor.
Am Morgen des 13. November hält Husarenoberst Geringer Wache am ersten Brückenbogen. Da nähern sich gemächlichen Schrittes vier hochrangige französische Offiziere in schmucken blauen Mänteln, die Marschälle Murat und Lannes, General Belliard sowie Generaladjutant Bertrand, der später einer der engsten Vertrauten Napoleons wird. Sie winken schon von Weitem mit weißen Tüchern, schütteln dem verdutzten Oberst die Hände und machen ihm mit freundlichen, nahezu herzlichen Worten weis, die Feindseligkeiten zwischen Frankreich und Österreich seien soeben durch einen Waffenstillstand beendet worden und die Brücke gehöre nun den Franzosen. Kaiser Franz habe sich bereit erklärt, Napoleon zu empfangen, und sie selbst wünschen den Fürsten Auersperg zu sprechen. Oberst Geringer ist derart perplex, dass er nichts unternimmt, als französische Pioniere beginnen, das geschlossene Holzgitter an der Brücke einzuhauen. Das Einzige, was er tut, ist, sich schnellstens zu entfernen, um seinem Vorgesetzten Meldung zu machen. Hinter ihm sprengen in gestrecktem Galopp französische Husaren auf die Brücke. Am Nordende der Brücke, am Ende des dritten Brückenbogens, steht Hauptmann Johannes Bulgarich von der Székler-Infanterie und sieht mit Entsetzen, wie eine starke Gruppe französischer Soldaten bereits die letzte Biegung des Dammes erreicht hat. »Die Franzosen kommen!«, schreit er den Kanonieren der Batterie zu. Aber bevor sie feuern können, sind die Marschälle Lannes und Murat bei ihnen und versichern ihnen, ein Waffenstillstand sei eingetreten und die Feindseligkeiten zwischen Franzosen und Österreichern seien vorbei. Murat, ein heißblütiger, mutiger Gascogner, setzt sich lächelnd auf ein Geschütz und ruft den österreichischen Kanonieren zu: »Wir sind nun alle gute Freunde!« Sie fallen auf den dreisten Bluff herein und lassen zu, dass Pioniere auf der Brücke die Zündschnüre durchschneiden und alles brennbare Material in die Donau werfen. Als ein Kanonier sich über die viele Bewegung auf der Brücke wundert, beruhigt ihn Lannes mit der Bemerkung, es sei doch ein kalter Tag, und da müssten die französischen Soldaten auf der Stelle treten und herumlaufen, um sich warmzuhalten.
Als General Fürst Auersperg, der im Posthaus von Stammersdorf sein Hauptquartier aufgeschlagen hat, auf dem Weg zur Taborbrücke ist, wundert er sich, dass die Geschützrohre seiner Batterie landeinwärts, geradewegs auf ihn, gerichtet sind. Beim zweiten Brückenbogen trifft er auf Marschall Murat. Er gibt Auersperg sein Ehrenwort als Offizier, dass die Feindseligkeiten beendet seien und er den Österreichern gestatten würde, sich unbehelligt zurückzuziehen. Die Batterie müsse er jedoch behalten. Im Denken und Handeln von Fürst Auersperg hat der Begriff der Ehre einen hohen Stellenwert. Er fällt blindlings ebenfalls auf das schamlose Gaunerstück herein. Die Franzosen überqueren die Donau und ziehen kampflos in Wien ein. Auersperg wird später vor ein Kriegsgericht gestellt und zum Tode verurteilt, vom Kaiser jedoch begnadigt. Er stirbt im Gefängnis.
Dieser dreiste Bluff – eine haarsträubende Begebenheit, die schon Leo Tolstoi in seinem 1896 fertiggestellten Roman »Krieg und Frieden« quellengetreu beschrieben hat – stellt sicherlich einen besonderen Tiefpunkt in der österreichischen Militärgeschichte dar. Aber es hat noch andere militärische Missgeschicke gegeben, gravierende Fehlgriffe und eklatante Fehleinschätzungen, die eine Schlacht gewendet oder sogar einen Krieg entschieden haben. Von solchen schlimmen Unglücken handelt dieses Buch, von Kämpfen, die tragisch endeten, von Schlachten, die für die Österreicher schon gewonnen schienen oder die sie zumindest hätten gewinnen müssen, und die dann doch noch unerwartet verloren gingen. So viele Gewinnchancen wurden aus der Hand gegeben, so viele Siege verpasst. Den Gründen hierfür werden wir in den ausgewählten, chronologisch aneinandergereihten Fallstudien näherkommen. Kann die Vielzahl der verpassten Siege zu der Annahme führen, dass die Ursachen hierfür vielleicht auch in der österreichischen Mentalität und generell eher gemütlichen Lebensart zu suchen sind? Die Österreicher waren ganz sicher immer ein friedliebendes Volk gewesen. Kriege sind ihnen im Grunde immer verhasst. Bei der Spurensuche öffnet sich in den nachfolgenden Kapiteln ein Panorama verschiedenster Zeitepochen der österreichischen Historie und gibt den Blick frei auf Personen, die sie herausragend bestimmten. Es spannt sich ein weiter Bogen über mehrere Jahrhunderte höchst interessanter österreichischer Geschichte.
Von welchem Zeitpunkt an können wir eigentlich von einer eigenständigen österreichischen Geschichte sprechen? Die von Otto dem Großen nach der Schlacht auf dem Lechfeld und dem Sieg über die Ungarn 955 errichtete und von den bayrischen Herzögen dem Geschlecht der Babenberger als Lehen übergebene Ostmark wird erstmals 996 als »Ostarrichi« (Österreich) urkundlich belegt. Kaiser Friedrich I. Barbarossa hat das Gebiet dann 1156 von Bayern losgelöst und zum Herzogtum erhoben. Aus einem alten, 1463 entstandenen Bericht, der »Cronica Austriae« des Theologen und Geschichtsschreibers Thomas Ebendorfer von Haselbach, wissen wir, dass in dieser Zeit auch die österreichischen Landesfarben Rot-Weiß-Rot entstanden sind: Herzog Leopold V. »der Tugendhafte« hatte im Dritten Kreuzzug bei der Belagerung von Akkon im Jahr 1191 den ganzen Tag über so heftig und ausdauernd gekämpft, dass sein weißer Waffenrock überall mit Blut bespritzt war, »ausgenommen jener Teil, den das Wehrgehenk deckte«. Als Leopold seinen breiten Gürtel abnahm und ein weißer Streifen zum Vorschein kam, ordnete Kaiser Heinrich VI. »zum nie versiegenden Ruhme Österreichs« an, dass nach dem Muster dieses blutdurchtränkten Rockes künftig alle Kampfschilder und Banner rot sein sollten, mit einem weißen Streifen in der Mitte. Wenn wir heute eine österreichische Flagge friedlich im Wind flattern sehen, ist uns gar nicht bewusst, welch martialischen Ursprung sie hat. In der ersten Schlacht, mit der wir auf den folgenden Seiten konfrontiert werden, der blutigen Schlacht bei Sempach im Jahr 1356, wehen die rot-weiß-roten österreichischen Banner bereits auf dem Schlachtfeld. Seit 1278 ist Österreich habsburgisch, mit Rudolf von Habsburg an der Spitze.
Zwei Jahrhunderte später ist das Habsburgerreich bereits eine Weltmacht und Österreich das Zentrum der katholischen Gegenreformation. Danach trägt es die Hauptlast der Verteidigung gegen die Türken und gegen die Hegemoniebestrebungen Frankreichs. Es ist Österreich und nicht Preußen, das das Reich 300 Jahre lang gegen den Angriff Frankreichs verteidigt. Dabei wird es oft genug von einzelnen Reichsfürsten verraten, auch von Preußen. Von da an gilt die österreichische Armee lange Zeit als eine der besten der Welt. Und berühmte österreichische Feldherren und Heerführer wie Prinz Eugen von Savoyen während der Türkenkriege oder Feldmarschall Daun während der kriegerischen Auseinandersetzungen mit Friedrich II. von Preußen erringen auf dem Schlachtfeld glänzende und glorreiche Siege. Aber keine Armee hat in der langen Menschheitsgeschichte immer nur gesiegt, auch die österreichische nicht.
Nach dem Wiener Kongress 1814/15 und der Verbannung Napoleons auf die Insel St. Helena steigt der Vielvölkerstaat Österreich zur europäischen Großmacht auf. Doch schon 1866 erlebt er nach der Niederlage bei Königgrätz gegen das deutsche Heer und dem nachfolgenden Ausscheiden aus dem Deutschen Bund einen neuen Tiefpunkt. Zehn Jahre später macht das Land mit der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn einen hoffnungsvollen Neuanfang. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg erfolgt 1919 die im Frieden von St. Germain festgelegte Aufteilung des Landes. Österreich wird eine selbstständige Republik. Von nun an schlägt es keine Schlachten mehr. Denn im März 1938 erfolgt der Einmarsch deutscher Truppen und der Anschluss an Hitlers Deutsches Reich, mit dem es bis zum Zusammenbruch 1945 vereint bleibt. Da dessen Schlachten im Zweiten Weltkrieg keine spezifisch österreichischen mehr sind, sind sie in diesem Buch auch nicht enthalten. Seit 1955 ist Österreich eine parlamentarische Demokratie und fortan als Mitglied der UNO und der EU Gott sei Dank in keinen Krieg mehr verwickelt worden. Das lässt uns zuversichtlich in die Zukunft schauen und eingedenk des in der obigen Überschrift wiedergegebenen Ausrufs von Murat hoffen, dass dies auch so bleiben möge. Dabei wollen wir uns stets der Worte Friedrichs II. des Großen bewusst sein, die er 1739/40 in seinem »Antimachiavell« niederschrieb: »Der Krieg ist ein solcher Abgrund des Jammers, sein Ausgang so wenig sicher und seine Folgen für ein Land so verheerend, dass es sich die Landesherren gar nicht genug überlegen können, ehe sie ihn auf sich nehmen.«
»Retta, Östreich, retta!«
Sempach, 9. Juli 1386
Papst Gregor X. wird ungeduldig. Er braucht dringend einen König für einen Kreuzzug, denn das christliche Königreich Jerusalem liegt in den Jahren 1272/73 in den letzten Zügen. Doch im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gibt es seit dem Tod des Stauferkönigs Friedrich II. im Jahr 1250 keinen Nachfolger. Es ist die Zeit des sogenannten Interregnums. Papst Gregor drängt die deutschen Kurfürsten, umgehend einen neuen König zu wählen. Andernfalls würde er selbst einen bestimmen. Das wirkt. Das Kollegium der Reichsfürsten kommt schleunigst zusammen und wählt am 1. Oktober 1273 den 55-jährigen Grafen Rudolf von Habsburg zum deutschen König. Nach der damaligen Lebenserwartung ist er bereits ein alter Mann. Kaum sitzt Rudolf I. von Habsburg auf dem Thron, da zeigt sich, dass eine neue gesellschaftliche Gruppe immer mehr zum Machtfaktor wird: die wirtschaftlich unaufhaltsam aufsteigenden Städte. Rudolf ist nicht nur ein asketischer, nüchterner und schlichter Politiker mit einer beherrschenden Adlernase, der gern auf jeden Prunk verzichtet und auf dem Marchfeld in rostiger Rüstung erscheint. Er ist auch schlau und vorsichtig, berechnend und erfolgsorientiert. Und er hat Charisma. Da die Städte ihn finanziell unterstützen und seinen Hofstaat versorgen, revanchiert er sich, indem er ihnen nicht nur den Lehnserwerb erlaubt, sondern auch Städtebünde unter königlicher Führung gestattet. Außerdem ist er bestrebt, möglichst viele Städte zu freien, zu nur dem König unterstehenden Reichsstädten zu machen und sie so dem Zugriff der Bischöfe und Fürsten zu entziehen.
Das gilt auch für die Bewohner der Gebiete um den Vierwaldstätter See. Rudolf I. behandelt die Schweizer Urkantone Schwyz, Uri und Unterwalden so, als wären sie selbstständig. Als er aber beginnt, auch hier die königliche Landfriedenspolitik durchzusetzen, wehren sich die Landgemeinden energisch gegen die Einsetzung landfremder Richter und königlicher Beamter. Überall erhebt sich der Gedanke der Selbstbestimmung, auch am Rhein, an Mosel und an Saar und in Lothringen und Schwaben. Nach dem Tod Rudolfs I. von Habsburg schließen sich die drei Schweizer Urkantone im August 1291 zum Schutz ihrer »alten Freiheiten« zum »Ewigen Bund« zusammen und sagen sich damit von der Herrschaft ihrer österreichischen Landesherren los. Die Beschwörung dieses Bundes soll auf dem Rütli erfolgt sein, so will es die Legende. Als daraufhin die Reichsacht über die Abtrünnigen verhängt wird und der österreichische Herzog Leopold I. sie vollziehen will, wird er 1315 von einem Schweizer Bauernheer bei Morgarten in einen Hinterhalt gelockt und entscheidend geschlagen. Unterstützt und begünstigt von allen Gegnern der Habsburger treten in den folgenden Jahren immer mehr Städte und Gemeinden dem in Brunnen erneuerten Bund der Schweizer Eidgenossen bei, nach Luzern 1351 Zürich, 1352 Glarus und Zug sowie 1353 auch Bern. Die habsburgischen Burgen in der Nähe werden angegriffen und zerstört und die Landgemeinden, die an der alten Herrschaft festhalten, werden verwüstet.
Die Schweizer Eidgenossen haben die Unabhängigkeit von den Habsburger Landesherren erstritten, aber der Konflikt mit dem österreichischen Nachbarn ist damit keineswegs beseitigt. Im Gegenteil, er verschärft sich noch. Im Frühjahr 1386 entschließt sich der 35-jährige ehrgeizige und tatendurstige Herzog Leopold III. von Österreich, ein Neffe Leopolds I., Besitz und Ehre seines Hauses zu retten und den alten Zustand mit Gewalt wiederherzustellen. Um die treubrüchigen Schweizer zu bestrafen, ruft er die Ritterschaft seiner habsburgischen Länder zur Heerfolge auf und wirbt zusätzlich Söldner aus ganz Europa an. Da er nicht genug Geld dafür hat, muss er einige seiner oberitalienischen Besitzungen an das reiche Venedig verpfänden. Auch aus Tirol und Mailand erhält er Hilfe.
Leopold versammelt seine Soldaten im Breisgau, nicht mehr als 3000 bis 4000 Mann. Hier setzt sich mit wehenden Bannern und von schmissigem Trompetenschall begleitet ein stolzer Heerzug in Bewegung und wälzt sich klirrend und stampfend nach Süden auf die Schweizer Kantone zu. Die schweren Plattenharnische, die kostbaren, wappengeschmückten Visierhelme der Ritter und die Panzerungen der Pferde blinken und glitzern in der Sonne. Die Ritter sind mit einem Langschwert bewaffnet, einem Dolch und einer eisenbewehrten, gut drei Meter langen Lanze. Jeder Ritter hat einige Knappen und Knechte um sich, die ihn bedienen. In der Schlacht kämpfen sie mit der Steinschleuder oder schießen mit der Armbrust. Während des Marsches reichen sie ihren adligen Herren ab und zu auf silbernen Gabeln delikate Bissen zu und in reich verzierten Pokalen köstlichen Wein. Die Ritter sind heiter und fröhlich gestimmt, denn es geht ja nicht in einen ernsthaften, ritterlichen Krieg, sondern sie sind zu einer Abstrafung unterwegs. Sie werden rauben und plündern, Äcker und Felder verwüsten, alles Vieh entführen, Frauen und Mädchen vergewaltigen und Bauern und Bürger köpfen oder an extra mitgeführten »Helsigen«, groben, derben Stricken, aufhängen. »Die Switzer wendt wir toeten, das junge und das alte bluot!« Das ist der Schlachtruf, mit dem sich die Ritter, wie uns der zeitgenössische Berner Chronist und Stadtschreiber Konrad Justinger in lebendigen Erzählungen überliefert hat, auf die untreuen Verräter stürzen werden. Einige Jünglinge haben ihren Helm abgenommen, sodass ihre nach Öl duftenden Haare in der Sonne glänzen. Hoch zu Ross tauschen sie galante Abenteuer aus, die sie mit hübschen Burgfrauen erlebt haben, und deftige, dröhnendes Gelächter auslösende Zoten machen die Runde.
In Brugg an der Aare, nur etwas mehr als 20 Kilometer nordwestlich von Zürich entfernt, hält Herzog Leopold eine glänzende Heerschau ab. Um die Kampfkraft und Stärke seines Heeres zu demonstrieren, paradieren seine Ritter öffentlich auf ihren gepanzerten Pferden und stellen Waffen und Ausrüstung zur Schau. Der Herzog ist selbst ein hervorragender Reiter und kann wie alle seine Ritter gut mit Lanze und Schwert umgehen. Aber sie werden hier wohl gar nicht kämpfen müssen. Denn wer sollte sich ihnen entgegenstellen? Oder haben die vereinten Kantone erneut ein eigenes Heer? Der Herzog ist nachdenklich geworden. Wahrscheinlich haben sie eins. Aber wo ist es? Vielleicht ist es doch besser, nicht auf einen der Hauptplätze wie Luzern oder Zürich zuzumarschieren. Denn die Bürger werden ihre Städte befestigt und vor einem Handstreich geschützt haben. Eine Überrumpelung erscheint ausgeschlossen. Und eine Einschließung ist auch kaum möglich, denn es fehlt an Belagerungsgerät. Ein kleinerer Ort lässt sich viel leichter einschließen, viel leichter besetzen. Ein Ort wie Sempach zum Beispiel. Dieser Ort, etwa 20 Kilometer nordwestlich von Luzern am Sempachersee gelegen, erscheint viel geeigneter. Da kann fast das ganze Heer draußen auf freiem Felde bleiben. Sempach bietet sich auch deshalb an, weil es im Januar 1386 in das Burgrecht mit Luzern eingetreten ist, um mit ihm zusammenzugehen und sich so seinen Schutz zu sichern. Ja, Sempach soll für diesen schändlichen Abfall von Österreich büßen! Leopold ändert seinen ursprünglichen Plan, marschiert von Brugg aus schnurstracks nach Süden und sammelt sein Heer am Sonntag, dem 9. Juli 1386, bei Sursee, einem den Habsburgern noch treu gebliebenen Ort, der an der Nordseite des Sempachersees liegt. Leopold empfängt ein paar Abgesandte aus der Umgebung, die herbeigeeilt sind, um ihm zu huldigen. Einige junge Adlige sind ganz begierig darauf, sich ihm anzuschließen und am Kampf teilzunehmen. Bereitwillig erteilt er ihnen den Ritterschlag.
Die Abbildung zeigt den ca. 30 Jahre alten Herzog Leopold III. von Österreich, der den Beinamen »der Gerechte« erhalten hat, etwa vier Jahre vor der Schlacht bei Sempach. Unter dem Porträt steht sein Wahlspruch »Virtuti nil invium«, frei übersetzt: »Der Tugend freie Bahn!«
Die Eidgenossen haben tatsächlich eine ansehnliche Streitmacht zusammenbekommen. Und sie haben das Heranrücken des österreichischen Ritterheeres auch frühzeitig bemerkt. Das war ja nicht schwer. Doch da sie zunächst glauben, es wende sich gegen Zürich, machen sie nun, als Späher melden, es bewege sich auf den Sempachersee zu, eiligst kehrt und marschieren ebenfalls in diese Richtung. Vermutlich ist die Brücke über die Reuß bei Gislikon der Ort gewesen, wo sich die zum Kampf entschlossenen Männer der vier Kantone gesammelt haben, um weiter nach Westen vorzustoßen, dem Feind entgegen. Hinsichtlich ihrer Anzahl schwanken die Quellen noch mehr als zu den Angaben auf österreichischer Seite. Die einen nennen nur 1300, andere sogar 33000 Mann. Wahrscheinlich lag die Zahl bei etwa 6000, womit das eidgenössische Heer beinahe doppelt so stark war wie das österreichische. Aber was kann ein armer Bauer oder Hirte ohne Rüstung, Pferd und Schwert schon gegen einen schwer bewaffneten Ritter ausrichten? Seine beste Waffe ist die Hellebarde, eine lange Stangenwaffe, mit der man hauen und stechen und manchmal auch einen Ritter aus dem Sattel stoßen kann. Die meisten Bauern verfügen allerdings nur über Äxte, Sensen oder Sicheln. Einige kämpfen auch mit dem gefürchteten Morgenstern. Diese mit Eisenspitzen gespickte schwere Kugel wird an einem Stiel mit Kette über dem Kopf geschwungen und kann, wenn man Glück hat, nah genug herankommt und trifft, auch einen gepanzerten Mann vom Pferd holen. Weil sie in der Bewaffnung völlig unterlegen sind, kämpfen die Bauern und Hirten nicht einzeln, sondern jeweils in einem Karree aus vier Mann. In diesen quadratischen Viererhaufen können sie sich, dicht zusammengedrängt, gegenseitig besser schützen. Einige Schweizer Bürger, die zu einem gewissen Wohlstand gekommen sind, haben mit ihrem Geld etwa 800 rheinische und niederländische Kriegsknechte angeworben. Diese Söldner sollen zwischen den einzelnen Bauernhaufen Führungsaufgaben übernehmen.
Am Morgen des 9. Juli 1386 verlässt das österreichische Heer in drei Kolonnen das Lager bei Sursee. Die erste marschiert mit Leopolds Feldhauptmann Johann von Ochsenstein an der Spitze direkt am Ostufer des Sees entlang bis Sempach und schließt den Ort ein. Von dort aus wendet sich die Kolonne die ziemlich steilen Höhen hinauf Richtung Osten auf die Reußbrücke bei Gislikon zu. Daraus haben Historiker den Schluss gezogen, dass Leopold darüber informiert gewesen sein muss, dass ihm von dort aus ein Schweizer Heer entgegenkommt. Aber sicher ist das nicht. Wahrscheinlich haben beide Seiten nicht genau gewusst, wo der Feind steht. Die zweite Kolonne des österreichischen Heeres marschiert direkt auf dem Höhenrücken und die dritte Richtung Willisau, um die rechte Flanke zu decken. Warum hat Leopold sein Heer geteilt? Strategisch notwendig war das keineswegs. Vermutlich fühlte er sich in Unkenntnis über die tatsächliche Anzahl der Feinde derart sicher und überlegen, dass er es nicht für nötig hielt, seine Kampfkraft zusammenzuhalten. Dieser Fehler wird sich bitter rächen. Alle Kolonnen haben zwar den Befehl, sofort zur Hilfe zu eilen, wenn eine von ihnen auf den Feind stoßen sollte. Sehr weit auseinander sind sie ja nicht. Aber werden sie auch rechtzeitig da sein?
Auf einer kleinen Ebene dicht vor dem Dorf Hildisrieden, etwa eine halbe Stunde östlich und oberhalb von Sempach, trifft von Ochsensteins erste Kolonne auf die Spitzen des Feindes. Die Schweizer haben die Kuppe einer steilen Anhöhe besetzt, die zu beiden Seiten durch Hohlwege und Wasserläufe geschützt ist, eine ausgezeichnete Verteidigungsstellung. Sofort sendet Ochsenstein Meldereiter zur zweiten österreichischen Kolonne, bei der sich auch Leopold befindet. Als sie kurze Zeit später zur ersten stößt, sieht der Herzog sofort: Da kommen die bepanzerten Pferde mit ihrer schweren Last kaum hinauf. Der Ritter trägt ja nicht nur ein Kettenhemd und einen Helm mit Visier, sondern auch Hose, Strümpfe, Stiefel und Fäustlinge bestehen aus stählernen Kettengliedern. Einschließlich Lanze, Streitaxt oder Streitkolben sowie Schild und Schwert hat ein Ritter ein Gewicht von nahezu einem Zentner zu tragen. Deshalb müssen Reiter und Pferd wahrlich körperliche Höchstleistungen vollbringen. Leopold befiehlt seinen Rittern abzusitzen. Sie sollen zu Fuß die Höhe erklimmen. Mürrisch und widerwillig übergeben die »Eisenmänner« ihre Pferde in die Obhut einiger Knappen. Sie führen sie zurück zur Wagenburg, wo auch Proviant und andere Vorräte gelagert sind.
Diese fragwürdige Entscheidung Leopolds ändert das Kräfteverhältnis erheblich. Denn der Sattel mit den Steigbügeln erlaubt den Reitern, darin freihändig, aber doch fest zu sitzen, sodass sie selbst im Galopp Schwert oder Lanze sicher führen können. An einen solchen, fast drei Meter hohen Koloss kommt ein Fußsoldat nur schwer heran, ein Nahkampf ist so gut wie unmöglich. Dieser Vorteil ist jetzt dahin. Hinzu kommt, dass die Beweglichkeit und Wendigkeit der Ritter zu Fuß stark eingeschränkt ist. Sie watscheln breitbeinig voran wie Enten auf trockenem Land. Und wenn sie zu Fall kommen, haben sie größte Mühe, sich wieder aufzurichten. Unter ihrer Eisenrüstung läuft der Schweiß den Körper herunter. Sie fühlen sich wie in einem Bratofen, denn die Sonne steht im Zenit und brennt unbarmherzig auf sie nieder. Es ist brütend heiß, und Himmel und Erde verschwimmen ineinander im gleißenden Licht.
Leopold ist sich sicher, dass seine gut ausgebildeten und kampferprobten Männer den Schweizern auch zu Fuß überlegen sind. Diese sorglose Überheblichkeit wird böse Folgen haben und den Ausgang einer Schlacht bestimmen, die schon gewonnen schien, bevor sie überhaupt begann. Man mag Leopold zugutehalten, dass er seine starken und schnellen Pferde schonen und schützen wollte. Er hat richtig erkannt, dass das enge, steile Gelände für eine Reiterattacke höchst ungeeignet war. Aber warum hat Leopold nicht abgewartet? Nach dem Eintreffen auch der dritten Kolonne hätten die Ritter auf ihren Pferden die Anhöhe umgehen und die Schweizer einschließen können. Stattdessen quälen sich die Ritter nun in mehreren Linien zu Fuß den Berg hinauf, mit vorgehaltener Lanze, keuchend und in zunehmendem Tempo. Jeder will der Erste sein, der dem Feind Auge in Auge gegenübersteht. Über dessen Stärke weiß Leopold so gut wie nichts. Eine gezielte Aufklärung ist unterblieben. Er nimmt an, dass er bereits alle Schweizer vor sich hat, und mengt sich, noch bevor alle seine Männer nach vorne aufgeschlossen haben, unter sie, um selbst am Kampf teilzunehmen.
Als die Schweizer sehen, dass die Ritter ohne ihre Pferde den Berg hinaufkommen, wollen sie den Vorteil der erhöhten Position nutzen und greifen unter dem schauerlichen Geheul ihrer Harsthörner ihrerseits an. Sie bilden Sturmkolonnen, die vorn wie ein Keil zugespitzt sind, und stürzen sich todesmutig auf die vorderste Reihe der Ritter. An der Spitze flattert das stolze, blau-weiße Banner von Luzern, dahinter das blutrote Tuch der Schwyzer. Aber auch Männer aus Uri und Unterwalden und anderen Regionen stürmen mit. Sie prallen auf eine eiserne Lanzenwand. Die Speerspitzen bohren sich in die Leiber der Luzerner. Als einzigen Schutz haben sie sich kleine Holzbrettchen an die Arme gebunden. Die Ritter stehen jetzt dicht an dicht und bilden drei große Vierecke, um sich so von allen Seiten zu schützen. Ihre Knappen unterstützen sie, indem sie mit gut gezielten Schüssen aus ihrer Armbrust viele Eidgenossen dahinstrecken. Das Luzerner Banner fällt, mit ihm ihr Anführer Petermann von Gundoldingen, der Schultheiß und reichste Bürger der Stadt. Als die Eidgenossen sehen, dass die Ritter nun an beiden Flügeln vorgehen und sie in die Zange nehmen wollen, bewegen sie sich Schritt für Schritt rückwärts und ziehen sich in das Meierholz zurück, einen kleinen Wald an der Straße nach Hiltisrieden. Hier haben sie einen »Letzi« errichtet, einen sperrenden und schützenden Verhau aus über 500 Baumstämmen. Auch die Österreicher haben Verluste erlitten. Aber jetzt triumphieren sie, denn es sieht ganz so aus, als sei der Sieg ihrer.
Kaum eine Schlacht des Mittelalters ist so schlecht dokumentiert wie die Schlacht bei Sempach. Es gibt eine alte Legende und ein paar Erzählungen über sie, die aber erst im 18. und 19. Jahrhundert niedergeschrieben wurden. Deshalb ist insbesondere unklar, was nach dem Rückzug der Eidgenossen ins Meierholz wirklich geschah. Vermutlich haben sie Kriegsrat gehalten und, da inzwischen auch ihre Hauptstreitmacht zu ihnen gestoßen ist, beschlossen erneut anzugreifen. Sie werfen sich auf die Knie, heißt es in der Sage, und sprechen in dumpfem Chor ihr Schlachtgebet. Als die Österreicher das hören, spotten sie: »Seht die Feiglinge, sie bitten uns auf den Knien um Gnade!« Die Eidgenossen springen jedoch auf und stürzen sich erneut in die Schlacht, angeblich mit dem jungen Arnold von Winkelried aus Unterwalden an der Spitze. Mit dem Ausruf: »Ich will euch eine Gasse bahnen, sorget für mein Weib und meine Kinder!« wirft er sich in die Lanzen der Ritter und drückt sie nieder, sodass seine Kameraden über seinen toten Körper hinweg in die Phalanx der Ritter einbrechen können. Dies ist nun, wie manches in der Schweizer Geschichte, ganz und gar erfunden. Einen Arnold von Winkelried aus Unterwalden hat es zwar wirklich gegeben. Er war ein berühmter Schweizer Söldnerführer. Aber er lebte über hundert Jahre später und fiel 1522 in der Schlacht bei Bicocca, als er versuchte, über die Spieße der französischen und spanischen Landsknechte hinweg in ihre Reihen einzudringen. In die 1476 gefertigte Abschrift einer älteren Züricher Chronik wird zum ersten Mal die Geschichte mit den niedergedrückten Speeren in der Schlacht bei Sempach eingeschoben. Aber noch ist der Name des Helden nicht genannt. Es wird auch nicht erwähnt, dass er dabei umgekommen ist. Erst 1531 erscheinen die 56 Strophen des Sempacher Schlachtliedes mit der Erwähnung des Arnold von Winkelried. Ähnlich wie später die Figur des Wilhelm Tell ist auch Arnold von Winkelried mit dem ihm in den Mund gelegten Ausspruch »Der Freiheit eine Gasse!« zum Symbol der eidgenössischen Unabhängigkeit und des Schweizer Patriotismus geworden.
Auch ohne Winkelrieds Opfertod in der Schlacht bei Sempach gelingt es den Eidgenossen, die gegnerische Phalanx in der Flanke zu fassen und sie zu durchbrechen. Umstellt von Dutzenden wendiger und wild entschlossener Krieger, die von allen Seiten auf jeden einzelnen, jetzt mit Schwert und Dolch kämpfenden Ritter zuschlagen und einstechen, sinkt einer nach dem anderen erschöpft und ermattet dahin. Die Schweizer kämpfen nicht nach den überkommenen Regeln der Ritterschaft. Deren Kodex verlangt, dass der gefangene Ritter, sofern er ein Adliger ist, mit großer Höflichkeit behandelt und gegen Zahlung eines seinem Rang angemessenen Lösegeldes wieder freigelassen wird. Die Schweizer nehmen nicht gefangen. Nein, sie stürzen sich mit lautem Gebrüll auf den Ritter und töten ihn, auch wenn er wehrlos ist und sich ergeben hat, auf der Stelle und ohne Erbarmen. Der Feldhauptmann Hans von Ochsenstein wird ebenso erschlagen wie der Tiroler Bannerträger Heinrich Karl von Kalliers samt 17 seiner Ritter, die um ihn herum vergeblich versuchen, das Banner zu verteidigen. Um das Banner des Markgrafen Otto von Baden-Hachberg scharen sich 170 Ritter und um das des Grafen von Saim sogar 300, keiner überlebt. Als auch des Herzogs Bannerträger Peter von Aarberg fällt, erschallt, wie eine Chronik berichtet, überall der laute Ruf »Retta, Östreich, retta!«
Da trifft endlich die dritte Kolonne der Österreicher auf dem Schlachtfeld ein, geführt von dem Grafen von Zollern und dem Freiherrn von Oberkirch. Aber statt in Schlachtformation in den Kampf einzugreifen, wenden sie ihre Rosse und galoppieren wieder davon. Die Knappen und Knechte, die noch am Leben geblieben sind, schwingen sich auf die Pferde ihrer getöteten Herren und folgen den fliehenden Rittern nach. Es hat nicht an Behauptungen gefehlt, da sei Verrat im Spiele gewesen. Beweisen lässt sich das nicht. Seit der Schlacht bei Marathon 490 v. Chr. hat es derartige Verrätergeschichten immer wieder gegeben. Viel wahrscheinlicher und erklärlicher ist, dass Leopolds dritte Kolonne, als sie nach ihrem Erscheinen auf dem Schlachtfeld die vielen bereits getöteten Ritter sah, einfach in Panik geraten ist.
Des Herzogs Getreue raten ihm, er solle Gott nicht versuchen und sich schnellstens an einen sicheren Ort zurückziehen. Aber Leopold eilt zur Verteidigung seines Banners herbei und antwortet: »Das will Gott nicht. So mancher Biedermann ist heute für mich in den Tod gegangen. Ich will nicht weichen von ihnen und lieber ehrlich sterben als unehrlich leben!« Er ergreift das blutgetränkte Banner und erhebt es über die Helme der noch kampffähigen Ritter. Mutig ergreift er sein Schwert und stürzt sich in das Getümmel. Umringt von Feinden und aus einigen Wunden blutend kommt er zu Fall. »Seine schwere Rüstung hinderte ihn, sich aufzurichten«, erzählt der Chronist. »Ein Mann, der ihn, so sagt man, nicht kannte, tötete ihn mit großer Mühe.« Martin Malterer, ein Ritter und Bannerträger aus Freiburg im Breisgau, der als persönlicher Beschützer schon seit neun Jahren in Leopolds Diensten steht, wirft sich auf den Leichnam, um ihn zu retten und vor weiteren Hieben zu schützen. Herzog Leopold wird einige Tage später in der Kirche des Klosters Königsfelden bei Brugg begraben, ebenso 60 seiner Ritter.
Die Sieger sinken auf dem Schlachtfeld in die Knie und danken Gott mit dem Kyrie eleison. An eine Verfolgung der fliehenden Österreicher denken sie nicht. Sie sind viel zu sehr damit beschäftigt, die Leichen der Ritter auszuplündern. In einer Chronik steht, sie seien deshalb sogar ganze drei Tage auf dem Schlachtfeld verblieben. Ludwig Feer, der tapferste der Luzerner, erhält als Geschenk das vergoldete Panzerhemd Leopolds. Die Leichen seiner getreuen Kameraden werden nach Luzern gebracht und dort begraben. Wie meistens nach Schlachten, vor allem wenn sie Jahrhunderte oder gar Jahrtausende zurückliegen, differieren die Verlustangaben beträchtlich. Die Österreicher haben wahrscheinlich etwa 400 Ritter verloren sowie um die 1100 Mann aus dem Fußvolk, darunter 200 Schwarzwälder. Eine Chronik spricht von 556 Rittern und erwähnt, 350 von ihnen wären wohl sehr hohe Adlige gewesen, denn ihre Helme hätten goldene Krönlein getragen. Einige der Gefallenen seien sogar unverwundet gewesen. Sie seien »in ihrem Harnisch und Helman versticket«, womit gemeint ist, dass sie in ihren Eisenpanzern, unter denen sie noch dickes Wollzeug trugen, um die Wucht der Schläge abzumindern, in der glühenden Hitze dieses Julitages an einem Hitzschlag gestorben sind. Von den 18 Feldzeichen Leopolds fielen 16 in die Hände der Schweizer. Das Banner von Zofingen ist nach der Überlieferung »verlorn und verrissen wurden«, weil sein Träger, dem beide Arme abgehauen worden waren, versucht hatte, es noch mit den Zähnen zu halten. Nur das Banner von Aarau konnte gerettet werden, obwohl der Schultheiß, der es trug, mit 17 seiner Männer gefallen war. Die Schweizer sollen nur 200 Mann verloren haben und 800 ihrer Söldner. Die alte Limburger Chronik nennt 600 tote Schweizer. Rechnet man die Zahl der gefallenen Söldner dazu, ergibt sich eine Verlustzahl, die auch im Jahrzeitbuch von Zurzach erwähnt wird. Es spricht von etwa 1500 Mann auf jeder Seite.