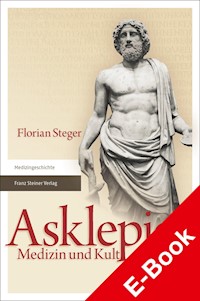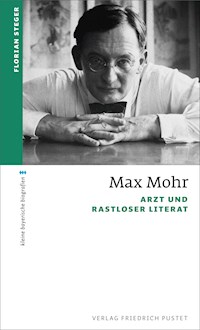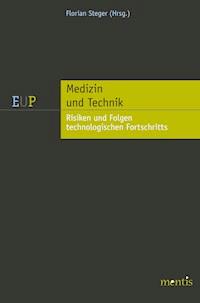Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Anfang der 70er Jahre wurde in der DDR die Anti-D-Prophylaxe eingeführt. Das verwendete Anti-D-Immunglobulin wurde aus Blutplasma hergestellt. Im Frühjahr 1978 bestand der Verdacht, dass Spender an einer Hepatitis erkrankt waren, dennoch wurde das kontaminierte Blutplasma verwendet. Im Januar 1979 häuften sich Meldungen über Hepatitiserkrankungen bei Frauen, die eine Anti-D-Prophylaxe erhalten hatten. 1979 fand ein Geheimprozess statt, Betroffene und Öffentlichkeit wurden nicht informiert. Mit der vorliegenden Untersuchung werden die damaligen Ereignisse rekonstruiert und die Folgen für die Frauen und ihre Angehörigen analysiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Studienreihe der Landesbeauftragten
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR in Sachsen-Anhalt
Sonderband
Florian Steger, Carolin Wiethoff und Maximilian Schochow
Vertuschter Skandal
Die kontaminierte Anti-D-Prophylaxe in der DDR
1978/1979 und ihre Folgen
mitteldeutscher verlag
Umschlaggestaltung unter Verwendung einer Graphik „Hepatitis nach Anti-D“ (Quelle: BArch, Bestand DQ 1/11705) und eines Ausschnitts „Anlage zur Gütevorschrift 14/76 (ARp 08/30/12-08)“ (Quelle: BArch, Bestand DQ 1/11705).
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek registriert diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten im Internet unter http://d-nb.de.
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Freigrenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
2017
© mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)
www.mitteldeutscherverlag.de
Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
ISBN 978-3-95462-829-2
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Geleitwort
Einleitung
1 Auftreten von Hepatitiserkrankungen nach der Anti-D-Immunprophylaxe und die Suche nach den Verantwortlichen
1.1 Hintergründe der Erkrankungen und erste Ermittlungen
1.1.1 Die Ereignisse 1978: Erkrankung der Spender und Anti-D-Produktion
1.1.2 Massenhaftes Auftreten von Erkrankungen in allen Bezirken der DDR im Frühjahr 1979
1.1.3 Mecklingers Anzeige und erste Befragungen der Staatsanwaltschaft
1.1.4 Einholen eines Sachverständigengutachtens
1.2 Das Ermittlungsverfahren
1.2.1 Ergebnisse der Vernehmungen und strittige Punkte
1.2.2 Auf dem Weg zur Anklage
1.3 Anklage, Hauptverhandlung und Urteil
1.3.1 Die Anklage
1.3.2 Die Hauptverhandlung
1.3.3 Das Urteil
1.4 Berufung gegen das Urteil und Abmilderung der Strafen
2 Situation der betroffenen Frauen in der DDR 1978/1979–1990
2.1 Information der Frauen und ärztliche Behandlung
2.1.1 Staatliche Weisungen zum Umgang mit den Frauen
2.1.2 Kritik aus der Bevölkerung
2.1.3 Erste Schritte: Untersuchung und Einweisung von Betroffenen ins Krankenhaus
2.1.4 Der stationäre Aufenthalt
2.1.5 Medizinische Betreuung und Leberpunktionen
2.2 Festlegung von Ausgleichszahlungen
2.2.1 Rechtliche Grundlagen des Schadensausgleichs
2.2.2 Anweisungen des Ministeriums für Gesundheitswesen
2.2.3 Regelungen der Staatlichen Versicherung
2.2.4 Forderungen der Betroffenen
2.2.5 Neuregelung der Ausgleichszahlungen
2.2.6 Weitere Beschwerden
2.3 Staatlicher Umgang mit Strafanzeigen aus der Bevölkerung
2.4 Fehler bei der Erfassung und Konsequenzen
2.5 Staatlicher Umgang mit chronischen Erkrankungen und Konsequenzen für die Erkrankten
2.5.1 Anzahl der langfristigen Erkrankungen
2.5.2 Dispensairebetreuung und Begutachtung
2.5.3 Versorgung oder Forschung?
2.5.4 Einschnitte in die Lebensplanung
3 Von der Wiedervereinigung bis heute
3.1 Auf dem Weg zu einem eigenständigen Entschädigungsgesetz
3.1.1 Situation der Betroffenen nach der Wiedervereinigung
3.1.2 Große Anfrage der SPD
3.1.3 Gespräche in den Bundesländern und Diskussionen im Bundestag
3.1.4 Stagnation und Regierungswechsel
3.2 Das Anti-D-Hilfegesetz
3.3 Weitere Kritikpunkte nach dem Anti-D-Hilfegesetz
3.3.1 Verfassungsbeschwerde und Petitionen
3.3.2 Politisches Engagement zur Verbesserung des Anti-D-Hilfegesetzes
3.3.3 Kritik der Betroffenen an Forschungsprojekten
3.4 Ausblick: Entwicklungen bis heute
4 Schluss
5 Quellen und Literatur
5.1 Quellen
5.2 Literatur
Autorenverzeichnis
Ebenfalls in der Studienreihe der Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR in Sachsen-Anhalt erschienen
Fußnoten
Geleitwort
Die Zusammenhänge und Hintergründe des hallischen Arzneimittelskandals von 1978/1979 sowie die Folgen für die betroffenen Frauen aufzuarbeiten, ist das Ziel dieser wissenschaftlichen Untersuchung. Die Aufgabe der Landesbeauftragten für Stasi-Unterlagen besteht in der Aufarbeitung der Vergangenheit, die von der Tätigkeit des Ministeriums für Staatssicherheit der ehemaligen DDR und politischer Einflussnahme belastet ist. Dazu gehören zunehmend auch Themen der Gesundheitspolitik.
Der Vorstand des Deutschen Vereins Anti-D HCV-Geschädigter e.V. wandte sich im Jahr 2014 an mich als Landesbeauftragte und bat mich um Unterstützung. In unseren Gesprächen wurde deutlich, dass die Frauen nicht nur an den Folgen des Geschehens von 1978/1979 leiden. Sie leiden auch darunter, dass sie immer wieder zu Objekten von Begutachtung und Beurteilung geworden sind. Die nahezu zeitgleiche Infektion eines „homogenen Patientinnenkollektivs“ ist objektiv ein bedeutsamer Gegenstand für Forschungsarbeit. Die Frauen fühlen sich bis heute hauptsächlich als Gegenstand von Forschung und fragen zu Recht, ob mehrfache äußerst schmerzhafte Untersuchungen an ihnen selbst und teilweise an ihren Kindern wirklich der Diagnose oder nicht eigentlich zuerst der Forschung dienten, über die sie nicht informiert worden waren.
Bis 1989 gehörte es zur Gesundheitspolitik, die Frauen zu isolieren und nicht über das Ausmaß der Krankheitsfälle in der DDR zu informieren. Die Frauen und ihre weitgehend noch unbekannte Erkrankung wurden zum Gegenstand staatlicher Untersuchung, staatlicher Verheimlichung und teilweise staatlicher Entschädigung. Die Frauen wurden auch innerhalb ihrer Aufgaben in der Gesellschaft als Mütter und als Arbeitskräfte unter Druck gesetzt, perfekt zu funktionieren. Viele betroffene Frauen haben sich von Beginn an gegen die Unterstellung von Simulation verwehren müssen. Als schwer erkrankte Patientinnen mussten sie sich immer wieder für ihre Rechte einsetzen und gegen Widerstände und Verharmlosung ankämpfen.
Erst seit 1990 war es ihnen möglich, eigene Interessensvertretungen zu bilden. Seitdem arbeiten die Frauen daran, die Hintergründe ihrer Geschichte aufzuarbeiten und zu verstehen.
Die vorliegende Arbeit ist die erste wissenschaftliche Aufarbeitung des Geschehens, die unter Einbeziehung der betroffenen Frauen entstanden ist. Die Frauen stellten den Wissenschaftlern ihre Unterlagen zur Verfügung. Dieser Beitrag unternimmt es, den Umgang mit dem hallischen Arzneimittelskandal bis in die Gegenwart hinein zu untersuchen und damit auch einen Beitrag zur aktuellen Debatte um die Fragen der Entschädigung und Anerkennung der betroffenen Frauen zu leisten.
In den Gesprächen mit den Frauen ist mir klar geworden, dass sie in den Debatten um die gesetzlichen Regelungen ihrer Entschädigung durch den Deutschen Bundestag zwar auch Hilfe und Unterstützung erfahren haben, dass ihre Unzufriedenheit mit der Praxis dieser Regelungen aber dennoch anhält. Deshalb haben sie auch Gesprächsbedarf angemeldet. Der Eindruck mangelnder Anerkennung ihrer Lebenssituation bleibt unter anderem dadurch bestehen, dass die Begutachtung der Schädigung von ihnen scharf zu kritisieren ist und Einkommenseinbußen aufgrund von Erkrankungen und Leistungsminderungen nicht berücksichtigt werden.
Diese Arbeit ist ein Gesprächsbeitrag, um einem breiten Publikum ein besseres Verständnis dieser komplizierten Materie zu ermöglichen.
Ich danke den betroffenen und vielfach engagierten Frauen für ihr Vertrauen.
Ich danke Professor Florian Steger, Carolin Wiethoff und Maximilian Schochow für ihre Einfühlung und ihre Genauigkeit. Ich hoffe sehr, dass dieser Band den Frauen den Respekt der Gesellschaft zeigen kann und dass diese unabhängige Forschungsarbeit allen Beteiligten eine gute Grundlage für weitere Beratungen sein wird.
Birgit Neumann-Becker
Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes
Einleitung
„Im Februar 1979 erhielt ich eine Zwangseinweisung in ein Krankenhaus, nachdem eine Blutkontrolle angeordnet und durchgeführt worden war. Den Grund für die Einweisung erfuhr ich nicht. Es ging mir verdammt schlecht. Beim Betreten des Krankenzimmers sahen mich elf Frauen an. Ein Bett war nur noch frei. Ich erinnere mich an einen Raum, der nur ein freihängendes Waschbecken zur Verfügung hatte. Ohne Vorhang, ohne Sichtschutz. Es war ein eher dunkler Saal mit spärlicher Beleuchtung. Die Seuchenstation erstreckte sich über die gesamte Ebene des Obergeschosses und umfasste mehrere Zimmer. Die Infektionsstationen im gesamten Land waren zu diesem Zeitpunkt gefüllt.“1 Nach acht Wochen wurde die Autorin, die unter dem Pseudonym Britt Brandenburger die Ereignisse aus dem Jahr 1979 veröffentlichte, ohne Aufklärung und ohne Diagnose aus dem Krankenhaus entlassen. Den Grund für ihre Zwangseinweisung, den wochenlangen Krankenhausaufenthalt und die Untersuchungen erfuhr Britt Brandenburger erst 1995 durch einen Zufall: Sie wurde 1978 mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter im Herbst 1978 hatte sie ein Serum zur Anti-D-Immunprophylaxe erhalten, das mit dem Hepatitis-C-Virus kontaminiert war.2 Sie wusste 17 Jahre nichts über ihre Hepatitis-C-Infektion und hatte in diesem Unwissen 1980 bei der Geburt ihrer zweiten Tochter den Virus auch auf ihr Kind übertragen. Wie Britt Brandenburger ging es vielen Frauen in der DDR. Sie wurden zwangsweise von ihren Familien getrennt, meist mehrere Wochen auf Isolierstationen festgehalten und – zumindest zunächst – ohne Aufklärung medizinisch betreut. Die Zahlen über die tatsächlichen Infektionen infolge der Anti-D-Immunprophylaxe differieren. Fest steht, dass in den Jahren 1978 und 1979 mehrere tausend Ampullen mit dem kontaminierten Serum verwendet wurden und damit ein großer Kreis von Frauen potenziell mit Hepatitis C infiziert worden war.3
Eine Anti-D-Immunprophylaxe oder Rhesusprophylaxe wird auch heute noch schwangeren Frauen verabreicht, die eine andere Rhesusgruppe als ihr Kind aufweisen. Neben den Blutgruppen A, B und 0 gibt es weitere Blutgruppenmerkmale wie das Rhesussystem. 1940 hatten Karl Landsteiner (1868–1943) und Alexander Solomon Wiener (1907–1976) das Erythrozyten-Antigen-System entdeckt.4 Rhesus-positive Individuen besitzen dieses System und damit spezielle Proteine auf der Zellmembran der Erythrozyten, den roten Blutkörperchen. Rhesus-negative besitzen das Erythrozyten-Antigen-System nicht. Der Name Rhesusfaktor geht auf die Verwendung von Erythrozyten aus dem Blut von Rhesusaffen für die Gewinnung der ersten Testseren zurück. Bei Rhesus-negativen Müttern, die ein Rhesus-positives Kind bekommen, tritt eine Rhesus-Inkompatibilität auf. Dabei bildet der Rhesus-negative Organismus Antikörper gegen die Rhesus-positiven Erythrozyten. Diese Antigen-Antikörper-Reaktion kann zu einer lebensbedrohlichen Situation führen. Daher erhalten diese Frauen während und unmittelbar nach der Schwangerschaft sowie nach einem Schwangerschaftsabbruch oder einer Fehlgeburt eine Prophylaxe mit Anti-D-Immunglobulinen. So werden die fremden Erythrozyten zerstört. Die Prophylaxe wurde in der Bundesrepublik Deutschland in den späten 1960er Jahren eingeführt.5 In der DDR war sie 1970/71 von einer Forschungsgruppe unter der Leitung des Obermedizinalrats (OMR) Dr.Wolfgang Schubert (*1924) entwickelt worden. Für die Entwicklung des Präparats und die Einführung in die Praxis wurde Schubert 1976 mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet. Er war Ärztlicher Direktor des Bezirksinstituts für das Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale). Unter seiner Leitung wurde der Impfstoff für die gesamte DDR hergestellt. Für die Produktion des Impfstoffs erhielt das Bezirksinstitut für das Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale) humanes Plasma geeigneter Spender von den anderen Bezirksinstituten der DDR.6
Im Frühjahr 1978 hatte Schubert die Information des Bezirksinstituts für Blutspende- und Transfusionswesen Neubrandenburg erhalten, dass im Bezirk Neubrandenburg mehrere Plasmaspender erkrankt waren. Das Plasma der erkrankten Spender war bereits an das Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale) geliefert und dort zu zwei Chargen mit je etwa 1.000 Ampullen Anti-D-Immunglobulin verarbeitet worden.7 Vor diesem Hintergrund stand Schubert vor der Alternative, die kontaminierten Chargen Anti-D-Immunglobulin zu vernichten und den Produktionsverlust durch Importe aus dem Nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet (NSW) zu ersetzen.8 Oder er konnte die fraglichen Chargen zurück in den Produktionsprozess geben. Der Direktor des Staatlichen Kontrollinstituts für Seren und Impfstoffe, Professor Dr.Friedrich Oberdoerster (1915–1984),9 hatte einen Import ausgeschlossen und Schubert für die Lieferung des Wirkstoffs verantwortlich gemacht. Daraufhin fasste Schubert einen folgenreichen Entschluss: Die beiden bereits fertiggestellten Chargen wurden zu einer neuen Charge umgearbeitet.10 Anschließend wurden die Chargen beim Staatlichen Kontrollinstitut für Seren und Impfstoffe zur Prüfung eingereicht, ohne darauf hinzuweisen, dass die verdächtigen Plasmen darin verarbeitet worden waren. Das Staatliche Kontrollinstitut gab die Chargen frei und das Anti-D-Immunglobulin wurde in den Bezirken der DDR verteilt.11
Ende Dezember 1978 häuften sich in der DDR Meldungen über erkrankte Frauen, die eine Anti-D-Immunprophylaxe erhalten hatten. Die Betroffenen klagten unter anderem über Oberbauchbeschwerden, Appetitlosigkeit sowie verfärbten Urin und zeigten Symptome einer Hepatitis. Der Gesundheitsminister der DDR, Obermedizinalrat (OMR) Professor Dr.Ludwig Mecklinger (1919–1994),12 hielt die Anti-D-Prophylaxe für die Ursache der Erkrankungen und ließ die verdächtigen Chargen Mitte Januar 1979 sperren.13 Zudem ordnete er an, dass alle Frauen, die seit dem 1. September 1978 eine Anti-D-Prophylaxe erhalten hatten, erfasst und medizinisch überwacht werden sollten.14 Sofern die Frauen erhöhte Blutwerte oder Symptome einer Hepatitis aufwiesen, wurden sie ins Krankenhaus zwangseingewiesen und von ihren Säuglingen, Kindern und Partnern getrennt. Im März 1979 meldeten die Krankenhäuser, dass auch Frauen erkrankt waren, die den Wirkstoff aus nachfolgenden Chargen des Anti-D-Immunglobulins erhalten hatten. Bei erneuter Kontrolle des Bezirksinstituts für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale) stellte sich heraus, dass durch Wiederverwendung einer Waschflüssigkeit diese Chargen kontaminiert worden waren. Auch diese Chargen wurden gesperrt.15 Bis Anfang September 1979 erkrankten mehrere tausend Personen, darunter auch infizierte Kontaktpersonen.16 Der Gesundheitsminister reagierte mit mehreren Anweisungen an die Bezirksärzte und erstattete Anzeige gegen Schubert und den Leiter der Technischen Kontrollorganisation des Bezirksinstituts für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale).17 Daraufhin leitete die Generalstaatsanwaltschaft der DDR ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden ein.
Das Hepatitis-C-Virus wurde erst Ende der 1980er Jahre entdeckt und erhielt seinen Namen. Zuvor war lediglich bekannt, dass es neben der Hepatitis A und B weitere Typen gab, die allgemein unter dem Begriff Non-A-Non-B-Hepatitis zusammengefasst wurden.18 Bei vielen Frauen, die in der DDR mit der kontaminierten Prophylaxe infiziert worden waren, wurde die Erkrankung chronisch und verlief mit jahrelangen Beschwerden. Diese betrafen nicht nur die Leber, sondern äußerten sich als sogenannte extrahepatische Manifestationen in Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Gelenkschmerzen, Gefäßerkrankungen sowie psychischen Beschwerden.19 Eine öffentliche Debatte zu den Ereignissen von 1978/1979 wurde in der DDR nicht geführt. Der Prozess gegen die Beschuldigten verlief unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Infektionen wurden als Impfschaden bewertet und nach der Zweiten Durchführungsbestimmung zum „Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen“ (GÜK) vom 27. Februar 1975 behandelt.20 Einige Frauen erhielten Entschädigungsleistungen. Auch Lohnausgleichszahlungen wurden in den folgenden Jahren vorgenommen. Mitte der 1990er Jahre waren Verbände der Betroffenen entstanden, der Bundesverband Anti-D-geschädigter Frauen e.V. und der Deutsche Verein HCV-Geschädigter e.V. Diese forderten von der Bundesregierung eine Entschädigung und eine öffentliche Anerkennung. Im Jahr 2000 wurde von der rot-grünen Bundesregierung das Anti-D-Hilfegesetz erlassen, welches „die unbefriedigende Situation“ der Betroffenen verbessern sollte.21 Das Anti-D-Hilfegesetz gewährte einem Teil der Frauen eine Einmalzahlung sowie monatliche Renten. Die Voraussetzung für den Bezug einer Rente und den Erhalt einer Einmalzahlung wurde an die Minderung der Erwerbsfähigkeit geknüpft und nach dem jeweiligen Grad gewährt.22
Durch zahlreiche Initiativen der Betroffenen-Verbände rückten die Ereignisse der Jahre 1978/1979 in die Öffentlichkeit. Die persönlichen Schilderungen von Britt Brandenburger trugen dazu ebenso bei23 wie ein Film der beiden Journalistinnen Anne Mesecke und Ariane Riecker aus dem Jahr 2012. Unter Rückgriff auf Archivalien und Zeitzeugeninterviews stellten sie die Geschichte aus journalistischer Sicht dar.24 Der Film entstand für den Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Er hat eine breite Resonanz gefunden, so auch bei sächsischen Ärzten, die ihn für „absolut entbehrlich“ halten, da er „fachlich historisch unzureichend und theatralisch politisch“ sei.25 Eine erste wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den rechtlichen Aspekten nach der Wiedervereinigung wurde von Elke Beatrice Käser in ihrer juristischen Dissertation vorgelegt.26 Dennoch fehlt bisher eine wissenschaftliche Arbeit, die sich umfassend mit den Ereignissen auseinandersetzt und diese kritisch in den Blick nimmt.
Die Kontamination von Anti-D-Immunglobulin-Chargen mit Hepatitis-C-Viren ist nicht auf die DDR beschränkt. Zwischen 1977 und 1978 wurden in Irland unwissentlich Chargen mit Hepatitis-C-Viren verwendet. Eine 1996 eingesetzte Untersuchungskommission kam zu dem Ergebnis, dass das Blutplasma einer einzigen erkrankten Person zu der Kontamination geführt hatte.27 Vor diesem Hintergrund ist die wissenschaftliche Bearbeitung der Geschichte der Hepatitis-C-Infektionen, des Strafprozesses und des Umgangs mit den betroffenen Frauen in der DDR notwendig, die den politischen Kontext beachtet. Das Gesundheitswesen der DDR war staatlich organisiert und unterstand dem direkten Einfluss der SED. Mit Mecklinger war erstmals ein SED-Mitglied Gesundheitsminister.28 Die Ereignisse aus den Jahren 1978/1979 zeigen, dass neben dem Gesundheitsminister weitere Personen aus dem Bereich des Gesundheitswesens als politische Akteure handelten. In jüngst veröffentlichten Arbeiten zu den geschlossenen Venerologischen Stationen in der DDR wurde herausgearbeitet, wie stark die Medizin in der DDR politisiert war. Danach beschränkten sich die Akteure bei ihrem Handeln nicht nur auf eine bloße Übernahme politischer Vorgaben. Sie prägten das politische System selbst durch ihre Normen, die sie in der alltäglichen Praxis anwandten.29 Der Alltag in den geschlossenen Venerologischen Stationen war durch Zwangseinweisungen, Isolation und Terror geprägt. Die Patientinnen in den geschlossenen Venerologischen Stationen wurden ohne Aufklärung und gegen ihren Willen über mehrere Wochen zwangsweise behandelt.30 Auch die Frauen, die durch eine kontaminierte Prophylaxe infiziert worden waren, wurden plötzlich, zum Teil in Unkenntnis über den Grund, monatelang von ihren Familien getrennt. Sie wurden von einer politisierten Medizin versorgt und teilweise für wissenschaftliche Forschungsprojekte eingesetzt. So ist danach zu fragen, welche persönlichen Folgen die Ereignisse für sie und ihre Angehörigen hatten. Zudem waren die infizierten Frauen direkt von den Maßnahmen des staatlichen Gesundheitswesens betroffen, die näher untersucht werden sollen. Inwiefern wurde durch staatliche Institutionen reagiert und wie wurde dabei mit den Frauen umgegangen? Untrennbar hängt damit die Frage nach einer fürsorglichen Verantwortungspflicht vonseiten des medizinischen Personals, aber auch vonseiten staatlicher Institutionen zusammen. Dabei gilt es nach einer umfassenden Aufklärung der Patientinnen ebenso zu fragen wie nach der anschließenden medizinischen Versorgung. Hier ist auch zu fragen, inwiefern die ärztliche Behandlung von Forschungsinteressen geleitet war und ob diese transparent kommuniziert wurden.
Eine Trennung zwischen ökonomischer Entwicklung und dem Gesundheitswesen in der DDR kann ebenso wenig vorgenommen werden wie die Trennung von politischem Unrecht und den medizinischen Folgen für die Betroffenen.31 Aktuelle Forschungen hierzu belegen, welche Konsequenzen eine politische Verfolgung auf den weiteren Lebensweg der Betroffenen hatte.32 Eine zentrale Rolle kommt dabei dem Ministerium für Staatssicherheit zu, das Einfluss auf den Bereich des Gesundheitswesens hatte.
So war gerade unter den Ärztinnen und Ärzten der DDR eine informelle Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit besonders ausgeprägt – insbesondere im Bereich der Psychiatrie und der Sportmedizin.33 Dabei kam vor allem den Bezirksärzten eine wesentliche Rolle zu.34 Es hat sich gezeigt, dass Ärztinnen und Ärzte in leitenden Funktionen von der Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit profitierten, indem sie sich Vorteile für ihre Forschung und für die medizinischen und biotechnischen Entwicklungen ihrer Kliniken beschafften.35 Denn das Gesundheitswesen war stark unterfinanziert und blieb trotz der Aufwertung der Sozialpolitik Anfang der 1970er Jahre bei der Mittelzuteilung benachteiligt.36 Die Ereignisse der Jahre 1978/1979 sind von diesem Mangel geprägt, da das Spenderplasma rar war und das Staatliche Kontrollinstitut für Seren und Impfstoffe einen Import aus dem Nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet (NSW) abgelehnt hatte. Das Ministerium für Staatssicherheit war auch in die Ermittlungen involviert, wie es zu der Kontamination der Chargen gekommen war. Es nahm Einfluss auf die Ermittlungen und begleitete das Strafverfahren.
Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert: Im ersten Kapitel werden die Hintergründe des Geschehens dargestellt. So stehen das Auftreten von Hepatitiserkrankungen nach der Anti-D-Prophylaxe und die Suche nach den Verantwortlichen im Vordergrund. Offiziell ermittelte die Staatsanwaltschaft Halle (Saale) in enger Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Das Ermittlungsverfahren endete schließlich mit einer nicht-öffentlichen Anklage. Schubert und der Leiter der Technischen Kontrollorganisation des Bezirksinstituts für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale) wurden zu Gefängnisstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden, verurteilt. Die ausgewerteten Akten des Ermittlungsverfahrens geben Aufschluss über die Hintergründe der Erkrankungen, aber auch über den Umgang mit den beiden Beschuldigten und über die Einschätzung der Angelegenheit durch die Verantwortlichen in der DDR. Hier stehen folgende Fragen im Vordergrund: Wusste das Ministerium für Gesundheitswesen von der Kontamination der Chargen? Welche Rolle spielten die zuständigen Prüfinstanzen wie das Staatliche Kontrollinstitut für Seren und Impfstoffe? Wie wurde die Verantwortung der beiden Beschuldigten gewertet und zu welcher Einschätzung kommen wir heute? Welche Rolle hatte das Ministerium für Staatssicherheit bei den Ermittlungen?
Im zweiten Kapitel wird auf die Situation der betroffenen Frauen eingegangen. Wie wurden die Frauen 1979 und auch danach über die Ereignisse und die Folgen für ihre Gesundheit aufgeklärt? Wie sahen der Krankenhausaufenthalt und die ärztliche Behandlung der Frauen aus? Hatten sie die Möglichkeit einer freien Arztwahl und welche Rechte hatten sie in Bezug auf die ärztliche Behandlung? Zum anderen stellt sich die Frage nach einer materiellen Entschädigung der Frauen durch die DDR. Die Erkrankungen wurden in der DDR als Impfschäden erfasst, und es wurden nach dem „Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen“ (GÜK) Ausgleichszahlungen gewährt. Hier war auch die Staatliche Versicherung der DDR involviert, welche die Zahlungen vornahm. Neben den unmittelbaren Maßnahmen des Ministeriums für Gesundheitswesen und der sich daraus ergebenden Situation für die Betroffenen wird auch nach langfristigen Erkrankungen gefragt. Wie wurden die Frauen bei längerer Erkrankung ärztlich behandelt und finanziell unterstützt? Dabei stellt sich insbesondere die Frage nach der ärztlichen Versorgung und dem Forschungsinteresse der beteiligten Ärztinnen und Ärzte. Inwiefern war die ärztliche Behandlung von Forschungsinteressen geleitet und welche Rolle spielten in diesem Zusammenhang staatliche Institutionen? Inwiefern waren die Untersuchungen notwendig für eine Heilung oder Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Frauen? Wurden Untersuchungen an den Frauen vorgenommen, die ausschließlich der Forschung dienten?
Im dritten Kapitel wird auf die Situation der Frauen nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung eingegangen. Die Frauen waren mit einem neuen politischen System konfrontiert, das sie nicht kannten. Sie konnten sich zusammenschließen, ihre Interessen bündeln und sich aktiv für ihre Rechte einsetzen. Vor allem aber konnten sie die Öffentlichkeit über das ihnen geschehene Unrecht aufklären. Untersucht wird, wie die Frauen mit einer chronischen Erkrankung für ihre Anerkennung und Entschädigung kämpften, und wie diese durch politische Initiativen unterstützt wurden. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang ihre Versorgung in der DDR? In diesem Teil wird dargestellt, welche Schwierigkeiten für die betroffenen Frauen nach der deutschen Wiedervereinigung auftraten und welche Streitpunkte zwischen den Frauen und der Bundesregierung bestanden. In einem Schlusskapitel werden die Ergebnisse zusammengeführt und diskutiert.
Für die Untersuchung der Fragen standen zahlreiche Quellen zur Verfügung. Zum einen konnten wir auf die Akten der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) zurückgreifen, die einen Einblick in das Ermittlungsverfahren und die Ursachen der kontaminierten Anti-D-Prophylaxe geben. Ergänzt wurden diese durch Akten der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU), die Aufschluss über die Aktivitäten des Ministeriums für Staatssicherheit in dieser Hinsicht ermöglichen. Die Situation der Betroffenen in der DDR konnten wir anhand von Dokumenten rekonstruieren, die uns von den Frauen zur Verfügung gestellt wurden. Zudem haben wir den Bestand des Ministeriums für Gesundheitswesen (DQ 1) im Bundesarchiv Berlin ausgewertet, um Fragen zur ärztlichen Behandlung, den Ausgleichszahlungen und der Forschung an den Patientinnen zu beantworten. Der Bestand DQ 1 beinhaltete zudem zahlreiche Eingaben von Frauen an die staatlichen Stellen der DDR in den Jahren 1979 bis 1989/90. Die Ereignisse nach der Wiedervereinigung lassen sich anhand der uns zur Verfügung gestellten Schriftstücke des Deutschen Vereins HCV-Geschädigtere.V. rekonstruieren. Den gesamten Quellenbestand haben wir quellenkritisch ausgewertet. Darüber hinaus haben wir die Methode der Oral History genutzt und mit betroffenen Frauen narrative Interviews durchgeführt. Diese haben uns einen Einblick in die individuellen Erfahrungen und die persönliche Situation gegeben.37 Zudem wurden von betroffenen Frauen Fragebögen ausgefüllt, die von uns ebenfalls kritisch ausgewertet wurden. Wir haben versucht, alle Akteure anzusprechen und mit ihnen ein Gespräch zu führen. Leider standen nicht alle Verantwortlichen gleichermaßen als Gesprächspartner zur Verfügung.
Wir haben uns entschlossen, einige Namen von Ärzten nicht zu anonymisieren, da sie in Medienberichten und vorangegangenen Publikationen mehrfach öffentlich gemacht worden sind und in Datenbanken eingesehen werden können. Allen Zeitzeugen, die mit uns ein Interview führten, haben wir Anonymität zugesichert. An diese Vereinbarung werden wir uns halten. Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte werden alle Namen real existierender oder bereits gestorbener Personen aus den Archivunterlagen des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU), der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) (StA Halle (Saale)) sowie des Bundesarchivs (BArch) vollständig anonymisiert. Damit sind Rückschlüsse auf die Identität dieser Personen nicht möglich.
Für die Begleitung des Projekts und die finanzielle Unterstützung möchten wir uns bei der Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Frau Birgit Neumann-Becker, bedanken. Dank gilt darüber hinaus dem Leitenden Oberstaatsanwalt Halle (Saale), Herrn Jörg Wilkmann, der uns durch die Einsicht in die Akten eine detaillierte Betrachtung des Ermittlungsverfahrens ermöglicht hat. Besonders bedanken möchten wir uns bei den betroffenen Frauen, die das Projekt initiierten, mit uns Interviews geführt und uns umfassendes Material zur Verfügung gestellt haben. Dank gilt darüber hinaus Frau Nadine Wäldchen, Frau Silvia Fischer und Frau Nicole Adam für ihre vielfältige Unterstützung.
1 Auftreten von Hepatitiserkrankungen nach der Anti-D-Immunprophylaxe und die Suche nach den Verantwortlichen
1.1 Hintergründe der Erkrankungen und erste Ermittlungen
1.1.1 Die Ereignisse 1978: Erkrankung der Spender und Anti-D-Produktion
Am 17. April 1978 erhielt der Leiter des Bezirksinstituts für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale), Wolfgang Schubert, einen Anruf des Ärztlichen Direktors des Bezirksinstituts für Blutspende- und Transfusionswesen Neubrandenburg. Dieser teilte Schubert mit, dass zwei Spender, deren Blut zur Produktion von Anti-D-Immunglobulin an das Institut in Halle (Saale) geliefert worden war, möglicherweise an Hepatitis erkrankt waren. Bei den beiden Spendern handelte es sich um einen Mann und eine Frau.38
Der Ärztliche Direktor des Bezirksinstituts Neubrandenburg hatte selbst erst an diesem Tag von der Oberschwester und dem Oberarzt erfahren, dass sich mehrere Spender mit Symptomen einer Hepatitis im Bezirkskrankenhaus befanden.39 Insgesamt handelte es sich um fünf Personen. Die Plasmaspender waren vor ihrer Spende mit den Erythrozyten einer Antigen-Spenderin immunisiert worden. In Neubrandenburg waren aufgrund des Ausfalls einer langjährigen Spenderin die Erythrozyten einer anderen Spenderin verwendet worden.40 Diese „Boosterung mit einem möglicherweise infektiösen Blut“ hatte bereits am 23. Februar 1978 stattgefunden.41 Das Blut der zwei Spender war dem Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale) im März 1978 zugegangen. Auf dem Lieferblatt war nachträglich notiert worden, dass am 17. April 1978 eine Meldung an Schubert erfolgt war, dass die gelieferten Proben unter „Hepatitis-Verdacht“ standen.42 Das Material der drei anderen erkrankten Spender war zeitgleich an das Staatliche Institut für Immunpräparate und Nährmedien (SIFIN) versandt worden.43 Diese Plasmen waren nicht für die Produktion in Frage gekommen, „da sie einen spezifischen Titer aufwiesen, der für die Herstellung des Human-Immunglobulin-Anti-D zu niedrig war.“44 Auch das Staatliche Institut für Immunpräparate und Nährmedien hatte am 17. April 1978 eine entsprechende Meldung erhalten.45 Die Oberschwester des Neubrandenburger Bezirksinstituts sagte später aus, dass sie dem Ärztlichen Direktor anhand der Speditionskarte mitgeteilt habe, wohin die Plasmen gegangen waren. Daraufhin hatte dieser zunächst mit dem Institut für Immunpräparate und Nährmedien und anschließend mit dem Bezirksinstitut in Halle (Saale) telefoniert.46
Schnell bestand im Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Neubrandenburg der Verdacht, dass die Erythrozytenspenderin die Ursache für die Erkrankungen war.47 Der Oberarzt und Leiter der Abteilung Blutgruppenseren hatte diese am 17. April 1978 in das Bezirkskrankenhaus zur Leberbiopsie überwiesen. Verbunden war dies mit dem Hinweis, dass die Übertragung des Erythrozytensediments der Spenderin vermutlich bei fünf Personen eine Hepatitis ausgelöst hatte. Die Erythrozytenspenderin hatte um Weihnachten 1977 über Appetitlosigkeit und Völlegefühl mit Schmerzen unter dem rechten Rippenbogen geklagt. Die Leber war „tastbar“ und „druckschmerzhaft“ gewesen.48
Die Erkrankung der anderen Spender war schon einige Tage, bevor der Ärztliche Direktor informiert worden war, im Bezirksinstitut Neubrandenburg bekannt geworden. Denn bereits am 8. und 10. April 1978 waren die beiden Spender, deren Plasma nach Halle (Saale) gegangen war, in das Bezirkskrankenhaus Neubrandenburg eingeliefert worden. Der Oberarzt des Bezirksinstituts für Blutspende- und Transfusionswesen Neubrandenburg hatte kurz darauf die telefonische Information von dort erhalten, dass beide aufgrund einer infektiösen Erkrankung aufgenommen worden waren. Dabei habe der Oberarzt des Bezirkskrankenhauses „möglicherweise“ von einem Verdacht auf Hepatitis gesprochen und auf einen „Zusammenhang zwischen der Spendertätigkeit dieser beiden Personen und ihrer Erkrankung“ hingewiesen.49 Daraufhin waren die anderen Spender in das Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen bestellt worden. Der dortige Oberarzt hatte sie persönlich untersucht, ihnen Blut abnehmen lassen und sie anschließend in das Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Ihm war schnell klar geworden, dass entweder das Blut der Antigen-Spenderin oder eine Infektion durch eine „andere Kontaktperson, die alle 5 gemeinsam hatten“ die Ursache gewesen war. In späteren Zeugenvernehmungen konnte er sich nicht mehr daran erinnern, ob er vor dem 17. April 1978 mit dem Ärztlichen Direktor darüber gesprochen hatte.50 Die Oberschwester des Bezirksinstituts in Neubrandenburg gab später an, dass sich die anderen Spender nach eigenen Aussagen nicht krank gefühlt hätten.51 In der akuten Erkrankungsphase hatten die Tests erhöhte Serum-Glutamat-Pyruvat-Transaminase-Werte (SGPT-Werte) ergeben.52 Der Serum-Glutamat-Pyruvat-Transaminase-Wert bezieht sich auf ein Leberenzym, dessen erhöhte Konzentration im Blut auf eine Schädigung der Leber hinweisen kann. Das Institut in Neubrandenburg hatte die Spenderplasmen auf HBs-Antigen, also das Hepatitis-B-Virus, testen lassen. Da der Antigennachweis „mit keiner Methode gesichert“ werden konnte, hatte der Ärztliche Direktor des Neubrandenburger Instituts gegenüber der Kreisärztin darauf hingewiesen, dass er von einer Hepatitis A ausging.53 Der Oberarzt des Bezirksinstituts behauptete später allerdings, dass er und der Ärztliche Direktor „von Anfang an alle 3 Hepatitisformen in Erwägung gezogen“ hätten. Er betonte in diesem Kontext auch, dass ein negatives Ergebnis der Untersuchungen auf Hepatitis B „nicht zur Verarbeitung der als infektiös gemeldeten Plasmen der Spender hätte führen dürfen.“54
Doch dies war bereits geschehen, denn das Plasma war in Halle (Saale) schon zu zwei Chargen, die mit einer fortlaufenden Nummerierung versehen wurden (60378 und 70478),55 verarbeitet worden.56 Eine Charge umfasste etwa 1.000 Ampullen. Schubert gab später an, dass aufgrund der unterschiedlichen Qualität das Plasma von etwa zehn Spendern miteinander verarbeitet werden müsse. „Global“ könne man davon ausgehen, dass in einer Charge ein Zehntel des Plasmas der erkrankten Spender verarbeitet wurde.57
Zum Zeitpunkt des Anrufs aus Neubrandenburg war noch alles unter Verschluss. Schubert ließ das Material sofort durch eine Mitarbeiterin sperren.58 Außerdem rief er unverzüglich das Institut für Impfstoffe Dessau an und sandte diesem zwei Ampullen der Chargen 6 und 7 mit der Bitte zu, diese im Radio-Immun-Assay (RIA) auf das HBs-Antigen, den Nachweis auf das Hepatitis-B-Virus, zu testen. Gleichzeitig hatte er das Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Neubrandenburg gebeten, per Eilpost drei Proben nach Dessau zu schicken.59 Dies war noch am 17. April 1978 geschehen. Der Ärztliche Direktor des Neubrandenburger Instituts bezog sich auf Schuberts Anruf in Dessau und bat darum, drei Seren auf HBs-Antigen im Radio-Immun-Assay zu testen. Es handelte sich dabei um Seren der beiden Spender, die nach Halle (Saale) gegangen waren, sowie das Serum der Antigen-Spenderin. Daneben waren auch Proben der drei anderen Spender und der ursprünglichen Antigen-Spenderin, die wegen einer nicht näher benannten Erkrankung ausgefallen war, an das Institut für Impfstoffe gegangen. Insgesamt hatte dieses sieben Proben aus Neubrandenburg erhalten. Der Ärztliche Direktor des Neubrandenburger Bezirksinstituts bat darum, die anderen Proben ebenfalls zu untersuchen, „da hierbei unter Umständen versicherungsrechtliche Fragen relevant werden können.“60 Dieser Hinweis hatte den Hintergrund, dass eine Schadensregulierung erfolgen sollte. Es war vorgesehen, den entstandenen Schaden nach der „Verordnung über die Erweiterung des Versicherungsschutzes bei Unfällen in Ausübung gesellschaftlicher, kultureller oder sportlicher Tätigkeiten“ vom 11. April 1973 zu entschädigen.61
Neben dem Material der erkrankten Plasma- und Erythrozytenspender hatte das Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale) weiteres Material testen lassen. Denn Schubert ging davon aus, dass man Hepatitisviren durch eine Fraktionierung von Plasma eliminieren konnte. Zu diesem Zweck hatte er Material, welches Australia-Antigen enthielt, ein Protein, das auf das Hepatitis-B-Virus hinweist, vor und nach der Fraktionierung testen lassen. Dabei war das Plasma normaler Blutspender verwendet worden, welche aufgrund eines hohen HBs-Gehaltes im Blut für die klinische Verwendung ausgeschieden waren.62 Die Leiterin der Laborabteilung des Bezirksinstituts Halle (Saale) schickte Ende April 1978 weitere Proben an das Institut für Impfstoffe Dessau. Es handelte sich hierbei um zwei Ampullen Plasma, welches für die Fraktionierung des Gammaglobulins (IgG) verwendet worden war, und zwei Ampullen einprozentige Gammaglobulin-Lösung. Die Leiterin der Laborabteilung bat darum, die Proben auf „Australia-Antigen“ zu prüfen.63
Die ersten Testergebnisse lagen im Institut für Impfstoffe Dessau am 27. April 1978 vor.64 Damit waren beide Proben der verdächtigen Chargen 6 und 7 negativ getestet worden. Die vier weiteren übersandten Ampullen aus dem Bezirksinstitut Halle (Saale) waren hingegen alle positiv getestet worden. Die Werte der vom Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Neubrandenburg übersandten Proben variierten stark.65 Der zuständige Mitarbeiter des Instituts für Impfstoffe teilte Schubert am 16. Mai 1978 die Ergebnisse der Testung mittels Radio-Immun-Assay (RIA) mit. Hierbei bezog er sich auf alle Proben, die er sowohl aus Halle (Saale) als auch aus Neubrandenburg erhalten hatte. Die Proben, die dem Institut für Impfstoffe nachträglich aus Halle (Saale) zugesandt wurden, waren positiv, die Ampullen der Chargen 6 und 7 negativ getestet worden. Auch die Spender waren in der Liste aufgeführt. Alle sieben Proben aus Neubrandenburg waren negativ auf Hepatitis B getestet worden.66
Das Neubrandenburger Institut hatte zudem Proben der Spenderplasmen an das Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen in Magdeburg und das Bezirkshygieneinstitut in Erfurt geschickt. Diese wurden in unterschiedlichen Testverfahren geprüft und wiesen ebenfalls negative Testergebnisse auf.67 Auch das Bezirksinstitut in Halle (Saale) hatte den im Magdeburger Bezirksinstitut möglichen Hämagglutinationstest genutzt. Mit diesem waren das Ausgangsplasma und die Lösung auf HBs-Antigen getestet worden. Die Ergebnisse trafen am 8. Mai 1978 in Halle (Saale) ein. Das Ausgangsplasma war positiv getestet worden, die Gammaglobulin-Lösung negativ.68
Die Leiterin der Laborabteilung des Bezirksinstituts für Blutspende- und Transfusionswesen in Halle (Saale) hatte zudem zwei Proben an das Staatliche Institut für Seren und Impfstoffe in Berlin geschickt. Sie bat einen dortigen Mitarbeiter „wie telefonisch abgesprochen“ um eine Kontrolluntersuchung. Geprüft werden sollte das HBsAg-positive Plasma, das zur Fraktionierung verwendet worden war, ebenso wie die einprozentige Lösung.69 Die Tests mittels einer Überwanderungselektrophorese ergaben, dass das Ausgangsplasma positiv und die Lösung negativ getestet worden war. Dieses Ergebnis teilte das Kontrollinstitut am 31. Mai 1978 Schubert mit.70
Insgesamt hatten also mehrere Tests mit drei verschiedenen Prüfmethoden stattgefunden. Dabei waren in allen Verfahren die Proben der Spender negativ auf Antikörper gegen das Hepatitis-B-Virus getestet worden. Gleiches galt für die Proben der beiden in Halle (Saale) angefertigten Chargen, die ebenfalls keinen Nachweis auf das Hepatitis-B-Virus ergaben. Gleichzeitig war in den unterschiedlichen Prüfverfahren das Ergebnis der Fraktionierung eines Australia-antigenhaltigen Ausgangsplasmas getestet worden. Das Ausgangsmaterial enthielt laut aller Tests das HBs-Antigen. Bei der geprüften Lösung, die nach der Fraktionierung entstanden war, ergaben die Tests unterschiedliche Ergebnisse. Während die Testverfahren aus Magdeburg und dem Kontrollinstitut Berlin ein negatives Ergebnis erzielt hatten, war das Material im Institut für Impfstoffe Dessau positiv getestet worden, enthielt damit also noch Antikörper gegen das Hepatitis-B-Virus.
Im Mai 1978 lagen die Ergebnisse der Leberbiopsien vor. Diese hatten bei den zwei Spendern, deren Proben in Halle (Saale) verarbeitet worden waren, eine akute Virushepatitis ergeben. Am 23. Mai 1978 übersandte der Oberarzt der Medizinischen Klinik Neubrandenburg die Befunde an das dortige Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen. Bei beiden Spendern war der Verlauf komplikationslos und ohne klinische Testsymptome. Beide waren im April 1978 erkrankt und wiesen ähnliche Symptome auf, unter anderem Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Kopfschmerzen und eine Gelbfärbung.71 Auch die anderen drei Spender waren an einer akuten Virushepatitis erkrankt. Dies hatte die Klinik für Innere Medizin Neubrandenburg der zuständigen Kreisärztin bereits am 8. Mai 1978 mitgeteilt.72
Am 1. Juni 1978 unterrichtete Schubert das Staatliche Institut für Seren und Impfstoffe von den Testergebnissen der Spenderplasmen. Er ging zudem auf das Plasma ein, das nach der Fraktionierung getestet worden war. Einzig im RIA-Test sei dieses „schwächer positiv als das Ausgangsmaterial“ gewesen.73 Nur falls man diesem Testverfahren „einen absoluten Beweiswert und keine Unspezifität“ zuordne, könne widerlegt werden, dass das Fraktionierungsverfahren „hepatitissicher“ sei.74 Schubert sah daher gegen die Verwendung der Chargen keinen Einwand. Doch die stellvertretende Direktorin des Kontrollinstituts erteilte ihm eine klare Absage. Nach Rücksprache mit dem Direktor des Kontrollinstituts, Friedrich Oberdoerster, sei entschieden worden, die beiden Chargen nicht für den Verkehr freizugeben. Sie lehnte einen Einsatz klar ab: „In Anbetracht der Unsicherheit bezüglich der klaren Aussage zur Diagnose Hepatitis, wie Sie sie hier auch im letzten Absatz Ihres Schreibens formuliert haben, sind wir der Meinung, daß wir in dieser Angelegenheit kein Risiko eingehen können.“75
Doch Schubert gab sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Er teilte einige Tage später mit, dass er auch aus medizinischer Sicht keinen Grund gegen den Einsatz dieser Chargen sehe. Schubert wies darauf hin, dass sein Institut seit zehn Jahren Anti-D-Immunglobulin herstelle, ohne dass jemals eine Hepatitisübertragung beobachtet worden sei. Die Plasmafraktionierung sei eingeführt worden, um das Hepatitisrisiko so weit wie möglich zu senken. Gleichzeitig unterrichtete er das Kontrollinstitut davon, noch eine weitere Charge „einbeziehen“ zu wollen: Es handelte sich hierbei um die Charge 90677, welche „leicht pyrogenhaltig“ sei. Dies hielt Schubert für „klinisch irrelevant“, da das Präparat in fünf Milliliter aufgelöst werde.76 Schubert machte der Stellvertretenden Direktorin des Kontrollinstituts deutlich, dass das Material knapp sei und mit einem Engpass gerechnet werden müsse. Denn die Herstellung von Immunglobulin-Anti-D im Bezirksinstitut in Halle (Saale) sollte aufgrund von Baumaßnahmen 1979 eingestellt werden. Stattdessen war vorgesehen, dass das Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen in Neubrandenburg die Produktion übernahm. Doch das Ministerium für Gesundheitswesen hatte telefonisch mitgeteilt, dass sich die Übernahme verzögere, da das Bezirkskrankenhaus nicht planmäßig fertiggestellt werde. Die Räume, die für die Produktionsübergabe benötigt wurden, hatte das Zentrallabor des Bezirkskrankenhauses belegt. Schubert führte an, dass damit 1979/80 eine „Produktionslücke“ entstehe, welche nur durch Importe aus dem Nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet (NSW) gedeckt werden könne, wenn „die Durchführung der Rh-Prophylaxe nicht zeitweilig unterbrochen werden soll.“ Er bat das Kontrollinstitut aus diesem Grund darum, den Standpunkt noch einmal zu überdenken. Eine Durchschrift des Schreibens hatte er an die Stellvertreterin des Ministers für Gesundheitswesen gesandt, „wegen der großen Bedeutung, die dem Problem an sich zukommt.“77
Daraufhin antwortete Oberdoerster persönlich. Er teilte mit, dass Schubert selbst in seinem Brief vom 1. Juli 1978 in Hinsicht auf das Hepatitis-Risiko zum Ausdruck gebracht habe, dass ein Risiko nicht auszuschließen sei und lehnte eine Verwendung der Chargen ab. Auch die von Schubert angesprochene Charge 90677 sei nach erneuter Prüfung „nach wie vor pyrogenhaltig und damit für die klinische Anwendung nicht zu verantworten.“78 Zu den von Schubert angesprochenen Problemen drohte Oberdoerster offen: „Die Bemerkung im letzten Abschnitt ihres Briefes vom 23.6.1978 bitte ich, gründlich zu überdenken. Sie sind als Produzent des registrierten Präparats entsprechend den arzneimittelgesetzlichen Bestimmungen verantwortlich für die Lieferung einer ausreichenden Menge in der geforderten Qualität und auch dafür, daß es ohne Unterbrechung zur Verfügung steht. Sie meinen doch wohl nicht ernsthaft, daß im Falle, daß Sie dieser Verantwortung nicht nachkommen, die Rh-Prophylaxe in der DDR zeitweilig unterbrochen werden könnte. Einer derartigen Entscheidung kann unter keinen Umständen entsprochen werden. Das gleiche trifft auf den von Ihnen angedeuteten NSW [Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet]-Import zu, wenn ein Präparat für einen Produzenten in der DDR registriert ist.“79 Das Kontrollinstitut hatte damit eine Verwendung des Plasmas offen abgelehnt. Gleichzeitig setzte Oberdoerster Schubert unter Druck, dass er als Produzent eine durchgängige Prophylaxe zu sichern habe. Damit befand sich Schubert in einer Zwickmühle, denn Oberdoerster hatte auch die von ihm vorgeschlagenen Importe deutlich verneint. Schubert traf daraufhin eine folgenschwere Entscheidung, deren Auswirkungen sich um den Jahreswechsel 1978/1979 zeigen sollten.
1.1.2 Massenhaftes Auftreten von Erkrankungen in allen Bezirken der DDR im Frühjahr 1979
Am 29. Dezember 1979 erhielt das Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale) „eine erste, sehr vorsichtig gehaltene Information“ von der Berliner Infektionsklinik Prenzlauer Berg.80 Diese teilte mit, dass möglicherweise im Zusammenhang mit der Gabe von Anti-D-Immunglobulin sechs Fälle von Gelbsucht aufgetreten seien. Weitere Meldungen folgten. Am 11. Januar 1979 handelte es sich in Berlin bereits um zehn Erkrankungen. Nach Angaben des zuständigen Oberarztes der Infektionsklinik Prenzlauer Berg war das Krankheitsbild trotz einer Leberpunktion unklar. Er ging daher von einer „Non-A-non-B-Hepatitis“ aus.81 Dieser Meldung aus Berlin folgten weitere Mitteilungen über sechs erkrankte Patientinnen in Wismar am 9. Januar 1979 und in Leipzig am 10. Januar 1979. Am 11. Januar 1979 waren zudem vier Erkrankungen aus Allstedt im Kreis Sangerhausen gemeldet worden.82
Daraufhin hatte der Bezirksarzt die Kreisärzte angewiesen, die Chargen zurückzuziehen. Das Staatliche Kontrollinstitut für Seren und Impfstoffe war informiert worden, und alle Bezirksinstitute und Bezirksblutspendezentralen wurden zur Rücksendung der Chargen aufgefordert. Zudem war das Bezirkshygieneinstitut informiert worden, welches bei der Ermittlung der Ursachen auch nach der Gabe von Anti-D-Immunglobulin forschen sollte. Der zuständige Leiter der Infektionsabteilung im Ministerium für Gesundheitswesen der DDR war gebeten worden, diese Maßnahmen für alle Bezirkshygieneinstitute anzuordnen.83 Die Infektionsklinik Prenzlauer Berg hatte zudem am 8. Januar 1979 das Staatliche Kontrollinstitut für Seren und Impfstoffe in Berlin benachrichtigt, das die verwendeten Chargen am 12. Januar 1979 gesperrt hatte.84 Einen Tag zuvor hatte der epidemiologische Wochenbericht der Staatlichen Hygieneinspektion über das Auftreten von Hepatitiserkrankungen nach der Anti-D-Immunprophylaxe in verschiedenen Bezirken berichtet.85
Aufgrund dieser Ereignisse sandte Schubert am 5. Januar 1979 erneut Proben an das Institut für Impfstoffe Dessau mit der Bitte um Testung auf HBs-Antigen im Radio-Immun-Assay-Verfahren. Es handelte sich dabei um je eine Ampulle der Chargen 8, 10, 11, 14 und 15 aus 1978.86 Am 8. Februar 1979 lag das Ergebnis vor, das in allen fünf Fällen negativ war.87 Handschriftlich war neben den Chargen 10 und 14 „infektiös“ eingefügt worden. Der zuständige Mitarbeiter gab später in den Vernehmungen an, dass er diesen handschriftlichen Vermerk erst nachträglich, „nach späteren Informationen“ eingefügt habe.88
Der Bezirksarzt von Halle (Saale) wies am 9. Januar 1979 die Kreisärzte fernschriftlich an, die Chargen 8, 10, 11, 14 und 15 zu sperren und an den Produktionsbetrieb zurückzuschicken. Schubert rechtfertigte daraufhin gegenüber dem Bezirksarzt die Verwendung des verdächtigen Materials. Als Grund nannte er den „chronischen Mangel an Ausgangsmaterial“ und die negativen Testergebnisse, aufgrund derer eine Hepatitis B habe ausgeschlossen werden können.89 Zudem habe eine Verdünnung des „suspekten Materials“ die Infektiosität senken können.90 Seit zehn Jahren sei keine Erkrankung bei Anwendung des Präparats bekannt geworden, obwohl die Spender lediglich in der Überwanderungselektrophorese auf Australia-Antigen untersucht worden seien. Schubert verteidigte seine Entscheidung mit der Situation im Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale). Im Projektierungsvertrag war eine Erweiterung des Bezirksinstituts in Halle (Saale) bis zum 30. September 1978 festgelegt worden. Noch 1978 sollte mit den Bauarbeiten begonnen werden. Das Bezirksinstitut Neubrandenburg habe die geplante Übernahme der Anti-D-Immunglobulin-Produktion „immer weiter hinausgeschoben, so daß eine Produktionslücke unvermeidlich erschien.“91 Schubert gab an, dass sich an dieser problematischen Situation bislang nichts geändert habe.
Der Ärztliche Direktor des Bezirksinstituts Neubrandenburg hatte währenddessen Präparate der Leberbiopsien der Spender an das Referenzzentrum für Lebererkrankungen bei der Gesellschaft für Pathologie der DDR übersandt. Er erhielt am 23. Januar 1979 von dort die Mitteilung, dass in allen fünf Fällen die in Neubrandenburg gestellte Diagnose bestätigt werden könne. Es läge „die typische Befundkombination einer akuten Hepatitis vom Typ der Virushepatitis“ vor.92 Die Fälle zeigten untereinander nur geringe Abweichungen. Der Leiter des Referenzzentrums gab an, dass es im akuten Stadium der Hepatitis nicht möglich sei, eine Differenzierung zwischen den verschiedenen Formen vorzunehmen. Daher könne „von morphologischer Seite“ auch nicht Stellung dazu bezogen werden, ob eine Hepatitis A oder Non-A-Non-B vorliege.93
Mitte Januar 1979 fand eine Betriebskontrolle im Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale) statt, die von Mitarbeitern des Staatlichen Kontrollinstituts für Seren und Impfstoffe und des Instituts für Arzneimittel (IfAR) durchgeführt wurde. Die Kontrolle des Waschprozesses ergab, dass jede Charge, mit Ausnahme der Charge 160978, die Waschflüssigkeit der jeweils vorhergehenden Charge enthielt. Gleichzeitig versuchten die Kontrolleure herauszufinden, welche Spender mehrfach in den verdächtigen Chargen auftauchten. Insgesamt waren in den Chargen 6 bis 23 „Plasmen von 35 Spendern bei der Herstellung zu Fraktionierung gelangt.“94 In Bezug auf die beiden Spender aus Neubrandenburg wurde festgehalten, dass diese im Jahr 1978 mit den Symptomen einer Hepatitis erkrankt waren. Offenbar verfügten die Kontrolleure über wenige Informationen, denn der Name einer Spenderin wurde im Protokoll falsch geschrieben und die Angaben zur Erkrankung waren ungenau. Vermerkt war hierzu, dass genauere Angaben zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht vorlagen. Die Kontrolleure konnten sich lediglich auf den Brief von Schubert an das Staatliche Kontrollinstitut von Juni 1978 berufen. Das Plasma der Spenderin aus Neubrandenburg war in den Chargen 6 bis 12 sowie in der Charge 15 verarbeitet worden, das Plasma des Spenders in den Chargen 10 bis 14. Die Kontrolle ergab, dass das Endprodukt der Gefriertrocknung, das sogenannte Lyophilisat der beiden Chargen, zur Charge 15 umgearbeitet worden und hierbei auch die Waschflüssigkeit der Charge 14 verwendet worden war. Bis zum 15. Januar 1979 waren den Kontrolleuren insgesamt 26 Erkrankungen infolge des Einsatzes der Chargen 8 bis 15 bekannt geworden.95 Bei der Kontrolle wurden zudem sechs weitere verdächtige Spender ermittelt, deren Plasma in die Chargen eingegangen war. Dabei berücksichtigte diese Aufteilung nicht die aus den jeweils vorangehenden Chargen verwendete Waschflüssigkeit.96 Die Kontrolleure stellten außerdem fest, dass die Charge 16 der Charge 90677 entsprach, welche das Kontrollinstitut „wegen pyrogener Verunreinigungen“ nicht freigegeben hatte.97 Falls alle acht Spender als verdächtig eingestuft würden, blieben letztlich nur die Chargen 16 und 21 als unverdächtig übrig.
Die Kontrolleure beanstandeten mehrere Punkte, unter anderem, dass das Plasma der Spender zum Einsatz gekommen war, nachdem deren Erkrankung schon bekannt war. Ein weiterer Punkt betraf die Umarbeitung der Chargen 6 und 7 zur Charge 15, ohne dass mit dem Kontrollinstitut Rücksprache gehalten worden war. Zudem wurde beanstandet, dass bei den Anträgen auf Freigabe der Chargen 15 und 16 keine Hinweise auf die inzwischen erfolgte Umarbeitung beider Chargen gegeben worden waren.98
Die Kontrolleure schlugen vor, neben den bereits gesperrten Chargen 8, 10, 11, 14 und 15 auch die Chargen 9, 12 und 13 zu sperren. Für die Zukunft sollte ein Vorrat von Anti-D-Immunglobulin angelegt werden. Hierdurch sollten die Plasmen erst nach einer Inkubationszeit von vier bis sechs Monaten und nach erneuter Untersuchung der Spender zum Einsatz kommen. Die gleichen Maßnahmen waren für Antigen-Spender vorgesehen. Der Kreis der acht verdächtigen Spender sollte eingegrenzt werden. Hierzu wurde vorgeschlagen, deren Laborbefunde und Anamnesen durch das Ministerium für Gesundheitswesen anzufordern und dem Kontrollinstitut zu übermitteln.99 Zudem erhielt das Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale) mehrere Auflagen. Schubert und der zuständige Leiter der Technischen Kontrollorganisation (TKO) hatten in voneinander unabhängigen Darlegungen Stellung zu den Beanstandungen zu nehmen. Das Plasma von Spendern, bei denen nach der Spende eine Hepatitis aufgetreten war oder bei denen der Verdacht auf eine vor der Spende erfolgte Hepatitisinfektion bestand, sollte nicht verwendet werden. Bereits verwendetes Plasma und die daraus folgenden Zwischenprodukte sollten in diesem Fall vernichtet werden. Über aus diesem Plasma hergestellte, bereits im Verkehr befindliche Produkte waren beide Kontrollinstanzen unverzüglich zu informieren. Ferner sollte das Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale) die vorgeschlagenen Veränderungen auf ihre Durchführbarkeit prüfen.100
Schubert erklärte anschließend in seiner Stellungnahme den Einsatz der beiden Spenderplasmen „retrospektiv“ zu einer „Fehlentscheidung“, die „nur aus der damaligen Situation verständlich“ werde.101 Seine Entscheidung rechtfertigte er damit, dass er das Plasma in unterschiedlichen Verfahren testen lassen und das Fraktionierungsverfahren als „hepatitissicher“ eingeschätzt habe.102 Die aus Neubrandenburg übermittelten Befunde hätten nicht eindeutig für eine Virushepatitis gesprochen. Der Verlauf der Erkrankungen sei „praktisch anikterisch“ gewesen und selbst in der später übermittelten Epikrise werde eine Cytomegalie, eine Erkrankung mit dem Cytomegalovirus, einem Herpesvirus, nicht ausgeschlossen. Schubert behauptete zudem, von der Erkrankung der anderen drei Spender in Neubrandenburg nichts gewusst zu haben. Er habe seine Entscheidung auch aufgrund des knappen und sich stetig verringernden Ausgangsmaterials getroffen. Anfang des Jahres 1978 hatte dem produzierenden Institut in Halle (Saale) nur noch eine Menge von 6,7 Litern zur Verfügung gestanden, welche dem Bedarf eines Monats entsprach. Daher hatte Schubert „auf der Direktoren-Konferenz in Frankfurt (Oder) einen erneuten Appell an die Kollegen gerichtet, die Zulieferung zu steigern.“103 Trotzdem sei von den Instituten aus Cottbus und Frankfurt (Oder) und von der Blutspendezentrale Dessau 1978 kein Ausgangsmaterial geliefert worden.
Schubert berichtete über neue Aufgaben des Bezirksinstituts für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale) im Zusammenhang mit dem Ausbau des Klinikums Kröllwitz zu einem Herzoperations- und Nierentransplantationszentrum. Aufgrund von Verzögerungen beim Bau des Bezirkskrankenhauses in Neubrandenburg habe sich die geplante Übernahme der Produktion nicht umgehend realisieren lassen. Daher habe er sich bemüht, den Bestand an Anti-D-Immunglobulin zu erhöhen. Dies war trotz Planübererfüllung nicht gelungen. Die Bestände waren von etwa 10.000 Ampullen am 1. Januar 1978 auf 8.000 Ampullen am 1. Januar 1979 zurückgegangen. Die Sperrung der Chargen war hierbei noch gar nicht berücksichtigt. Zu der empfohlenen Vorratsbildung gab er daher an, dass diese höchstens für zwei Monate möglich sei. Zwar habe sich die Zulieferung verbessert, aber ein Vorrat für sechs Monate sei nicht realisierbar. Schubert wies in seiner Stellungnahme außerdem darauf hin, dass ihm keine Bestimmungen bekannt seien, nach der Umarbeitungen von Chargen besonders berichtspflichtig seien.104
Auch der Leiter der Technischen Kontrollorganisation nahm Stellung zu den Beanstandungen. Er bestritt, von der Verwendung des verdächtigen Plasmas bei der Erstellung der Chargen 8 bis 14 gewusst zu haben.105 Die Entscheidung über den Einsatz des Ausgangsmaterials unterliege allein dem für die Herstellung verantwortlichen Leiter. Der Leiter der Technischen Kontrollorganisation gab an, trotz der Vorbehalte des Staatlichen Kontrollinstituts von Schuberts Argumenten für eine Umarbeitung der Plasmen überzeugt gewesen zu sein. Er berief sich zudem auf §19 der Siebenten Durchführungsbestimmung zum Arzneimittelgesetz.106 Danach entscheide der für die Herstellung verantwortliche Leiter über die Verwendung der Arzneimittel, die wegen der Prüfung nicht für den Verkehr freigegeben worden waren. Abschließend erklärte er, dass ihm erst „nach Auswertung aller inzwischen bekannt gewordenen Fakten das verhängnisvolle Zusammenwirken von Irrtümern und daraus resultierender Fehlhandlungen sowie das Ausmaß der Folgen bekannt geworden“ sei.107
Um den Sachverhalt zu klären, hatte das Ministerium für Gesundheitswesen eine Expertenkommission unter dem Vorsitz von Friedrich Oberdoerster eingesetzt. Diese tagte am 18. Januar 1979 im Staatlichen Kontrollinstitut für Seren und Impfstoffe Berlin. Das Staatliche Kontrollinstitut repräsentierten neben dem Leiter vier weitere Mitarbeiter. Anwesend waren Vertreter der Bezirksinstitute für Blutspende- und Transfusionswesen Cottbus, Halle (Saale) und Magdeburg. Auch Vertreter mehrerer Kliniken nahmen an der Sitzung der Expertenkommission teil. So war ein Vertreter des Städtischen Krankenhauses Berlin Prenzlauer Berg, der Frauenklinik Dresden und der Medizinischen Klinik der Medizinischen Akademie Dresden anwesend. Auch eine Mitarbeiterin der Hauptabteilung Hygiene und Staatliche Hygieneinspektion des Gesundheitsministeriums war anwesend, ebenso wie je eine Mitarbeiterin des Hygieneinstituts Erfurt und des Instituts für Arzneimittelwesen der DDR.108
Bis zum 19. Januar 1979 waren 47 Erkrankungen bekannt geworden. Diese führte die Expertenkommission auf die Verwendung der beiden Spenderplasmen aus Neubrandenburg in den Chargen 8 bis 15 zurück. Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen wurde davon ausgegangen, dass es sich nicht um eine Hepatitis B, sondern um eine Hepatitis A oder Non-A-Non-B handelte. Zum Nachweis der Hepatitisform sollten mehrere Maßnahmen ergriffen werden. Ein elektronenmikroskopischer Nachweis von Antikörpern gegen Hepatitis A sollte in den Seren und Stuhlproben von 10 frisch erkrankten Patienten erbracht werden. Zur Sicherung einer Non-A-Non-B-Hepatitis wurde vorgeschlagen, ein Referenzlaboratorium der Weltgesundheitsorganisation einzubeziehen. Es war vorgesehen, die Spenderseren und Blutproben einiger erkrankter Patientinnen in mehreren Testverfahren zu untersuchen, um eine Hepatitis B wirklich auszuschließen.109
Bei der Verwendung der Chargen 17 bis 23 ging die Expertenkommission von einem „vertretbarem Risiko hinsichtlich der Gefahr der Übertragung einer Hepatitis“ aus. Sie begründete dies mit der Tatsache, dass diese Chargen kein Plasma der beiden Spender aus Neubrandenburg enthielten. Zudem sei „anzunehmen, daß durch die Sterilisation der wiederholt verwendeten Austauschgele ggf. vorhandenes Hepatitisvirus inaktiviert“ werde. Eine in Betracht gezogene Strahlensterilisation der Chargen 8 bis 15 lehnte die Expertenkommission ab. Gleichzeitig wurde „dringend empfohlen“, die Immunprophylaxe nicht zu unterbrechen.110 Alle bisher nicht erkrankten Frauen, die mit dem Anti-D dieser Chargen behandelt worden waren, sollten im Abstand von vier Wochen zweimal je 6ml Gammaglobulin erhalten und in die Dispensairebetreuung einbezogen werden. Auch Säuglinge, deren Mütter an Hepatitis erkrankt waren oder hohe Transaminasewerte aufwiesen, sollten Gammaglobulin erhalten. Die Erfassung und Betreuung der Patientinnen sollte den Kreisärzten übertragen werden.111
Neben dem Einsatz einer Expertenkommission zur Klärung der Ursachen hatte das Ministerium für Gesundheitswesen weitere Maßnahmen ergriffen. Gesundheitsminister Ludwig Mecklinger informierte die Bezirksärzte am 23. Januar 1979 darüber, dass die Chargen 8 bis 15 gesperrt und sichergestellt worden waren. Er gab an, dass der Zusammenhang zwischen den aufgetretenen Erkrankungen und der Anti-D-Prophylaxe untersucht werde und wies spezielle Maßnahmen zum Umgang mit den betroffenen Frauen an.112
Neben dem Bezirksinstitut in Halle (Saale) wurde auch das Bezirksinstitut in Neubrandenburg geprüft, in dem am 9. Februar 1979 ein „Informationsbesuch“ von Vertretern des Kontrollinstituts stattfand. Dabei stellte sich heraus, dass die Erythrozyten der Antigen-Spenderin nur einmalig bei den fünf Spendern verwendet worden waren. Zwar war die Spenderin seit 1976 im Bezirksinstitut Neubrandenburg registriert und hatte vor diesem Zeitpunkt am 15. November 1977 das letzte Mal Blut gespendet. Ihre Erythrozyten waren jedoch nur deshalb benutzt worden, weil die bisherige Spenderin erkrankt war, die seit 1970 Erythrozyten gespendet hatte. Die Spenderin, mit deren Erythrozyten die fünf Plasmaspender immunisiert worden waren, hatte sich bereits Mitte Januar 1978 aufgrund von Oberbauchbeschwerden in ärztliche Behandlung begeben. Stuhl und Urin seien unauffällig gewesen.113 Die Erythrozytenspenderin war am 14. April 1978 in das Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Neubrandenburg bestellt und anschließend zur weiteren Klärung der Diagnose in das Bezirkskrankenhaus überwiesen worden. Eine erbetene Leberpunktion hatte nicht stattgefunden, da im Bezirkskrankenhaus Neubrandenburg „weder klinisch noch paraklinisch ein Anhalt für eine Hepatitis zu finden war.“114
Diese Information hatte der Ärztliche Direktor des Neubrandenburger Bezirksinstituts bereits Ende Januar 1979 Oberdoerster mitgeteilt und ihm die Epikrisen und einen kurzen Bericht zugesandt. Alle fünf Personen hätten mehrfach Blut gespendet und seien niemals bei den durchgeführten Kontrolluntersuchungen aufgefallen. Er informierte Oberdoerster zudem über die negativen Testergebnisse hinsichtlich des HBs-Antigens sowie des HBs-Antikörpers, die nach der Prüfung in Dessau, Erfurt und Magdeburg vorlagen.115 Die Virushepatitis aller fünf Spender war durch eine Biopsie gesichert. Bei einem Spender hatte die Hepatitis einen anikterischen Verlauf genommen. Im Protokoll wurde zudem über das gewonnene Material und die Lieferung berichtet. Das Bezirksinstitut in Halle (Saale) hatte mehr Blut von der Spenderin als von dem Spender erhalten. Das Blut der Erythrozytenspenderin war „bis auf die zur Immunisierung verwendeten Blutkörperchen“ vernichtet worden.116 Ferner ging es um die zukünftige Produktion des Anti-D-Immunglobulins im Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Neubrandenburg. Das Material sollte trotzdem den Vermerk „staatlich geprüft im BIBT-Halle“ erhalten.117 Das Institut für Arzneimittel sollte darüber entscheiden, ob die staatliche Prüfung in Zukunft durch das Bezirksinstitut in Halle (Saale) übernommen werden könne. Im Rahmen des Informationsbesuchs war offenbar auch der Verdacht geäußert worden, dass die Spender vor ihrer Spende nicht den Vorschriften entsprechend untersucht worden waren.118 Zwar hatte der Ärztliche Direktor des Neubrandenburger Instituts zuvor auf mehrere Tests hingewiesen, doch diese bezogen sich auf den Zeitraum nach der Spende und der Erkrankung.119 Er teilte dem Kontrollinstitut im Februar 1979 mit, dass seine „diesbezüglichen Nachforschungen“ ergeben hätten, dass die Vermutung „leider den Tatsachen entspricht.“ Lediglich das Blut der Erythrozytenspenderin war am 27. Januar 1978 einem Hepatitis-Screening zugeführt worden. Der Ärztliche Direktor musste zugeben, dass dieses Vorgehen „nicht den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen“ entsprach und drückte sein Bedauern darüber aus. Bis dahin sei er stets davon überzeugt gewesen, dass die notwendigen Kontrolluntersuchungen durchgeführt würden. Er versicherte, dass dies auch ab sofort der Fall sei.120
Über diese ersten Ergebnisse informierte Oberdoerster das Ministerium für Gesundheitswesen, das ihn zuvor offenbar um eine Einschätzung gebeten hatte. Oberdoerster fasste den Verlauf der Ereignisse knapp zusammen und teilte die Ergebnisse der Betriebskontrolle im Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Halle (Saale) mit. Er sah insbesondere die Gütevorschrift Anti-D-Immunglobulin verletzt, nach der Plasmaspender den Forderungen zur Anordnung über den Blutspende- und Transfusionsdienst beziehungsweise den hierzu erlassenen Richtlinien entsprechen mussten. In Richtlinie Nr.1 war festgelegt, dass die Spender frei von übertragbaren Krankheiten sein mussten. Nicht in Frage kamen dabei Personen, die in den letzten fünf Jahren vor der Spende an einer Hepatitis erkrankt waren. Auch wenn in deren unmittelbaren Umgebung im letzten halben Jahr vor der Blutspende eine Hepatitis aufgetreten war, sollten potenzielle Spender nicht herangezogen werden. Die Richtlinie sah ferner die Erstuntersuchung des Spenders vor. Bei dieser sollten eine Anamnese, ein Siebtest auf Hepatitis und die Kontrolle des Sozialversicherungsausweises stattfinden, vor jeder weiteren Blutspende eine Nachuntersuchung.121 Dass das Bezirksinstitut für Blutspende- und Transfusionswesen Neubrandenburg diese Richtlinien nicht beachtet hatte, erwähnte Oberdoerster nicht. Stattdessen ging er ausführlich auf Schuberts Verantwortlichkeit ein, der seiner Ansicht nach selbst ein Risiko in der Verwendung der Chargen gesehen habe. Oberdoerster sah in den Festlegungen der Gütevorschrift und der Richtlinie Nr.1 ausreichende Gründe gegen den Einsatz der beiden Chargen. Diese Vorschriften hätten auch bei der weiteren Verwendung der Plasmen herangezogen werden müssen.
Oberdoerster kritisierte, dass Schubert davon ausgegangen war, mithilfe des Fraktionierungsverfahrens Hepatitisviren zu eliminieren, und sich nur auf Testverfahren zum Nachweis des HBs-Antigens gestützt hatte. Er wandte dagegen ein, dass 70 bis 90% aller posttransfusioniellen Hepatitiden durch Non-A-Non-B-Hepatitisviren ausgelöst werden und stützte sich dabei auf einen Bericht der Weltgesundheitsorganisation. Die Hepatitissicherheit der Immunglobuline werde zwar in der Literatur häufig erwähnt und auch von Expertengruppen der Weltgesundheitsorganisation betont. Doch um diese zu gewährleisten, seien mehrere Faktoren wichtig. Hierzu gehörten unter anderem die Kriterien für die Auswahl der Plasmaspender, das Fraktionierungsverfahren und die Anzahl der Plasmen als Ausgangsmaterial für eine Charge. Oberdoerster bezifferte diese bei normalem Human-Immunglobulin auf Plasmen von 1.000 und mehr Spender.122 Er kritisierte insbesondere, dass sich Schubert bei der Fraktionierung nur auf die Wirkung des Äthanols verlassen habe, wofür er keinen Anhaltspunkt sah. Stattdessen verwies er darauf, dass allgemein eine Wärmebehandlung von Albuminlösungen zur Inaktivierung gegebenenfalls vorhandener Hepatitisviren gefordert werde. Schubert hatte seiner Meinung nach keine Kenntnisse über diese Kriterien oder hatte diese fahrlässig missachtet. Der Vollständigkeit halber fügte Oberdoerster hinzu, dass Schubert seine Entscheidung auch in Anbetracht der Schwierigkeit, ausreichend Material zu erhalten, getroffen hatte.