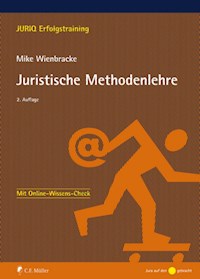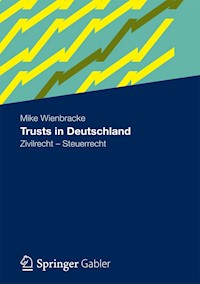19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: JURIQ Erfolgstraining
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Der Inhalt: Nach einem einführenden Teil zu den verwaltungsgerichtlichen Rechtsbehelfen, dem Gerichtsaufbau und den Verfahrensgundsätzen werden ausführlich die Zulässigkeit und Begründetheit sowie die einzelnen Klagearten (Anfechtungsklage, Verpflichtungsklage, Fortsetzungsfestellungsklage und Allgemeine Leistungsklage) dargestellt. Ein eigener Teil widmet sich dem vorläufigen Rechtsschutz nach §§ 80, 123 VwGO. Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Verwaltungsprozessrecht
von
Dr. iur. Mike Wienbracke, LL. M. (Edingburgh)
Professor an der Westfälischen HochschuleGelsenkirchen, Bocholt, RecklinghausenDozent an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management
3., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-9429-9
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.dewww.cfmueller-campus.de
© 2019 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre verwaltungsprozessualen Kenntnisse!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Inhaltlich widmet sich das vorliegende Skript den wesentlichen verwaltungsprozessualen Fragestellungen. Schwerpunktmäßig werden die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Anfechtungs-, Verpflichtungs-, Fortsetzungsfeststellungs-, allgemeinen Leistungs- und (Nichtigkeits-)Feststellungsklage behandelt und dabei – ebenso wie im Rahmen der Darstellung von deren jeweiliger Begründetheit – die Zusammenhänge zum Allgemeinen Verwaltungsrecht sowie dem übrigen Öffentlichen Recht (inkl. des Verfassungs- und Europarechts) aufgezeigt. Ein weiterer Schwerpunkt des Skripts liegt im Bereich des verwaltungsprozessualen vorläufigen Rechtsschutzes gem. §§ 80, 80a und 123 VwGO. Die insbesondere im ersten juristischen Staatsexamen weniger relevanten Rechtsmittel wurden dagegen bewusst nicht weiter thematisiert; eine vertiefende Darstellung des Normenkontrollverfahrens nach § 47 VwGO ist den Skripten zum „Baurecht“ vorbehalten.
Um Wiederholungen zu vermeiden, werden im 2. Teil des Skripts sämtliche Zulässigkeitsvoraussetzungen nacheinander dargestellt. Aus den Schemata, die unter dem Prüfungspunkt „Statthafte Klageart“ zu jeder der vorgenannten Klagearten geliefert werden, ergibt sich dann, welche der Zulässigkeitsvoraussetzungen für die jeweilige Klageart von Bedeutung sind. Hinsichtlich Detailfragen finden sich in den Fußnoten weiterführende Hinweise auf die jeweils einschlägige Rechtsprechung und Literatur.
Die vorliegende dritte Auflage wurde vollständig durchgesehen, überarbeitet und aktualisiert.
Auf geht's – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen.
Recklinghausen, im Januar 2019
Mike Wienbracke
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müllermit Online-Wissens-Check
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
zurück zu Rn. 33, 122, 219, 359, 389, 451, 478, 590, 640
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. TeilEinleitung
A.Rechtsbehelfe
I.Formlose Rechtsbehelfe
II.Förmliche Rechtsbehelfe
B.Rechtsschutzgarantie
C.Gerichtsaufbau
I.Verwaltungsgerichte
II.Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe
III.Bundesverwaltungsgericht
D.Verfahrensgrundsätze
E.Entscheidung des Gerichts
I.Entscheidungsformen des Gerichts
II.Form, Inhalt und Aufbau des Urteils
2. TeilVerwaltungsgerichtliche Klage
A.Ggf.: Auslegung bzw. Umdeutung des Klagebegehrens
B.Zulässigkeit
I.Ordnungsgemäße Klageerhebung
II.Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs
1.Aufdrängende Sonderzuweisung
2.Generalklausel des § 40 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 VwGO
a)Rechtsstreit
b)Öffentlich-rechtliche Streitigkeit
c)Nichtverfassungsrechtlicher Art
3.Keine abdrängende Sonderzuweisung
a)§ 40 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 VwGO
b)§ 40 Abs. 1 S. 2 VwGO
c)§ 40 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 VwGO
III.Statthafte Klageart
1.Anfechtungsklage
2.Verpflichtungsklage
3.Übungsfall Nr. 1
4.Fortsetzungsfeststellungsklage
5.Übungsfall Nr. 2
6.Allgemeine Leistungsklage
7.(Nichtigkeits-)Feststellungsklage
IV.Zuständiges Gericht
1.Sachliche Zuständigkeit
2.Instanzielle Zuständigkeit
3.Örtliche Zuständigkeit
V.Beteiligungsfähigkeit
1.Beteiligte
2.Beteiligtenfähigkeit
VI.Prozessfähigkeit
VII.Postulationsfähigkeit
VIII.Klagebefugnis
1.Schutznormtheorie
2.Individuelle Zuordnung des subjektiv-öffentlichen Rechts zum Kläger
3.Möglichkeit der Rechtsverletzung des Klägers
IX.Richtiger Klagegegner
X.Vorverfahren
1.Auslegung
2.Ordnungsgemäße Widerspruchserhebung
3.Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs
4.Statthaftigkeit des Widerspruchs
5.Widerspruchsbefugnis
6.Erhebung bei der zuständigen Behörde
7.Widerspruchsfrist
8.Widerspruchsinteresse
XI.Klagefrist
XII.Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis
1.Fortsetzungsfeststellungsklage
2.(Nichtigkeits-)Feststellungsklage
C.Begründetheit
I.Anfechtungsklage
1.Ermächtigungsgrundlage
2.Nachschieben von Gründen
3.Gerichtliche Kontrolldichte
a)Unbestimmte Rechtsbegriffe
b)Ermessensentscheidungen
4.Maßgeblicher Zeitpunkt
5.Vollständige bzw. teilweise Aufhebung des Verwaltungsakts
6.Übungsfall Nr. 3
II.Verpflichtungsklage
1.Anspruchsgrundlage
2.Spruchreife
3.Maßgeblicher Zeitpunkt
4.Verpflichtung zum Erlass des Verwaltungsakts oder zur Bescheidung
5.Übungsfall Nr. 4
III.Übrige Klagearten
1.Fortsetzungsfeststellungsklage
2.Allgemeine Leistungsklage
3.Übungsfall Nr. 5
4.(Nichtigkeits-)Feststellungsklage
5.Übungsfall Nr. 6
3. TeilEinstweiliger Rechtsschutz
A.Vorläufiger Rechtsschutz nach §§ 80 ff. VwGO
I.§ 80 Abs. 1 VwGO
II.§ 80 Abs. 2 VwGO
1.Öffentliche Abgaben und Kosten (§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VwGO)
2.Unaufschiebbare Anordnungen und Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten (§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 VwGO)
3.Spezialgesetzlicher Ausschluss der aufschiebenden Wirkung (§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 3, S. 2 VwGO)
4.Behördliche Anordnung der sofortigen Vollziehung (§ 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO)
III.§ 80 Abs. 4 VwGO
IV.§ 80 Abs. 5 VwGO
1.Zulässigkeit des Antrags nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO
a)Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs
b)Statthaftigkeit des Antrags nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO
c)Zuständiges Gericht
d)Beteiligten- und Prozessfähigkeit
e)Antragsbefugnis
f)Richtiger Antragsgegner
g)Antragsfrist
h)Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis
2.Begründetheit des Antrags nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO
3.Übungsfall Nr. 7
B.Vorläufiger Rechtsschutz nach § 123 VwGO
I.Zulässigkeit des Antrags nach § 123 Abs. 1 VwGO
1.Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs
2.Statthaftigkeit des Antrags nach § 123 Abs. 1 VwGO
3.Zuständiges Gericht
4.Beteiligten- und Prozessfähigkeit
5.Antragsbefugnis
6.Richtiger Antragsgegner
7.Antragsfrist
8.Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis
II.Begründetheit des Antrags nach § 123 Abs. 1 VwGO
1.Anordnungsanspruch
a)Sicherungsanordnung (§ 123 Abs. 1 S. 1 VwGO)
b)Regelungsanordnung (§ 123 Abs. 1 S. 2 VwGO)
2.Anordnungsgrund
a)Sicherungsanordnung (§ 123 Abs. 1 S. 1 VwGO)
b)Regelungsanordnung (§ 123 Abs. 1 S. 2 VwGO)
3.Glaubhaftmachung
4.Entscheidung des Gerichts
a)Nicht mehr als in der Hauptsache
b)Keine Vorwegnahme der Hauptsache
5.Exkurs: Schadensersatzanspruch
III.Übungsfall Nr. 8
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Bader/Funke-Kaiser/Stuhlfauth/von Albedyll
Verwaltungsgerichtsordnung, 7. Aufl. 2018
Ehlers/Schoch
Rechtsschutz im Öffentlichen Recht, 2009
Erbguth/Guckelberger
Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. Aufl. 2018
Eyermann
Verwaltungsgerichtsordnung, 15. Aufl. 2019
Fehling/Kastner/Störmer
Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2016
Finkelnburg/Dombert/Külpmann
Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungsstreitverfahren, 7. Aufl. 2017
Gärditz
VwGO, 2. Aufl. 2018
Gersdorf
Verwaltungsprozessrecht, 5. Aufl. 2015
Hufen
Verwaltungsprozessrecht, 10. Aufl. 2016
Kopp/Schenke
VwGO, 24. Aufl. 2018
Kugele
VwGO, 2013
Mann/Wahrendorf
Verwaltungsprozeßrecht, 4. Aufl. 2015
Pietzner/Ronellenfitsch
Das Assessorexamen im Öffentlichen Recht, 13. Aufl. 2014
Posser/Wolff
Verwaltungsgerichtsordnung, 2. Aufl. 2014
Ramsauer/Lambiris/Kappet
Die Assessorprüfung im Öffentlichen Recht, 8. Aufl. 2018
Redeker/von Oertzen
Verwaltungsgerichtsordnung, 16. Aufl. 2014
Schenke
Verwaltungsprozessrecht, 15. Aufl. 2017
Schmitt Glaeser/Horn
Verwaltungsprozeßrecht, 15. Aufl. 2009
Schoch/Schneider/Bier
Verwaltungsgerichtsordnung, Stand: September 2018
Sodan/Ziekow
Verwaltungsgerichtsordnung, 5. Aufl. 2018
Wolff/Decker
VwGO/VwVfG, 3. Aufl. 2012
Würtenberger/Heckmann
Verwaltungsprozessrecht, 4. Aufl. 2018
Wysk
VwGO, 2. Aufl. 2016
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 6Methoden zum besseren Lernen und Behalten
Viele Lernende stellen sich die Frage, wie sie den umfangreichen Lernstoff noch besser aufnehmen, verstehen und wiedergeben können. In einem ersten Schritt geht es in den Lerntipps um die Erkenntnisse der Lernforschung zum Thema „Lernkanäle“. Dann erhalten Sie praktische Tipps zu einer speziellen Lesemethode und einem System des Wiederholungslernens.
Lerntipps
Viele Aufnahmekanäle führen zum Lernen!
Die häufigsten Lernkanäle sind Lesen (Text), Sehen (natürliche Situationen, Abbildungen), Hören (Vorlesung, Diskussion) und Handeln (selbst aufschreiben, anderen erzählen). Über die genaue Nutzungseffektivität der Lernkanäle gibt es wenig gesicherte Erkenntnisse. Dennoch gibt es einen Vorteil, wenn Sie unterschiedliche Kanäle für gleiche Lerninhalte nutzen. Die unterschiedlichen Aufnahmemodi erlauben unterschiedliche Orte der Abspeicherung des gleichen Lerninhalts im Gehirn. Der Lerngegenstand wird dem Gehirn damit zum einen „plastischer“, und beim Erinnern haben wir zum anderen mehr als eine Zugriffsmöglichkeit auf das Gelernte.
Folgende Tipps dazu zusammengefasst:
•
Wenn es nur irgendwie geht, machen Sie sich den Stoff auf unterschiedlichen Kanälen zugänglich.
•
Wichtige Begriffe, Definitionen sollten gelesen, gesprochen, geschrieben, gehört und in einen Sinnzusammenhang gebracht werden.
•
Sprechen Sie Fragen und Antworten vor sich hin – denken Sie laut!
•
Schreiben Sie sich Lernmaterial auf (z.B. Karteikarten).
•
Lesen Sie nach bestimmten Methoden (z.B. SQ3R-Methode).
•
Nutzen Sie eLearning.
•
Hören Sie Argumente, Querverbindungen von Studienkollegen, Dozenten.
SQ3R – Sie werden sich wundern!
Sie erinnern sich an den letzten Roman, den Sie gelesen haben. Drama, Liebe, Spannung, Unterhaltung … . Einen Roman beginnt man üblicherweise vorn zu lesen, häufig folgt er einem Zeitstrahl, hat Höhepunkte, lebendige Charaktere, erzeugt bei Ihnen Erlebniswelten mit Gefühlen und persönliche Identifikationsmöglichkeiten. Ein Fachbuch greift nicht auf die stilistischen Mittel eines Romanautors zurück, sondern benutzt den „roten Faden der Sachlogik“. Trotz allem lesen viele Lernende Fachbücher und -artikel wie Romane von vorne bis hinten (und damit häufig ohne Höhepunkt).
Die Ergebnisse des Lernforschers Robinson (Erfinder der Wunderformel SQ3R) zeigen:
•
Mit der Romanlesemethode wird bei Fachtexten nur die Hälfte des Gelesenen inhaltlich aufgenommen.
•
Das nochmalige Durchlesen nach dieser Methode erbringt kaum Verbesserungen.
Fachtexte müssen mit besonders dafür entwickelten Lesetechniken erarbeitet werden. Dafür wurde die Methode SQ3R von Robinson entwickelt. Obwohl sich das kompliziert anhört, ist die Methode aber einfach anzuwenden und sehr effektiv.
Survey – Verschaffen Sie sich den Überblick!
Lesen Sie nicht, sondern erforschen Sie grob, was auf Sie zukommt.
Bei einem Buch, Artikel oder Text können Sie z.B. folgendermaßen vorgehen:
•
Titel, Überschriften und Unterüberschriften, Inhaltsverzeichnis lesen
•
Zusammenfassungen, Umschlagtexte eines Buches lesen
•
Abbildungen, Tabellen und ihre Überschriften ansehen
•
Texthervorhebungen gegebenenfalls überfliegen.
Diese Phase dauert nur wenige Minuten. Das weitere Lesen ist nicht mehr orientierungslos, sondern trifft auf eine sinnvolle Struktur. Es wird eine Erwartungshaltung und Neugier erzeugt, welche die Aufnahmebereitschaft begünstigt.
Question – Stellen Sie sich Fragen!
Sie sollten sich jetzt immer noch bremsen mit dem Lesen. Es wurde eine Erwartungshaltung bei Ihnen erzeugt, es tauchen Fragen in Ihrem Kopf auf, Ihr Gehirn ist auf aktive Suche umgeschaltet. Stellen Sie sich jetzt Fragen, die Sie bei Bedarf auch aufschreiben können:
•
Was stelle ich mir unter diesem Thema vor?
•
Was weiß ich bereits von dem Stoff? Was über den Autor?
•
Welche Kapitel und Überschriften werden genannt?
•
Welche unbekannten Fachbegriffe tauchen auf?
•
Welche Verbindungen sehe ich zu anderen Themen?
•
Welche spezifischen Fragen tauchen auf?
Sie werden schneller vorgegebene Strukturen des Textes erkennen, Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden können. Sie lernen immer spezifischer Ihre Sachfragen zu stellen, um diese später gezielter zu beantworten.
Read – Lesen Sie jetzt gründlich Abschnitt für Abschnitt!
Sie sind jetzt gut vorbereitet. Lesen den Text bitte langsam und konzentriert durch und beachten Sie folgende Hinweise:
•
Erkennen Sie die vorgegebene Struktur des Textes, beachten Sie Gliederungshierarchien und ordnen Sie danach ein, was Haupt- und Unterpunkte sind.
•
Schlagen Sie unbekannte Fachbegriffe direkt nach und klären Sie diese im Kontext.
•
Beachten Sie grafische Hervorhebungen im Text besonders (fett, kursiv, Einrückungen).
•
Beachten Sie auch sprachliche Hervorhebungen („wesentlich, von zentraler Bedeutung, kritisch ist, wie oben erwähnt, im Gegensatz zu ...“).
•
Finden Sie die Hauptaussagen der einzelnen Abschnitte.
•
Heben Sie zusätzlich für Sie Wesentliches hervor durch Markierungen im Text oder am Seitenrand mit Bemerkungen (z.B. „Theorie, Vergleiche, Kritik, Ergebnis, Bezug“).
•
Lassen Sie sich anfangs nicht davon verwirren, Sie werden später derartige Worthinweise und Kernideen dann immer schneller finden.
Nach dem Lesen eines Abschnittes machen Sie eine kleine Pause von 3 Minuten.
Recall – Wiederholen Sie und fassen Sie jeden Abschnitt schriftlich zusammen!
Nachdem Sie einen Abschnitt gelesen haben, sind Sie in der Lage, die wesentlichen Inhalte ohne Vorlage wiederzugeben. Sie können die Kernaussagen im Geiste wiederholen. Bei komplexeren Lerninhalten sollten Sie sich aber schriftliche Notizen machen.
Gehen Sie wie folgt vor:
•
Schreiben Sie die wichtigsten Begriffe, Kerngedanken kurz auf und gebrauchen Sie dabei Ihre eigenen Formulierungen.
•
Beantworten Sie die unter „Question“ gestellten spezifischen Fragen.
•
Erstellen Sie eigenständig Tabellen, Abbildungen, Gliederungen und Schemata, um komplizierte Inhalte zu veranschaulichen.
Auf diese – erst einmal zeitaufwändige Weise – haben Sie nun eine aussagekräftige Sammlung wesentlicher Inhalte, die Sie möglichst gut auffindbar in Aktenordnern oder auf Karteikarten für die spätere Verwendung dokumentieren können. In der Vorbereitung der Prüfungen und Arbeitsgruppensitzungen können Sie gezielter darauf zurückgreifen.
Review – Wiederholen Sie den gesamten Text mündlich!
Jetzt kommt die Zusammenschau in einer mündlichen Wiederholung. Gehen Sie dafür noch einmal alle Überschriften, Gliederungen, Hervorhebungen und Notizen (zügig) durch, um gut auf Ihre mündliche Nacherzählung vorbereitet zu sein. Stellen Sie sich nun mündlich die wesentlichen Aussagen des Textes vor. Sie können dabei auch Vergleiche, Querverbindungen zu anderen Texten oder ähnlichen Theorien herstellen.
Üben Sie die SQ3R Methode!
Erarbeiten Sie jetzt einen einfachen nicht allzu langen Text nach der SQ3R Methode. Sie werden bei häufigerer Anwendung merken, dass diese Arbeitstechnik genial einfach ist, dank Robinson.
SurveyErforschen, Überblick gewinnen: Titel, Kapitel, Überschriften, Zusammenfassungen
QuestionFragen stellen: Was weiß ich bislang zum Thema, Autor?Was möchte ich gerne wissen?
ReadLangsames Lesen des Textes/Abschnitts mit Hervorhebungen und Bemerkungen
RecallWiederholen und schriftliches Zusammenfassen der wichtigsten Inhalte mit eigenen Formulierungen
ReviewNacherzählen und Wiederholen des gesamten Textes mit Querverbindungen, Kritik
Die SQ3R Methode hilft vor allem beim Erlernen von Zusammenhangswissen.
Wiederholen Sie auch Ihr Faktenwissen (z.B. Definitionen) mit System!
Sie kennen vom Vokabellernen vielleicht, dass es für einen aktiven Wortschatz besonders günstig ist, Vokabeln nach individueller Schwierigkeit z.B. auf Karteikarten zu lernen und nicht nach Kapiteln. Erstellen Sie sich analog eine differenzierte Lernkartei für Definitionen, die Sie so regelmäßig wiederholen können. Vielleicht eignet sich das grundlegende Wiederholungssystem auch für Schemata. Probieren Sie es aus!
•
Jede neue Definition wird auf eine kleine Karteikarte (ca. 7 x 10 cm) geschrieben. Auf der einen Seite ist der Begriff, auf der anderen Seite die Definition.
•
Je nach subjektiv empfundener Schwierigkeit werden die Karten in fünf unterschiedliche Pakete eingeteilt.
•
Nehmen Sie einen Karteikasten mit fünf möglichst unterschiedlich großen Fächern.
•
Die schwierigsten Karten kommen in das kleinste, die leichtesten in das größte Fach. Sie brauchen auf jeden Fall fünf unterschiedlich schwierige Karteipakete (können auch nummeriert sein).
•
Täglich werden zehn Definitionen wiederholt, indem aus jedem Fach zwei Karten vom Anfang des Stapels abgefragt werden.
•
Wird die Definition gut beherrscht, so wandert sie nach hinten in das nächst größere (leichtere) Fach.
•
Die schlecht beherrschten Definitionen wandern ins nächst schmalere (schwierigere) Fach.
•
„Mittelprächtig“ beherrschte bleiben im gleichen Fach, wandern jedoch wieder ans Ende des Stapels.
Auf diese Weise wiederholen Sie die noch nicht erlernten Definitionen häufiger. Wenn Sie täglich konsequent zehn Definitionen in zehn Minuten wiederholen würden, hätten Sie in einem Vierteljahr ca. 900 Definitionen präsent.
Online-Wissens-Check statt Karteikasten!
Alternativ hierzu können Sie auch den zu diesem Skript gehörenden kostenlosen Online-Wissens-Check nutzen. Dabei nutzen Sie gleich mehrere „Lernkanäle“. Sie beantworten einfach die dort gestellten Wiederholungsfragen, erhalten direktes feedback zum Wissensstand und sehen tagesaktuell Ihren individuellen Lernfortschritt. Einfach anmelden unter www.juracademy.de/skripte/login. Den user code finden Sie auf der Codeseite nach dem Vorwort zu diesem Skript.
1. TeilEinleitung
A.Rechtsbehelfe
B.Rechtsschutzgarantie
C.Gerichtsaufbau
D.Verfahrensgrundsätze
E.Entscheidung des Gerichts
1
Im Skript „Allgemeines Verwaltungsrecht“ (Rn. 22, 38) wurde dargestellt, über welche Handlungsmöglichkeiten die Verwaltung verfügt. Hat die Verwaltung von einer dieser Möglichkeiten im konkreten Fall Gebrauch gemacht, so muss die betreffende Verwaltungsmaßnahme (z.B. Verwaltungsakt, § 35 S. 1 VwVfG) nach dem in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung in Einklang mit „Gesetz und Recht“ stehen; insbesondere darf sie den Bürger nicht in dessen (subjektiven) Rechten verletzen. Ob dies der Fall ist, kann der Betroffene durch die entsprechenden Kontrollinstanzen – namentlich die Verwaltungsgerichte – überprüfen lassen.[1]
Anmerkungen
Vgl. Schenke Verwaltungsprozessrecht Rn. 1; Würtenberger/Heckmann Verwaltungsprozessrecht Rn. 3, 5, 7.
1. Teil Einleitung › A. Rechtsbehelfe
A.Rechtsbehelfe
2
Die dem Einzelnen durch die Rechtsordnung eingeräumten Befugnisse, in einem Verfahren auf die Überprüfung staatlichen Verhaltens hinzuwirken, lassen sich danach unterscheiden, ob sie form- und fristlos sowie ohne die Geltendmachung der Verletzung eines subjektiven Rechts, d.h. ohne materielle Beschwer, eingelegt werden können (formlose Rechtsbehelfe) oder nicht (förmliche Rechtsbehelfe).[1]
3
„Rechtsbehelf“ ist jedes von der Rechtsordnung zur Verwirklichung eines Rechts zur Verfügung gestellte Mittel.[2]
1. Teil Einleitung › A. Rechtsbehelfe › I. Formlose Rechtsbehelfe
I.Formlose Rechtsbehelfe
4
Zu den formlosen Rechtsbehelfen, mittels derer der Bürger eine Kontrolle der Verwaltung „anregen“ – nicht aber: „erzwingen“ – kann und die häufig als „formlos, fristlos und fruchtlos“ verspottet werden, gehört die[3]
5
•
Gegenvorstellung: Diese richtet sich an dieselbe Behörde, die die Entscheidung erlassen bzw. verweigert hat, mit welcher der Einzelne nicht einverstanden ist und deren Änderung er erstrebt;
6
•
Aufsichtsbeschwerde: Im Gegensatz zur Gegenvorstellung ist die Aufsichtsbeschwerde nicht an die Ausgangsbehörde, sondern an deren übergeordnete Stelle (die Aufsichtsbehörde) gerichtet. Diese soll das Verhalten der nachgeordneten (weisungsgebundenen) Ausgangsbehörde inhaltlich prüfen und ggf. im Wege der (Rechts-[4] bzw. Fach-[5])Aufsicht korrigieren. Bezieht sich die Beschwerde nicht auf das Ergebnis des Verwaltungshandelns, sondern vielmehr auf das persönliche Verhalten (z.B. Unhöflichkeit) eines Angehörigen des öffentlichen Dienstes (Beamter, Angestellter), so ist die an dessen Dienstvorgesetzten zu adressierende Dienstaufsichtsbeschwerde das richtige Kontrollinstrument. Der Dienstvorgesetzte kann u.U. zu disziplinarrechtlichen Maßnahmen gegenüber dem betreffenden Bediensteten greifen;
7
•
Petition: Dass Petitionen, d.h. auf künftiges Verhalten gerichtete Bitten und gegen vergangenes Verhalten gerichtete Beschwerden, von jedermann einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich nicht nur an die Volksvertretung (Deutscher Bundestag, Landtage bzw. Bürgerschafen; str.[6] bzgl. Gemeinderäte), sondern darüber hinaus „an die zuständigen Stellen“ (v.a. Behörden) gerichtet werden können, ist im GG[7] in Art. 17 grundrechtlich garantiert. Dieses „Petitionsrecht“ (Art. 17a Abs. 1 GG) gewährt einen Anspruch nicht nur auf Entgegennahme der Petition, sondern darüber hinaus auch einen Anspruch auf deren Prüfung und Bescheidung, d.h. Mitteilung von der Art der Erledigung, nicht aber auch auf besondere Begründung (str.[8]).
1. Teil Einleitung › A. Rechtsbehelfe › II. Förmliche Rechtsbehelfe
II.Förmliche Rechtsbehelfe
8
Die förmlichen (ordentlichen) Rechtsbehelfe, welche grundsätzlich form- und fristgebunden sind und eine materielle Beschwer voraussetzen, zielen regelmäßig nicht nur auf die Sicherung der objektiven Gesetzmäßigkeit der Verwaltung ab, sondern dienen zusätzlich auch dem Schutz der subjektiven Rechte des Einzelnen. Bei Erfüllung der entsprechenden Zulässigkeitsvoraussetzungen hat dieser ein Recht auf Entscheidung in der Sache und nicht bloß auf Bescheidung seines Rechtsbehelfs. Entschieden wird über förmliche Rechtsbehelfe durch die Verwaltung selbst (Widerspruch) oder durch die Gerichte (Klage, Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes etc.). Eine Untergruppe der förmlichen Rechtsbehelfe bilden die Rechtsmittel (vgl. § 58 Abs. 1 VwGO),[9] d.h. in der VwGO die Berufung (§§ 124 ff. VwGO), die Revision (§§ 132 ff. VwGO) und die Beschwerde (§§ 146 ff. VwGO). Grundsätzlich hemmen diese Rechtsmittel den Eintritt der formellen Rechtskraft der mit ihnen angefochtenen gerichtlichen Entscheidung (Suspensiveffekt; Rn. 500) und begründen die Entscheidungsbefugnis der jeweils höheren Instanz (Devolutiveffekt).[10] Während bei der Berufung und bei der Beschwerde die angefochtene Entscheidung – innerhalb des betreffenden Rechtsmittelantrags – in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht, d.h. umfassend, kontrolliert wird (vgl. § 128 f. bzw. § 148 VwGO), findet bei der Revision grundsätzlich nur eine Überprüfung von Rechtsfragen statt, vgl. § 137 Abs. 2 VwGO.
Anmerkungen
Schenke Verwaltungsprozessrecht Rn. 1 f., 7.
Mann/Wahrendorf Verwaltungsprozessrecht § 5 Rn. 69; Würtenberger/Heckmann Verwaltungsprozessrecht Rn. 799.
Hierzu sowie zum gesamten Folgenden siehe Hufen Verwaltungsprozessrecht § 5 Rn. 1; Kingreen/Poscher Grundrechte Rn. 1084, 1086, 1090; Schenke Verwaltungsprozessrecht Rn. 2 ff.; Schmitt Glaeser/Horn Verwaltungsprozessrecht Rn. 5 ff.
Im Rahmen der Rechtsaufsicht wird die Rechtmäßigkeit der Verwaltungsmaßnahme geprüft.
Im Rahmen der Fachaufsicht wird die Zweckmäßigkeit der Verwaltungsmaßnahme geprüft.
Nachweise zum Meinungsstreit bei Kingreen/Poscher Grundrechte Rn. 1144.
Zudem siehe Art. 24, 227 AEUV, Art. 44 EU-GrCh sowie etwa Art. 115 Abs. 1 Bay. Verf.
Nachweise zum Meinungsstreit bei Jarass in: ders./Pieroth, GG Art. 17 Rn. 9.
Diese sind wenigerklausurrelevant und werden hier daher nicht weiter behandelt.
Die Beschwerde, bei welcher der Devolutiveffekt nur im Fall der Nichtabhilfe eintritt (§ 148 Abs. 1 Hs. 2 VwGO), hat lediglich in den § 149 VwGO genannten Fällen aufschiebende Wirkung. Zum gesamten Vorstehenden siehe Mann/Wahrendorf Verwaltungsprozessrecht § 5 Rn. 169; Schenke Verwaltungsprozessrecht Rn. 7, 1122 ff., 1150; Würtenberger/Heckmann Verwaltungsprozessrecht Rn. 717, 728, 733.
1. Teil Einleitung › B. Rechtsschutzgarantie
B.Rechtsschutzgarantie
9
Dass dem Einzelnen, der durch die (vollziehende) öffentliche Gewalt, d.h. die Regierung oder die Verwaltung[1], in seinen subjektiven Rechten des öffentlichen (Rn. 255 ff.) oder des privaten Rechts (möglicherweise; Rn. 274 ff.) verletzt wird, der Rechtsweg offensteht, ist verfassungsrechtlich durch Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG garantiert. Diese Bestimmung geht dem aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden allgemeinen Justizgewährungsanspruch als lex specialis vor und ergänzt Art. 14 Abs. 3 S. 4 sowie Art. 34 S. 3 GG.[2] Dieses Grundrecht verlangt grundsätzlich nach einem lückenlosen, umfassenden und effektiven (Primär-)Rechtsschutz gegenüber der öffentlichen Gewalt, d.h. nach einer wirksamen Kontrolle der Verwaltung durch die staatlichen Gerichte intatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (siehe aber Rn. 415 ff., 429 ff.). M.a.W.: Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG dient dazu, „die ,Selbstherrlichkeit‚ der vollziehenden Gewalt gegenüber dem Bürger zu beseitigen.“[3]
Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG setzt die Existenz eines subjektiven Rechts voraus, begründet dieses aber nicht.[4] Vielmehr kann sich ein solches nur „aus einem anderen Grundrecht oder einer grundrechtsgleichen Gewährleistung ergeben, aber auch durch [einfaches] Gesetz begründet sein“[5] oder durch Vertrag oder Verwaltungsakt (Rn. 258).
10
Darüber hinaus bedeutet „wirksamer Rechtsschutz“ i.S.v. Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG auch Rechtsschutz, d.h. eine verbindliche gerichtliche Entscheidung, innerhalb angemessener Zeit, vgl. ferner Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 6 Abs. 1 S. 1 und Art. 13 EMRK sowie Art. 47 Abs. 2 S. 1 EU-GrCh. Um dies sicherzustellen, hat der Gesetzgeber nicht nur Vorschriften zum einstweiligen Rechtsschutz (Rn. 487 ff.), sondern mit Wirkung vom 3.12.2011 zudem § 198 GVG erlassen. Dieser gibt i.V.m. § 173 S. 2 VwGO den Verfahrensbeteiligten im Fall einer unangemessenen (Gesamt-)Dauer eines Gerichtsverfahrens „von der Einleitung bis zum rechtskräftigen Abschluss“[6] in Abs. 3 das (präventive) Instrument der Verzögerungsrüge und in Abs. 1, 2 einen kompensatorischen Entschädigungsanspruch als „staatshaftungsrechtliche[n] Anspruch sui generis“[7] an die Hand; zum vorbeugenden Rechtsschutz siehe Rn. 182, 197 ff.
11
Nicht in Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG verbürgt ist demgegenüber ein Anspruch auf mehr als eine Instanz („Rechtsschutz durch den Richter, nicht aber gegen den Richter“[8]). Allein die in Art. 95 Abs. 1 GG abschließend aufgezählten Gerichte – und damit u.a. das dort genannte BVerwG – müssen errichtet werden, vgl. ferner Art. 92 GG: „Gerichte der Länder“. Andererseits steht Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG der einfach-gesetzlichen Errichtung eines mehrstufigen Aufbaus der Verwaltungsgerichtsbarkeit freilich auch nicht entgegen (Rn. 12 ff.).
Anmerkungen
D.h. die Exekutive (BVerfGE 112, 185 [207] m.w.N.), nicht dagegen auch die Judikative oder die Legislative, siehe BVerfGE 45, 297 (334); 107, 395 (403 f.).
Hierzu sowie zum gesamten Folgenden siehe BVerfGE 93, 1; EGMR NJW 2006, 2389; 2010, 3355; NVwZ 2013, 47; Hufen Verwaltungsprozessrecht § 1 Rn. 18 ff., § 2 Rn. 2 ff., § 4 Rn. 1 f., § 11 Rn. 7 f.; Jarass in: ders./Pieroth, GG Art. 19 Rn. 32, 34, 36, 42, 49 ff., 55 ff., 73; Remmert Jura 2014, 906; Schenke Verwaltungsprozessrecht Rn. 32; Voßkuhle/Kaiser JuS 2014, 312 ff.; Würtenberger/Heckmann Verwaltungsprozessrecht Rn. 3, 40 f., 559.
BVerfG NVwZ 2009, 240 (241) m.w.N.
Kopp/Schenke VwGO § 42 Rn. 136 m.w.N.
BVerfGE 113, 273 (310).
BVerwG NJW 2014, 96 (98).
BR-Drucks. 540/10, S. 25. Zuvor kam als Anspruchsgrundlage allenfalls § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG in Betracht, vgl. etwa BVerfG NJW 2013, 3630.
BVerfGE 107, 395 (403) m.w.N.
1. Teil Einleitung › C. Gerichtsaufbau
C.Gerichtsaufbau
12
Die nähere Ausgestaltung des von Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG geforderten Rechtsschutzes (Rn. 9 ff.) ist Aufgabe des (Bundes-[1])Gesetzgebers, welcher er namentlich mit der VwGO nachgekommen ist.[2] Gemäß deren § 1 wird die Verwaltungsgerichtsbarkeit durch unabhängige, von den Verwaltungsbehörden getrennte Gerichte ausgeübt, vgl. auch Art. 97 Abs. 1 GG. Diese Gerichte sind in den Ländern die Verwaltungsgerichte (VG) und je ein Oberverwaltungsgericht (OVG) bzw. Verwaltungsgerichtshof (VGH)[3] sowie im Bund das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) mit Sitz in Leipzig, § 2 VwGO (Rn. 55). Aufgrund seiner sachlichen Unabhängigkeit ist der Richter nicht verpflichtet, bei der Auslegung der jeweils herrschenden Meinung zu folgen; an die höchstrichterliche Rechtsprechung sind die Instanzgerichte grundsätzlich nur im Rahmen der §§ 121, 130 Abs. 3, 144 Abs. 6 VwGO gebunden.[4]
13
Um die Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu sichern, ist sowohl bei den OVGen bzw. VGHen als auch beim BVerwG jeweils ein Großer Senat (GrS) gebildet, §§ 11 f. VwGO. Dieser entscheidet gem. § 11 Abs. 2 VwGO (ggf. i.V.m. § 12 Abs. 1 S. 1 VwGO) immer dann, wenn ein Senat in einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Senats oder des betreffenden Großen Senats abweichen will, sog. Divergenz. Nicht mit dem Großen Senat (beim BVerwG) zu verwechseln ist der Gemeinsame Senat der Obersten Gerichtshöfe des Bundes (GemS-OGB). Dessen Funktion besteht nach Art. 95 Abs. 3 S. 1 GG in der Wahrung der einheitlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), des BVerwG, des Bundesfinanzhofs (BFH), des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und des Bundessozialgerichts (BSG), siehe auch § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes.
14
Die Besetzung der Spruchkörper, die Vertretung und die Geschäftsverteilung wird durch das Präsidium bestimmt, § 4 VwGO i.V.m. § 21e Abs. 1 GVG. Getroffen werden müssen diese Anordnungen hiernach vor dem Beginn des Geschäftsjahres für dessen Dauer. Hintergrund dieser Regelung ist das grundrechtsgleiche Recht des Bürgers auf den gesetzlichen Richter aus Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG.[5] Dieses soll der Gefahr vorbeugen, „dass die Justiz durch eine Manipulation der rechtsprechenden Organe sachfremden Einflüssen ausgesetzt wird. Es soll vermieden werden, dass durch eine auf den Einzelfall bezogene Auswahl der zur Entscheidung berufenen Richter das Ergebnis der Entscheidung beeinflusst werden kann.“[6] Diesem Postulat wird nur dann Genüge getan, wenn die richterliche Zuständigkeit nicht einzelfallbezogen, sondern im Voraus nach abstrakt-generellen Kriterien bestimmt wird. Verstöße hiergegen können zur nicht vorschriftsmäßigen Besetzung des Gerichts i.S.v. §§ 132 Abs. 2 Nr. 3, 138 Nr. 1 VwGO (absoluter Revisionsgrund) bzw. § 153 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 579 Abs. 1 Nr. 1 ZPO (Wiederaufnahmegrund) führen.[7]
1. Teil Einleitung › C. Gerichtsaufbau › I. Verwaltungsgerichte
I.Verwaltungsgerichte
15
Bei den VGen sind Kammern gebildet, § 5 Abs. 2 VwGO. Nach § 5 Abs. 3 S. 1 VwGO entscheiden diese vorbehaltlich der Entscheidung durch den Einzelrichter grundsätzlich jeweils in der Besetzung von drei Richtern und zwei ehrenamtlichen Richtern. Bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung und bei Gerichtsbescheiden (§ 84 VwGO) wirken die ehrenamtlichen Richter allerdings nicht mit, § 5 Abs. 3 S. 2 VwGO. Gem. § 6 Abs. 1 S. 1 VwGO „soll“ die Kammer den Rechtsstreit „in der Regel“ einem ihrer Mitglieder als Einzelrichter zur Entscheidung übertragen, wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat. Neben den in § 87a Abs. 1 VwGO genannten Fällen kann der Vorsitzende im Einverständnis der Beteiligten auch sonst anstelle der Kammer entscheiden, sog. konsentierter Einzelrichter, § 87a Abs. 2 VwGO. Ist ein Berichterstatter bestellt, so entscheidet dieser gem. § 87a Abs. 3 VwGO anstelle des Vorsitzenden.
1. Teil Einleitung › C. Gerichtsaufbau › II. Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe
II.Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe
16
Die Spruchkörper bei den OVGen bzw. VGHen heißen Senate (§ 9 Abs. 2 VwGO), die in der Besetzung von drei Richtern entscheiden; jedoch kann die Landesgesetzgebung (z.B. § 109 Abs. 1 S. 1 JustG NRW) vorsehen, dass die Senate in der Besetzung von fünf Richtern entscheiden, von denen zwei auch ehrenamtliche Richter sein können, § 9 Abs. 3 S. 1 VwGO.
1. Teil Einleitung › C. Gerichtsaufbau › III. Bundesverwaltungsgericht
III.Bundesverwaltungsgericht
17
Beim BVerwG sind ebenfalls Senate gebildet, § 10 Abs. 2 VwGO. Gem. § 10 Abs. 3 VwGO entscheiden diese in der Besetzung von fünf Richtern, bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung in der Besetzung von drei Richtern.
Anmerkungen
Vgl. Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG. Die Bundesländer haben durch Bundesgesetz zugelassene Regelungen v.a. in ihren jeweiligen Ausführungsgesetzen zur VwGO (AGVwGO) bzw. Landesjustizgesetzen (z.B. JustG NRW) etc. getroffen, siehe v.a. Rn. 234 ff., 287 ff.
Kopp/Schenke VwGO § 1 Rn. 8 f., 14.
So in Baden-Württemberg (§ 1 Abs. 1 S. 1 AGVwGO BW), Bayern (Art. 1 Abs. 1 S. 1 bay. AGVwGO) und Hessen (§ 1 Abs. 1 S. 1 HessAGVwGO), jeweils gestützt auf § 184 VwGO. Zum Sitz beispielsweise des OVG NRW und der VGe in Nordrhein-Westfalen siehe §§ 16 f. JustG NRW.
Stelkens/Panzer in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO § 1 Rn. 47, 49 m.w.N.
Vgl. Mann/Wahrendorf Verwaltungsprozessrecht § 3 Rn. 10; Würtenberger/Heckmann Verwaltungsprozessrecht Rn. 87 f., 100. Auch die Nicht-Vorlage an das BVerfG (Art. 100 Abs. 1 GG) bzw. den EuGH (Art. 267 Abs. 3 AEUV) kann das Recht aus Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG verletzen, siehe BVerfGE 109, 13 (22 ff.); 129, 78 (105 f.).
BVerfGE 95, 322 (327).
Kopp/Schenke VwGO § 4 Rn. 7, 15 m.w.N.
1. Teil Einleitung › D. Verfahrensgrundsätze
D.Verfahrensgrundsätze
18
Das Verfahren, in dem namentlich die VGe ihre Entscheidungen finden, unterliegt bestimmten Grundsätzen, welche ihrerseits zum größten Teil durch das Verfassungsrecht (v.a. das Rechtsstaatsprinzip) vorgegeben sind.[1] Bei diesen Verfahrensgrundsätzen[2] handelt es sich im Einzelnen um den
19
•
Dispositionsgrundsatz/-maxime bzw. Verfügungsgrundsatz. Abweichend vom Strafprozess, wo das Gericht bzw. ein anderes staatliches Organ (Staatsanwaltschaft) das (Straf-)Verfahren von Amts wegen einleitet, fortführt und über dessen Gegenstand bestimmt (Offizialprinzip, -maxime), liegt im Verwaltungsprozess – ebenso wie im Zivilprozess – die Verfahrensherrschaft bei den Beteiligten (§ 63 VwGO; Rn. 225 ff.) des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens. D.h. diese – und nicht etwa das Gericht – entscheiden über den Beginn, den Umfang (Streitgegenstand) und das Ende des Rechtsstreits. Das Gericht wird allein auf Initiative des Klägers bzw. Antragstellers hin tätig (siehe z.B. §§ 42 Abs. 1, 80 Abs. 5 S. 1 VwGO) und darf gem. § 88 VwGO in seiner Entscheidung nicht über das Klagebegehren hinausgehen (ne ultra petita; Rn. 37). Der Kläger kann, nachdem er sich zunächst autonom für die prozessuale Durchsetzung seines subjektiven Rechts entschieden hat, die Klage ändern (§ 91 VwGO), wieder zurücknehmen (§ 92 VwGO), auf den mit ihr geltend gemachten Anspruch verzichten (§ 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 306 ZPO; vgl. auch § 87a Abs. 1 Nr. 2 VwGO) oder sich mit dem Beklagten vergleichen (§ 106 VwGO) bzw. einseitig oder zusammen mit diesem den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklären, vgl. § 161 Abs. 2 VwGO (Rn. 166). Der Beklagte kann den mit der Klage geltend gemachten Anspruch anerkennen, § 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 307 ZPO und vgl. §§ 87a Abs. 1 Nr. 2, 156 VwGO;
20
•
Amtsermittlungs-/Untersuchungsgrundsatz bzw. Inquisitionsmaxime. Im Gegensatz zum Zivilprozess, wo der Sachverhalt nach dem Beibringungs-/Verhandlungsgrundsatz durch die Parteien beigebracht werden muss,[3] erforscht das Gericht im Verwaltungsprozess – ebenso wie im Straf-, Finanz- und Sozialgerichtsprozess – den Sachverhalt von Amts wegen, soweit dies für die Entscheidung des Gerichts über das klägerische Begehren erforderlich ist (§ 86 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 VwGO), bis zu seiner vollen „Überzeugung“, § 108 Abs. 1 S. 1 VwGO.[4] Eingeschränkt wird die grundsätzliche Verantwortung des Gerichts zur Aufklärung sämtlicher entscheidungsrelevanter Tatsachen durch die aus § 86 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 VwGO resultierende (Prozessförderungs-)Pflicht der Beteiligten zur Mitwirkung an der Erforschung des Sachverhalts (z.B. muss ein Asylbewerber die Gründe für seine Furcht vor politischer Verfolgung schlüssig vortragen). Erfüllt ein Beteiligter seine Mitwirkungspflicht trotz Möglichkeit und Zumutbarkeit nicht, so hat dies grundsätzlich eine Verringerung des Umfangs der gerichtlichen Sachverhaltsaufklärungspflicht sowie eine Reduzierung des Beweismaßes zur Folge. Auch kann das Gericht hieraus in Abhängigkeit von den konkreten Umständen des Einzelfalls für den betreffenden Beteiligten ungünstige Schlussfolgerungen ziehen (z.B. auf die Nichteignung zum Führen eines Kfz bei Weigerung des Betroffenen, sich einer medizinisch-psychologischen Untersuchung zu unterziehen, § 11 Abs. 8 S. 1 FeV); vgl. ferner § 155 Abs. 4 VwGO zu möglichen kostenrechtlichen Folgen. Können die tatsächlichen Voraussetzungen einer Norm nicht geklärt werden, so geht dies zu Lasten desjenigen Beteiligten, der sich auf diese beruft. „Dies gilt auch, wenn die tatsächlichen Voraussetzungen sich nicht klären lassen, von denen die Zulässigkeit der erhobenen Klage abhängt“[5];
Aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes haben Formulierungen wie „schlüssiger Klagevortrag“ oder „erhebliche Verteidigung des Beklagten“ in einer öffentlich-rechtlichen Klausur nichts zu suchen. Vielmehr kann sich „eine nach dem Klagevortrag nicht begründete Klage […] nach gerichtlicher Aufklärung und Rechtsprüfung […] durchaus im Ergebnis als begründet erweisen.“[6]
21
•
Amtsbetriebs- und Konzentrationsgrundsatz. Nach Ersterem, der den Untersuchungsgrundsatz ergänzt, erfolgt die Zustellung der Klage (§ 85 VwGO) sowie von Anordnungen und Entscheidungen, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird, von Terminbestimmungen, Ladungen (§§ 56 Abs. 1, 2, 102 VwGO) und des Urteils (§ 116 Abs. 1 S. 2 VwGO) von Amts wegen, d.h. durch das Gericht – und nicht etwa durch die Beteiligten im Parteibetrieb. In engem Zusammenhang hiermit steht der Konzentrationsgrundsatz (bzw. -maxime), dem zufolge das Gericht den Rechtsstreit möglichst in einer mündlichen Verhandlung erledigen soll, § 87 Abs. 1 S. 1 VwGO. Vgl. auch §§ 87–87b, 92 VwGO;
22
•
Grundsatz des rechtlichen Gehörs vor Gericht. Als einfach-gesetzliche Konkretisierung dieses aus Art. 103 Abs. 1 GG folgenden grundrechtsgleichen Rechts bestimmt § 108 Abs. 2 VwGO, dass das Urteil nur auf solche Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden darf, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Zudem hat das Gericht die Beteiligten auf solche Gesichtspunkte hinzuweisen, welche bisher zwar nicht Gegenstand der Verhandlung waren, die nach Ansicht des Gerichts aber gleichwohl entscheidungsrelevant sind, vgl. § 86 Abs. 3 VwGO. Unmittelbar aus Art. 103 Abs. 1 GG folgt, dass wesentliche, der Rechtsverfolgung oder -verteidigung dienende Tatsachenbehauptungen der Beteiligten vom Gericht in den Entscheidungsgründen zu verarbeiten sind;
23
•
Mündlichkeits- und Unmittelbarkeitsgrundsatz. Der Verwirklichung des Rechts auf rechtliches Gehör dient der Mündlichkeitsgrundsatz[7] des § 101 Abs. 1 VwGO. Diesem zufolge entscheidet das Gericht auf Grund mündlicher Verhandlung, soweit nichts anderes bestimmt ist (so aber z.B. in §§ 84 Abs. 1 S. 1, 101 Abs. 2, 3 VwGO). In engem Zusammenhang hiermit steht das Unmittelbarkeitsprinzip. Danach erhebt das Gericht Beweis in der mündlichen Verhandlung (§ 96 Abs. 1 S. 1 VwGO),[8] so dass alle Mitglieder des Gerichts aufgrund ihres unmittelbaren („unvermittelten“) persönlichen Eindrucks sowohl vom Sach- und Rechtsvortrag der Beteiligten als auch von der Beweisaufnahme entscheiden können. Vgl. ferner §§ 108 Abs. 2, 112 VwGO;
24
•
Öffentlichkeitsgrundsatz. Dieser ist in § 55 VwGO i.V.m. § 169 Abs. 1 S. 1 GVG verankert und verlangt, dass die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließlich der Verkündung der Urteile und Beschlüsse öffentlich erfolgt, vgl. auch Art. 6 Abs. 1 EMRK. Jedermann, also auch die am konkreten Verfahren nicht beteiligten Personen, muss daher im Rahmen der örtlichen und räumlichen Verhältnisse Zutritt zum Gerichtssaal haben. Hierdurch soll insbesondere die Objektivität der Rechtsprechung und ihre Kontrolle durch die Allgemeinheit sichergestellt werden (keine „Geheimjustiz“). Das in § 169 S. 2 GVG a.F. vormals enthaltene strikte Verbot von Ton- und Fernseh-Rundfunkaufnahmen sowie von Ton- und Filmaufnahmen zum Zweck der öffentlichen Vorführung oder Veröffentlichung ihres Inhalts ist mit Wirkung vom 18.4.2018 durch das Gesetz über die Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren (EMöGG) aufgelockert worden, siehe § 169 Abs. 1 Sätze 3 bis 5, Abs. 2 bis 4 GVG n.F. Mit dieser Neuregelung sucht der Gesetzgeber das Spannungsverhältnis zwischen dem Grundrecht auf freie Information aus allgemein zugänglichen Quellen (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG) und auf Rundfunk- und Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG) einerseits sowie dem allgemeinen Persönlichkeits(grund-)recht namentlich des Klägers bzw. Antragstellers (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG), deren Anspruch auf ein faires Verfahren (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG) sowie der Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege (vgl. Art. 92, 97 f. GG) andererseits zum Ausgleich zu bringen; dies unter Berücksichtigung der sich aus dem „Pressekodex“ des Deutschen Presserats und den „Richtlinien für die publizistische Arbeit“ ergebenden Selbstverpflichtungen der journalistischen Berichterstattung.[9] Der Ausschluss der Öffentlichkeit für bestimmte Verfahren oder aus sitzungspolizeilichen Gründen bemisst sich nach § 55 VwGO i.V.m. §§ 171a ff. GVG. Erhebt das Gericht gem. § 96 Abs. 2 VwGO schon vor der mündlichen Verhandlung durch eines seiner Mitglieder als beauftragten Richter Beweis oder ersucht es durch Bezeichnung der einzelnen Beweisfragen ein anderes Gericht um die Beweisaufnahme, so gilt der Grundsatz der Parteiöffentlichkeit. Danach werden (nur) die Beteiligten von allen Beweisterminen benachrichtigt und können der Beweisaufnahme beiwohnen, § 97 S. 1 VwGO.
25
Verstöße gegen die vorgenannten Verfahrensgrundsätze können von den Verfahrensbeteiligten im Wege der Berufung (§ 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO), der Revision (§ 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO) bzw. der Anhörungsrüge (§ 152a VwGO)[10] geltend gemacht werden.
Anmerkungen
Hierzu sowie zum gesamten Folgenden siehe BVerfGE 84, 188; 87, 331; 103, 44; BVerfG NJW 2013, 1293; NVwZ 2016, 238; Hufen Verwaltungsprozessrecht §§ 35, 36 Rn. 32 ff.; Ehlers in: ders./Schoch, Rechtsschutz im Öffentlichen Recht § 25 Rn. 28; Kopp/Schenke VwGO § 96 Rn. 1, § 108 Rn. 1 f.; Mann/Wahrendorf Verwaltungsprozessrecht § 4; Schenke Verwaltungsprozessrecht Rn. 18 ff., 1101, 1111 ff.; Schmitt Glaeser/Horn Verwaltungsprozessrecht Rn. 514 ff.; 537 ff.; Würtenberger/Heckmann Verwaltungsprozessrecht Rn. 87 ff., 558 ff., 593, 633 ff.
Der Verfahrensfairness dient u.a. § 54 VwGO (i.V.m. §§ 41–49 ZPO), der die Unparteilichkeit des Richters sicherstellen soll.
Danach gilt: „Da mihi factum – dabo tibi ius“ (lat.: „Gib Du mir die Tatsache – ich werde Dir das [daraus folgende] Recht geben“).
Anders als im Zivilprozess (§§ 330 ff. ZPO) gibt es im Verwaltungsprozess daher insbesondere kein Versäumnisurteil, vgl. § 102 Abs. 2 VwGO. Siehe aber Rn. 624 zur Glaubhaftmachung.
BVerwG NVwZ 2014, 1666 (1669). Zur Normbegünstigungstheorie siehe Rn. 19 in der 1. Auflage.
Jacob JuS 2011, 511 (512).
Gegenmodell: Schriftliches Verfahren mit Entscheidung nach Aktenlage.
Siehe allerdings auch § 96 Abs. 2 VwGO und vgl. §§ 87 Abs. 3, 87a Abs. 2, 3 VwGO.
Vgl. BT-Drucks. 18/12591, S. 14 ff.
Ob der seinem Wortlaut nach allein Gehörsverletzungen erfassende § 152a VwGO auf die Verletzung anderer verfassungsrechtlich geschützter Verfahrensgarantien analoge Anwendung findet, ist str., siehe Kaufmann in: Posser/Wolff, BeckOK VwGO, § 152a Rn. 2, 25 ff. m.w.N.
1. Teil Einleitung › E. Entscheidung des Gerichts
E.Entscheidung des Gerichts
1. Teil Einleitung › E. Entscheidung des Gerichts › I. Entscheidungsformen des Gerichts
I.Entscheidungsformen des Gerichts
26
Seinen Abschluss findet der unter Beachtung der vorgenannten Verfahrensgrundsätze (Rn. 18 ff.) durchgeführte Verwaltungsprozess regelmäßig mit dem Urteil[1] des Gerichts, vgl. § 107 VwGO. Abweichend hiervon sieht § 84 Abs. 1 VwGO aus Vereinfachungsgründen (keine mündliche Verhandlung) die Möglichkeit der Entscheidung durch Gerichtsbescheid vor, wenn die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist und der Sachverhalt geklärt ist. Der Gerichtsbescheid wirkt als Urteil, § 84 Abs. 3 Hs. 1 VwGO. Bei entsprechender ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung (z.B. §§ 80 Abs. 7 S. 1, 123 Abs. 4 VwGO; Rn. 587, 630) entscheidet das Gericht durch Beschluss, vgl. § 122 VwGO.
1. Teil Einleitung › E. Entscheidung des Gerichts › II. Form, Inhalt und Aufbau des Urteils
II.Form, Inhalt und Aufbau des Urteils
27
Form, Inhalt und Aufbau des in deutscher Sprache (§ 55 VwGO i.V.m. § 184 GVG) abzufassenden Urteils als „Regelentscheidungsform des Verwaltungsprozesses“[2] ergeben sich v.a. aus § 117 VwGO. Das Rubrum (Urteilskopf; § 117 Abs. 2 Nr. 1, 2 VwGO) eines verwaltungsgerichtlichen Urteils lässt sich in etwa wie folgt darstellen:[3]
28
Aktenzeichen[4]
VERWALTUNGSGERICHT [Ort]
Im Namen des Volkes
Urteil[5]
In dem Verwaltungsrechtsstreit[6]
des [Name, Beruf, Adresse],
Klägers,
– Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt [Name, Adresse] –
gegen
die Stadt [Name],
vertreten durch den Oberbürgermeister [Adresse]
Beklagte,
– Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt [Name, Adresse] –
(ggf.: „beigeladen: [Name, Adresse])
(ggf.: „beteiligt: Der Vertreter des Öffentlichen Interesses bei dem Verwaltungsgericht [Ort]“)
wegen
[Betreff]
hat die [Zahl]. Kammer des Verwaltungsgerichts [Ort] auf die mündliche Verhandlung vom [Datum][7] durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht [Name], die Richter am Verwaltungsgericht[8] [Name] und [Name] sowie die ehrenamtlichen Richter [Name] und [Name]
am [Datum]
für Recht erkannt:
29
Unmittelbar an das Rubrum schließt sich gem. § 117 Abs. 2 Nr. 3 VwGO die Urteilsformel[9] (Tenor) an, welche neben dem (Haupt-)Ausspruch zur Sache auch noch die (Neben-)Entscheidungen über die Kosten (§ 161 Abs. 1 VwGO), zur vorläufigen Vollstreckbarkeit (§ 167 Abs. 1 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO) und ggf. über die Zulassung eines Rechtsmittels (§§ 124, 124a Abs. 1, 132, 135 f. VwGO; Rn. 8) enthält. Im Fall eines erstinstanzlichen, klageabweisenden Urteils lautet der Tenor etwa wie folgt:[10]
30
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.
3. Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 110% des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
31
Im Anschluss an den Tenor folgt gem. § 117 Abs. 2 Nr. 4 VwGO der als solcher überschriebene „Tatbestand“. In diesem ist der Sach- und Streitstand unter Hervorhebung der gestellten Anträge seinem wesentlichen Inhalt nach gedrängt darzustellen, § 117 Abs. 3 S. 1 VwGO. Wegen der Einzelheiten soll nach § 117 Abs. 3 S. 2 VwGO auf Schriftsätze, Protokolle und andere Unterlagen verwiesen werden, soweit sich aus ihnen der Sach- und Streitstand ausreichend ergibt.
32
Die nach § 117 Abs. 2 Nr. 5 VwGO auf den Tatbestand folgenden „Entscheidungsgründe“, welche mit dem zusammenfassenden Gesamtergebnis beginnen (z.B. „Die zulässige Klage ist nicht begründet“), geben diejenigen Gründe an, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind, § 108 Abs. 1 S. 2 VwGO. Insoweit ist zunächst auf die Zulässigkeit und – sofern diese bejaht wird – anschließend auf die Begründetheit der Klage einzugehen (Rn. 40).
33
Abgeschlossen wird das Urteil durch die Rechtsmittelbelehrung (§ 117 Abs. 2 Nr. 6 VwGO; Rn. 8) und die Unterschriften der mitwirkenden (Berufs-)Richter, § 117 Abs. 1 S. 2, 4 VwGO.[11] Das Urteil wird in der Regel in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, verkündet und ist den Beteiligten zuzustellen, § 116 Abs. 1 VwGO.[12] Damit beginnen gem. §§ 124a Abs. 2 S. 1, 139 Abs. 1 S. 1 VwGO die Rechtsmittelfristen zu laufen.
Überprüfen Sie jetzt online Ihr Wissen zu den in diesem Abschnitt erarbeiteten Themen. Unter www.juracademy.de/skripte/login steht Ihnen ein Online-Wissens-Check speziell zu diesem Skript zur Verfügung, den Sie kostenlos nutzen können. Den Zugangscode hierzu finden Sie auf der Codeseite.
Anmerkungen
Hinsichtlich der verschiedenen Arten von Urteilen kann differenziert werden zwischen Gestaltungs- (z.B. § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO), Leistungs- (z.B. § 113 Abs. 5 VwGO) und Feststellungsurteilen (z.B. § 43 Abs. 1 VwGO); Prozess- und Sachurteilen; End- (§ 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 300 ZPO) und Zwischen- (§§ 109, 111 VwGO) sowie Voll- und Teilurteilen (§ 110 VwGO). Ferner gibt es Vorbehalts- (§ 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 302 ZPO), Abänderungs- (§ 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 323 ZPO), Verzichts- (§ 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 306 ZPO) und Anerkenntnisurteile (§ 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 307 ZPO).
Hufen Verwaltungsprozessrecht § 38 Rn. 1.
Zum Folgenden siehe Jansen/Wesseling JuS 2009, 32 ff., 322 ff.; Mann/Wahrendorf Verwaltungsprozessrecht § 15 Rn. 16 und Anhang; Martens/Koch Mustertexte zum Verwaltungsprozess Rn. 341; Pietzner/Ronellenfitsch Das Assessorexamen im Öffentlichen Recht Rn. 860; Ramsauer/Lambiris/Kappet Die Assessorprüfung im öffentlichen Recht Rn. 5.12; Schenke Verwaltungsprozessrecht Rn. 57d; Schmitt Glaeser/Horn Verwaltungsprozessrecht Rn. 520.
Zu den Registerzeichen siehe etwa den Anhang im v. Hippel-Rehborn.
Ggf. ist die besondere Urteilsart zu kennzeichnen.
Synonym: Verwaltungsrechtssache, -streitsache, -streitverfahren, verwaltungsgerichtliches Verfahren.
Bzw. falls keine mündliche Verhandlung stattgefunden hat: „ohne mündliche Verhandlung am“.
Der Richter auf Probe führt gem. § 19a Abs. 3 DRiG nur die Amtsbezeichnung „Richter“ (ohne „am Verwaltungsgericht“, vgl. § 19a Abs. 1 DRiG). Nach § 29 S. 1 DRiG darf bei einer gerichtlichen Entscheidung nicht mehr als ein Richter auf Probe mitwirken.
Die Urteilsformel ist nicht zu verwechseln mit den Leitsätzen des Urteils, bei denen es sich um eine Zusammenfassung der wichtigsten Entscheidungsgründe handelt.
Zum gesamten Vorstehenden siehe Hufen Verwaltungsprozessrecht § 38 Rn. 13; Ramsauer/Lambiris/Kappet Die Assessorprüfung im öffentlichen Recht Rn. 6.01; Schenke Verwaltungsprozessrecht Rn. 57b. Zum Folgenden siehe Finger Jt 2008, 635 (640); Hufen Verwaltungsprozessrecht § 38 Rn. 20; Jansen/Wesseling JuS 2009, 32 (33); Kment JuS 2005, 420 (421); Preusche JuS 2000, 170 ff.
Die Streitwertfestsetzung wird in Klausuren üblicherweise erlassen.
Entscheidet das Gericht ohne mündliche Verhandlung, so wird das Urteil nicht verkündet, sondern nur zugestellt.
2. TeilVerwaltungsgerichtliche Klage
A.Ggf.: Auslegung bzw. Umdeutung des Klagebegehrens
B.Zulässigkeit
C.Begründetheit
34
Die in verwaltungsrechtlichen Klausuren anzutreffenden Aufgabenstellungen erfordern regelmäßig die Prüfung der Erfolgsaussicht eines förmliches Rechtsbehelfs (Rn. 8), sei es in Form eines Gutachtens im 1. Staatsexamen oder eines entsprechenden gerichtlichen Entscheidungs- oder anwaltlichen Klage-/Antragsentwurfs im 2. Staatsexamen. Ein förmlicher Rechtsbehelf, namentlich die im Folgenden behandelte verwaltungsgerichtliche Klage, hat dann Erfolg – und nicht nur wie die Verfassungsbeschwerde Aussicht hierauf[1] –, wenn sie zulässig (Rn. 40 ff.) und begründet (Rn. 390 ff.) ist. D.h., es müssen alle für die Entscheidung des Gerichts in der Sache erforderlichen (Sachentscheidungs-)Voraussetzungen gegeben sein und nach dem vom Gericht festgestellten Sachverhalt (Rn. 20) die Anforderungen vorliegen, an die das materielle Recht die Zuerkennung des mit der Klage geltend gemachten Anspruchs knüpft. Damit ist zugleich das Grobschema der Falllösung vorgegeben: „1. Zulässigkeit, 2. Begründetheit“.[2]
35
Der abweichenden Auffassung,[3] die wegen § 17a Abs. 2 S. 1 GVG (i.V.m. § 173 S. 1 VwGO; Rn. 65) in einer dreistufigen Gliederung vor der „Zulässigkeit“ und der „Begründetheit“ des Rechtsschutzbegehrens noch die „Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs“ prüfen will, ist nicht zu folgen. Letztlich sollte der Streit um den zwei- oder dreistufigen Aufbau allerdings nicht überbewertet werden, scheint es in der Prüfungspraxis doch zu einer „friedlichen Koexistenz“ beider Konzepte gekommen zu sein.[4] Keinesfalls aber darf der gewählte Aufbau im Gutachten begründet werden.[5]
Anmerkungen
Hierzu Wienbracke Einführung in die Grundrechte, Rn. 573 f. Vgl. auch Schübel-Pfister JuS 2012, 420.
Zum gesamten Vorstehenden siehe Ehlers in: ders./Schoch, Rechtsschutz im Öffentlichen Recht § 21 Rn. 2; Gersdorf Verwaltungsprozessrecht Rn. 1, 17, 64, 82, 99, 116, 128; Hufen Verwaltungsprozessrecht § 10 Rn. 1 ff.; Kopp/Schenke VwGO Vorb § 40 Rn. 2; Mann/Wahrendorf Verwaltungsprozessrecht § 6 Rn. 1; Schenke Verwaltungsprozessrecht Rn. 58, 62, 155. Zum infolge anderer Aufgabenstellungen mitunter gebotenen abweichenden Aufbau siehe Bull JuS 2000 778.
Einen Überblick über den Streitstand geben Fischer Jura 2003, 748 ff.; Heidebach Jura 2009, 172 ff.; Leifer JuS 2004, 956 ff.; Schübel-Pfister JuS 2017, 1078 (1079 a.E.).
Hufen Verwaltungsprozessrecht § 10 Rn. 1. Vgl. auch Schaks/Friedrich JuS 2018, 860 (861).
Vgl. Wolff in: ders./Decker, VwGO/VwVfG § 40 VwGO Rn. 10 f.
2. Teil Verwaltungsgerichtliche Klage › A. Ggf.: Auslegung bzw. Umdeutung des Klagebegehrens
A.Ggf.: Auslegung bzw. Umdeutung des Klagebegehrens
36
Noch vor Behandlung der Zulässigkeitsvoraussetzungen kann es u.U. erforderlich sein, auf bestimmte prozessuale Fragestellungen (kurz) einzugehen, wozu neben der Rubrumsberichtigung u.a. die Auslegung bzw. Umdeutung des Klagebegehrens zählt.[1]
37
Nach dem im Verwaltungsprozessrecht herrschenden Dispositionsgrundsatz entscheiden die Beteiligten über den Umfang des Rechtsstreits (Rn. 19). Folglich ist das Gericht an das Klagebegehren (§ 82 Abs. 1 S. 1 VwGO), d.h. an den – ggf. auszulegenden bzw. umzudeutenden – Antragdes Klägers (§ 82 Abs. 1 S. 2 VwGO), welcher den Streitgegenstand (mit-)bestimmt (Rn. 58), gebunden, vgl. § 88 Hs. 1 VwGO. Das Gericht darf dem Kläger daher weder quantitativ mehr (z.B. Verpflichtung der Behörde zum Erlass eines bestimmten Verwaltungsakts anstatt der beantragten bloßen Verbescheidung des Antrags) nochetwas anderes (aliud; z.B. Leistung statt bloße Feststellung) zusprechen als beantragt, wohl aber – bei (teilweise) unzulässiger oder unbegründeter Klage – weniger (z.B. nur Aufhebung des ablehnenden Bescheids anstelle der begehrten Verpflichtung der Behörde zum Erlass eines bestimmten Verwaltungsakts). Folge dieses Verbots, über den gestellten Antrag hinaus zu gehen (ne ultra petita) oder dem Kläger etwas anderes zuzusprechen als von diesem beantragt, ist die grundsätzliche Geltung des Verböserungsverbots (Verbot der reformatio in peius) im Verwaltungsprozess, vgl. §§ 88, 129, 141 S. 1 VwGO (Ausnahmen z.B.: Widerklage nach § 89 VwGO, Anschlussrechtsmittel nach §§ 127, 141 S. 1 VwGO). Auf eine Klage hin darf das Gericht nicht zum Nachteil des Klägers eine von diesem nicht beantragte (ungünstigere) Entscheidung treffen (z.B. Aufhebung eines Verwaltungsakts insgesamt, d.h. inkl. dessen für den Kläger günstigen Teilregelung, statt wie beantragt nur hinsichtlich des für den Kläger nachteiligen Teils).
38
In der vorbezeichneten Weise gebunden ist das Gericht gem. § 88 Hs. 1 VwGO allerdings nur an das Klagebegehren (Klage- bzw. Rechtsschutzziel), so wie es sich ihm im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung aufgrund des gesamten Prozessvorbringens (inkl. Klagebegründung) darstellt, nicht aber auch an die ggf. irrtümlich falsch gewählte (Wortlaut-)Fassung der Anträge, § 88 Hs. 2 VwGO.
„Das ,Klagebegehren‘ i.S.v. § 88 VwGO ist das […] wirkliche Rechtsschutzziel“[2], dessen Ermittlung nach dieser Vorschrift Aufgabe der Verwaltungsgerichte ist.[3]
39
Sofern Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein Rechtsbehelf eingelegt werden soll und gegen welche Maßnahme er sich richtet, ist aufgrund des verfassungsrechtlichen Gebots des effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG; Rn. 9) davon auszugehen, dass der Kläger denjenigen Rechtsbehelf einlegen wollte, der ihm im konkreten Fall ein Maximum an Rechtsschutz gewährt. Liegen diese Voraussetzungen vor, so kann eine dementsprechende Auslegung (§§ 133, 157 BGB analog) bzw. Umdeutung (§ 140 BGB analog) zulässig und geboten sein (z.B. kann die ausdrückliche Anfechtung nur des Erstattungsbescheids i.S.v. § 49a Abs. 1 VwVfG zugleich die konkludente Anfechtung des zugrundeliegenden [Subventions-]Rücknahmebescheids i.S.v. § 48 VwVfG enthalten).[4] Insofern „[w]esentlich ist der geäußerte Parteiwille, wie er sich aus der prozessualen Erklärung und sonstigen Umständen ergibt; der Wortlaut der Erklärung tritt hinter deren Sinn und Zweck zurück. Neben dem Klageantrag und der Klagebegründung ist auch die Interessenlage des Klägers zu berücksichtigen, soweit sie sich aus dem Parteivortrag und sonstigen für das Gericht und den Beklagten als Empfänger der Prozesserklärung erkennbaren Umständen ergibt; Anträge sind somit unter Berücksichtigung des recht verstandenen Interesses des Klägers auszulegen. Ist der Kläger bei der Fassung des Klageantrags anwaltlich vertreten worden, kommt der Antragsformulierung allerdings gesteigerte Bedeutung für die Ermittlung des tatsächlich Gewollten zu. Selbst dann darf die Auslegung jedoch vom Antragswortlaut abweichen, wenn die Klagebegründung, die beigefügten Bescheide oder sonstige Umstände eindeutig erkennen lassen, dass das wirkliche Klageziel von der Antragsfassung abweicht.“[5] Notwendige Voraussetzung eines derartigen Vorgehens gem. § 88 VwGO ist allerdings stets, dass das auf diese Weise erzielte Ergebnis dem vom Kläger in erkennbarer Weise verfolgten Rechtsschutzziel entspricht und von diesem insbesondere nicht bewusst ausgeschlossen wurde. In der Praxis hat bei unklaren Anträgen das Gericht auf eine Erläuterung hinzuwirken, § 86 Abs. 3 VwGO.
Anmerkungen
Hierzu sowie zu weiteren derartigen Situationen siehe Bülter Verwaltungsgerichtliche Urteile und Beschlüsse im Assessorexamen Rn. 267 ff.; Jansen/Wesseling JuS 2009, 32 (34 f.); Ramsauer/Lambiris/Kappet Die Assessorprüfung im öffentlichen Recht Rn. 8.12 f. Zum gesamten Folgenden siehe BVerwG SächsVBl 2015, 164; Decker in: Wolff/Decker, VwGO/VwVfG § 88 VwGO Rn. 1, 3; Kopp/Schenke VwGO § 88 Rn. 1 ff., 6 ff.; Schenke Verwaltungsprozessrecht Rn. 42a.
Kugele VwGO § 88 Rn. 3.
BVerfG NVwZ 2016, 238 (241) m.w.N.
Die Übergänge zwischen Auslegung (Ermittlung des vom Kläger tatsächlich verfolgten Zwecks – unabhängig von der gewählten Formulierung) und Umdeutung (Ermittlung des hypothetischen Willens des Klägers, wenn Ersterer in der vom Letzteren vorgesehenen Weise nicht zu erreichen ist) sind fließend. Beispiele hierzu bei Seibert JuS 2017, 122 (123); Wienbracke VR 2015, 93 (95).
BVerwG SächsVBl 2015, 164 (165) m.w.N.
2. Teil Verwaltungsgerichtliche Klage › B. Zulässigkeit
B.Zulässigkeit
40
Das Vorliegen der Zulässigkeitsvoraussetzungen prüft das Gericht von Amts wegen und in jedem Verfahrensstadium.[1] Sind diese erfüllt, so muss das Gericht zur Sache entscheiden; sind sie nicht erfüllt, darf das Gericht keine Sachentscheidung treffen und muss die Klage durch Prozessurteil als unzulässig abweisen, vgl. Art. 20 Abs. 3 GG. Das Gesetz erlaubt eine Sachentscheidung erst dann, wenn alle Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen. Deshalb ist die Zulässigkeit einer Klage (vgl. z.B. § 42 Abs. 2 VwGO) zwingend vor deren Begründetheit (vgl. z.B. § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO) zu prüfen. Insbesondere darf nicht etwa auf die Prüfung zweifelhafter Zulässigkeitsvoraussetzungen verzichtet und das prozessuale Begehren als jedenfalls unbegründet abgewiesen werden. Gleichfalls verbietet es sich, eine Klageabweisung sowohl auf ihre Unzulässigkeit als auch ihre Unbegründetheit zu stützen. Für die Rechtskraft eines Urteils ist es nämlich von erheblicher Bedeutung, ob eine Klage durch Prozessurteil als unzulässig oder durch Sachurteil als unbegründet abgewiesen wird. Allein bzgl. doppelt relevanter Tatsachen, d.h. solcher, die sowohl im Rahmen der Zulässigkeit als auch der Begründetheit von Bedeutung sind (z.B. Streit um die Wirksamkeit der Auflösung einer juristischen Person), ist anerkannt, die Klage in diesem Punkt (z.B. Beteiligtenfähigkeit, § 61 Nr. 1 Alt. 2 VwGO) als zulässig zu behandeln und erst im Rahmen der Begründetheit näher zu prüfen, ob die betreffenden Umstände tatsächlich vorliegen (z.B. § 3 VereinsG).
41
Ist die Klage unzulässig und ergibt sich aus der jeweiligen Aufgabenstellung nichts Abweichendes, so ist die Begründetheit in einem Hilfsgutachten zu prüfen.[2]
42
Maßgebender Zeitpunkt, zu dem die Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen müssen, ist grundsätzlich[3] derjenige der letzten mündlichen Verhandlung; findet diese nicht statt, so kommt es auf den Erlass der schriftlichen Entscheidung an. Bis zu diesem Zeitpunkt kann eine zunächst fehlende Zulässigkeitsvoraussetzung – sofern möglich (Negativbeispiel: Fristversäumnis) – noch nachträglich herbeigeführt werden (z.B. Erlangung der Prozessfähigkeit gem. § 62 VwGO). Gelingt dies nicht und wird die Klage folglich als unzulässig abgewiesen, so besteht die Möglichkeit, nach Behebung des betreffenden Mangels eine neue – insoweit dann zulässige – Klage zu erheben. Der Wegfall einer Zulässigkeitsvoraussetzung während des Rechtsstreits hat unterschiedliche prozessuale Konsequenzen, siehe z.B. einerseits § 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 17 Abs. 1 S. 1 GVG (Unbeachtlichkeit der nach Rechtshängigkeit eintretenden Veränderung der die Zulässigkeit des beschrittenen Rechtswegs begründenden Umstände; Rn. 64) und andererseits § 173 S. 1 VwGO i.V.m. §§ 239, 246 ZPO (Unterbrechung bzw. Aussetzung des Prozesses bei Wegfall der Beteiligungsfähigkeit).
43
In welcher Reihenfolge die verschiedenen Zulässigkeitsvoraussetzungen zu prüfen sind, ist vorwiegend eine Frage der Logik bzw. der Zweckmäßigkeit. Für die Klausurpraxis empfiehlt sich der nachfolgende Aufbau, wobei allerdings vor der „schematischen Anwendung des Schemas“ in Rn. 46 nachdrücklich zu warnen ist.
44
„Eine gute juristische Arbeit erkennt man nicht zuletzt auch daran, dass sie die Schwerpunktebei der Fallbearbeitung richtigsetzt.“ Nähere rechtliche Ausführungen zu offensichtlich unproblematischen Zulässigkeitsvoraussetzungen können den Wert der Arbeit sogar mindern.[4]
45
Stets erwartet werden allerdings – ggf. zumindest knappe – Ausführungen zu den im nachfolgenden Schema[5]fett hervorgehobenen Prüfungspunkten. Diese sind aufgrund des aus Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG folgenden Gebots der Gewährleistung von effektivem Rechtsschutz (Rn. 9 ff.) sämtlich „so anzuwenden und auszulegen, dass sie es nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise erschweren, einen eröffneten Rechtsweg [Rn. 53 ff.