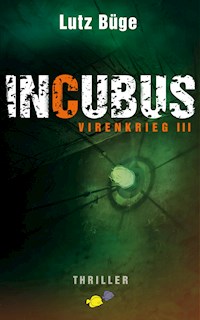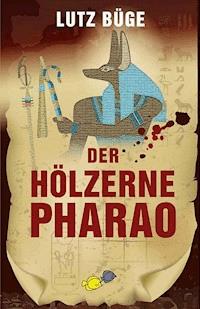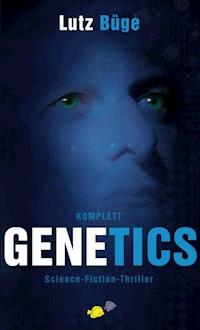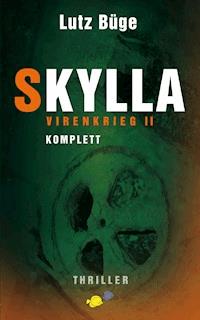Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
"Wir haben Ihre kleine Schwester. Wir werden ihr kein Leid zufügen, aber dafür erwarten wir etwas von Ihnen. Sie fliegen nach Ägypten, ins Fayyum, und zwar sofort. Denken Sie daran, wir brauchen nur eine einzige Kugel, um Ihrer Schwester ein Loch in den Kopf zu pusten, und Kugeln haben wir wirklich genug." . Wir schreiben das Jahr 2024. Al-Qaida ist besiegt. In einem jahrzehntelangen Krieg gegen den Terror haben die USA den Todfeind niedergerungen — doch um welchen Preis! Das gesellschaftliche Klima im Land ist durch Hass und Misstrauen verdorben. Alles wurde dem einen großen Kriegsziel untergeordnet. Das "land of the free" ist zu einem Überwachungsstaat geworden. Nun braucht die Militärmaschinerie einen neuen Feind. Die neugegründete "Islamische Allianz" kommt da gerade zur richtigen Zeit. . Der deutsche Mikrobiologie und Genetiker Jan Metzner wird in diesen Konflikt hineingezogen, als seine Schwester Meike von Terroristen der Gama'a al Islamiyya entführt wird. Jan erhält den Befehl, nach Ägypten zu fliegen. So gerät er mitten hinein in den Virenkrieg, der fast unbemerkt von der Öffentlichkeit mit biologischen Waffen geführt wird. Die Situation eskaliert, als das Luxus-Kreuzfahrtschiff Queen Mary 2 von Terroristen entführt wird. Doch diese "Terroristen" sind etwas anders als erwartet … . "Virenkrieg - Erstes Buch" ist der erste Teil des Zyklus "Virenkrieg". Teil 2 erscheint 2016. Leserstimmen: "Gänsehautbewirkende Dichte" (Amazon Customer) "... es geht spannend weiter! und wie! Lutz Büge schafft es die Spannung zu erhöhen, man zittert richtiggehend mit Jan." (ivg "isi") "Obwohl die Geschichte in zehn Jahren spielt, wurde ich das Gefühl nicht los: das könnte es heute schon geben. Das Buch ist faszinierend und alles andere als Science Fiction – das macht es auch so erschreckend. Was, wenn das tatsächlich schon so ist. Wäre es kein Buch, würde ich sagen: GANZ GROSSES KINO." (Marc Lesser) . Mehr Info: ybersinn.de/news
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 788
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Virenkrieg
Erstes Buch
Inhaltsverzeichnis
Prolog 1
Prolog 2
1. Kapitel: Alles hängt mit allem zusammen
2. Kapitel: Ausgeliefert
3. Kapitel: Alles wie früher
4. Kapitel: Der Tod des Senators
5. Kapitel: Unter Beobachtung
6. Kapitel: Himmelfahrt
7. Kapitel: Charybdis
8. Kapitel: Am Pranger
9. Kapitel: Hydra des Hasses
10. Kapitel: Gottesurteil
„Verehrte Herren, lassen Sie mich nun zum Punkt kommen. Welche Kriterien zeichnen ein echtes Killervirus also aus? Ich glaube, es sind die vier folgenden:
Erstens: Ein hohes Ansteckungspotenzial. Es kann leicht übertragen werden, nicht nur direkt von Mensch zu Mensch. Es reicht, eine Türklinke zu berühren, die vorher ein Infizierter in der Hand hatte, der sich die Hände nicht gewaschen hat. Unübertroffen ansteckend ist Orthopoxvirus variola, das Pocken-Virus, aber auch Influenza-Viren wie H5N1 können das gut.
Zweitens: Eine hohe Sterbequote. Je weniger Menschen die Infektion mit einem Virus überleben, desto höher sind seine Mortalitätsrate und das Potenzial, selbst das beste Gesundheitssystem dieses Planeten zum Zusammenbruch zu bringen. Unübertroffen in dieser Hinsicht: das Marburg-Virus mit einer Mortalitätsrate von bis zu 90 Prozent.
Drittens: Mieses Image. Unser Killervirus löst Panik unter den Menschen aus und lässt jedes gesellschaftliche Zusammenleben zum Erliegen kommen. Das schlechteste Image aller Viren hat zweifellos die Menschheitsgeißel schlechthin, das Pocken-Virus.
Viertens: Keine Gegenmittel. Es steht kein Impfstoff zur Verfügung und es kann in der Eile auch keiner hergestellt werden. Da viele Staaten sich mit Pocken-Impfstoff für ihre Bevölkerungen bevorratet haben, scheidet der Pocken-Erreger und wohl auch Pocken-Chimären trotz vieler Vorzüge leider aus. Im Idealfall sollte es sich um ein unbekanntes Virus handeln, das noch nicht erforscht werden konnte.
Und damit kommen wir zum Kern dieser Veranstaltung, sehr geehrte Herren, denn ich hätte hier etwas für Sie, hier in diesem kleinen, unscheinbaren Hochsicherheitsbehälter …“
Auszug aus den SCOUT-Protokollen,
Prolog 1
9. September 2022
Seattle, Lakeside Avenue
Der Himmel war tiefblau, als habe ihn ein unerbittlicher, stählerner Besen leergefegt. Die Sonne glitzerte auf den Wellen von Lake Washington, die von einigen dahinschnellenden Segelbooten durchschnitten wurden, und in der klaren Luft erhoben sich weit jenseits des Sees in der Ferne die schneebedeckten Viertausender-Vulkane der Cascade Range. Nur im Südosten, wo Mount Rainier thronte, ballten sich Wolken. Der mächtige Vulkan entzog sich häufig den Blicken der Tiefländer.
Samuel McWeir liebte dieses Panorama. Hier oben im Nordwesten war die Welt noch in Ordnung. Das ließ sich sonst nur noch von sehr wenigen Orten auf diesem Planeten behaupten. Stundenlang konnte Samuel auf der Terrasse seiner Villa sitzen, besonders wenn er, wie jetzt, von einer längeren, erschöpfenden Reise durch mehrere US-Bundesstaaten zurückgekehrt war, in deren Verlauf er sich mit viel Banalem hatte abgeben müssen. Er liebte das sanfte Glucksen, mit dem Lake Washington um die hölzernen Fundamente der Terrasse spülte, und er liebte es, sein Leben, das weitgehend hinter ihm lag, mit dem Blick auf die Cascade Range zu vergleichen. Dabei war ihm völlig klar, dass etwas Anstrengung nötig war, um den Anblick einer Gipfelkette nicht etwa mit einer Kurve von Börsennotierungen eines Unternehmens zu assoziieren oder mit dem Auf und Ab eines menschlichen Lebens, sondern mit einer immerwährenden Erfolgsgeschichte, einem permanenten Gipfelsturm, der nur eine Richtung kannte: aufwärts.
Samuel empfing gern Journalisten, damit sie über ihn berichteten, aber vor ungefähr einem Monat, vielleicht auch erst vor drei Wochen – jedenfalls vor seiner Reise nach Arkansas – hatte er eine junge Frau hinausgeworfen. Sie hatte ihn von Anfang an mit Misstrauen erfüllt, unter anderem weil sie von einem dieser Blogs kam, die in der Medienarbeit mittlerweile so wichtig waren wie Fox News. Raphael, Samuels Medienberater, hatte ihm geraten, die Journalistin zu empfangen, aber kaum hatte er sie gesehen, da wusste er schon, dass es in die Hose gehen würde. So freundlich, so herzlich – und so ehrgeizig! Die Sprache kam auf seine Arbeit, und statt der üblichen Fragen – „Wie haben Sie sich gefühlt, Sir, als Sie den Nobelpreis in Empfang nahmen? Meinen Sie nicht, Sir, dass Sie den Nobelpreis schon mindestens zwei Jahre früher verdient hätten?“ und derlei –, statt solche Fragen zu stellen, hatte diese Frau wissen wollen:
„Mr. McWeir, glauben Sie wirklich, dass Sie den Nobelpreis verdient haben?“
Der Affront beschäftigte ihn noch heute, Wochen später. Die Frage hatte etwas in ihm aufgerührt. Ja, er war überzeugt davon, dass er den Preis verdient hatte, denn er hatte viel geleistet. Er verstand nicht, wie jemand daran offenbar zweifeln konnte. War das etwa ein Vorbote dessen, was in linken Medien gern als „kritische Würdigung“ bezeichnet wurde? Durfte man denn nicht mehr seine Meinung sagen? Samuel stand dazu, was er der Nation neulich in jenem Time-Interview zu amerikanischen Werten und Tugenden gesagt hatte, aber vielleicht wäre es doch klüger gewesen, hätte er diese Gedanken für sich behalten. Dann hätte er seinen Frieden gehabt und könnte so sterben, wie er es sich immer vorgestellt hatte, ganz schlicht, zurückgelehnt im bequemen Liegestuhl, vor sich auf dem Tisch eine Tasse Tee, die Maggie ihm gerade serviert hatte, die nagenden Geräusche des Wassers im Ohr, und das letzte, was er auf Erden sähe, wäre dieses unglaubliche Bergpanorama.
Er war unruhig. Immer wieder sah er auf die Uhr, die inzwischen 3:20 nachmittags zeigte, und schüttelte den Kopf. Es war nicht Michaels Art, sich zu verspäten. Zumindest würde er etwas von sich hören lassen, eine erklärende SMS, ein kurzer Anruf. Um 17 Uhr kamen die Gäste zur jährlichen Soirée, und zwischen Samuel und Michael war verabredet, dass sie sich vorher in Ruhe ein wenig unterhalten wollten. Samuel freute sich darauf, den jungen Professor von seiner in Schwung kommenden Karriere berichten zu hören, von den Projekten mit all dem unerforschten Leben, das er da unten in Phoenix auf den Labortisch bekam. Michael berichtete zwar in regelmäßigen Mails, wie es ihm erging, aber es war doch etwas anderes, wenn man sich beim Erzählen gegenübersaß. Samuel war vor allem auf die Dinge neugierig, von denen Michael in seinen Mails wohlweislich nichts schrieb.
Samuel hatte die Universität von Phoenix dezent auf den jungen Mann hingewiesen, als er von dem Projekt mit Fupro gehört hatte. Dieses Projekt entsprach in seiner Bedeutung dem Human Genom Project, in dem Ende des vergangenen Jahrtausends das menschliche Erbgut komplett kartiert worden war. Am CER – dem Center for Epidemiological Research – wollten sie etwas Ähnliches mit der Welt der Mikroben versuchen, doch dagegen war das Human Genom Project ein Kinderspiel. Samuel schätzte, dass weniger als ein Tausendstel aller auf Erden existierenden mikroskopisch kleinen Lebensformen überhaupt bekannt, geschweige denn systematisch erfasst oder gar erforscht worden war. Über die großen Menschheitsgeißeln wie die Erreger der Pest oder der Lepra wusste man natürlich eine Menge, aber es gab unzählige weitere mikroskopisch kleine Organismen, über die sich kaum jemals ein Wissenschaftler den Kopf zerbrochen hatte, einfach weil sie noch niemand bemerkt hatte. In dieser Welt des Mikroskopischen stand die Wissenschaft immer noch ganz am Anfang. Selbst in Sachen Tiefseeforschung war man inzwischen weiter. Und jenseits des Mikroskopischen, in Bereichen, die kein konventionelles Lichtmikroskop mehr erhellen konnte, wartete das Universum der Viren auf Erforschung. Dafür war Michael Schwartz genau der Richtige.
Sie suchten also einen Mikrobiologen und Genetiker dort unten in Arizona. Eigentlich hatten sie nach jemanden mit etwas mehr Erfahrung Ausschau gehalten, doch wenn ein Nobelpreisträger jemanden empfahl, dann schaute man sich den Kandidaten zumindest einmal genauer an. Samuel hatte gewusst, dass es passen würde. Michael war sein bester Student, eine Art Meisterschüler, und das wollte etwas bedeuten, denn im Laufe der Jahre hatte Samuel etliche junge Leute ausgebildet. Michael war etwas Besonderes. Samuel hatte es sich nicht nehmen lassen, ihn auch über den Zeitpunkt seiner Emeritierung hinaus zu unterstützen, so wie er selbst damals unterstützt worden war. Er hatte denen in Phoenix nichts aufgeschwatzt, im Gegenteil: Er hatte ihnen ein Jahrhunderttalent vermittelt. Manchmal genügten eben ein paar Worte, um Großes zu bewirken. Man musste nur die richtigen Menschen zusammenbringen.
Seit zwei Monaten war Michael nun in Phoenix. Zuletzt hatte sich der Tonfall seiner Mails verändert. Es musste mit dem Tod seines Vaters zusammenhängen. Samuel hatte natürlich sein Beileid ausgesprochen, das Unglück aber ansonsten nicht kommentiert. Philipp Schwartz, Senator von Vermont, war ein demokratisches Weichei. Einer, der hinter jeder noch so geringfügigen Kooperation gleich finstere Machenschaften des militärisch-industriellen Komplexes witterte. Samuel hatte stets seinem Land und seinen Präsidenten gedient, auch der Präsidentin. Für Bedenkenträger wie diesen Senator hatte er nichts als Verachtung übrig, aber zu Michael hatte er darüber natürlich kein einziges Wort verloren. Michael war völlig anders als sein Vater, er war einer von denen, die das Land voranbringen wollten, einer von denen, die neugierig voranstürmten und sich beim Anblick eines Busches nicht als erstes fragten, welche Gefahr dahinter lauern mochte. Aber der Tod seines Vaters hatte ihn natürlich verstört. Das war nur normal.
Schade war allerdings, dass Michael auch in Phoenix kein Glück bei den Frauen zu haben schien. Das las Samuel zwischen den Zeilen heraus, und diese Frage hatte er vor allen anderen heute Nachmittag ansprechen wollen. Michael musste unbedingt daran denken, seine Gene weiterzugeben! Das Projekt, die Arbeit – alles wunderbar. Doch darüber durfte Michael nicht vergessen, Kinder zu zeugen. Leider waren die Frauen heute völlig anders als damals, viel komplizierter, viel mehr darauf erpicht, selbst Karriere zu machen, statt sich darum zu kümmern, ihrem Mann im Hintergrund den Rücken frei zu halten und ihm Kinder zu gebären. Dafür war natürlich die demokratische Gleichmacherei verantwortlich. So eine wie Maggie, die Samuel durchs Leben begleitet und ihre fünf Kinder erzogen hatte, so eine Frau war heutzutage leider kaum noch aufzutreiben. Samuel verstand nicht, warum die Frauen vielfach nichts mehr von den Vorzügen der klassischen Arbeitsteilung hielten. Dabei war Michael doch ein gutaussehender Mann!
3:30 Uhr. Noch immer kein Ton von Michael. Sie waren für drei Uhr verabredet gewesen.
Irgendetwas muss passiert sein, dachte Samuel McWeir.
Fragend sah er Maggie an, die ihm gegenüber am Tisch auf der Terrasse über den Wellen von Lake Washington saß und so oft wie möglich tief durchatmete, bevor die Gäste kamen, denn sie mochte diese Akademiker-Soirées nicht.
Sie erfasste, was in Samuel vorging, und zuckte mit den Achseln.
„Das Flugzeug aus Phoenix, mit dem er kommen wollte, ist vor drei Stunden gelandet“, sagte sie, bevor er fragen konnte. „Michael war nicht an Bord.“
Sie hatte im Netz nachgesehen, auf seinen Wunsch hin mehrfach.
„Es muss etwas passiert sein“, wiederholte Samuel laut seinen Gedanken. „Das ist nicht Michaels Art.“
„Ach, Sam, verstehst du die Welt noch?“
Samuel runzelte die Stirn.
„Ich bilde es mir ein“, gab er zurück, „aber was hat das mit Michael zu tun?“
„Gar nichts, du hast recht“, sagte sie seufzend.
Wie immer gab sie nach, sobald er nachhakte. Sie wich jeder ernsthaften Diskussion aus, um des lieben Friedens willen.
Es klingelte an der Tür.
„Das wird er sein“, sagte Samuel, und Maggie stand ächzend auf und schlurfte von der Terrasse ins Haus. Es klingelte erneut, bevor sie die Haustür erreichte.
Samuel setzte sich aufrecht hin und machte sich bereit, in jugendlicher Frische aufzuspringen und seinem vielversprechendsten Studenten freudig entgegenzueilen. Doch anstelle von Michael kam ein unbekannter Mann hinter Maggie auf die Terrasse, der einen billigen Anzug trug.
Samuel runzelte die Stirn.
„Wer ist das denn?“
„NSA, sagt er“, antwortete Maggie.
Da zeigte ihm der Agent seine Dienstmarke, die tatsächlich von der NSA war. Allerdings hielt er sie ein wenig ungeschickt zwischen Daumen und drei Fingern, und sein Mittelfinger klopfte zweimal gegen den Rand der Marke, als habe der Agent ein Nervenleiden. Doch Samuel erkannte das Zeichen. Er blickte erstaunt auf.
„Fredrick Johnson“, sagte der Agent. „Osborne schickt mich. Ich habe ein paar Fragen an Sie, Sir.“
„Osborne?“, wiederholte McWeir ungläubig. „Osborne schickt jemanden? Warum benutzt er nicht das Net?“
„Bitte, Sir, es geht um Michael Schwartz. Können wir uns unterhalten?“
Samuel zuckte zusammen.
„Gehen wir in mein Arbeitszimmer“, sagte er und erhob sich schwerfällig. „Ist etwas mit Michael geschehen?“
„Er ist … verschwunden.“
McWeir registrierte das leise Zögern vor „verschwunden“.
„Kommen Sie“, sagte er.
Prolog 2
26. April 2024
Küste des Sudan, Nähe Dungunab
Agent Omar Chalhoub drückte sich keuchend in eine schattige Senke zu Füßen der glühend heißen Felsen. Der Schweiß lief ihm in Strömen, aber bevor er daran denken konnte, zu rasten und etwas zu trinken, musste er einen Platz finden, der besser geschützt war. Diese Senke taugte nur zum Luftholen. Für alles andere war sie zu flach, und vor allem konnte er von hier aus nicht sehen, was am Eingang geschah. Dazu musste er höher in die Felsen hinauf.
Der Agent konzentrierte sich auf seinen Kreislauf, seine Atmung und gab sich eine halbe Minute, um auf einen Ruhepuls von 44 herunterzukommen. Drunter ging es unter diesen Bedingungen nicht. Normalerweise schlug sein Herz gerade einmal alle zwei Sekunden, aber hier war es zu heiß, der Muskel hatte zu tun.
Rundherum war nichts als felsige Wüste – und die steinige Piste, die hierher führte, zu dieser abgelegenen Hügelkette am Roten Meer. Doch diese Piste wurde häufiger benutzt, als es den Anschein hatte, und vor allem führte sie zu diesem Portal, das Omar vorhin entdeckt hatte. Ungefähr zwei Kilometer vom Meer entfernt verschwand die Piste plötzlich in einem Tunnel. Der sauber gemauerte Eingang befand sich gut getarnt unter überkragenden Felsen und war damit für Satelliten schwer zu entdecken.
Omar hatte seine Position an die Zentrale in Langley durchgegeben und zur Antwort bekommen, dass er von nun an auf sich allein gestellt sei. Über diesen Tunnel lägen keine Informationen vor. Aber die Erkenntnis, dass es hier einen Tunnel gab, erstaunte in Langley niemanden. Das Portal selbst mochte auf den Satellitenbildern nicht zu sehen gewesen sein, aber man hatte Bilder von Lastwagen, die plötzlich verschwanden. Also ging es hier wohl unter die Erde. Bestimmte Leute in Langley hegten schon seit längerem den Verdacht, dass die Sudanesen ein geheimes Süppchen kochten. Deswegen war Omar hier, denn das wüsste man in Langley gern genauer.
Omar war am Ziel. Hierher versuchten sie seit drei Jahren vorzudringen. Zwei Agenten waren bei dem Versuch, das Ende dieser Piste zu erforschen, spurlos verschwunden. Omars Versuch war der dritte Versuch. Der am besten geplante. Auch der am besten ausgerüstete, obwohl Omar kaum mehr am Körper trug als seine sandfarbenen Camouflage-Klamotten.
Er blinzelte hinauf zum Himmel. Dort oben rasten die Satelliten um die Erde, die ihn mit Langley verbanden, ein riesiges Netzwerk von Satelliten, denen fast nichts auf der Erde entging. In Langley hatten sie ihn in diesem Moment auf ihren Schirmen, doch wenn er durch das Portal ging, würde er außer Reichweite sein. Ein unwirkliches, ungewohntes Gefühl. Niemand würde ihm zu Hilfe kommen können, und wenn er versagte und ums Leben kam, würde niemand je davon erfahren, trotz aller Satelliten, die dort oben, hinter dem tiefen, fast ins Schwarze spielenden Himmelsblau ihre Bahnen zogen.
Er winkte nach oben.
Darauf bedacht, seinen Puls möglichst niedrig zu halten, kletterte Omar über den Felssporn, bis er einen guten Blick auf Piste und Tunnelportal hatte. Die Gegend war menschenleer, aber erst vor zehn Minuten war hier ein Lastwagen durchgekommen und im Tunnel verschwunden. Mit einem winzigen Hightech-Feldstecher, der die Bilder synchron nach Langley übertrug, versuchte Omar, in den Tunneleingang zu spähen. Es sah nicht so aus, als ob dort jemand wäre. Das Areal wirkte völlig verlassen.
Omar sah sich mit dem Gerät die Tunnelwände nahe am Eingang an und entdeckte – nichts. Sie waren glatt, völlig glatt, viel zu glatt. Wie poliert. Es gab also Sensoren. Omar tippte auf Bewegungsmelder, das Übliche eben. Das sollte kein Hindernis darstellen. Doch was kam danach, in den Tiefen des Tunnels?
Es gab nur einen Weg, dies herauszufinden. Er atmete tief und kontrolliert durch. Für diesen Moment hatte er trainiert. Er war darauf vorbereitet, was passieren würde, wenn er das Signal gab, aber er wusste auch, dass es das erste Mal unter den Bedingungen eines realen Einsatzes passieren würde. Was er hier versuchte, hatte es noch nie gegeben.
Omar suchte ein Versteck in den Klippen, die zur Piste hin abfielen, nicht zu weit oben. Nachdem er eine Weile vorsichtig hin und her geklettert war, fand er eine Art winziger Grotte, die seinen Zwecken genügte. Sie war vielleicht zwanzig Meter vom Tunneleingang entfernt und keine drei Meter oberhalb der Piste. Er kauerte sich in die Nische und begann, sich auszuziehen, bis er nackt war, völlig nackt, sogar Unterwäsche, Stiefel und Socken zog er aus, und bis auf die Stiefel stopfte er alles in seinen Rucksack, den er so tief wie möglich in einen Felsspalt drückte. Dann gab er nach Langley durch:
„Bereit!“
„Genug getrunken, Agent?“, kam es fast sofort aus einer Entfernung von mehr als zehntausend Meilen zurück.
Also trank Omar nochmals, er schüttete das Wasser geradezu in sich hinein.
„Ich schalte jetzt ein.“
„Viel Glück, Agent!“
Omar drückte auf den Schalter, der an der Innenseite seines linken Handgelenks unter der Haut verborgen war, und versuchte, vorbereitet zu sein, doch das war unmöglich. Er erlebte es jetzt zum zehnten Mal, und es war so fürchterlich wie beim ersten Mal.
Ping!, machte es irgendwo in ihm, und ihm sträubten sich die wenigen Haare seines Körpers, als der Impuls durch seinen Körper rann. Seine Muskeln strafften sich, seine Sehnen spannten sich, er verfiel in ein katatonisches Zittern. Er verlor die Kontrolle über sich, vermochte nicht einmal den kleinen Finger zu rühren. Derweil erwachten die Billiarden Nano-Roboter, die bis gerade eben noch abgeschaltet in Omars Blut und Körpergewebe gesteckt hatten, zu plötzlichem Leben. Sie waren die kleinsten Maschinen, die Menschen bisher gebaut hatten – nur so groß wie Moleküle. Kein Scanner konnte sie erkennen, kein Immunsystem konnte etwas gegen sie unternehmen. Alle Kleinst-Roboter in Omars Körper zusammen wogen kaum mehr als zehn Kilo. Jeder Arzt hätte gestaunt, wenn er Omars Daten bei einer Erstuntersuchung aufgenommen hätte: 80 Kilo bei 1,75 Meter Körpergröße und einem derart schlanken, drahtigen Körperbau?
Es waren die Nanobots, die den Gewichtsunterschied ausmachten. Sie folgten einem genau festgelegten Aktionsplan, indem sie sich wie ein Bienenvolk organisierten. Auf Geheiß ihrer Königin schwärmten sie durch Omars Körper und taten, wozu sie erschaffen worden waren: Sie machten ihn unsichtbar. Sie polarisierten seine Haut, indem sie alles Licht, das auf seinen Körper traf, ablenkten und von Nanobot zu Nanobot weiterreichten. Omars Körper hörte auf, Licht zu reflektieren, und damit verschwand er aus dieser Welt. Nur ein wissendes Auge konnte ihn noch erkennen, denn er warf einen flirrenden Schatten, der jedoch nie an der Stelle war, an der sich Omar tatsächlich gerade befand.
Das Ganze war natürlich nicht gesund. Die Nanobots, so klein sie auch sein mochten – das beste Lichtmikroskop der Welt konnte sie nicht sichtbar machen – ernährten sich von den elektrischen Potenzialen seiner Nervenbahnen, von der Energie seines Nervensystems. Er hatte fünf, höchstens sechs Minuten. In vier Minuten würden seine Füße und Finger anfangen zu kribbeln, als seien sie eingeschlafen, in etwa fünf Minuten würde er Schwierigkeiten bekommen, sich auf den Beinen zu halten, und spätestens in sechs Minuten musste er den Impuls auslösen, indem er den implantierten Schalter im linken Handgelenk berührte, und die Nanobots abschalten.
Omar hatte also keine Zeit zu verlieren. Er sprang auf, nachdem er die Kontrolle über sich wiedererlangt hatte, kletterte die Felsen hinab zur Piste und trat durch das Portal. Es war hoch wie drei Männer und mindestens sechs Meter breit. Direkt dahinter begann ein Tunnel, der in einer sanften Biegung nach rechts abwärts in den Fels führte. Ein salziger Hauch lag in der Luft im Tunnel. Meerwasser!
Keiner der Sensoren am Portal reagierte, als Omar eintrat. Darauf hatte er gehofft. Er sprintete los. Mit seinen nackten Fußsohlen bewegte er sich lautlos wie eine Katze auf dem geglätteten, leicht abschüssigen Felsboden des Tunnels.
Gut, dass er ausreichend getrunken hatte. Es war heiß im Tunnel, der zudem länger war, als Omar erwartet hatte. Doch nach etwa eineinhalb Minuten erreichte er das Ende und drückte sich instinktiv an die Tunnelwand, während er in die weite Halle spähte, die sich vor ihm auftat.
Eine natürliche Höhle, künstlich erweitert, die Decke gestützt von mächtigen Stahlpfeilern. Er schätzte die Länge der Höhle auf zweihundert Meter, ihre Höhe auf zehn Meter. Helles Licht flutete von Leuchtkörpern unter der Decke herab. Längs der Seitenwände der Höhle sah Omar Gebäude, in denen Licht brannte. Unweit der Tunnelmündung standen aufgereiht mehrere Lastwagen mit Anhängern, darunter auch der, den Omar vor wenigen Minuten erst hatte im Tunnel verschwinden sehen. Andere trugen das Logo der staatlichen Ölfirma des Sudan und standen weiter hinten, bei den Bassins.
Omar reckte den Hals und blickte zu den riesigen Becken hinüber. Er blinzelte vor Überraschung. Eines der Bassins war leer. In dem anderen lag ein U-Boot!
Omar runzelte die Stirn. Der Sudan besaß offiziell keine nennenswerte Marine, also auch keine U-Boote! Nicht nach allem, was Omar wusste. Das würde Langley brennend interessieren. Warum lag hier ein U-Boot in seinem Versteck? Oder gab es vielleicht sogar zwei von der Sorte? Es gab ja schließlich auch zwei Bassins, auch wenn das zweite leer war …
Omar musste näher ran. Der Blick war zum größten Teil verstellt durch Maschinen, aufgestapelte Container und die Lastwagen. Doch er musste vorsichtig sein. Am Rand der Bassins waren Menschen zu sehen, und auch drüben bei den Gebäuden regte sich in diesem Moment etwas. Ein Fahrer stieg ins Führerhaus eines der Lastwagen und ließ den Motor an.
Omar schlüpfte entlang der Wand der Halle zwischen einige Geröllhaufen. Er hatte nicht mehr viel Zeit, um sich ein Versteck zu suchen, in dem er sich enttarnen und für eine Weile erholen konnte. Sein Herz klopfte bis zum Hals.
Er drückte sich zwischen zwei Lastwagen hindurch und an einem Container entlang, auf dem das Logo der sudanesischen Ölgesellschaft prangte. Von hier aus konnte er das U-Boot besser sehen, aber der Ort taugte nicht als Versteck. Drei Minuten waren verstrichen. Am besten wäre ein Versteck, von dem aus Omar sich einen Überblick verschaffen konnte, etwas höher Gelegenes, vielleicht in einem der Gebäude rechterhand oder …
Kurz entschlossen machte er kehrt und schlich zu den Lastwagen zurück. Schon beim ersten, einem Tankwagen, hatte er Glück. Die Beifahrertür war unverschlossen, das Fahrerhaus war leer und der Schlüssel steckte. Glücklicher Zufall. Ansonsten hätte er sich ein Weilchen verstecken müssen, ehe er sich wieder unsichtbar gemacht hätte, um zu entkommen und die gewonnenen Erkenntnisse zu übermitteln.
Aus dem erhöhten Fahrerhaus hatte er einen besseren Überblick über den U-Boot-Hangar. Im Hintergrund waren mächtige, geschlossene Stahlschotten zu sehen. Dahinter lag vermutlich das Meer.
Aber was war das für ein U-Boot, das in dem rechten Bassin ruhte? Keinesfalls handelte es sich um ein Boot amerikanischer Bauart. Es wirkte breiter und bulliger als alles, was aus amerikanischen Werften kam, einschließlich des Kommandoturms. Wenn es nicht so unwahrscheinlich gewesen wäre – Omar hätte gewettet, dass es sich um ein sowjetisches Boot handelte, um ein Relikt des Kalten Krieges. Wenn er sich nicht täuschte, waren auf der Oberseite des Vorschiffs eine Reihe von kreisrunden, verschlossenen Luken auszumachen – die Öffnungen von Raketensilos.
War das etwa ein sowjetisches Atom-U-Boot? Das würde bedeuten, dass der Koloss mindestens 35 Jahre auf dem Buckel hatte. Merkwürdigerweise wirkte er jedoch wie neu, wie gerade erst zu Wasser gelassen.
Hatte man das Boot hier stillgelegt? Aber warum an diesem geheimen Ort? Nein, es wirkte nicht wie eingemottet, sondern im Gegenteil: Es wirkte, als könne es jederzeit in den Einsatz starten. Und was hatten all die Tankwagen hier im Hangar zu suchen?
Das stählerne Ungetüm schien zu warten. Worauf auch immer.
Omar wusste, dass er eine wichtige Entdeckung gemacht hatte, über die Langley unbedingt informiert werden musste. Rasch berührte er mehrfach hintereinander einen Punkt hinter seinem linken Ohr. Eine zwischen seine Augenbrauen implantierte Mikrokamera machte eine Reihe von Bildern von den Booten und hätte diese auch sofort nach Langley geschickt, wenn sie denn Verbindung gehabt hätte. Doch Omar befand sich viele Meter tief im Fels der Hügelkette. Also speicherte die Kamera die Bilder und würde sie versenden, sobald sie Kontakt bekam. Die Experten in Langley würden im Handumdrehen herausfinden, was das für ein U-Boot war, da war Omar sicher, auch wenn von seinem Standort aus keine Typenbezeichnung oder Seriennummer zu erkennen waren.
Omars Finger begannen zu kribbeln. Die vier Minuten waren um, der Energieverbrauch der Nanobots machte sich bemerkbar. Omar fühlte sich allerdings nicht erschöpft, im Gegenteil: Adrenalin ließ sein Herz aufgeregt pochen. Er musste jetzt schnellstmöglich von hier verschwinden. Er hatte schon genug riskiert.
Immer noch unsichtbar rutschte er hinüber auf den Fahrersitz, doch genau in dem Moment, als er den Lastwagen anließ, wurde die Fahrertür geöffnet – jedoch nicht von ihm. Erschrocken sah er dem sudanesischen Fahrer in die entsetzt aufgerissenen Augen. Die Blicke des Mannes irrten umher und suchten nach einer Erklärung dafür, dass der Wagen in dem Moment angesprungen war, in dem er die Fahrertür geöffnet hatte, doch sie fanden keine.
Omar überwand seinen Schrecken und verpasste dem schockierten Mann einen gezielten Schlag gegen die Schläfe. Der Fahrer ging zu Boden. Omar sprang aus dem Fahrerhaus. Sein linkes Bein knickte ein, als er auf dem Boden aufkam. Er begann, die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren, er hatte nur noch wenige Sekunden, bis er die Nanobots abschalten musste. Mit jeder weiteren Sekunde stieg die Wahrscheinlichkeit, dass er neurologische Schäden davontrug. Seine Reserven reichten auf keinen Fall, um den Hangar wieder zu verlassen. Erst musste er abschalten und sich ein wenig regenerieren.
Die Zahl der Verstecke in seiner Nähe war überschaubar. Er huschte hinüber Richtung Tunnelmündung, so schnell er noch konnte, und während zusehends die Kraft und das Gefühl aus seinen Armen und Beinen wichen, schaffte er es bis in einen Winkel hinter der Geröllhalde, wo er vorhin schon gelegen hatte. Mit tauben Fingern tastete er nach dem Schalter in seiner Handfläche.
Aufatmend sank er zu Boden, in den Schutt, als die Nanobots abschalteten. Augenblicklich ließ das Kribbeln in seinen Beinen und Armen nach. Nun würde er für einige Sekunden so gut wie bewegungsunfähig sein.
Da hörte er aufgeregte Rufe. Jemand schien den bewusstlosen Fahrer entdeckt zu haben. In den Gebäuden an den Wänden der Halle sprangen Türen auf, Menschen stürzten hervor.
Omar drückte sich so tief in sein Versteck wie nur möglich. Frühestens in fünf Minuten konnte er die Tarnung wieder aktivieren. Bis dahin musste er hoffen, dass sie ihn hier nicht entdeckten.
Doch sie sahen schon herüber, und Gewehrmündungen zielten in seine Richtung.
Virenkrieg
Erstes Buch
Thriller
1. Kapitel
Alles hängt mit allem zusammen
4. Juni 2024
Kala Nera, Griechenland
Nach dem Essen saß Jan Metzner allein auf der Terrasse und blickte auf den Golf von Pagasitikós, in der Hand den Schwenker mit dem unvergleichlichen Brand, den Stavros destillierte, einer seiner Nachbarn und Kunden. Das Zeug war besser als jeder noch so edle Cognac. Die Seele Griechenlands steckte darin. Karstige Hügel und tiefblaues Meer, Rosmarin, Salbei und Thymian – und die speziellen Trauben von jenem besonderen Südhang, die das Licht der Sonne auf ihre ganz eigene, unnachahmliche Weise gespeichert hatten.
Ein leiser Schauer rann Jans Rücken hinab, als er sich klarmachte, dass er im Grunde gerade Sonnenlicht trank, und er hob den Schwenker in Richtung der untergehenden Sonne, prostete ihr zu und fühlte sich einen Moment lang vollkommen mit der Schöpfung und sich selbst im Reinen.
„Dank sei dir“, murmelte er zur Sonnenscheibe, die blutrot im Westen stand, dicht über den Gipfeln des zentralgriechischen Berglands, und fügte hinzu. „Gezeichnet: Echnaton.“
Witziger Gedanke!
Zugegeben, er war nicht mehr ganz nüchtern, wie eigentlich immer, wenn er die Dinge zusammenzuwerfen begann. Echnaton hatte mit Griechenland herzlich wenig zu tun. Doch der altägyptische Pharao, ein Sonnenverehrer, hatte trotzdem etwas verstanden: Alles Leben auf Erden hing von der Sonne ab. Den zugrundeliegenden Prozess, in dem aus Licht Materie wurde, die Photosynthese, verstand man erst seit rund 60 Jahren; so lange hatten die Menschen gebraucht, um aus Glauben Gewissheit werden zu lassen. Sonnenlicht in Verbindung mit Kohlendioxid und Wasser – das war die einfache Lebensgleichung, auf der auch der unvergleichliche Genuss beruhte, den der Brandy von Stavros verschaffte.
Und doch war Sonnenlicht nicht gleich Sonnenlicht. Das eine brannte auf der Haut, das andere brannte von innen. Jan mochte beides. Darum hatte er sich völlig ausgezogen, bevor er sich in den Liegestuhl am Pool hatte sinken lassen, streckte seinen Körper nun den letzten Sonnenstrahlen entgegen und schlürfte vom Brand.
Die Berge am gegenüberliegenden Ufer, dunkel vor den Schleierwolken, die im Licht der untergegangenen Sonne orangefarben nachglühten, das inzwischen fast schwarze Wasser des Golfs mit den Fischkuttern, die in aller Ruhe nach Süden tuckerten, Richtung offenes Meer, die Wärme des Abends, die Ruhe – es war ein bisschen zu viel der Idylle.
Alles hing mit allem zusammen. Das Sonnenlicht mit Stavros‘ edlem Tropfen ebenso wie mit den beunruhigenden Nachrichten und mit dem Frieden hier auf der Halbinsel Pilion, wo Jan seit sieben Jahren lebte. Immer wieder nahm er sich vor, keine Nachrichten mehr zu sehen, aber dann überkam ihn regelmäßig dieses Gefühl, etwas zu verpassen – ein Junkie auf Entzug. Er konnte nicht leben, ohne zu wissen, was draußen vorging, auch wenn dieses Draußen mit der vergessenen Weltgegend, in der er lebte, denkbar wenig zu tun hatte. Dieses Bedürfnis war das Ergebnis seiner Erziehung. Seine Eltern waren das gewesen, was man „homo politicus“ nannte – immer interessiert, immer engagiert und immer auf der Suche nach Zusammenhängen. Und so war eine der Weisheiten, die Jan gewissermaßen mit der Muttermilch aufgesogen hatte: Alles hängt mit allem zusammen.
Die Welt schien in einer Dauerkrise. Wenn es mal keine Horrormeldungen über die Eskalation in Ägypten gab, dann gab es stattdessen welche über Flüchtlingsströme und Bürgerkriege anderswo auf der Welt. Oder es gab neue Spekulationen über die sogenannte Islamische Allianz. Diese Organisation, in deren Namen vor vier Wochen eine Autobombe vor der deutschen Botschaft im Jemen gezündet worden war, hatte eine Webseite, auf der ein Countdown lief; und der beschäftigte die halbe Welt. Auch Jan sah regelmäßig auf der Seite nach. Vorhin, vor dem Abendessen, hatte der Countdown „06:05:54 AST“ und die Sekunden angezeigt, die in dem ihnen eigenen unerbittlichen Rhythmus verrannen. AST stand für Arabia Standard Time; das war dieselbe Zeitzone, in der sich auch Griechenland befand. Niemand wusste, was das alles zu bedeuten hatte.
Über dem Countdown stand ein Ausschnitt aus dem achten Vers der fünften Sure des Koran:
„Die Feindseligkeit eines Volkes soll euch nicht verleiten, anders denn gerecht zu handeln.“
Daneben stand der Slogan der Islamischen Allianz:
„Wir haben noch nicht angefangen.“
Das schien zu bedeuten, dass die Islamische Allianz in sechs Tagen und knapp sechs Stunden, also mit Beginn des 11. Juni, irgendetwas zu tun beabsichtigte; mit irgendetwas wollten diese Leute anfangen. So wie man sie kannte, konnte es sich dabei eigentlich nur um einen Terroranschlag handeln. Dagegen sprach aber, dass ausgerechnet der jordanische König Abdallah II. der Kopf der Islamischen Allianz war. Er hatte sie ins Leben gerufen, und er hatte viele namhafte islamische Geistliche und Politiker zu jener sonderbaren Versammlung nach Amman gerufen, die er „Rat des Islam“ und „Große Schura“ nannte und die derzeit tagte. Islam-Experten sagten, es handele sich um eine Art Konzil – und damit um etwas, was es im Islam bisher nicht gegeben hatte. Abdallah II. war ein angesehener Mann, ein Garant für Stabilität, Ausgleich und Frieden im Nahen Osten. Nach dem Anschlag auf die deutsche Botschaft im Jemen hatte er der Welt versichert, dass die Allianz nichts damit zu tun habe und dass sie keine Terror-Organisation sei, sondern im Gegenteil gegen den Terror vorgehen werde. Vor fünf Jahren war er selbst Ziel eines Anschlags der al-Qaida gewesen, bei dem er beinahe getötet worden wäre.
Die Lage war also unklar, doch Jan sagte sich, dass die Welt schon noch erfahren würde, was die Allianz vorhatte – und zwar in gut sechs Tagen. Er versuchte, sich auch weiterhin nicht von der Paranoia anstecken zu lassen, die in Teilen Europas und in den USA vorherrschte. Überall wurden Sicherheitsvorkehrungen verschärft. An der amerikanischen Ostküste war es sogar schon zu Hamsterkäufen gekommen.
Doch nicht die Allianz beherrschte heute die Schlagzeilen, sondern die Aufrüstung Chinas. Die Volksrepublik hatte ein riesiges Problem: Sie war keine Exportweltmeisterin mehr. Die Billigstrategie, die sie jahrelang gefahren hatte, zahlte sich auf Dauer nicht aus, und die Versuche, sich mit Qualitäts-Hightech-Produkten wie etwa modernen Autos auf den Märkten zu behaupten, funktionierten nicht, weil chinesische Produkte immer nur so lange mithalten konnten, bis andere Produzenten neue, bessere und vor allem innovative Produkte auf den Markt brachten. Im Kopieren und Nachahmen waren die Chinesen traditionell groß, aber gerade weil sie den Urheberschutz und das Recht auf geistiges Eigentum nicht achteten, hatte eine Mentalität des Erfindergeistes, Basis jeder Innovation, in China nicht Fuß fassen können. Auch in Sachen Militärtechnologie würde China immer hinterherhinken, aber seine Bevölkerung war viermal so groß wie die der USA, und was China mit Klasse nicht schaffte, das schaffte es eben mit Masse. Im Prinzip war es ja schon immer so gewesen.
Warren Mills, ein einflussreicher US-Senator von der Republikanischen Partei, hatte nun vor den Chinesen gewarnt und verstärkte Rüstungsanstrengungen der USA gefordert.
Getöse eines konservativen Hardliners.
Warum sollten die Chinesen einen Weltkrieg provozieren? Schon die Nazis hatten erkennen müssen, dass selbst die effizienteste Kriegswirtschaft nur begrenzte Zeit durchzuhalten vermochte. China war zu sehr von anderen Teilen der Welt abhängig, als dass es sich leisten konnte, einen Krieg zu beginnen, der das Land auf der Stelle von lebenswichtigen Importen abschneiden würde. So war die Verflechtung Chinas in die Weltwirtschaft ein besserer Garant für den Frieden als jedes militärische Abschreckungskonzept.
Doch das militaristische Gerede aus den USA beunruhigte Jan, diese Forderungen nach Aufrüstung. Dabei gaben die USA schon jetzt jeden vierten Dollar ihres Staatsbudgets direkt für militärische Zwecke aus. Und weiteres Geld floss in ihre unzähligen Sicherheitsprojekte und natürlich in ihre Geheimdienste.
Auf solche Nachrichten reagierte Jan empfindlich, denn er hatte in den USA studiert, er hatte dieses Land lieben gelernt und war zugleich tief gespalten in seinem Urteil über die Weltmacht. Er hatte noch immer Freunde drüben, mit denen er in regelmäßigem Mailkontakt stand. Genau wie Jan verzweifelten sie an der Oberflächlichkeit, mit der in den USA mit den Themen umgegangen wurde. So lebte seine beste Freundin Diane in Los Angeles, wo sie sich als kritische Journalistin für ein viel gelesenes Blog beinahe die Finger wundschrieb. Jan las ihre Artikel regelmäßig. Und sein bester Freund Michael hatte zuletzt in Phoenix, Arizona, gelebt, bevor er spurlos verschwunden war. Die beiden waren umfassen gebildete, interessierte Menschen und überzeugt davon, dass man einzelne Phänomene nicht losgelöst von allen anderen betrachten konnte.
Aber das bedeutete nichts dort drüben. Da brachte Fox News die Meldung, dass die Chinesen ihren Militäretat erneut aufstocken wollten, und zwar auf die gigantische Summe von 120 Milliarden US-Dollar. Als erste Reaktion auf die Nachricht gab es dann ein Interview mit irgendeinem Experten aus dem Umfeld der US-Regierung, der die Losung ausgab, dass die US-Regierung eine angemessene Antwort geben müsse, der aber natürlich zu erwähnen vergaß, dass der Militärhaushalt der USA das Fünffache betrug. Es gab sie immer noch, die „Falken“, die alles aufs Militärische reduzierten und die der Chainey-Doktrin folgten: Die USA mussten jederzeit in der Lage sein, überall auf der Welt zwei Kriege gleichzeitig führen zu können. Dass ein Krieg für China keine Option sein konnte, das blendeten diese Leute aus, um aufrüsten zu können, und Fox News assistierte dabei, denn neue Kriege bedeuteten neue Nachrichten. Schon war die öffentliche Meinung gebildet – abgesehen von jenem Häufchen hilfloser Intellektueller, die diese Zusammenhänge durchschauten und doch nichts dagegen tun konnten. Ihnen fühlte Jan sich verbunden.
Doch auch in den USA hing alles mit allem zusammen, war alles mit allem auf eine ganz spezielle Art verflochten. Darum hatte Jan es dort nicht ausgehalten. Er hätte Karriere in den USA machen können, er war begabt, ein Mikrobiologe und Genetiker aus dem Stall von Professor Marcus Fairbanks, der dieses Jahr für den Nobelpreis vorgeschlagen war. Jan war zwar Deutscher, aber es war auch schon anderen Deutschen vor ihm gelungen, Karriere in den USA zu machen, darunter sogar einem von Jans direkten Vorfahren. Sein Ururgroßvater Herrmann Metzner war „Arzt“ im Konzentrationslager Sachsenhausen gewesen. Dort hatte er unter anderem erforscht, wie die unmittelbare Injektion von Phenol auf den menschlichen Körper wirkte – nämlich indem sie einen qualvollen, sich über Minuten hinstreckenden Todeskampf auslöste, den dieser „Arzt“ wie ein Chronist mit schriftlichen Kommentaren für die Nachwelt festgehalten hatte. Da war von wiederkehrenden Spasmen die Rede, da wurde Wert auf die Feststellung gelegt, dass die Testperson zum Glück sorgsam festgeschnallt worden war, und hervorquellende Augen und Schaum vor dem Mund wurden ebenso akribisch eingetragen wie der Zeitpunkt des endgültigen Herzstillstandes.
Dieser „Arzt“ hatte seine Forschungen in den USA fortsetzen dürfen, als Mitarbeiter jenes legendären Projekts der CIA, das den Namen MK-Ultra getragen hatte. Agenten der CIA-Vorgängerorganisation OSS – das stand für Office of Strategic Services – hatten Herrmann Metzner kurz nach Kriegsende in die USA und damit in Sicherheit gebracht. Allen Dulles, der spätere erste CIA-Chef, hatte persönlich dafür gesorgt, dass Metzner nicht vor das Nürnberger Kriegsverbrechertribunal musste. Offiziell hatte der „Arzt“ als verschollen gegolten.
Jan war 14 Jahre alt gewesen, als seine Eltern ihn mit diesem Teil der Familiengeschichte konfrontiert hatten, und seitdem war er für immer immunisiert. Ja, er hätte Karriere in den USA machen können. Die Gelegenheit dazu hatte es gegeben. Er hätte nur die ausgestreckte Hand ergreifen müssen. Doch er hatte dankend abgelehnt. Sein Seelenfrieden war ihm wichtiger als eine Karriere, in deren Verlauf er zwangsläufig mit dem amerikanischen Militär in Berührung gekommen wäre. Selbst Michael Schwartz, sein hochbegabter bester Freund, hatte ihn für diese Haltung verspottet, dann aber selbst ebenfalls auf Abstand zu diesen Leuten geachtet.
Jan und Michael hatten sich zuletzt vor etwa zwei Jahren gesehen. Michael hatte Jan auf dem Pilion besucht, und als er den Wert dessen begriff, was Jan hier geleistet hatte, war er ziemlich zurückhaltend geworden mit weiteren spöttischen Anmerkungen. Jan hatte es nicht angesprochen, aber indirekt hatte er aus Michaels Verhalten geschlossen, dass Michael inzwischen Kontakt zum amerikanischen Militär gehabt haben musste.
Jan dachte gern an Michaels Besuch zurück, auch wenn er schon zwei Jahre zurücklag, ziemlich genau sogar – im Juni 2022, wie Jan gerade einfiel. Der griechische Sommer war schon in vollem Gang gewesen, aber noch nicht zur Höchstform aufgelaufen, die Temperaturen hatten 35 Grad noch nicht überschritten. Sie waren hinübergefahren nach Hiliadou, an den schönsten Strand Griechenlands, der zum Glück immer noch so schwer erreichbar war wie damals, als sie zum ersten Mal hier gewesen waren. Sie hatten gezeltet, als wären sie wieder Studenten, und Michael hatte zugegeben:
„Du hast alles richtig gemacht.“
Ein paar Monate später war Michael verschwunden. In die Wälder gegangen, hieß es. Jan hatte Michaels Mutter damals angerufen.
„Er ist nicht verrückt geworden, wie alle jetzt behaupten“, hatte Amy Schwartz gesagt. „Er war absolut klar im Kopf. Ich glaube, er hat etwas vor.“
Die Gedanken an den Kommilitonen und Freund machten Jan traurig – auch weil sie hier am Pool gelegen hatten, genau wie er in diesem Moment, und weil sie dieses köstliche Zeug getrunken hatten. Und weil sie miteinander geschwiegen hatten. Für Jan bedeutete das die Krönung von Freundschaft: Schweigen. Unentwegt plappern, Smalltalk halten, die Welt mit geistigen Ergüssen überschwemmen, das konnte jeder, und gewiss war das manchmal auch amüsant, kurzweilig und vielleicht sogar notwendig. Doch miteinander zu schweigen, nicht nur für eine Minute, sondern für eine Stunde, und dem anderen bei seinen Gedanken zuzuhören, ohne dass man sie aussprach, das war das Höchste. Mit Michael war das möglich gewesen – und nur mit ihm.
***
In Pakistan war eine Seuche ausgebrochen. Das war die zweite Hauptnachricht des Abends, und zum ersten Mal seit Monaten fühlte Jan sich dazu animiert, noch vor dem Abendessen mehr Informationen einzuholen – denn der Nachrichtensprecher bezeichnete den Erreger als „unbekannt“, „noch nicht identifiziert“, und es hieß, die Seuche breite sich „explosionsartig“ aus. Die Erkrankten litten unter plötzlicher Übelkeit und schwerem, blutigen Erbrechen, und bisher, so hieß es, seien alle Erkrankten gestorben. Diese Nachrichten weckten Jans professionelle Neugier, die des Mikrobiologen, und er begann zu recherchieren.
Eine Krankheit, die hundert Prozent Todesopfer forderte, war im evolutionären Sinn Quatsch. Menschen machten meistens den Fehler, Krankheiten aus der Perspektive des Betroffenen, des Opfers zu betrachten und sie als besonders schlimm zu empfinden, je mehr Opfer sie forderten. Das war nur menschlich. Doch Krankheiten und ihre Erreger ließen sich besser verstehen, wenn man sie vom Erreger her dachte. Ein solches Tötungspotenzial wie das, was den Erreger in Pakistan zu kennzeichnen schien, wirkte auf den ersten Blick natürlich hocheffizient, aber aus der Perspektive des Erregers war das Gegenteil richtig: Wer sollte die Nachkommen des Erregers weitergeben, wenn die Infizierten so schnell und überdies vollständig starben? Wie sollte der Erreger sich weiter verbreiten? Ein Erreger, der zu hundert Prozent tötete, war zum Aussterben verurteilt.
Das war auch der Grund dafür, dass die Erreger schwerer hämorrhagischer Fieber – wie etwa Marburg- oder Ebola-Virus – sich nie über einen eng umgrenzten regionalen Umkreis hinaus ausbreiteten: Sie töteten ihre Opfer so schnell und so effizient, dass sie ihre eigene Ausbreitung behinderten und an sich selbst erstickten. Das änderte natürlich nichts daran, dass Ebola furchterregend war; Jan hatte sich während seines Studiums eingehend damit befasst. Aber es war im evolutionären Sinn kein Erfolgskonzept, denn es würde niemals große Verbreitung erfahren, weil es zu effizient war. Daher würde es nie eine weltweite Ebola-Epidemie geben. Es sei denn, es entstand eine Ebola-Mutante mit reduziertem Tempo. Oder jemand manipulierte das Virus und drosselte es. Aber das war nicht so einfach.
Also war er online gegangen, um mehr zu erfahren als nur die nackte Tatsache, und was er las, war erschreckend. Bisher gab es seit Ausbruch der Seuche vor zwei Tagen geschätzte dreitausend Opfer. Das Gebiet, in dem sie ausgebrochen war, galt inzwischen als weiträumig abgeriegelt, niemand kam mehr hinein und hinaus. Was Jan aufhorchen ließ, war die Tatsache, dass es sich um das Swat-Tal im Nordwesten Pakistans an der Grenze zu Afghanistan handelte, eine fast ausschließlich von Paschtunen besiedelte Gegend. Die Paschtunen galten als – vorsichtig ausgedrückt – eigenwillig und problematisch. Aus Glaubensgründen hatten viele von ihnen sich vor Jahren schon geweigert, ihre Kinder gegen Kinderlähmung impfen zu lassen. Aus den Reihen der Paschtunen speisten sich überwiegend die afghanischen Taliban. Das Swat-Tal war während des Afghanistan-Kriegs der Nato das Rückzugsgebiet der Taliban gewesen. Auch die afghanische Bevölkerungsmehrheit war paschtunisch, aber von dort wurden bisher keine Krankheitsfälle gemeldet. Es schien, als sei die Seuche auf das Swat-Tal begrenzt.
In so gut wie allen Meldungen war die Rede von einer Seuche, einer Epidemie und von einem bisher unbekannten Erreger, aber was Jan über die Entwicklung las, sprach gegen eine Seuche, und er bekam den Verdacht, dass die Medien ein weiteres Mal nur eine offizielle Sprachregelung nachplapperten.
Seuchen entstanden nicht explosionsartig. Sie waren nicht einfach plötzlich da. Sie gingen meist von einzelnen Infektionsherden aus, die mit modernen Mitteln ausfindig gemacht werden konnten. Bei der Vogelgrippe etwa war es möglich gewesen, gewissermaßen den Hühnerstall ausfindig zu machen, in dem das tödliche Virus mutiert und damit zur globalen Gefahr geworden war. Am Ausgangspunkt solcher Seuchen gab es immer nur einen einzigen oder wenige Infizierte, die den Erreger weitergaben, bevor sie selbst ernsthaft erkrankten. So konnte er sich mit rasch wachsender Geschwindigkeit ausbreiten. Diese rasche Ausbreitung war typisch für das Anfangsstadium solcher Seuchen. In Pakistan aber hatte es in diesem ersten Stadium der Ausbreitung gleich 3000 Menschen getroffen, und zwar innerhalb kürzester Zeit, fast auf einen Schlag. Das roch nicht nach einem Erreger und einer Seuche, das roch eher nach einer Vergiftung. Oder wie schaffte es dieser Erreger, quasi schlagartig im ganzen Swat-Tal gleichzeitig aufzutauchen?
Da hat jemand ein Virus gegen Islamisten konstruiert und flächendeckend ausgebracht!
Jan wurde diesen Gedanken nicht mehr los, und Erinnerungen an die Zeit unmittelbar nach Abschluss seiner Doktorarbeit krochen in ihm hoch, als er sich der „Antennen“, die andauernd um ihn herumscharwenzelt waren, kaum noch hatte erwehren können. Michael hatte dazu einmal gesagt:
„Mein Vater würde jetzt sagen: Der militärisch-industrielle Komplex sucht Nachwuchs.“
Gleichgültig bis ablehnend hatte er sich von ihnen umwerben lassen. Von ihm stammte auch die Bezeichnung „Antennen“ für diese Leute.
Das Militär hatte durchaus Verwendung für Mikrobiologen und Genetiker, wie Michael und Jan welche waren, aber es trat niemals direkt in Erscheinung. Wenn man aber einmal ein wenig recherchierte, wer hinter den Firmen steckte, deren Schriftzüge auf den Visitenkarten der „Antennen“ prangte, dann landete man bei undurchsichtigen Konsortien und bei Konzernen wie Hellibarton, MediGen, Raethyon und Lockhead-Morten, die alle zusammen den militärisch-industriellen Komplex bildeten.
Im Jahr 1972 waren die USA der UN-Biowaffenkonvention beigetreten, welche die Erforschung und Entwicklung von Biowaffen untersagte. Die ganze Welt wusste, dass diese Konvention ein zahnloser Tiger war, denn es gab kein Zusatzprotokoll, in dem regelmäßige Kontrollen vereinbart worden wären. Am Beispiel Russlands hatte sich gezeigt, was die Konvention wert war: nichts. Die Russen hatten nachweislich bis vor 30 Jahren in verschiedenen Einrichtungen an Biowaffen geforscht und unter anderem extrem gefährliche Milzbranderreger entwickelt. Sie hatten aber auch ein gutes Beispiel dafür geliefert, dass Biowaffen ein zweischneidiges Schwert waren, denn ein Krankheitserreger kümmerte sich nicht darum, ob der Mensch, in dem er sich gerade vermehrte, zu den „Guten“ oder zu den „Schlechten“ gehörte. Es hatte Unfälle in Russland gegeben, die Opfer gefordert hatten. Biologische Waffen waren eben schwer handhabbar und in ihren Konsequenzen nicht kalkulierbar. Vielleicht hatte die Welt also recht damit, sich nicht sonderlich um Biowaffen zu sorgen.
Jan war überzeugt davon, dass in den USA noch heute an biologischen Waffen gearbeitet wurde – und nicht nur an solchen eher harmlosen Bakterien, die Tarnanstriche fraßen oder Gummidichtungen auflösten.
Er erinnerte sich noch gut an eine Vorlesung, die er hatte genießen dürfen, einen dieser ganz besonderen Momente. Er war im vierten Semester, und das Auditorium Maximum der Universität von Cincinnati war völlig überfüllt, als der Nobelpreisträger Samuel McWeir, Mikrobiologe und Genetiker, eine Gast-Vorlesung über „Waffen aus der Natur“ gehalten hatte. Für den provozierenden Titel der Veranstaltung war der ehrwürdige, charismatische Mann mit dem dünnen grauen Haar zwar nicht verantwortlich; das ging auf das Konto des Uni-Komitees, das gern die Frage erörtert hätte, ob es nicht denkbar wäre, dass die Natur sich gegen den Raubbau durch die Menschen wehren könnte, indem sie eine Krankheit schickte, eine globale Seuche. Eine Waffe gegen die Menschheit. McWeir nutzte den – wie er ihn nannte – „reißerischen“ Titel der Veranstaltung, um als erstes die Sache mit der Perspektive zu erläutern – ein Gedanke, den Jan nicht vergessen hatte: Man solle keinen Organismus, egal wie groß oder klein, als von vornherein für oder gegen den Menschen geschaffen betrachten. Selbst der kleinste Organismus, ja, sogar ein Virus sei in erster Linie nur eines: er selbst. Welche Folgen seine Existenz für andere hätten, das sei keine Frage, die ein Virus oder ein Bakterium sonderlich interessiere. Sie seien dazu geschaffen, sich zu vermehren, nichts weiter. Im Prinzip tue auch die Menschheit nichts anderes. Gewiss, einzelne Vertreter der sonderbaren Spezies namens Homo sapiens fragten nach den Konsequenzen menschlichen Tuns, aber änderte die Spezies insgesamt deswegen etwa ihr Verhalten? Nein, sie verhielt sich genauso gedankenvergessen wie ein Virus, obwohl ihr Hirn gegeben war.
Das Auditorium lachte, als der Professor ausführte, dass er keinen qualitativen Unterschied zwischen Menschen und Viren sah. Das war eine dieser Pointen, wegen denen man solche Vorlesungen besuchte. Da wurde die eigene Weltsicht ein bisschen aufgemischt, da bekam man schräge Gedanken präsentiert, die bei näherem Nachdenken aber immer plausibler wurden. Ja, nahm man sich als Mensch denn nicht wirklich viel zu wichtig?
Der berühmte Professor warb also dafür, die Lebewesen wertfrei und unvoreingenommen zu betrachten, und er warnte davor, die Natur als eine Art Selbstbedienungsladen aufzufassen. Als er so in sein Fachgebiet eintrat, die Welt der mikroskopisch kleinen Organismen und der Viren, da hing das Auditorium gebannt an seinen Lippen, denn es ging um 50 Jahre Gentechnik in den USA – McWeirs eigentliches Thema. McWeirs Credo war, dass nicht alles, was gemacht werden könne, auch gemacht werden dürfe. Dafür erntete er an diesem Campus, freundlichen Applaus, aber vor einem anderen Publikum hätte er sich gewiss mit eisigem Schweigen konfrontiert gesehen.
Anschließend beantwortete der Nobelpreisträger Fragen. Jan erinnerte sich genau, wie der schmächtige junge weiße Mann in der vierten Reihe aufstand und geduldig wartete, bis das Mikrofon zu ihm durchgereicht worden war, so dass er seine Frage stellen konnte:
„Sir, was halten Sie von der Idee, das Terrorismus-Problem zu lösen, indem man Pocken oder die Pest in Afghanistan und Pakistan einsetzt?“
Plötzlich lag eine unglaubliche Spannung in der Luft. Die Frage war politisch alles andere als korrekt, und so richteten sich viele empörte Blicke auf den jungen Mann. War der noch ganz dicht? Wie kam man auf solche Gedanken? Selbst McWeir wirkte einen Moment lang wie vor den Kopf gestoßen. Doch dann reagierte er souverän:
„Ich merke, Ihnen schwebt eine besondere Art von Manipulation der Natur vor.“
Die Spannung entlud sich in Gelächter. Das war ja wohl offensichtlich, nicht wahr? Der Nobelpreisträger als begriffsstutziger Clown, der wie alle normalen Menschen ein Weilchen brauchte, um einen einfachen Gedanken in seiner Tragweite zu begreifen – und der ihn dann mit wenigen Worten dem Thema des Abends zuordnete und ihn sich so zu eigen machte.
McWeir erinnerte zunächst daran, dass die USA der UN-Konvention beigetreten war, die Besitz und Entwicklung von Biowaffen untersagte.
„Alles Weitere ist also rein theoretisch gemeint“, fügte er hinzu, um dann von den Grenzen genetischer Manipulation zu sprechen. Ja, theoretisch galt es als machbar, eine Art lautlosen Genozids zu verüben, wenn man virale Waffen – diesen Begriff hatte er tatsächlich benutzt – so programmierte, dass sie bevorzugt Menschen töteten, die Gene trugen, die für ein bestimmtes Volk typisch waren. McWeir nannte diese Waffen „ethnische Viren“. Er ging dabei inhaltlich nicht über das hinaus, was Jan später bei Wikipedia nachlas. Vor allem merkte er an, dass Ethnien – also Stämme, Völker – nicht in erster Linie durch bestimmte Gene definiert würden, sondern durch ihre Kulturen, ihre Formen des Zusammenlebens. Das sei auch der Grund dafür, dass die Juden wahrscheinlich auf ewig dazu verdammt seien, erfolglos nach ihrem berühmten „jüdischen Gen“ zu suchen: Es existierte einfach nicht. Der Mensch hatte 99,8 Prozent seiner genetischen Ausstattung mit seinem nächsten Verwandten im Stammbaum der Arten gemeinsam, dem Schimpansen. Selbst wenn 0,2 Prozent angesichts der Länge eines DNA-Stranges immer noch eine Menge Material seien, gebe es in diesem Material mit Sicherheit kein Gen, das schrie: Ich bin jüdisch. Oder: Ich bin deutsch. Geschweige denn: Ich bin Islamist.
Jan hatte allerbeste Erinnerungen an diesen Abend, und selbst wenn er vieles schon gewusst hatte – er war ja nicht zu einer Expertenveranstaltung gegangen, sondern zu einem populärwissenschaftlichen Vortrag –, hatte er das Gefühl, etwas Neues mitgenommen zu haben. Später war ihm klar geworden: Dieses Neue – man nannte es „Überblick“. Von da an hatte er sich immer, wenn er sich in Details verhedderte, an diesen Abend mit seinen klaren Botschaften erinnert. Und auch an diesem Abend im Jahr 2024, 15 Jahre später, erinnerte er sich daran, und wieder durchflutete ihn dieses erhabene Gefühl, mit einer ungewöhnlichen Perspektive konfrontiert worden zu sein. Ein durch und durch gutes Gefühl, das ihn ein wenig aus seinen täglichen Zusammenhängen herauslöste. Der Wein beim Abendessen schmeckte plötzlich heiterer, und auch wenn der Anstoß zu diesen Erinnerungen – die Seuche in Pakistan – alles andere als schön war, fühlte er sich rundherum wohl, als er sich am Pool ausstreckte.
***
„Hallo, Meike“, sagte er.
Sie hatte wieder versucht, sich anzuschleichen, und hatte abgewartet, bis es ihrer Meinung nach dunkel genug dafür war. Heute hätte sie in der Tat gute Chancen gehabt, Jan zu überraschen, denn er war in sich versunken. Ihre leisen Schritte mit bloßen Füßen auf den Steinplatten der Terrasse hatte er nicht gehört. Es gab auch keine Veränderung der Lichtverhältnisse, kein Schatten, der ihm hätte auffallen können. Meike war sanft und leise wie immer, eine Katze, die sich an ihr Opfer heranpirschte. Und doch war ihm ihr Auftauchen nicht entgangen.
Er spürte sie, sobald sie die Terrasse betreten hatte.
Schon vor Jahren, gleich nach ihrem Einzug, hatte er ihr gesagt, dass es keinen Sinn hatte zu versuchen, ihn zu überraschen. Er würde sie immer bemerken, ehe sie über ihn herfallen und ihn ermorden konnte – oder was auch immer Schwestern sonst mit einem machten, wenn sie sich anzuschleichen versuchten. Jan hatte eine Gabe, eine Art sechsten Sinn: Er nahm seine Umgebung auch dann wahr, wenn er sie nicht sah. Er spürte sie. Auch seine Mutter hatte diese Gabe besessen. Alles hing mit allem zusammen.
Er spürte die Mauern des Hauses in etwa fünf Metern Entfernung, spürte die Fugen zwischen den Natursteinplatten der Terrasse und die feinen Unebenheiten ihrer Oberfläche, er spürte jedes leise Kräuseln des Wassers im Pool, wenn ein leichter Wind darüber hinweg strich, jeden Grashalm des Rasens, der den Pool umgab, und viele kleine und große Käfer und andere Insekten, die durchs Gras krochen. Er spürte die Nachtfalter in der Luft und die Fledermaus, die sie sich schnappte, und am Rand seines Wahrnehmungsbereichs spürte er die Blätter und Blüten der Hibiskushecke, die den Poolbereich zum unteren Teil des Gartens abgrenzte. Und das alles, ohne hinzusehen. Vieles von dem, was er wahrnahm, wäre für das Auge nicht zu erkennen gewesen. Was Jan spürte, ließ sich mit einer dreidimensionalen Karte seiner Umgebung vergleichen oder mit einem Hologramm, das nur in seinem Kopf existierte.
Er wusste nicht, wie das funktionierte, und er hatte schon vor langer Zeit aufgehört, sich diese Frage zu stellen. Es war nie anders gewesen, schon als Kind hätte er sich dank dieser Gabe selbst ohne Augenlicht in der Welt zurechtgefunden. Seine Mutter hatte auf die Anzeichen geachtet und daher früh erkannt, dass er die Gabe besaß. Sie hatte ihm klargemacht, dass es etwas Besonderes war, die Welt auf diese Weise spüren zu können, und dass man es besser für sich behielt.
„Meike, du kannst aufhören“, sagte Jan. „Ich weiß genau, wo du bist.“
„Aber das ist ungerecht!“, empörte sich Meike. „Wie konntest du das wissen? Wieder einmal deine besondere Gabe?“
Sie wartete seine Reaktion nicht ab, hüpfte an ihm vorbei und tauchte in das Wasser des Pools ein. Sie war nackt, so wie auch Jan, und auch das hatte er schon gespürt.
Er war komplett in Meike vernarrt. Schon immer gewesen. Sonst hätte er sie damals, als sie plötzlich vor seiner Tür hier auf dem Pilion stand, nicht einfach einziehen lassen. In Deutschland war für sie damals alles zu Ende gewesen. Freund weg – deutsche Männer waren sowieso „scheiße“, wie Meike es ausdrückte. Job weg – auf berufliche Qualifikation hatte Meike es noch nie angelegt, sie hatte mit Mühe Abitur gemacht und dann eine Ausbildung als Verlagskauffrau abgeschlossen. Für eine mögliche Karriere hatte sie einfach nicht den nötigen Biss. Darum hatte sie sich auch nie um einen Job in einer der Metzner-Firmen gerissen. Die Firmen wurden gut geführt – warum sollte sie den Managern ins Werk pfuschen? Sie wollte lieber leben, im Augenblick, im Jetzt. Das hatte sie mit Jan gemein. Aber inzwischen waren die Bedingungen in Deutschland so schlecht, dass es kaum noch möglich war, einfach nur zu leben, und sie wurden immer schlechter.
Was Meike angeboten worden war, nachdem sie sich arbeitslos gemeldet hatte, spottete jeder Vernunft und auch ihrer Qualifikation. Mit etwas wohlwollender Phantasie konnten diese Jobs vielleicht als Niedriglohnjobs gelten. Schließlich hatte Meike nur noch die Wahl, es eben doch in einer der Metzner-Firmen zu versuchen oder in derselben Tretmühle zu landen, in der sich schon ein Viertel aller Deutschen befand, deren Leben aus nichts als Arbeit am Rande des Existenzminimums bestand.
Doch Meike war das Kind derselben Eltern, die auch Jan gezeugt hatten, und das bedeutete, dass sie einen eigenen Kopf hatte, der es nicht akzeptierte, vor Aufgaben gestellt zu werden, zu deren Lösung ihr ausschließlich unattraktive Optionen angeboten wurden. Und tatsächlich fand Meike eine dritte Option, die sie kurzentschlossen wahrnahm: Sie kehrte Deutschland den Rücken. Die Lust auf Kämpfen und Durchbeißen hatte sie verlassen. Sie hatte Ellenbogen, aber die brauchte sie für Anderes. Das ererbte Geld rührte sie trotzdem nicht an. Es lag ohnehin zum größten Teil in Fonds und Anleihen oder steckte direkt in Unternehmen, die den Metzners gehörten. Nein, den Flug nach Griechenland zu ihrem Bruder hatte sie vom eigenen Ersparten bezahlt. Seitdem lebten sie hier auf fast symbiotische Weise zusammen. Sie machte die Buchhaltung und kümmerte sich um den Papierkram, und Jan zahlte ihr ein Gehalt dafür, dass sie ihm die Bürokratie abnahm, so dass er konzentriert an seinen Mischungen arbeiten konnte.
Als Jan nach Griechenland gezogen war, hatte er noch keinen festen Plan gehabt, was er machen wollte. Hauptsache weg aus den USA und ihrem verrotteten gesellschaftlichen Klima, das sich nach all den Jahren des Kriegs gegen den Terror anfühlte wie in einer Wagenburg. Und auch weg von den „Antennen“. Es gab diese Villa hier auf dem Pilion, die seine Eltern gebaut hatten, etwas abseits in einer herrlichen Landschaft gelegen; also war er hierher geflüchtet. Auf seinen ersten Streifzügen durch die Umgebung stach ihm sofort die Vielfalt der Aromen in die Nase. Auf dem Pilion wuchsen mehr Kräuterarten als sonst irgendwo in Griechenland. Er begann, sich mit ihnen zu beschäftigen, fand heraus, dass viele von ihnen einst in der griechischen Volksmedizin angewendet worden waren und dass sie nicht nur ganz ausgezeichnet zur Lammkeule passten, sondern dass sie auch pharmazeutisch wirksam waren. Ihre ätherischen Öle wirkten entzündungshemmend und desinfizierend. Manche Kräuter warteten mit pflanzlichen Antibiotika auf, und es gab sogar welche, die auf die Psyche wirkten und Glücksgefühle hervorriefen. Jan dachte sofort an die wachsende Zahl von Menschen in Europa, die an Depressionen litten, und so zeichneten sich erste Umrisse einer Unternehmensidee ab.
Doch dabei blieb es nicht. Jan hatte Berichte über eine alte Frau gehört, die in einem Dorf im Süden des Pilion abgöttisch verehrt wurde, weil sie mit ihren Kräutern, so hieß es, jede Krankheit heilen konnte. Er schaffte es, ihre Bekanntschaft zu machen, und tatsächlich vollbrachte sie Erstaunliches. Sie heilte nicht nur Durchfälle und Husten und befreite von Warzen, sondern sie behandelte auch erfolgreich schwere Infektionen wie Lungenentzündungen, und wenn Jan sich nicht täuschte, blieb sie sogar im Kampf gegen Malaria siegreich – und das war wirklich außergewöhnlich! Gegen Malaria gab es weltweit noch immer kein wirksames Gegenmittel. Doch die Krankheit war auf dem Vormarsch, auch nach Südeuropa war sie wieder zurückgekehrt.
Die alte Frau kannte ein Kraut. Sie wusste nicht, wie der exakte botanische Name war, ebenso wenig wie sie die Namen der Krankheiten kannte, die sie behandelte; sie hätte niemals eine klare medizinische Diagnose stellen können. Das Kraut ließ sie Jan nur einmal kurz sehen, aber dieser Augenblick genügte ihm, um es gründlich genug zu spüren. Die behaarten, verkrüppelt wirkenden Stängel, die kleinen Blätter, der niedrige Wuchs – er prägte sich die Wahrnehmung genau ein, unternahm in den folgenden Tagen einige Wanderungen im Süden des Pilion und erspürte schließlich, was er suchte. Fortan wuchsen einige Exemplare des Malariakrauts frei in seinem Garten.
Das war schon die zweite gute und sinnvolle Unternehmensidee, seit er sich auf den Pilion zurückgezogen hatte. Keine von beiden setzte er sofort um, denn er hatte noch eine dritte. Sowohl sein Anti-Depressionsmittel als auch die Malaria-Medizin erforderten Forschung, klinische Studien und Auseinandersetzungen mit der Bürokratie und wahrscheinlich auch mit Konkurrenten, die besser mit den Entscheidungsträgern vernetzt waren als er; Griechenland war immer noch Mitglied der EU. Jan hatte jedoch keine Lust auf langwierige Auseinandersetzungen mit dem Bürokratiemonster. Er wollte Fortschritte, und zwar schnell!
Weil das Malariakraut nur sehr langsam wuchs, suchte Jan nach Mitteln, sein Wachstum auf möglichst natürliche Weise zu beschleunigen. Wenn er ein Labor wie das an der Uni von Cincinnati zur Verfügung gehabt hätte, wäre er vielleicht in Versuchung gekommen, die gewünschten Verbesserungen durch genetische Optimierung zu erzielen, aber erstens hatte er kein Labor, und zweitens hätte er dann einen gentechnisch veränderten Organismus geschaffen, den er in die Natur hätte entlassen müssen, um ihn zu testen, denn er hatte kein Hochsicherheitslabor, in dem dies unter abgeschirmten Bedingungen möglich gewesen wäre. Also war er lieber vorsichtig, auch wenn er die Gentechnik-Paranoia der Europäer nicht in allen Punkten teilte.