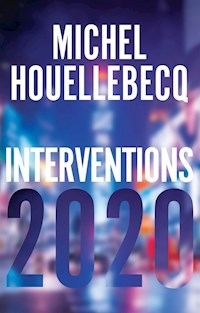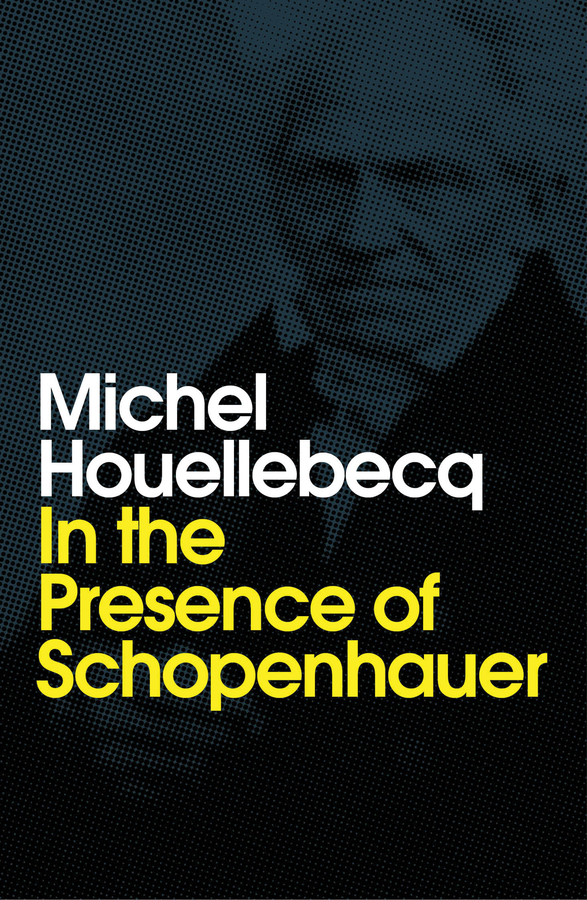9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Nach den Kontroversen um den Roman ›Unterwerfung‹ und den persönlichen Anfeindungen gegen seinen Autor ist dieses Duell in Worten aktueller denn je. Bernard-Henri Lévy und Michel Houellebecq sind zwei der wichtigsten Intellektuellen des französischen Literaturbetriebs und erwiesenermaßen »Volksfeinde«: Der umstrittene Philosoph trifft auf den meistgehassten französischen Schriftsteller der Gegenwart. Zwei bekennende Narzissten fragen sich, womit sie den Hass der Öffentlichkeit verdient haben, und sezieren das eigene Image mit kluger Koketterie: ein Schlagabtausch, der ins Private und Politische geht, poetologische Fragen ebenso behandelt wie philosophische und nebenbei glänzend unterhält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Ähnliche
Nach den Kontroversen um den Roman ›Unterwerfung‹ und den persönlichen Anfeindungen gegen dessen Autor ist dieses Duell in Worten aktueller denn je. Bernard-Henri Lévy und Michel Houellebecq sind zwei der wichtigsten Intellektuellen des französischen Literaturbetriebs und erwiesenermaßen »Volksfeinde«: Der umstrittene Philosoph trifft auf den meistgehassten französischen Schriftsteller der Gegenwart. Zwei bekennende Narzissten fragen sich, womit sie den Hass der Öffentlichkeit verdient haben, und sezieren das eigene Image mit kluger Koketterie: ein Schlagabtausch, der ins Private und Politische geht, poetologische Fragen ebenso behandelt wie philosophische und nebenbei glänzend unterhält. Michel Houellebecq wurde 1958 geboren. Er gehört zu den wichtigsten Autoren der Gegenwart, seine Bücher werden in über vierzig Ländern veröffentlicht. Auf Deutsch ist nahezu sein gesamtes Werk bei DuMont verlegt. Zuletzt erschienen der mit dem renommiertesten französischen Literaturpreis, dem Prix Goncourt, ausgezeichnete Roman ›Karte und Gebiet‹ (2011), der Gedichtband ›Gestalt des letzten Ufers‹ (2014) sowie der Roman ›Unterwerfung‹ (2015). Bernard-Henri Lévy
MICHEL HOUELLEBECQBERNARD-HENRI LÉVY
Volksfeinde
EIN SCHLAGABTAUSCH
Aus dem Französischenvon Bernd Wilczek
Vollständige eBook-Ausgabe der im DuMont Buchverlag erschienenen Taschenbuchausgabe
1. Auflage 2016
Alle Rechte vorbehalten
Die französische Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel ›Ennemis publics‹ bei Flammarion / Grasset, Paris.
© Flammarion / Grasset & Fasquelle, Paris, 2008
© 2009 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Übersetzung: Bernd Wilczek
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © plainpicture/Image Source
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8916-7
www.dumont-buchverlag.de
Brüssel, den 26. Januar 2008
Lieber Bernard-Henri Lévy,
wir sind, könnte man sagen, grundverschieden – mit Ausnahme eines entscheidenden Punktes: Es handelt sich bei uns beiden um ziemlich verachtenswerte Individuen.
Als Fachmann für Winkelzüge und Medienpossen beschmutzen Sie selbst die weißen Hemden, die Sie tragen, und als enger Freund der Mächtigen, der seit seiner Kindheit in obszönem Reichtum schwelgt, sind Sie ein Sinnbild für das, was einige billige Magazine wie Marianne nach wie vor als »Kaviar-Linke« und die deutschen Journalisten etwas feinsinniger als die »Toskana-Fraktion« bezeichnen. Sie sind ein Philosoph ohne Gedanken, aber dafür mit Beziehungen, und darüber hinaus zeichnen Sie verantwortlich für den lächerlichsten Film der Filmgeschichte.
Nihilist, Reaktionär, Zyniker, Rassist und verabscheuungswürdiger Frauenfeind: Es wäre für mich zu viel der Ehre, wenn man mich der wenig appetitlichen Familie der rechten Anarchisten zuordnen würde; eigentlich bin ich nichts weiter als ein Spießer. Als stilloser Autor platter Bücher bin ich nur durch eine Reihe unwahrscheinlicher geschmacklicher Fehlurteile zu literarischer Berühmtheit gelangt, die verwirrte Kritiker vor einigen Jahren abgegeben haben. Glücklicherweise ist man meiner kurzatmigen Provokationen seither überdrüssig geworden.
Wir beide sind die perfekten Verkörperungen der entsetzlichen Erschlaffung der französischen Kultur und Intelligenz, die das Time Magazine kürzlich ebenso streng wie angemessen monierte.
Wir haben nicht das Geringste zum Wiederaufleben der elektronischen Musik in Frankreich beigetragen. Unsere Namen tauchen nicht einmal im Abspann von Ratatouille auf.
Die Eckpunkte für die Auseinandersetzung wären damit genannt.
Paris, den 27. Januar 2008
Die Auseinandersetzung?
Es gibt drei mögliche Reaktionen, lieber Michel Houellebecq.
Nummer 1: Bravo! Alles liegt auf dem Tisch. Ihre Mittelmäßigkeit. Meine Nichtigkeit. Jenes hallende Nichts, das uns als Ersatz für das Denken dient. Die uns gemeinsame Vorliebe für die Posse, wenn nicht sogar Täuschung. Seit dreißig Jahren stelle ich mir die Frage, wie die Leute auf einen Typen wie mich hereinfallen können. Seit dreißig Jahren übe ich, so talentlos wie marktschreierisch, harmlose Selbstkritik, in Erwartung des klugen Lesers, der mich entlarvt. Nun, jetzt sind wir so weit. Dank Ihnen, mit Ihrer Hilfe werde ich es vielleicht schaffen. Ihre Eitelkeit und die meine. Meine Verderbtheit und die Ihre. Um es mit den Worten eines anderen, allerdings erstklassigen Scheusals zu sagen: »Decken Sie Ihre Karten auf, dann decke ich meine auf.« Was für eine Erleichterung!
Nummer 2: Was Sie betrifft, in Ordnung. Aber warum ich? Warum soll ich mich eigentlich dieser Übung in Selbstverleumdung unterziehen? Warum soll ich mir eigentlich Ihren Hang zur wütenden, lärmenden, demütigenden Selbstzerstörung zu eigen machen? Ich bin kein Freund des Nihilismus. Ich verabscheue das Ressentiment und die Melancholie, die damit einhergehen. Und ich denke, dass die Literatur den einzigen Zweck hat, jenem Depressionismus entgegenzuwirken, der mehr denn je zum Leitbegriff unserer Epoche geworden ist. Ich könnte mich entsprechend darum bemühen zu erklären, dass es auch glückliche Existenzen gibt, gelungene Werke und harmonischere Leben, als die Schwarzseher, die uns verachten, allem Anschein nach glauben. Ich übernähme die Rolle des wahrhaft Bösen, die bei Molière Philinte gegenüber Alceste spielt, und würde mir ein treffliches Lob Ihrer Bücher abringen, und da ich einmal dabei wäre, auch gleich eines meine eigenen Bücher betreffend. Das ist der zweite Weg, eine andere Art und Weise, die Auseinandersetzung zu eröffnen.
Und dann wäre da schließlich noch die dritte Möglichkeit. Die Antwort auf die Frage, die Sie mir neulich abends im Restaurant gestellt haben, als uns die Idee zu diesem Briefwechsel kam. Warum so viel Hass? Woher kommt er? Und wie kommt es, dass er, sobald er sich gegen Schriftsteller richtet, einen so scharfen Ton annimmt, eine solche Heftigkeit entfaltet? Wie bei Ihnen. Wie bei mir. Aber auch wie im Fall von Sartre, den seine Zeitgenossen auf eine zwar andere Weise, aber genauso entschieden ablehnten … Wie im Fall von Cocteau, der sich nicht einmal einen Film bis zum Ende ansehen konnte, weil am Kinoausgang immer schon irgendjemand auf ihn wartete, der ihn zusammenschlagen wollte … Wie bei Pound in seinem Käfig … Bei Camus in seiner Kiste… Oder bei Baudelaire, der in einem großartigen Brief schrieb, dass sich die »menschliche Rasse« gegen ihn verbündet habe. Die Liste wäre lang. Man müsste nämlich die gesamte Literaturgeschichte zitieren. Und vielleicht müsste man – das wäre meine These – den Wunsch der Schriftsteller selbst zu ergründen suchen. Welchen Wunsch? Den Wunsch zu missfallen natürlich. Die Vorliebe für die Abtrünnigkeit. Die Lust, die Freude an der Niedertracht.
Sie haben die Wahl.
2. Februar 2008
Lieber Bernard-Henri,
im Moment versage ich mir das Vergnügen der wunderbaren Diskussion, die wir über den »Depressionismus« führen könnten (und führen werden), zu dessen ausgewiesensten Vertretern ich ja nun einmal gehöre. Hier in Brüssel, wo mir keines meiner Bücher zur Verfügung steht, kann es passieren, dass ich mir über dieses oder jenes Schopenhauer-Zitat den Kopf zerbreche, während Baudelaire der einzige Autor ist, den ich einigermaßen aus dem Kopf zitieren kann. Im Übrigen ist es immer nett, in Brüssel über Baudelaire zu sprechen.
An einer Stelle, die wahrscheinlich vor der von Ihnen zitierten verfasst wurde (weil er darin die Schuld noch nicht bei der menschlichen Rasse, sondern bei Frankreich sucht), sagt Baudelaire, dass ein großer Mensch sich nur im Widerstand gegen alle seine Landsleute als ein solcher erweist, er mithin eine Angriffskraft entwickeln muss, welche der gesamten Verteidigungskraft, die seine miteinander verbündeten Landsleute aufbringen, gleichkommt oder sie sogar übertrifft.
Die erste Bemerkung, die einem hierzu einfällt, ist, dass das extrem anstrengend sein muss. Die zweite, dass Baudelaire mit 46 Jahren gestorben ist.
Baudelaire, Lovecraft, Musset, Nerval – allesamt Autoren, die für mich in meinem Leben auf die eine oder andere Weise wichtig waren – sind in ihrem 47. Lebensjahr gestorben. Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen 47. Geburtstag. Im Laufe des Vormittags hatte ich die Arbeit an meinem Roman Die Möglichkeit einer Insel abgeschlossen und dann das Manuskript an den Verlag geschickt. Ein paar Tage zuvor hatte ich Texte zusammengetragen, die ich niemals vollendet hatte und die auf CD-ROMs oder Disketten abgespeichert waren. Bevor ich die Wechseldatenträger wegwarf, zog ich die Dokumente auf die Festplatte eines alten Computers; und dann formatierte ich aus Versehen die Festplatte, und alle Texte waren verloren. Mir fehlten nur noch wenige Meter bis zum Berggipfel, und ich vermochte mir ungefähr vorzustellen, woraus der lange Abstieg besteht, der den zweiten Lebensabschnitt bildet: aus dem alterungsbedingten zunehmenden Verfall und schließlich dem Tod. Mehrmals drängte sich mir, so unwillkürlich wie bohrend, der Gedanke auf, dass mich nichts dazu zwingt, diesen zweiten Abschnitt zu leben; dass ich ohne weiteres das Recht hätte, ihn zu schwänzen.
Ich habe es nicht getan, und ich habe den Abstieg in Angriff genommen. Nach einigen Monaten begriff ich, dass ich dabei war, in einen unsicheren Bereich ohne festen Grund vorzudringen, und dass es Geduld brauchte, um dort wieder herauszukommen. Ich spürte ein (mal kürzeres, mal längeres) Nachlassen des Wunsches, Missfallen zu erregen, den ich gegenüber der Welt hegte. Es ist mir unangenehm, es zugeben zu müssen, aber ich empfand immer häufiger den Wunsch, geliebt zu werden. Wie ein Sportler oder Sänger einfach nur von allen geliebt zu werden, in einen verwunschenen Raum ohne Anschuldigungen, Sticheleien oder Auseinandersetzungen einzudringen. Wenn ich nur ein wenig nachdachte, wurde mir natürlich jedes Mal klar, wie absurd dieser Traum war; das Leben ist begrenzt und Vergebung unmöglich. Doch das Nachdenken änderte nichts daran, dass der Wunsch fortbestand – und ich muss zugeben, dass er bis jetzt fortbesteht.
Wir beide haben beharrlich den Genuss der Verworfenheit, der Demütigung und der Lächerlichkeit gesucht; und man übertreibt wohl nicht, wenn man sagt, dass uns das vorzüglich gelungen ist. Allerdings ist dieser Genuss weder unmittelbar noch natürlich; unser eigentlicher Wunsch, unser ursprünglicher Wunsch (entschuldigen Sie, wenn ich für Sie spreche) besteht, wie bei allen anderen auch, darin, bewundert oder geliebt zu werden oder beides zusammen.
Wie erklärt sich dieser merkwürdige Umweg, den wir beide genommen haben? Bei unserem letzten Zusammensein war ich verblüfft darüber, dass Sie nach wie vor Ihren Namen googlen und sogar die Benachrichtigungsfunktion nutzen, mit deren Hilfe man über jeden neuen Eintrag informiert wird. Ich für meinen Teil habe die Benachrichtigungsfunktion abgeschaltet und verzichte mittlerweile gänzlich auf Google-Recherchen.
Sie haben mir gesagt, dass Sie über die Positionen des Gegners informiert sein möchten, um gegebenenfalls zurückschlagen zu können. Ich weiß nicht, ob Sie den Krieg wirklich mögen, oder besser gesagt, ich weiß nicht, seit wann Sie ihn mögen, wie viele Jahre Übung Sie benötigt haben, um ihn interessant und reizvoll zu finden; fest steht jedenfalls, dass Sie, genau wie Voltaire, denken, dass man in dieser Welt »mit der Waffe in der Hand« lebt und stirbt.
Dieser fehlende Überdruss am Kampf ist eine beachtliche Kraft. Sie verhindert, und wird auf lange Zeit verhindern, dass man der menschenfeindlichen Apathie verfällt, die für mich die größte Gefahr darstellt; dieses mürrische und fruchtlose Schmollen, das dazu führt, sich in seine Ecke zurückzuziehen und unablässig zu wiederholen: »Alles Idioten!«; und dazu, buchstäblich nichts anderes mehr zu tun.
Diejenige Kraft, der bei meiner Sozialisation diese Rolle zufallen könnte, ist eine gänzlich andere: Mein Wunsch zu missfallen kaschiert einen unsinnigen Wunsch zu gefallen. Doch ich möchte gefallen, »wie ich bin«, ohne zu verführen, ohne das zu verbergen, was an mir schändlich sein mag. Es mag durchaus vorgekommen sein, dass ich mich der Provokation hingegeben habe; das bedauere ich, denn es entspricht nicht meinem tiefsten inneren Wesen. Ich nenne denjenigen einen Provokateur, der, unabhängig davon, was er denken oder sein mag (und wenn der Provokateur provoziert, hört er auf zu denken, hört er auf zu sein), auf den Satz oder die Haltung spekuliert, die bei seinem Gesprächspartner ein Höchstmaß an Missfallen oder Verlegenheit hervorruft; und der dann das Ergebnis seiner Berechnung planmäßig anwendet. Viele Humoristen der zurückliegenden Jahrzehnte waren bemerkenswerte Provokateure.
Im Gegensatz dazu ist mir eine Art perverse Aufrichtigkeit zu eigen: Beharrlich und verbissen suche ich danach, was ich Schlechtes an mir haben könnte, um es dann dem Publikum ganz aufgeregt vor die Füße zu legen – so wie ein Terrier seinem Herrchen einen Hasen oder einen Pantoffel vor die Füße legt. Ich tue das nicht, um irgendeine Form von Erlösung zu erfahren; allein die Vorstellung ist mir fremd. Ich möchte nicht trotz des Schlechten an mir geliebt werden, sondern aufgrund dieses Schlechten. Ich gehe sogar so weit, mir zu wünschen, dass das, was ich Schlechtes an mir habe, genau das ist, was man an mir mag.
Es ist nun einmal so, dass ich mich angesichts offener Feindseligkeit unwohl und wehrlos fühle. Jedes Mal, wenn ich eine dieser berühmten Google-Recherchen gemacht habe, überkam mich dasselbe Gefühl, das ich empfinde, wenn mich ein besonders schmerzhaftes Ekzem quält und ich mich schließlich blutig kratze. Meine Ekzemausschläge tragen die Namen Pierre Assouline, Didier Jacob, François Busnel, Pierre Mérot, Denis Demonpion, Éric Naulleau und viele andere mehr, den Namen desjenigen vom Figaro habe ich vergessen. Ich erinnere mich nicht an alles und habe es schließlich aufgegeben, meine Feinde zu zählen; das Kratzen habe ich, gegen den ausdrücklichen Rat meines Arztes, nicht aufgegeben.
Genauso wenig habe ich es aufgegeben, mein Ekzem zu kurieren, obwohl ich glaube, begriffen zu haben, dass mich diese Kleinstparasiten mein ganzes Leben lang begleiten werden. Sie können ohne mich buchstäblich nicht mehr leben, ich verschaffe ihnen eine Daseinsberechtigung, und sie scheuen, wie kürzlich beispielsweise Assouline, nicht einmal davor zurück, in einem Vortrag, den ich in Chile gehalten hatte (wo ich mich ein klein wenig vor ihnen in Sicherheit wähnte), herumzuwühlen, um etwas aufzustöbern, das man ein bisschen kürzen und neu mixen kann, um mich in ein lächerliches oder hässliches Licht zu stellen.
Trotzdem verspüre ich kein Verlangen nach Feinden, nach erklärten und entschiedenen Feinden. Ich habe schlichtweg kein Interesse daran. Mag in mir auch ein Wunsch vorhanden sein zu gefallen, ebenso wie ein unlösbar damit verbundener Wunsch zu missfallen, so habe ich doch niemals etwas empfunden wie den Wunsch zu siegen, und ich glaube, dass es das ist, worin wir uns unterscheiden.
Ich will damit nicht sagen, dass Ihnen der Wunsch zu gefallen fremd ist, sondern dass Ihnen auch der Wunsch bekannt ist zu siegen, dass Sie also alles in allem fest auf beiden Beinen stehen (was nach dem großen Vorsitzenden Mao Zedong auch besser ist). Will man schnell und weit gehen, ist das in der Tat besser. Andererseits haben die Bewegungen eines Einbeinigen etwas Sprunghaftes und Unvorhersehbares an sich; für denjenigen, der normal geht, ist der Einbeinige in etwa das Gleiche wie der Rugby-Ball für den Fußball, und es ist nicht ausgeschlossen, dass ein robuster Einbeiniger einem Scharfschützen leichter entkommt.
Ich mache Schluss mit den fragwürdigen Metaphern, die zu nichts anderem dienen, als der von Ihnen gestellten Frage auszuweichen: »Warum so viel Hass?« Oder genauer gesagt: Warum wir? Selbst wenn man feststellen kann, dass wir selbst alles dafür getan haben, bleibt zu klären, wie wir dabei so erfolgreich sein konnten. Man könnte zwar meinen, dass ich unnötigerweise meine Energie verschwende, wenn ich mich mit so unbedeutenden Gestalten wie Assouline oder Busnel befasse. Aber dessen ungeachtet ist es meinen ganz persönlichen Kellerasseln (und gleichzeitig auch den Ihren) gelungen, allein durch ihre Verbissenheit einen gewissen Erfolg zu erzielen. In mehreren E-Mails, die ich von Schülern erhielt, haben diese darauf hingewiesen, dass einer ihrer Lehrer sie ausdrücklich vor der Lektüre meiner Bücher gewarnt habe. Und auch Ihnen scheint immer noch eine Art Blutdurst zu folgen. Oft, wenn Ihr Name in einem Gespräch fiel, blickte ich in maliziös verzerrte Gesichter. Es war ein Gesichtsausdruck, den ich sehr gut kenne, der Ausdruck niederer Freude, der üblicherweise dann auftaucht, wenn man an jemanden denkt, den man ohne jedes Risiko verhöhnen kann. Als ich noch ein Kind war, habe ich häufig genug (eigentlich immer dann, wenn ich mich in einer Gruppe männlicher Jugendlicher befand) diesen scheußlichen Prozess der Bestimmung eines Opfers miterlebt, das die Gruppe dann nach Belieben erniedrigen und verhöhnen kann. Und nie habe ich auch nur im Geringsten an der Tatsache gezweifelt, dass die Sache ohne die Präsenz einer übergeordneten Autorität, um genau zu sein von Lehrern oder Polizisten, eskaliert wäre, bis hin zu Folter oder Mord. Zwar brachte ich nicht den Mut auf und verfügte auch nicht über die körperlichen Voraussetzungen, um mich auf die Seite des Opfers zu schlagen; aber ich verspürte auch nie den Wunsch, mich dem Lager der Henker anzuschließen. Möglicherweise taugen wir beide nicht als moralische Vorbilder, aber man kann uns zumindest zugutehalten, dass wir nichts von einem Rudeltier haben. Wenn ich Zeuge hässlicher Szenen wurde, habe ich mich als Kind damit beschieden, den Blick abzuwenden und mich darüber zu freuen, dass ich dieses Mal verschont worden war. Und wenn ich jetzt zu den Opfern gehöre, kann ich weiterhin den Blick abwenden, weil ich einigermaßen davon überzeugt bin, dass alles rein verbal bleibt, zumindest so lange, wie wir in einem zivilisierten Staat leben.
Natürlich könnte ich auch versuchen zu verstehen, ich könnte mich mit diesem unangenehmen Phänomen beschäftigen, zumal mich die gängigen, mehr oder weniger symbolischen Erklärungen, die sich aus der Religionsgeschichte ableiten, nie wirklich überzeugt haben. Dieses Phänomen existierte in den ländlichen Gesellschaften, es existiert in unseren Städten, und es würde auch dann fortexistieren, wenn unsere Städte verschwinden und Kommunikation nur noch in virtueller Form stattfinden sollte. Es erscheint mir vollkommen unabhängig vom politischen System oder der bestehenden geistigen Lage. Ich glaube, die Offenbarungsreligionen könnten verschwinden, ohne dass sich hieran merklich etwas ändern würde.
Mehrere Passagen in Ihrem Buch Comédie, das ich gerade zu Ende gelesen habe, legen die Vermutung nahe, dass Sie die Möglichkeit gehabt haben, vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen über die Frage nachzudenken. Daher überlasse ich jetzt Ihnen das Feld.
Und grüße Sie herzlich.
4. Februar 2008
Ach ja, das Ekzem …
Wussten Sie, dass es passenderweise bei Cocteau großartige Seiten zu dieser Sache mit dem Ekzem gibt?
Sie finden sich in dem wunderschönen kleinen Buch, das er während der Dreharbeiten von Es war einmal – Die Schöne und das Biest als Tagebuch verfasste, und das Truffaut allen Nachwuchsfilmern zu lesen empfahl.
Es enthält interessante Seiten über das Abenteuer der Dreharbeiten an sich, über das Verhältnis zu Bérard, die Meinungsverschiedenheiten mit Alekan in Bezug auf das Licht, die Entdeckung der Kamerafahrt, die Bildbearbeitung, den Stil, die Geduld der Darsteller, die lebenden Statuen, Jean Marais.
Aber es enthält auch (und es scheint mir fast, als sei das die eigentliche Obsession des Buches, sein roter Faden, das, was ihm seinen Rhythmus und seine Farbe verleiht) verblüffende, für den Leser zuweilen schwer zu ertragende Seiten über das, was er als seinen »Juckreiz« bezeichnet, seine »aufgesprungene Maske«, die »Feuerkoralle« oder den »brennenden Dornbusch« der Nerven, die an die Stelle seiner Gesichtszüge getreten sind, seine »Furunkel«, seine »Phlegmone«, seine roten »Gesichtsnarben«, seine »Geschwülste«, seine »nässenden Geschwüre«, seine »Wunden«. Das ganze Buch ist eine einzige lange Klage, ein aufs Papier gebrachter Schmerzensschrei, die Zurschaustellung eines von einem so unerträglichen Leiden gequälten Gesichts, dass er morgens manchmal nur am Drehort erscheinen kann, wenn ihm sein Chefelektriker vorher mehrere Schichten frischen Schweineschmalzes auf Wangen und Nase aufgetragen hat.
Armer Cocteau …
Armer »Dichterfürst«, den ich, trotz Arno Breker, trotz seiner Pappmaché-Ästhetik, trotz seiner schwülstigen und langweiligen Seite nie zu verabscheuen vermochte …
Und, natürlich, armer Baudelaire – der an der menschlichen Rasse litt, an Frankreich, an Belgien, an was auch immer Sie wollen. Ihm lastet die ganze Welt auf den Schultern! Die Jagd ist sofort eröffnet! Ablehnung auf den ersten Blick! Die Meute ist zunächst vorsichtig, weil das Dandyhafte von Carolines Sohn und dessen abgetragene Klamotten des ersten Ehemannes sie einschüchtern, doch dann, in der zweiten Lebenshälfte, die Baudelaire in Brüssel und im Hôtel du Grand Miroir verbringt, verhält sie sich zunehmend offen feindselig! Vor Sartre, der nicht zufällig einen sehr guten Essay mit dem Titel Baudelaire geschrieben hat, wurden nur wenige Schriftsteller derart angefeindet. Nur wenige waren mit einer derart massiven Ablehnung konfrontiert, wie es insbesondere in seinen Jahren des Exils der Fall war. Ich beneide Sie darum, dass Sie in Brüssel sind, Michel. Ich bin dorthin gezogen, um dort meinen Roman über seine letzten Tage (die von Baudelaire) zu schreiben. Das war wenige Monate nachdem man das Hôtel du Grand Miroir abgerissen hat, um an derselben Stelle einen Sexshop zu errichten. Dieser Name passte so wunderbar zu dem Mann, der erklärtermaßen »vor einem Spiegel leben und sterben« wollte, um darin »ungestört erhaben« zu erscheinen. Dass ich zu spät dort angekommen bin, dass ich das Grand Miroir und seine Geheimnisse so knapp verpasst habe, ist eine der großen literarischen Enttäuschungen meines Lebens. Ich beneide Sie darum, dass Sie dort sind, weil es, und vielleicht möchten Sie es sich ja einmal ansehen, das Kopfsteinpflaster in der Rue Ducale noch gibt, über das heute noch immer die Mädchen mit ihren hochhackigen Schuhen auf den Spuren des Autors der Raketen stolzieren; genauso wie den Square du Petit Sablon, wo es zumindest zu meiner Zeit noch ein Bordell gab, das er gemocht hatte; das Augustinerinnenkloster, wo man ihn nach seinem Schlaganfall unterbrachte; ganz zu schweigen von Namur, Saint-Loup de Namur, wo er zum ersten Mal den »Windzug des Flügelschlags der Geistesschwäche« verspürte …
Aber gut.
Zu Ihrer Frage.
Ob ich, wie Sie sagten, Gelegenheit hatte, über »die« Frage in Bezug auf mich selbst nachzudenken.
Nun, die Antwort lautet letztlich Ja und Nein.
Ja schon allein deshalb, weil ich, auch wenn ich selbst gar nicht da bin, gut genug sehe und gut genug höre, um das feindselige Raunen zu vernehmen, das an jedem beliebigen öffentlichen Ort aufbrandet, sobald mein Fall zur Sprache kommt.
Nein wiederum, weil es da ein ziemlich merkwürdiges Phänomen gibt, das dazu führt, dass es mir – offenbar im Gegensatz zu Ihnen – nie gelungen ist, mir vorzustellen, dass bzw. so zu leben, als ob ich das »Opfer« einer wirklichen »Verfolgung« sei.
Ich bin Angriffen ausgesetzt wie nur wenige andere Schriftsteller.
Jedes meiner Bücher bringt mir eine Vielzahl an Beschimpfungen ein, die so manchen anderen entmutigen würden.
Und was das Ekzem betrifft … Ach, das Ekzem! … Wenn das Ekzem ein Kriterium ist, dann muss ich wohl zugeben, dass ich auch in Bezug auf Ekzeme ein recht kundiger Fachmann bin.
Allerdings fällt es mir wahnsinnig schwer, mich in den Angriffen, wenn ich sie schon zur Kenntnis nehme, wiederzuerkennen, mir die Vorstellung, die sie von mir vermitteln, zu eigen zu machen oder sie auf mich zu beziehen, das wenig schmeichelhafte und manchmal jämmerliche Bild, das sie zeichnen, mit meiner inneren oder auch nur mit meiner gesellschaftlichen Identität in Verbindung zu bringen.
Ein Beispiel. Es geht um diesen Film, den ich vor zwölf Jahren gedreht habe, und durch den ich in den Genuss kam, sehr eingehend Cocteaus Tagebuch von Es war einmal – Die Schöne und das Biest zu lesen. Ich weiß, was man über meinen Film gesagt hat und immer noch darüber sagt, falls man ihn nicht vollkommen aus dem Gedächtnis gestrichen hat. Mir ist bekannt, dass man ihn für »Schrott« hält, dass er offiziell als »armseliges« Werk gilt, als »schlechtester Film der Filmgeschichte«, wie Serge Toubiana, der damalige Chef der Cahiers du Cinéma, schrieb. Ich weiß, dass es Leute gibt, die, wenn der Film im Fernsehen gezeigt wird, »Dinner für Spinner« organisieren, wobei der Spinner natürlich der Regisseur des Films ist. Aber was soll ich sagen? Ich weiß es, aber es beeinflusst mein Leben nicht. Es ist mir bewusst, aber ich nehme es mir nicht zu Herzen. Ich mag noch so gut informiert sein über die Schmutzlawine, die sich bei seinem Kinostart über ihn ergossen hat – es gelingt mir einfach nicht, mich selbst als Macher-des-armseligsten-und-am-meisten-mit-Häme-überschütteten-Films-der-Filmgeschichte zu sehen. Und es kann durchaus vorkommen, dass ich mich in einer Situation wiederfinde – einer Diskussionsrunde, einem Treffen mit Freunden, einer Sitzung –, in der ich, ohne die grinsenden Gesichter zu sehen, ohne die Lächerlichkeit, der ich mich aussetze, oder das durch mich hervorgerufene höfliche Schweigen zu registrieren, darüber rede, als sei es ein normaler, ganz schöner, ja beinahe bedeutender Film, auf den ich stolz bin.
Ein anderes, ein bedeutungsvolleres und folgenschwereres Beispiel ist die Tatsache, dass ich Jude bin … Jude zu sein, das heißt, dass man prinzipiell ein besonderes Verhältnis zu dieser ganzen Verfolgungs-Geschichte hat. Jude zu sein ist für die meisten Juden so etwas wie ein Freischein dafür, sich selbst als jemanden wahrzunehmen, der verletzbar und gefährdet ist, niemals wirklich an seinem Platz, ein Helfershelfer des Antisemitismus. Und ich kenne übrigens nur sehr wenige Juden, die sich nicht an ein Ereignis, eine Urszene erinnern, die sie selbst oder jemand aus ihrer Familie erlebt haben, und die diese angeborene Vertrautheit mit der Kränkung bezeugen. Doch auch hiervon bin ich nicht betroffen. Es versteht sich von selbst, dass ich den Antisemitismus bekämpfe. Sie wissen, dass ich zu denen gehöre, die diesbezüglich nichts, aber auch rein gar nichts durchgehen lassen. Aber vielleicht handelt es sich dabei ja auch um eine Form der Verneinung. Vielleicht handelt es sich um ein Symptom meiner tief verwurzelten Neurose. Vielleicht hängt es auch mit dem Umstand zusammen, dass ich in einer Region dieser Welt geboren wurde, in der die Juden einigermaßen verschont geblieben sind. Tatsache ist, dass ich, wenn ich mich für die Juden einsetze, nie das Gefühl habe, für mein eigenes Wohl zu kämpfen. Tatsache ist auch – und ich bitte Sie inständig, mir zu glauben –, dass ich mich nicht erinnere, jemals, ob in meiner Kindheit oder später, körperlich oder seelisch unter Diskriminierungen oder Kränkungen gelitten zu haben, gegen die ich aufbegehre und mich wehre. Es gibt leidende Juden; ich bin ein Jude, der kämpft. Es gibt Juden, die ihr Judentum leben wie eine Reise ans Ende der Verlassenheit und der Nacht; ich bin ein glücklicher Jude – Jean-Claude Milner würde sagen, ein »affirmativer« Jude (und Albert Cohen würde sagen, einer in der Art seines Romanhelden Solal, d.h. nach seinem Verständnis »sonnengleich« und quasi »griechisch«, die in den biblischen und talmudischen Texten, deren Erben sie sind, nichts als Glanz, Prunk und Licht sehen).
Da wir nun einmal beim Thema Kindheitserinnerungen sind, werde ich Ihnen auch eine von meinen erzählen. Genau wie Sie habe ich jene polymorph perversen Schulklassen kennengelernt, in denen man sich einen Prügelknaben ausguckt, dessen Schulranzen man klaut, dessen Federmäppchen man ausleert oder dessen Gesicht man mit Tinte beschmiert. Der offizielle Prügelknabe am Lycée Pasteur in Neuilly, wo ich mein Abitur gemacht habe, hieß Mallah. An seinen Vornamen erinnere ich mich nicht mehr. Aber sein viel zu blasses Gesicht, seine unbeholfenen und ängstlichen Bewegungen, die zugleich barmherzigen und flehenden Blicke, die er seinen Peinigern zuwarf, habe ich noch vor Augen. Sein Name ist mir dieser Tage in Erinnerung gekommen, als ich in der Zeitung las, dass die Mutter des französischen Präsidenten Sarkozy einer jüdischen Familie aus Thessaloniki namens Mallah entstammt. War er ein Verwandter? Ein Cousin? Entstammte er einem Familienzweig der Sarkozys? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was aus ihm geworden ist und ob er überhaupt noch lebt. Ich weiß nur, dass ich, genau wie Sie, Abstand zu dem Rudel kleiner Hyänen gehalten habe, die ihn erniedrigten, ihn bis in die Metro hinein jagten. Und dass ich mich nicht damit zufrieden gab, mich nicht an der Jagd auf Mallah zu beteiligen, mich von diesem zukünftigen Lynchmob fernzuhalten, sondern diesen Jungen in Schutz nahm und ihn mir mehrere Jahre zum Freund gemacht habe. Genauso wenig wie Sie betrachte ich das als ein besonderes Verdienst. Doch da war dieser Charakterzug – für einen kleinen jüdischen Jungen, wie ich es Ende der fünfziger Jahre war, nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit –: Der Gedanke, dass ich selbst zur Beute dieses Rudels werden könnte, lag mir so fern, die Angst, dass ich dieser wild gewordenen Saubande als Zielscheibe dienen könnte, war mir so fremd, jede Form von Verfolgungsangst, wenn Sie so wollen, lag so weit jenseits meiner Vorstellung, dass ich überhaupt kein Problem damit hatte, mich mit ihm sehen zu lassen.
Einige Zeit später habe ich übrigens eine sehr verstörende Entdeckung gemacht. In der Vorbereitungsklasse für Lehrende an Gymnasien und Hochschulen hatte ich einen Französischlehrer namens Jean Deprun, der, obwohl dreißig Jahre älter, ein Doppelgänger des kleinen Mallah war (dasselbe hektische Wesen, derselbe große Kopf auf einem unförmigen Körper, dieselbe blasse Gesichtsfarbe und eine erstaunlich glatte Haut, die völlig unverbraucht wirkte). Ich fand, dass er sich mir gegenüber merkwürdig verhielt. Beinahe feindselig. Ich spürte, ohne es mir erklären zu können, wie angestrengt er es vermied, dass sich unsere Blicke kreuzten, wenn er mich zum Beispiel nach vorne an die Tafel holte, um ein Gedicht von Maurice Scève oder eine Seite aus Flauberts Salammbô zu kommentieren. Bis zu jenem Tag, als ich seinen Namen zu Hause bei Tisch erwähnte und mein Vater ausrief: »Deprun? Den kenne ich noch von früher!« Woraufhin er mir erzählte, wie dieser berühmte Gelehrte, ein Spezialist für die »Philosophie der Unruhe« bei den Autoren des 18. Jahrhunderts, während des Krieges auf der Offiziersschule von Cherchell eine Art Vorläufer von Mallah gewesen war, der von den jungen Männern drangsaliert, verfolgt und gequält wurde, und wie mein Vater ihn genauso in Schutz genommen hatte wie ich dreißig Jahre später seine Reinkarnation in Neuilly.
Wenn ich Ihnen jetzt diese Geschichte erzähle, wenn ich mich wieder an sie erinnere und ich sie Ihnen erzähle, dann deshalb, weil mich zunächst einmal das Geheimnis dieser alten Gesten immer noch fasziniert, die wie ein Zauber wirken und die man ungewollt immer wiederholt.
Vor allem aber möchte ich Ihnen damit sagen, dass mir dieses potenziell kriminelle Gruppengebilde, dieses mörderische, bluthungrige, marodierende Rudel, dieses »unbehaarte und bösartige Tier«, von dem Franz in seinem Monolog in den Eingeschlossenen von Altona spricht, diese »fleischfressende« Spezies, »die unser Verderben heraufbeschworen hat«, kurz gesagt, dieses fette Biest, das »sich hinter den vertrauten Augen unserer Mitmenschen« verbirgt und nur darauf wartet, endlich »hervorspringen« zu können, gewissermaßen in zweifacher Form bekannt ist. Ich kenne, fast schon herkunftsbedingt, den typischen Atem, den schnellen Schritt, die Vorzeichen, das Kriegsgeschrei, die Schurkerei; dennoch habe ich weder je das Gefühl gehabt, dass sie es speziell auf mich abgesehen haben, noch dass ich sowieso nichts zu verlieren hätte, weil ich früher oder später ohnehin an der Reihe wäre …
Lassen Sie es mich anders sagen.
Nachdem ich über die Frage nachgedacht habe, lautet die Antwort natürlich Ja.
Ich weiß, dass es »das« Phänomen schlechthin ist, dass dieses Phänomen grundlegend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, dass es dies offenbar in noch stärkerem Maße ist als beispielsweise die Liebe, der Vertrag oder die universelle Zuneigung der Menschen für andere Menschen.
Ich weiß, dass es keinen Einschluss ohne Ausschluss gibt, und mir ist bewusst, dass, wenn zwei Menschen sich zusammentun, sie sich im Allgemeinen darauf geeinigt haben, einen Dritten zurückzuweisen und zu verbannen, mit anderen Worten, sie misstrauen dem, was die Griechen als »Synkretismus« bezeichneten; wobei ich immer dachte, dass die eigentliche Bedeutung dieses Begriffs weniger »Zusammenschluss mehrerer Kreter« ist, wie es die Etymologie nahelegt, sondern vielmehr »alle zusammen gegen den Kreter« (der in der Antike der am schlechtesten beleumundete, der verrufenste Mensch war) – das passt perfekt.
Doch je mehr ich dieses Wissen über den Anderen vertieft habe, je mehr Seiten ich über dessen tiefgründige Logik geschrieben habe, je mehr ich, indem ich den von René Girard eingeschlagenen Weg weiter verfolgte, meiner Ansicht nach beispielsweise dazu beigetragen habe, zu zeigen, dass die Offenbarungsreligionen – um eine Ihrer Bemerkungen aufzugreifen – in keiner Weise für die Erzeugung von Sündenböcken verantwortlich zu machen sind, sondern im Gegenteil eher dazu beitragen, die Zügellosigkeit dieses Phänomens abzumildern, desto stärker drängt sich mir der Eindruck auf, dass mir mein persönlicher Fall, meine Erfahrungen, die ich als Jugendlicher und Erwachsener gemacht habe, in dieser Angelegenheit keine große Hilfe waren.
Das mag merkwürdig erscheinen, aber es ist so.
Es passt nicht zu der Vorstellung vom verdammten, beschimpften, durch den Dreck gezogenen Schriftsteller, von der wir ursprünglich ausgegangen waren – aber es entspricht der Wahrheit.
Noch ein Letztes.
Sie scheinen mir nicht recht zu glauben, wenn ich Ihnen sage, dass das, was man über mich schreibt, und was ich von Zeit zu Zeit beim teuflischen Google aufstöbere, nur in genau dem Maße für mich von Bedeutung ist, in dem es mir Informationen über den Stand der Dinge, die Disposition des Feindes, seine möglichen Schwächen und die passenden Antworten liefert.
Sie irren.
Denn ich versichere Ihnen, dass es sich auch hierbei genau so verhält.
Sobald ich sie gelesen und die taktischen oder strategischen Rückschlüsse gezogen habe, die sich für mich daraus ergeben, vergesse ich die Artikel dieser Leute.
Sie haben keine Auswirkungen auf meinen Narzissmus.
Mein Ego ist garantiert feuerfest, gepanzert, gegen Angriffe geschützt.
Und es ist mit einer Art Zaubertafel versehen, die dazu führt, dass die gegen es gerichtete Feindseligkeit sich in genau dem Augenblick in Luft auflöst, in dem sie sich über mich ergossen hat, und mir dafür den exakten Standort dessen anzeigt, was Flaubert in einem Brief an Baudelaire als die »Batterien« und »Stellungen« der »Gegenseite« bezeichnete.
Mit anderen Worten, und diesmal haben Sie recht, nichts übertrifft das Vergnügen daran, als Antidot für die beiden korrespondierenden Gifte, die der Wille zu gefallen und der Wille zu missfallen sind, zu wirken und sie zu besiegen.
Nichts übertrifft den Kriegssinn; nicht nur, um ein Werk zu schützen, es heiligzusprechen, sondern um es fortzusetzen und gegen alle Unbilden unbeirrt den Wunsch aufrechtzuerhalten, es abzuschließen.
Voltaires Worte hatte ich vergessen.
Aber ich muss sagen, dass sie mir gefallen, und dass ich mir die von mir bewunderten Schriftsteller gerne genau so vorstelle: mit der Waffe in der Hand leben und sterben … sich nach der Decke strecken, so wie der große Valmont … »Schlachtenmaler«, so wie ich – wenn auch meiner eigenen Schlachten –, oder so wie in dem gleichnamigen Buch von Pérez-Reverte beschrieben, auf das Sie mich hingewiesen haben und das ich wirklich atemraubend finde …
Doch an dieser Stelle mache ich Schluss, lieber Michel.
Denn andernfalls müsste ich jetzt auf die Kriegskunst zu sprechen kommen.
Das heißt auf das Schlachtfeld, das die literarische oder philosophische Bühne genau genommen eigentlich ist.
Oder auf den permanent bewaffneten Zustand, der das Leben eines Schriftstellers ist, wie auch die allergrößten von ihnen sagen.
Zum Beispiel Kafka …
Kafka, der, wie Sie wissen, ein Bewunderer Napoleons war, und der im Zögern des Kaisers in der Schlacht von Borodino oder im Rückzug aus Russland die verborgene Wahrheit der »Kampagnen« und »Manöver« erkannte, die das tägliche Brot seiner Existenz als Schriftsteller waren …
Glauben Sie mir – das spart uns Zeit.
8.Februar 2008
Lieber Bernard-Henri,
nun gut, ich glaube Ihnen. Ihr Brief hat mir zunächst eine Art Schock versetzt, aber ich habe beschlossen, Ihnen zu glauben – was mir durchaus zur Ehre gereicht, denn einem so ausgeprägten Ego wie dem Ihren haftet für mich etwas Geheimnisvolles, ja Anormales an.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!