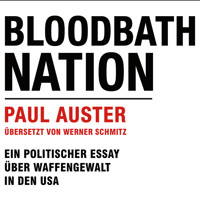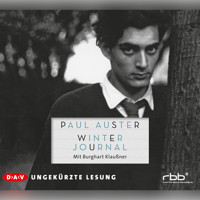7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
«Von der Hand in den Mund» ist ein amüsantes Porträt des Künstlers als hungernder Mann vor dem Hintergrund der bewegten sechziger und siebziger Jahre. Der schnöde Mammon spielt darin die entscheidende Rolle – als Metapher für den Tanz um das Goldene Kalb, als Fessel der Gesellschaft, als schlichtes Überlebensmittel. Auster beschreibt seinen ebenso kompromißlosen wie krummen Werdegang voller Selbstironie, aber auch mit der Sicherheit des gereiften Künstlers, für den der Weg seiner Identitätssuche stets das Ziel war. Und er komplettiert das Lesevergnügen, indem er im Anhang einen Teil seiner frühen Werke erstmals zugänglich macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 648
Ähnliche
Paul Auster
Von der Hand in den Mund
Eine Chronik früher Fehlschläge
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
Rowohlt E-Book
Inhaltsübersicht
Von der Hand in den Mund
Mit Ende zwanzig, Anfang dreißig durchlebte ich mehrere Jahre, in denen mir alles, was ich anfing, zum Fehlschlag geriet. Meine Ehe wurde geschieden, meine Arbeit als Schriftsteller geriet ins Stocken, und meine finanzielle Lage war erdrückend. Ich rede hier nicht von einem gelegentlichen Minus oder gewissen vorübergehenden Engpässen, sondern von einem ständigen, gravierenden, geradezu erstickenden Geldmangel, der mir die Seele vergiftete und mich in immerwährender Panik hielt.
Schuld daran konnte ich nur mir selbst geben. Mein Verhältnis zum Geld war schon immer schlecht gewesen, rätselhaft und voller Widersprüche, und jetzt zahlte ich den Preis für meine Weigerung, diesbezüglich einen klaren Standpunkt zu beziehen. Ich hatte immer nur schreiben wollen. Das hatte ich schon als Sechzehn-, Siebzehnjähriger gewusst, mich aber nie der trügerischen Hoffnung hingegeben, dass ich davon würde leben können. Schriftsteller werden, das ist keine «Karriereentscheidung» wie die, Arzt oder Polizist zu werden. Man sucht sich das nicht aus, eher wird man ausgesucht, und hat man erst einmal akzeptiert, dass man zu gar nichts anderem taugt, muss man bereit sein, für den Rest seiner Tage einen langen, harten Weg zu gehen. Entpuppt man sich nicht zufällig als Liebling der Götter (und wehe dem, der sich darauf verlässt), bringt die Arbeit nie genug zum Leben ein, und wer ein Dach überm Kopf haben und nicht verhungern will, muss sich damit abfinden, nebenher andere Arbeiten zu übernehmen, um seine Rechnungen zu bezahlen. Das alles war mir durchaus klar, ich war darauf vorbereitet, ich konnte mich nicht beklagen. So gesehen hatte ich enormes Glück. Nach irgendwelchen materiellen Gütern stand mir nicht der Sinn, und die Aussicht, arm zu sein, schreckte mich nicht. Ich wollte nur eine Chance haben, den Beruf auszuüben, für den ich mich geeignet fühlte.
Die meisten Schriftsteller führen ein Doppelleben. Sie verdienen gutes Geld in richtigen Berufen und verwenden im Übrigen möglichst jede freie Minute zum Schreiben: früh morgens, spät abends, an Wochenenden und im Urlaub. William Carlos Williams und Louis-Ferdinand Céline waren Ärzte. Wallace Stevens arbeitete für eine Versicherungsgesellschaft. T. S. Eliot war zeitweilig Bankangestellter und dann Verleger. In meinem Bekanntenkreis betätigt sich der französische Dichter Jacques Dupin als Kodirektor einer Pariser Kunstgalerie. Der amerikanische Dichter William Bronk führte über vierzig Jahre lang die Geschäfte der Kohle- und Holzhandelsfirma seiner Familie im Bundesstaat New York. Don DeLillo, Peter Carey, Salman Rushdie und Elmore Leonard arbeiteten jahrelang in der Werbebranche. Andere Schriftsteller geben Unterricht. Das ist wahrscheinlich die heutzutage verbreitetste Lösung, und wenn vom letzten Provinzcollege bis zu den größten Universitäten überall sogenannte «creative writing»-Kurse angeboten werden, ist es nicht verwunderlich, dass sich Romanautoren und Dichter unablässig um die Plätze balgen. Wer kann ihnen einen Vorwurf daraus machen? Das Gehalt mag nicht sehr hoch sein, aber die Arbeit ist regelmäßig und nicht sehr zeitaufwendig.
Mein Problem war, dass ich an einem Doppelleben kein Interesse hatte. Nicht dass ich nicht arbeiten wollte, aber die Vorstellung, mich täglich nach einer Stechuhr richten zu müssen, konnte mich ganz und gar nicht begeistern. Ich war Anfang zwanzig, ich fühlte mich zu jung für ein geregeltes Leben und hatte zu viele andere Pläne, als dass ich meine Zeit damit verschwenden konnte, mehr Geld zu verdienen, als ich haben wollte oder nötig hatte. Was das Geld anging, wollte ich einfach gerade so auskommen. Damals war das Leben noch billig, und da ich nur für mich allein zu sorgen hatte, glaubte ich mit einem jährlichen Einkommen von etwa dreitausend Dollar über die Runden kommen zu können.
Ein Jahr lang studierte ich auf den Magister hin, aber nur weil die Columbia University mir ein gebührenfreies Studium inklusive eines Stipendiums in Höhe von zweitausend Dollar angeboten hatte: im Grunde wurde ich also fürs Studieren bezahlt. Selbst unter derart idealen Bedingungen erkannte ich bald, dass ich damit nichts zu tun haben wollte. Ich hatte genug von der Schule, und die Aussicht, weitere fünf oder sechs Jahre als Student zu verbringen, schien mir schlimmer als der Tod. Ich wollte nicht mehr über Bücher debattieren, ich wollte selbst welche schreiben. Schon aus Prinzip hielt ich es für falsch, dass Schriftsteller sich in Universitäten verkrochen und in Gesellschaft allzu vieler Gleichgesinnter Gefahr liefen, in Bequemlichkeit und Selbstzufriedenheit zu erstarren. Dieses Risiko war mir zu groß, denn wer als Schriftsteller selbstzufrieden wird, hat praktisch ausgespielt.
Ich habe nicht vor, meine Entscheidungen zu rechtfertigen. Wenn sie unsachlich waren, dann eben deshalb, weil ich nicht sachlich sein wollte. Was ich wollte, waren neue Erfahrungen. Ich wollte in die Welt hinausziehen und mich erproben, alles Mögliche versuchen, möglichst viel erkunden. Solange ich die Augen offenhielt, stellte ich mir vor, würde alles, was sich begab, nützlich sein und mich Dinge lehren, die ich noch nicht wusste. Das mag sich ziemlich altmodisch anhören, und das war es wohl auch. Junger Schriftsteller nimmt Abschied von Familie und Freunden und bricht zu unbekannten Zielen auf, um herauszufinden, was für ein Mensch er ist. So oder so, ich glaube kaum, dass irgendeine andere Entscheidung mich zufrieden gestellt hätte. Ich hatte jede Menge Ideen, ich war voller Energie und Tatendrang. Die Welt hatte so viel zu bieten, und ich dachte gar nicht daran, auf Nummer sicher zu gehen.
Es fällt mir nicht schwer, diese Vorgänge zu beschreiben und mich daran zu erinnern, wie ich darüber gedacht habe. Die Schwierigkeiten fangen erst an, wenn ich mich frage, warum ich das alles getan und warum ich so und nicht anders gedacht habe. Alle anderen jungen Dichter und Schriftsteller, mit denen zusammen ich studierte, trafen vernünftige Zukunftsentscheidungen. Keiner von uns war reich, keiner konnte sich auf milde Gaben seiner Eltern verlassen, und mit dem Abgang vom College waren wir auf uns selbst gestellt. Wir standen alle vor derselben Situation, wir wussten alle genau Bescheid, und dennoch handelten sie so und ich anders. Dafür habe ich immer noch keine Erklärung. Warum handelten meine Freunde so klug, und warum war ich so leichtsinnig?
Ich stamme aus einer gutbürgerlichen Familie. Meine Kindheit war unbeschwert, und nie habe ich die Sorgen und Nöte erlebt, von denen die meisten Menschen auf dieser Erde geplagt werden. Ich habe niemals Hunger gelitten, ich habe nie gefroren, ich habe nie befürchten müssen, irgendetwas zu verlieren. Sicherheit war etwas Selbstverständliches, und dennoch, bei allem Glück und aller Geborgenheit, drehten sich die Gespräche bei uns zu Hause unablässig um Geld und Geldsorgen. Meine Eltern hatten die Weltwirtschaftskrise miterlebt und sich von diesen schlimmen Zeiten nie so richtig erholen können. Beide waren geprägt von der Erfahrung, nicht genug zum Leben zu haben, und beide hatten, jeder auf seine Weise, zeitlebens daran zu tragen.
Mein Vater war geizig, meine Mutter verschwenderisch. Sie gab Geld aus, er nicht. Die Erinnerung an die einmal erlebte Armut ließ ihn einfach nicht los, und mochten sich auch die Umstände geändert haben, er brachte es nie so recht fertig, darauf zu vertrauen. Sie hingegen fand an diesen neuen Umständen große Freude. Sie genoss die Rituale des Konsums, und wie so viele Amerikaner vor ihr und nach ihr pflegte sie das Einkaufen als Mittel der Selbstdarstellung und machte es manchmal geradezu zu einer Kunstform. Ein Geschäft betreten, das bedeutete, sich auf einen alchimistischen Prozess einzulassen, der der Ladenkasse magische, transformative Kräfte verlieh. Undeutliche Wünsche, unbestimmbare Bedürfnisse und unausgesprochene Sehnsüchte zogen in unablässigem Strom durch ihren Geldschub und kamen als reale Dinge wieder zum Vorschein, als greifbare Gegenstände, die man in der Hand halten konnte. Meine Mutter wurde es niemals müde, dieses Wunder in Szene zu setzen, und die daraus resultierenden Rechnungen boten ihr und meinem Vater immer wieder Anlass zum Streit. Sie fand, wir könnten uns das leisten, er nicht. Zwei Lebensstile, zwei Weltanschauungen, zwei Moralphilosophien lagen in ständigem Wettstreit miteinander, und schließlich ist ihre Ehe daran gescheitert. Geld war die Bruchstelle, es wurde zum einzigen, aber unüberwindlichen Zankapfel zwischen ihnen. Um so trauriger, dass sie beide gute Menschen waren – höflich, ehrlich, fleißig – und dass sie, abgesehen von diesem einen scharfen Interessenkonflikt, ziemlich gut miteinander auszukommen schienen. Ich konnte beim besten Willen nicht verstehen, wie ein relativ unwichtiges Thema wie dieses so viel böses Blut machen konnte. Aber freilich ist Geld niemals nur Geld. Es ist immer auch etwas anderes, es ist immer etwas mehr, und es hat immer das letzte Wort.
Als kleiner Junge wurde ich mitten in diesen ideologischen Krieg hineingezogen. Wenn meine Mutter mit mir Kleider einkaufen ging, mich im Strudel ihrer Begeisterung und Großzügigkeit mit sich fortriss, ließ ich mich immer wieder überreden, die Dinge, die sie mir anbot, auch haben zu wollen – stets mehr, als ich erwartet hatte, stets mehr, als ich zu brauchen glaubte. Es war unmöglich, dem zu widerstehen, unmöglich, es nicht zu genießen, wie die Verkäufer sie umschwärmten und sich von ihr kommandieren ließen, unmöglich, sich von ihrem energischen Auftreten nicht mitreißen zu lassen. Doch mengte sich stets eine starke Prise Angst in mein Glück, denn ich wusste genau, was mein Vater sagen würde, wenn er die Rechnung bekäme. Und er sagte es tatsächlich immer. Der unvermeidliche Ausbruch kam jedes Mal, und fast ebenso unvermeidlich ging die Sache jedes Mal so aus, dass mein Vater erklärte, wenn ich wieder einmal etwas brauche, werde er selbst mit mir einkaufen gehen. Und als es dann wieder so weit war und ich eine neue Winterjacke oder neue Schuhe brauchte, fuhren mein Vater und ich eines Abends nach dem Essen zu einem Discountladen, der irgendwo am Highway in der Finsternis von New Jersey lag. Ich erinnere mich an die grellen Neonlichter, die Betonwände, die endlosen Ständer mit billiger Herrenkleidung: Es war wie in der Radioreklame jener Tage: «Bei Robert Hall, wie fabelhaft/Gibt’s Sonderpreise massenhaft.» Genau genommen gehört ein Vers wie dieser ebenso zu meiner Kindheit wie das Treuegelöbnis oder das Vaterunser.
Hand aufs Herz, ich habe diese Schnäppchenjagden mit meinem Vater genauso genossen wie die von meiner Mutter inszenierten Kauforgien. Meine Loyalität war zu gleichen Teilen auf meine Eltern verteilt, und die Frage, in welchem der beiden Lager ich mein Zelt aufschlagen sollte, hat sich mir nie gestellt. Die Art und Weise meiner Mutter war vielleicht reizvoller oder jedenfalls mit mehr Spaß und Aufregung verbunden; aber die Sturheit meines Vaters hatte etwas, das mich kaum weniger faszinierte, diese Aura von hart erworbener Erfahrung und Wissen, die seinen Überzeugungen zugrunde lag, dieses rechtschaffene Streben, das ihn zu einem Menschen machte, der niemals nachgab, nicht einmal auf die Gefahr hin, in der Öffentlichkeit einen schlechten Eindruck zu machen. Ich fand das bewundernswert, und sosehr ich meine schöne, unendlich charmante Mutter dafür verehrte, wie sie die Welt zu beeindrucken verstand, sosehr verehrte ich auch meinen Vater, weil er sich eben dieser Welt widersetzte. Es war zum Verrücktwerden, ihn in Aktion zu sehen – einen Mann, der sich nie darum zu kümmern schien, was die anderen von ihm dachten –, aber es war auch lehrreich, und auf die Dauer habe ich diesen Lektionen wohl mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als mir damals selbst bewusst gewesen ist.
Als kleiner Junge war ich ein klassischer Hansdampf. Bei der ersten Schneeflocke rannte ich mit meiner Schippe nach draußen und fragte bei den Nachbarn an, ob ich ihnen die Einfahrten und Gartenwege freischaufeln dürfe. Wenn im Oktober das Laub fiel, zog ich mit meinem Rechen los und fragte dieselben Nachbarn, ob ich ihnen den Rasen harken dürfe. Und wenn es mal nichts vom Boden zu entfernen gab, ging ich herum und bewarb mich um «Gelegenheitsjobs». Garagen aufräumen, Keller entrümpeln, Hecken schneiden – was auch immer zu tun war, ich war der Mann dafür. Im Sommer verkaufte ich auf dem Bürgersteig vor unserem Haus Limonade, das Glas zu zehn Cent. Ich holte leere Flaschen aus der Vorratskammer, lud sie in mein rotes Wägelchen, zog damit zum Kaufmann und machte sie zu Bargeld. Zwei Cent für die kleinen, fünf Cent für die großen. Meine Einkünfte verwandte ich hauptsächlich für den Kauf von Baseballbildern, Sportzeitschriften und Comics, und was übrig blieb, steckte ich gewissenhaft in mein Sparschwein, das kein Schwein war, sondern eine kleine Ladenkasse. Ich war wirklich das Kind meiner Eltern, und nie habe ich die Grundsätze, von denen sie sich leiten ließen, in Frage gestellt. Geld regiert die Welt, und in dem Maße, in dem man sich nach ihm richtete und ihm folgte, fand man sich in der Welt zurecht.
Einmal war ich im Besitz eines Fünfzigcentstücks. Wie ich daran gekommen bin, habe ich vergessen – es war damals schon so selten wie heute –, aber ob ich es nun geschenkt bekommen oder ob ich es mir verdient habe, fest steht, dass ich noch genau weiß, wie viel es mir bedeutete und was für ein riesiger Betrag das für mich war. Für fünfzig Cent konnte man damals zehn Päckchen Baseballbilder kaufen, fünf Comic-Hefte, zehn Schokoriegel, fünfzig Lutschbonbons – oder, wenn man wollte, verschiedene Kombinationen dieser Dinge. Ich schob den halben Dollar in die Gesäßtasche, marschierte zum Laden und überlegte fieberhaft, wie ich mein kleines Vermögen anlegen sollte. Irgendwo unterwegs jedoch, aus Gründen, die ich noch heute nicht verstehe, ist die Münze verschwunden. Ich tastete in der Tasche danach – ich wusste ja, dass sie da war, und wollte mich nur noch einmal vergewissern –, und da war das Geld weg. Hatte ich ein Loch in der Tasche? War mir die Münze aus der Hose gerutscht, als ich das letzte Mal danach gefühlt hatte? Ich weiß es nicht. Ich war sechs oder sieben Jahre alt, und ich erinnere mich noch heute, wie elend mir zumute war. Ich hatte versucht aufzupassen, das Geld aber trotz aller Vorsicht verloren. Wie hatte ich so etwas zulassen können? Mangels einer logischen Erklärung kam ich zu dem Schluss, dass Gott mich bestraft hatte. Warum, wusste ich nicht, aber ich war mir sicher, dass der Allmächtige mir in die Tasche gegriffen und die Münze herausstibitzt hatte.
Nach und nach begann ich mich von meinen Eltern zu lösen. Nicht dass meine Liebe zu ihnen nachließ, es war nur so, dass die Welt, aus der sie kamen, mir immer weniger verlockend zu sein schien. Schon mit zehn, elf, zwölf Jahren ging ich in die innere Emigration und empfand das Haus meiner Eltern wie ein Exil. Die Pubertät, die schlichte Tatsache, dass ich älter wurde und eigene Gedanken entwickelte, mag viele dieser Veränderungen erklären – aber nicht alle. Auch andere Kräfte wirkten zu dieser Zeit auf mich ein, und jede trug dazu bei, mich auf den Weg zu bringen, den ich später einschlagen sollte. Es war nicht nur der Schmerz, das Zerbröckeln der Ehe meiner Eltern mitansehen zu müssen, und es war nicht nur die Unzufriedenheit, in einer kleinen Vorstadt gefangen zu sein, und es war nicht nur das Klima im Amerika der späten fünfziger Jahre – doch all das zusammen ergab ein überzeugendes Argument gegen den Materialismus, eine vernichtende Kritik an der orthodoxen Ansicht, dass Geld ein Gut sei, das man über alles zu schätzen habe. Meine Eltern schätzten das Geld sehr, und wohin hatte es sie gebracht? Sie hatten so danach gestrebt, hatten so viel Glauben darin investiert, und doch war für jedes Problem, das es gelöst hatte, ein neues aufgetaucht. Der amerikanische Kapitalismus hatte eine der blühendsten Epochen der Menschheitsgeschichte herbeigeführt. Er hatte unzählige Autos, Tiefkühlgemüse und Wundershampoos produziert, und dennoch hatte sich das Land unter Eisenhowers Präsidentschaft in eine einzige gigantische Fernsehreklame verwandelt, die uns unaufhörlich zuposaunte: Kauft mehr, verdient mehr, verprasst mehr und tanzt im Reigen um den Dollarbaum, bis ihr alle tot umfallt im Taumel der Raserei, mit den anderen mithalten zu müssen.
Schon bald kam ich dahinter, dass ich nicht der Einzige war, der so dachte. Mit zehn stieß ich in einem Süßwarenladen in Irvington, New Jersey, auf die Zeitschrift Mad, und ich erinnere mich noch an das intensive, schier umwerfende Vergnügen, das ich beim Lesen dieser Seiten empfand. Hier sagte mir jemand, dass ich mit meinen Ansichten nicht allein auf der Welt war, dass andere Menschen die Türen, die ich noch zu öffnen versuchte, bereits aufgeschlossen hatten. Im Süden der USA wurden Feuerwehrschläuche auf Schwarze gerichtet, die Russen hatten den ersten Sputnik hochgeschossen, und ich begann genauer hinzusehen. Nein, man musste das Dogma nicht schlucken, das sie einem einzutrichtern versuchten. Man konnte ihnen Widerstand leisten, sich über sie lustig machen, man konnte sie zwingen, Farbe zu bekennen. Die Unverwüstlichkeit, die fade Rechtschaffenheit des amerikanischen Lebens war nichts als ein Schwindel, ein halbherziger Reklametrick. Sobald man sich mit den Tatsachen beschäftigte, kamen überall Widersprüche und Heucheleien zum Vorschein, und plötzlich war die Möglichkeit da, die Dinge von einer ganz anderen Warte aus zu betrachten. Man hatte uns beigebracht, an «Freiheit und Gerechtigkeit für alle» zu glauben; tatsächlich aber standen diese Freiheit und Gerechtigkeit allzu oft in Widerstreit miteinander. Die Jagd nach dem Geld hatte mit Anständigkeit nichts zu tun, ihre Triebfeder war der gesellschaftliche Grundsatz: «Jeder ist sich selbst der Nächste.» Als sollte die fundamentale Unmenschlichkeit der Marktwirtschaft damit bewiesen werden, stammten viele ihrer Metaphern aus dem Tierreich: Löwenanteil, Miethai, Bullen und Polypen, das Überleben des Stärkeren. Das Geld teilte die Welt in Gewinner und Verlierer auf, in reich und arm. Eine schöne Sache für die Gewinner – aber was war mit den Verlierern? Soweit ich das mitbekam, wurden sie beiseitegestoßen und vergessen. Sehr bedauerlich, gewiss, aber so war es nun mal. Was kann man auch schon anderes erwarten, wenn man eine Welt konstruiert, die so primitiv ist, dass sie Darwin zu ihrem führenden Philosophen und Äsop zum führenden Dichter macht? Die Welt da draußen ist ein Dschungel, stimmt’s? Sieh dir nur den Löwen der Brokerfirma Dreyfus an, wie er in der Werbung über die Wall Street stolziert. Kann die Botschaft noch deutlicher sein? Fressen oder gefressen werden. Das ist das Gesetz des Dschungels, mein Freund, und wenn dein Magen das nicht aushält, dann steig aus, solange du noch kannst.
Ich war ausgestiegen, bevor ich überhaupt eingestiegen war. Schon mit zehn, elf Jahren stand für mich fest, dass die Welt des Handels und des Wandels ohne mich würde auskommen müssen. Ich muss damals absolut schrecklich, unerträglich und konfus gewesen sein. Feuer und Flamme für meine neuentdeckten Ideale und unerbittlich nach Vollkommenheit strebend, wurde ich zu einem Puritaner im Zwergenformat. Die Äußerlichkeiten des Reichtums stießen mich ab, und wenn meine Eltern irgendetwas ins Haus brachten, das mir nach Angeberei aussah, reagierte ich nur mit Verachtung. Das Leben war nicht fair. Endlich war ich dahintergekommen, und da ich es selbst entdeckt hatte, traf es mich mit der ganzen Wucht einer Offenbarung. Im Lauf der Monate fiel es mir immer schwerer, mein Glück mit dem Unglück so vieler anderer auszusöhnen. Womit hatte ich all diese Bequemlichkeiten und Vorteile verdient, mit denen ich überschüttet wurde? Mein Vater konnte es sich leisten – das war alles –, und ob er und meine Mutter sich um Geld zankten oder nicht, war ziemlich belanglos im Vergleich zu der Tatsache, dass sie überhaupt Geld besaßen, um das sie sich zanken konnten. Ich krümmte mich jedes Mal vor Scham, wenn ich in unser Auto steigen musste – dieses glänzende, kostspielige Vehikel, das aller Welt Respekt vor unserem Wohlstand abnötigen sollte. Mein Mitgefühl galt allein den Unterdrückten, den Enteigneten, den von der Gesellschaft Ausgestoßenen, und für ein Auto wie dieses konnte ich mich nur schämen – nicht bloß meinetwegen, sondern auch, weil die Welt, in der ich lebte, zuließ, dass es so etwas gab.
Meine ersten Jobs zählen nicht. Da ernährten mich noch meine Eltern, und nichts zwang mich, für mich selbst zu sorgen oder etwas zum Etat der Familie beizutragen. Ich stand also nicht unter Druck, und ohne Druck wird nie etwas Bedeutendes geleistet. Ich freute mich über das Geld, das ich verdiente, musste es aber nie für Lebensnotwendiges ausgeben, brauchte mir niemals Sorgen zu machen, ob ich genug zu essen hätte oder mit der Miete in Rückstand geriete. Diese Probleme kamen erst später. Fürs Erste war ich bloß ein Schüler auf der Suche nach Flügeln, die mich von dort, wo ich war, wegtragen sollten.
Mit sechzehn arbeitete ich zwei Monate als Kellner in einem Sommerlager im Norden des Staates New York. Im Sommer darauf arbeitete ich im Haushaltsgeräteladen meines Onkels Moe in Westfield, New Jersey. Die Jobs waren sich insofern ähnlich, als meine Aufgaben im Wesentlichen körperlicher Natur waren und nicht viel Nachdenken erforderten. Tabletts tragen und Töpfe auskratzen war vielleicht nicht ganz so interessant wie Klimaanlagen installieren oder Kühlschränke aus Dreißigtonnern abladen, aber ich möchte dem nicht allzu viel Wert beilegen. Es geht hier nicht um Äpfel und Birnen, sondern um zwei Sorten Äpfel, und beide gleich grün. Doch so langweilig die Arbeit auch war, empfand ich beide Jobs als ungeheuer befriedigend. Ich begegnete dabei zu vielen prächtigen Persönlichkeiten, zu vielen Überraschungen, zu vielen neuen Ideen, die es zu verarbeiten galt, als dass mir die Plackerei hätte missfallen können, und nie hatte ich das Gefühl, dass ich meine Zeit verschwendete, bloß um eine Lohntüte zu bekommen. Natürlich war das Geld wichtig, aber es ging bei der Arbeit nicht nur um Geld, sondern vor allem darum zu erfahren, wer ich war und wie ich in die Welt passte.
Selbst in dem Sommerlager, wo alle meine Arbeitskollegen sechzehn- und siebzehnjährige Schüler waren, kamen die Küchenhilfen aus einem völlig anderen Universum. Menschliche Wracks, Penner aus der Bowery, Männer mit zweifelhaften Lebensläufen, die der Betreiber des Lagers auf den Straßen von New York aufgelesen und überredet hatte, diese schlechtbezahlten Jobs anzunehmen – immerhin zwei Monate an der frischen Luft, dazu freie Kost und Logis. Die meisten blieben nicht lange. Irgendwann verschwanden sie einfach und zogen ohne Abschied in die Stadt zurück. Ein paar Tage später rückte für den Verschwundenen eine andere verlorene Seele nach, die aber auch nur selten lange blieb. Einer dieser Tellerwäscher war Frank, ein verbitterter, griesgrämiger Alkoholiker. Ich weiß nicht mehr wie, aber wir wurden Freunde, und manchmal saßen wir abends nach der Arbeit auf der Treppe hinter der Küche und unterhielten uns. Wie sich herausstellte, war Frank sehr intelligent und belesen. Er hatte als Versicherungsvertreter in Springfield, Massachusetts, gearbeitet und, bis er dem Trinken erlag, das normale Leben eines fleißigen Steuerzahlers geführt. Ich erinnere mich genau, dass ich es nicht wagte, ihn zu fragen, was denn passiert sei, aber eines Abends kam er von selbst darauf zu sprechen und gab mir eine sachliche Kurzfassung der komplizierten Ereignisse, die ihn zugrunde gerichtet hatten. Alle Menschen, die ihm je etwas bedeutet hätten, erzählte er, seien in einem Zeitraum von sechzehn Monaten gestorben. Er berichtete das in gleichmütigem Tonfall, fast als rede er von jemand anderem, aber eine gewisse Verbitterung schwang doch in seiner Stimme mit. Erst seine Eltern, sagte er, dann seine Frau und dann seine zwei Kinder. Krankheiten, Unfälle und Begräbnisse, und als sie alle weg waren, war er innerlich zerbrochen. «Ich habe einfach aufgegeben», sagte er. «Es war mir plötzlich egal, was aus mir wurde, und so bin ich Penner geworden.»
Ein Jahr später lernte ich in Westfield einige weitere unvergessliche Gestalten kennen. Zum Beispiel Carmen, eine gutgepolsterte, ständig witzelnde Buchhalterin, bis zum heutigen Tag die einzige bärtige Frau, die ich kenne (sie musste sich richtiggehend rasieren), und Joe Mansfield, der Kundendienstmann mit zwei Eingeweidebrüchen und einem altersschwachen Chrysler, dessen Meilenzähler bereits dreimal über Null gelaufen war und jetzt auf 360000 stand. Joe finanzierte zwei Töchtern das Studium und arbeitete zusätzlich zu seinem Job in dem Haushaltsgeräteladen Nacht für Nacht noch einmal acht Stunden als Vorarbeiter in einer Brotfabrik; um neben den riesigen Teigtrögen nicht einzuschlafen, las er Comics. Ein so erschöpfter und gleichzeitig so energiegeladener Mensch wie er ist mir seither nie wieder begegnet. Er lebte praktisch von Mentholzigaretten und täglich circa sechzehn Flaschen Orangenlimonade; dass er sich jemals etwas Essbares in den Mund geschoben hätte, habe ich nicht erlebt. Wenn er mittags etwas essen würde, sagte er, wäre er danach zu müde und bräche zusammen. Die Brüche hatte er sich ein paar Jahre zuvor zugezogen, als er und zwei andere Männer einen übergroßen Kühlschrank eine sehr enge Treppe hinauftragen mussten. Die beiden anderen konnten das Ding nicht mehr festhalten, Joe musste das ganze Gewicht alleine tragen und kämpfte verzweifelt, um nicht von den etlichen hundert Pfund zerquetscht zu werden, und bei diesem Kraftakt wurden ihm die Hoden aus dem Skrotum nach oben gedrückt. Erst ein Ei, sagte er, dann das andere. Plopp … plopp. Jetzt durfte er eigentlich keine schweren Gegenstände mehr tragen, aber jedes Mal, wenn ein besonders großes Gerät auszuliefern war, kam er dazu und half uns, damit wir uns ja nicht damit umbrachten.
Wir, das waren ich und ein neunzehnjähriger Rotschopf namens Mike, ein nervöser, drahtiger Zwerg, dem ein Zeigefinger fehlte; dafür besaß er so ziemlich die flinkeste Zunge, die mir je begegnet ist. Mike und ich waren als Team für die Installation von Klimaanlagen zuständig und verbrachten auf den Fahrten zu und von unseren Einsatzstellen zahllose Stunden im Lieferwagen der Firma. Ich wurde es niemals müde, dem Schwall der verrückten, verblüffenden Metaphern und skandalösen Ansichten zu lauschen, der sich bei jeder Gelegenheit aus seinem Mund ergoss. Zum Beispiel, wenn er einen Kunden pampig fand, sagte er nicht etwa: «Der Kerl ist ein Arschloch» (was das Übliche gewesen wäre), sondern: «Der Kerl führt sich auf wie Graf Rotz von Hohenschnoddern.» Der junge Mike hatte ein besonderes Talent, und mehrmals konnte ich in jenem Sommer beobachten, wie nützlich ihm das war. Wenn wir irgendwo eine Klimaanlage installierten, kam es regelmäßig vor, dass, während wir arbeiteten, Schrauben festzogen, Dichtungsmaterial für die Fenster abmaßen und so weiter, plötzlich ein Mädchen ins Zimmer kam. Es war fast wie ein Naturgesetz. Und immer war das Mädchen siebzehn, immer schön, immer gelangweilt, immer «ganz allein im Haus». Kaum tauchte sie auf, wurde Mike charmant. Es war, als hätte er gewusst, dass sie kommen würde, als hätte er seinen Text schon lange geprobt, als wäre er bestens darauf vorbereitet. Mir hingegen blieb jedes Mal die Spucke weg, und während Mike dann seine Show abzog (eine Mischung aus Schwachsinn, Angeberei und Dreistigkeiten), plagte ich mich weiter stumm und dumm mit der Arbeit ab. Mike redete, und das Mädchen schmunzelte. Mike redete ein wenig mehr, und das Mädchen lachte. Binnen zwei Minuten waren sie alte Freunde, und während ich noch mit den abschließenden Arbeiten beschäftigt war, tauschten sie schon Telefonnummern aus und verabredeten sich für Samstagabend. Es war grotesk; es war grandios; es machte mich sprachlos. Wäre das nur ein- oder zweimal passiert, hätte ich es als pure Glückstreffer abtun können, aber diese Szene spielte sich immer wieder ab, mindestens fünf- oder sechsmal allein in diesem einen Sommer. Am Ende musste ich widerwillig zugeben, dass Mike mehr als nur ein Glückspilz war. Er war jemand, der sich selbst zu seinem Glück verhalf.
Im September begann mein letztes Jahr an der Highschool. Es war auch das letzte Jahr, das ich zu Hause verbrachte, und es war das Jahr, in dem die Ehe meiner Eltern geschieden wurde. Die Trennung hatte sich so lange angekündigt, dass ich, als man mir am Ende der Weihnachtsferien die Sache eröffnete, eher erleichtert als bestürzt reagierte.
Die beiden hatten von Anfang an nicht zueinander gepasst. Nur «wegen der Kinder», nicht ihrer selbst wegen hatten sie es überhaupt so lange zusammen ausgehalten. Ich maße mir nicht an, irgendwelche Antworten parat zu haben, vermute aber, dass eine der wesentlichen Ursachen für die Trennung die gewesen war, dass zwei oder drei Jahre zuvor mein Vater die Lebensmitteleinkäufe für den Haushalt übernommen hatte. Das war der letzte große Kampf ums Geld, den meine Eltern ausgetragen haben, und für mich ist das der symbolische letzte Tropfen, der das Fass dann endgültig zum Überlaufen gebracht hat. Es stimmte natürlich, dass meine Mutter es liebte, ihren Einkaufswagen so hoch zu beladen, dass sie ihn kaum noch schieben konnte; es stimmte, dass es ihr Spaß machte, die schönen Sachen zu kaufen, um die meine Schwester und ich sie baten; es stimmte, dass wir zu Hause gut aßen und die Vorratskammer stets reichlich gefüllt war. Es stimmte aber auch, dass wir uns all das leisten konnten und dass die Beträge, die meine Mutter an der Kasse zahlte, die finanziellen Ressourcen unserer Familie keineswegs gefährdeten. Nach Ansicht meines Vaters jedoch schaufelte sie das Geld unkontrolliert zum Fenster hinaus. Dass er schließlich einschritt, war ein Fehler; so etwas sollte ein Mann seiner Frau nicht antun. Er nahm ihr praktisch ihre Aufgabe. Von da an war er dafür verantwortlich, dass etwas zu essen ins Haus kam. Einmal, zweimal, dreimal die Woche hielt er (als ob er nicht schon genug am Hals gehabt hätte) irgendwo auf dem Heimweg von der Arbeit an und belud die Ladefläche seines Kombiwagens mit Lebensmitteln. Die zarten Schnitzel, die meine Mutter nach Hause zu bringen pflegte, wurden durch billigeren Schulterbraten ersetzt, Markenware durch No-Name-Produkte. Zwischenmahlzeiten wurden gestrichen. An Klagen meiner Mutter erinnere ich mich nicht, aber es muss schon eine furchtbare Niederlage für sie gewesen sein. Sie hatte in ihrem eigenen Haus nichts mehr zu sagen, und dass sie nicht protestierte, dass sie sich nicht wehrte, kann nur bedeutet haben, dass sie ihre Ehe bereits aufgegeben hatte. Als das Ende dann kam, spielten sich keine Dramen ab, es gab weder lautstarke Auseinandersetzungen noch zu späte Reuebekundungen. Die Familie ging in aller Stille auseinander. Meine Mutter zog in eine Wohnung im Newarker Stadtteil Weequahic (meine Schwester und mich nahm sie mit), mein Vater blieb allein in dem großen Haus zurück und lebte dort bis zu seinem Tod.
Es mag abartig scheinen, aber ich war über diesen Ausgang sehr glücklich. Froh, dass endlich die Wahrheit an den Tag gekommen war, begrüßte ich die Umwälzungen und Veränderungen, die diese Wahrheit nach sich zog. Das Ganze hatte etwas Befreiendes, ich empfand ein Hochgefühl bei dem Gedanken, dass nun endlich reiner Tisch gemacht war. Ein Abschnitt meines Lebens war zu Ende gegangen, und wenn auch mein Körper mechanisch weiter zur Highschool ging und meiner Mutter beim Umzug half, hatte mein Geist schon das Weite gesucht. Ich war nicht nur dabei, von zu Hause wegzugehen – das Zuhause selbst hatte sich aus dem Staub gemacht. Es gab nichts mehr, wohin ich zurückkehren konnte, kein Ziel mehr als die weite Welt.
Als die Highschool geschafft war, ging ich nicht einmal zur Abschlussfeier. Ich erwähne das zum Beweis dessen, wie wenig mir an alldem lag. Während meine Klassenkameraden in Talar und Hut ihre Abgangszeugnisse in Empfang nahmen, befand ich mich bereits auf der anderen Seite des Atlantiks. Ich hatte die Überfahrt auf einem Schiff gebucht, das Anfang Juni von New York aus in See stach, und die Schule hatte mir den vorzeitigen Abgang ausdrücklich gestattet. Meine gesamten Ersparnisse gingen in diese Reise. Das Geld, das ich zum Geburtstag, zum Schulabschluss, zur Bar-Mizwa bekommen hatte, die Kleinigkeiten, die ich von meinen Sommerjobs gehortet hatte – insgesamt etwa fünfzehnhundert Dollar, den genauen Betrag weiß ich nicht mehr. Damals reiste man mit dem Handbuch «Europa für fünf Dollar am Tag», und wer sein Geld sorgfältig zusammenhielt, konnte damit tatsächlich auskommen. In Paris wohnte ich über einen Monat lang in einem Hotel, wo die Übernachtung sieben Franc ($ 1.40) kostete; ich reiste nach Italien, Spanien und Irland. In zweieinhalb Monaten nahm ich über zwanzig Pfund ab. Während der ganzen Zeit schrieb ich an dem Roman, den ich im Frühjahr angefangen hatte. Zum Glück ist das Manuskript nicht mehr auffindbar, aber in jenem Sommer war die Geschichte, die ich in meinem Kopf herumtrug, für mich nicht weniger real als die Orte, die ich besuchte, und die Menschen, die meinen Weg kreuzten. Ich habe, vor allem in Paris, einige außerordentliche Menschen kennengelernt, aber die meiste Zeit war ich allein, manchmal sogar sehr allein, so allein, dass ich Stimmen im Kopf hörte. Weiß der Himmel, was von diesem Achtzehnjährigen zu halten war. Ich sehe mich selbst als Rätsel, als Schauplatz unerklärlicher Tumulte, als schwereloses Wesen mit wildem Blick, ein wenig übergeschnappt vielleicht, anfällig für Ausbrüche von Verzweiflung und Verzückung, jähe Kehrtwendungen, himmelstürmende Gedanken. Wenn jemand die richtigen Worte für mich fand, konnte ich offen, charmant und durchaus gesellig sein. Sonst aber war ich zugeknöpft und wortkarg, kaum anwesend. Ich glaubte an mich selbst, besaß aber kein Selbstvertrauen. Ich war verwegen und zaghaft, leichtfüßig und unbeholfen, zielstrebig und impulsiv – ein wandelndes Denkmal des Widerspruchs. Mein Leben hatte eben erst begonnen, und schon bewegte ich mich in zwei Richtungen zugleich. Damals wusste ich es noch nicht, aber ich hatte doppelt so hart zu arbeiten wie jeder andere, wenn ich irgendwohin kommen wollte.
Die letzten zwei Wochen der Reise waren die seltsamsten. James Joyce und Ulysses zogen mich nach Dublin. Ich hatte dort nichts Bestimmtes vor, wollte einfach nur in dieser Stadt sein und dachte, das Übrige werde sich schon von selbst ergeben. Das Touristenbüro schickte mich zu einem Bed-and-Breakfast in Donnybrook, fünfzehn Busminuten vom Stadtzentrum entfernt. Abgesehen von dem älteren Ehepaar, das die Pension führte, und zwei oder drei Gästen, habe ich in der ganzen Zeit praktisch mit keinem Menschen gesprochen. Ich habe nicht einmal den Mut aufgebracht, einen Pub zu betreten. Irgendwann im Lauf der Reise war mir ein Zehennagel eingewachsen, und wenn sich das heute vielleicht auch komisch anhört, fand ich es damals ganz und gar nicht zum Lachen. Mein großer Zeh fühlte sich an, als ob eine Messerspitze darin steckte. Das Gehen war eine einzige Qual, und dennoch tat ich von morgens bis abends nichts anderes, als in meinen zu engen und längst durchgelaufenen Schuhen durch Dublin zu humpeln. Dass ich mit dem Schmerz leben konnte, fand ich bald heraus, aber die Anstrengung, die mich das kostete, trieb mich nur noch weiter in mich selbst hinein und machte mich als geselliges Wesen vollends unbrauchbar. In der Pension hatte ein bärbeißiger amerikanischer Sonderling seinen festen Wohnsitz – ein siebzigjähriger Ruheständler aus Illinois oder Indiana –, der mir, sobald er von meinem Zustand erfuhr, endlose Geschichten von seiner Mutter erzählte, die sich jahrelang nicht richtig um ihren eingewachsenen Zehennagel gekümmert hatte, nur diverses Zeug aus der Hausapotheke – Desinfektionsmittel, Wattebäusche – angewendet, aber den Stier nicht bei den Hörnern gepackt hatte, und siehe da, schließlich hatte sie Zehenkrebs, der sich im ganzen Fuß und von dort ins Bein und weiter nach oben ausbreitete, bis sie am Ende daran starb. Er erging sich mit Wonne in den grauenhaften Details ihres Ablebens (selbstverständlich nur zu meinem Besten), und als er merkte, wie empfänglich ich für seine Darstellungen war, tischte er mir das Ganze immer wieder von neuem auf. Und ich will nicht bestreiten, dass er mir Angst eingejagt hat. Das lästige Ärgernis war zu einer lebensgefährlichen Krankheit geworden, und je länger ich es aufschob, etwas dagegen zu unternehmen, desto schlechter wurden meine Aussichten. Jedes Mal, wenn ich auf dem Weg in die Stadt an der Klinik für die unheilbar Kranken vorbeifuhr, wandte ich den Blick ab. Die Worte des alten Mannes ließen mich einfach nicht mehr los. Mein Untergang war nahe, und überall sah ich Hinweise auf meinen baldigen Tod.
Auf einigen meiner Streifzüge begleitete mich eine sechsundzwanzig Jahre alte Krankenschwester aus Toronto. Sie hieß Pat Gray und war am selben Abend wie ich in die Pension gekommen. Ich hatte mich Hals über Kopf in sie verliebt, aber die Sache war aussichtslos, von Anfang an verloren. Nicht nur war ich zu jung für sie und viel zu schüchtern, ihr meine Gefühle zu offenbaren, sondern sie selbst war in jemand anderen verliebt – in einen Iren natürlich, und nur seinetwegen war sie überhaupt nach Dublin gekommen. Eines Abends kam sie spät von einem Stelldichein mit ihrem Geliebten zurück. Es war schon halb eins, aber ich war noch auf und schrieb an meinem Roman; als sie unter meiner Tür noch Licht sah, klopfte sie an und fragte, ob sie reinkommen dürfe. Ich war bereits im Bett, hatte ein Notizbuch auf den Knien und kritzelte vor mich hin; die Wangen vom Trinken gerötet, übersprudelnd vor guter Laune, lachte sie bei meinem Anblick laut auf. Und ehe ich etwas sagen konnte, schlang sie mir die Arme um den Hals und küsste mich, und ich dachte, Wunder über Wunder, mein Traum wird wahr. Doch es war leider nur ein Fehlalarm. Ich hatte nicht einmal die Chance, ihr meinerseits einen Kuss zu geben, so schnell ließ sie mich wieder los, um zu erzählen, dass ihr Ire an diesem Abend um ihre Hand angehalten habe und sie das glücklichste Mädchen auf der ganzen Welt sei. Es war unmöglich, sich nicht mit ihr zu freuen. Diese unkomplizierte, hübsche junge Frau mit ihren kurzen Haaren und unschuldigen Augen und der ehrlichen kanadischen Stimme hatte mich als denjenigen auserwählt, dem sie die Neuigkeit mitteilen wollte. Ich gratulierte ihr nach Kräften und versuchte meine Enttäuschung nach diesem kurzen, vollkommen unbegründeten Aufflackern von Erwartung zu verbergen, aber der Kuss hatte mich geschafft, war mir buchstäblich in die Knochen gegangen, und ich musste sehr an mich halten, um keinen schweren Fehler zu begehen. Ich konnte die Fassung nur bewahren, indem ich mich wie ein Klotz verhielt. Ein Klotz hat zweifellos gute Manieren, ist aber kaum der richtige Gefährte für eine Feier.
Ansonsten gab es nur Einsamkeit, Schweigen, das Gehen. Ich las Bücher im Phoenix Park, besuchte Joyce’ Martello Tower an der Küste und überquerte unzählige Male die Liffey. Zu der Zeit brachen zu Hause die Unruhen in Watts aus, und ich erinnere mich an die Schlagzeilen an einem Kiosk in der O’Connell Street; ich erinnere mich aber auch an ein kleines Mädchen, das eines Abends, als die Leute von der Arbeit nach Hause schlurften, mit einer Kapelle der Heilsarmee sang – irgendein trauriges, wehmütiges Lied über das Elend der Menschen und die Wundertaten Gottes –, und diese Stimme höre ich noch heute, so hell und rein, dass sie den gröbsten Klotz zum Weinen bringen könnte, und das Bemerkenswerte daran war, dass kein Mensch ihr die geringste Aufmerksamkeit schenkte. Die Menge schob sich an ihr vorbei, und sie stand im unheimlichen Dämmerlicht des Nordens einfach an der Ecke und sang, die anderen ebenso wenig beachtend wie diese sie, ein Vögelchen in zerrissenen Kleidern, das seinen Psalm all denen zwitscherte, die gebrochenen Herzens waren.
Dublin ist keine große Stadt, und ich brauchte nicht lange, mich darin zurechtzufinden. Meine Spaziergänge hatten etwas Zwanghaftes, ich folgte einem unersättlichen Drang, umherzustreifen und wie ein Gespenst unter Fremden umzugehen, und nach zwei Wochen waren mir die Straßen vollkommen vertraut und zur Landkarte meines Innenlebens geworden. Noch Jahre später fand ich mich, wenn ich vor dem Einschlafen die Augen schloss, jedes Mal in Dublin wieder. Wenn der Tag langsam von mir abfiel und ich im Halbbewussten versank, war ich plötzlich wieder dort und wanderte durch Dublins Straßen. Ich kann mir das nicht erklären. Irgendetwas Wichtiges muss dort mit mir geschehen sein, aber was genau das war, habe ich niemals herausgefunden. Es muss etwas Schreckliches gewesen sein, eine lähmende Begegnung mit meinen eigenen Abgründen, als ob ich in der Einsamkeit jener Tage in die Finsternis geblickt und mich zum ersten Mal selbst gesehen hätte.
Im September kam ich aufs Columbia College, und in den nächsten vier Jahren war Geld das Letzte, woran ich dachte. Zwischendurch hatte ich verschiedene Jobs, doch ging es in diesen Jahren nicht ums Plänemachen und schon gar nicht um Vorsorge für meine finanzielle Zukunft. Es ging um Bücher, um den Krieg in Vietnam, um das Ringen darum, wie ich das, was mir vorschwebte, verwirklichen konnte. Wenn ich überhaupt daran dachte, Geld zum Leben zu verdienen, dann nur sporadisch und ins Blaue hinein. Bestenfalls malte ich mir ein Dasein am Rande der Gesellschaft aus – als Schnorrer und hungernder Poet, der am Außenrand der Alltagswelt sein Leben fristete.
Trotzdem waren die Jobs meiner Studentenzeit lehrreich. Knochenarbeit war mir schon immer lieber gewesen als Büroarbeit, und jetzt lernte ich immerhin, dass diese meine Vorliebe durchaus begründet war. Zum Beispiel wurde ich irgendwann im zweiten Studienjahr von einem Verlag eingestellt, für den ich Texte zu kurzen Lehrfilmen schreiben sollte. Als Kind hatte ich eine Unmenge «audiovisueller Lehrmittel» konsumieren müssen, und nun erinnerte ich mich an die ungeheure Langeweile, die meine Freunde und ich stets dabei empfunden hatten. Gewiss war es jedes Mal schön, aus dem Klassenzimmer zu kommen und zwanzig, dreißig Minuten im Dunkeln sitzen zu dürfen (als ob man im Kino wäre!), aber die plumpen Bilder auf der Leinwand, die monotone Stimme des Kommentators und das gelegentliche «Ping», das den Lehrer aufforderte, auf den Knopf zu drücken und das nächste Bild zu zeigen, wurden uns jedes Mal bald zu viel. Schon nach wenigen Minuten war der ganze Raum von Flüstern und hektischem, halb unterdrücktem Kichern erfüllt. Und dann flogen die ersten Papierkügelchen durch die Luft.
Es widerstrebte mir, eine weitere Generation von Kindern dieser Langeweile auszusetzen, und so nahm ich mir vor, mein Bestes zu tun und etwas Pep in die Sache zu bringen. Am ersten Tag sagte mir der Produzent, ich sollte mir erst einmal einige Filme der Firma ansehen und mich mit dem Schema vertraut machen. Ich nahm mir irgendeinen Film heraus. Er hieß Regierungsarbeit oder Einführung in die Regierungsarbeit oder so ähnlich. Die Spule wurde eingelegt, und dann ließ man mich mit dem Film allein. Schon beim zweiten oder dritten Bild stieß ich auf eine Behauptung, die mich entsetzte. Die alten Griechen hätten das Konzept der Demokratie erfunden, hieß es da, und dazu wurde ein Gemälde gezeigt, das bärtige Männer in Togen zeigte. Das ging ja noch, aber dann (Ping: Schnitt zu einem Gemälde des Capitol-Gebäudes) wurde umgehend erklärt, dass Amerika eine Demokratie sei. Ich stellte den Apparat aus, ging durch den Flur und klopfte an der Bürotür des Produzenten an. «In dem Film ist ein Fehler», sagte ich. «Amerika ist keine Demokratie. Sondern eine Republik. Das ist ein gewaltiger Unterschied.»
Er sah mich an, als hätte ich ihm mitgeteilt, ich sei Stalins Enkel. «Das ist für kleine Kinder», sagte er, «nicht für Studenten. In so einem Film können wir nicht ins Detail gehen.»
«Das ist kein Detail», antwortete ich, «sondern ein erheblicher Unterschied. In einer reinen Demokratie kann jeder bei allem direkt mitbestimmen. Wir hingegen wählen Vertreter, die das für uns tun. Ich sage ja nicht, dass das schlecht ist. Reine Demokratie kann gefährlich sein. Die Rechte von Minderheiten müssen geschützt werden, und eine Republik kann das leisten. So steht es in den Federalist Papers. Die Regierung hat uns vor der Tyrannei der Mehrheit zu schützen. Das sollten Kinder wissen.»
Die Debatte wurde ziemlich hitzig. Ich war entschlossen, ihn zu überzeugen, ihm zu beweisen, dass die Behauptung in dem Film falsch war, aber er wollte es nicht schlucken. Für ihn war ich vom ersten Satz an ein Unruhestifter, und dabei blieb es. Zwanzig Minuten nach Arbeitsbeginn wurde ich gefeuert.
Viel besser war der Job, den ich im Sommer nach dem ersten Studienjahr hatte – als Hilfsgärtner beim Commodore Hotel in den Catskills. Angestellt wurde ich über die Arbeitsvermittlung in Manhattan, ein Amt der Regierung des Staates New York, das dem Bodensatz der Gesellschaft, ungelernten und vom Pech verfolgten Menschen Jobs verschaffte. Anspruchslos und schlecht bezahlt, bot mir die Arbeit immerhin Gelegenheit, aus der Stadt herauszukommen und der Hitze zu entfliehen. Mein Freund Bob Perelman und ich heuerten gemeinsam an, und am nächsten Morgen wurden wir mit einem Bus der Short Line Company nach Monticello, New York, geschickt. Etwas ganz Ähnliches hatte ich drei Jahre zuvor schon einmal erlebt, und unsere Mitpassagiere waren die gleichen Penner und Wracks, mit denen ich damals als Kellner in dem Sommerlager zu tun gehabt hatte. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt auch einer von ihnen war. Das Fahrgeld und die Jobvermittlungsgebühr wurden uns vom ersten Lohn abgezogen, und man musste schon eine gewisse Zeit dabeibleiben, um das Ganze nicht mit Verlust abzuschließen. Manchen gefiel die Arbeit nicht. Sie kündigten nach wenigen Tagen und standen dann mit leeren Händen da – vollkommen pleite, hundert Meilen von zu Hause entfernt und mit dem Gefühl, man habe sie übers Ohr gehauen.
Das Commodore war ein kleines, heruntergekommenes Hotel im Borschtsch-Gürtel. Es war der örtlichen Konkurrenz, dem Concord und dem Grossinger’s, in keiner Hinsicht gewachsen, und eine gewisse wehmütige, nostalgische Stimmung, die Erinnerung an rosigere Zeiten, umgab das ganze Anwesen. Bob und ich langten dort einige Wochen vor Beginn der Sommersaison an und erhielten die Aufgabe, das Gelände für den Besucherstrom im Juli und August in Schuss zu bringen. Wir mähten Wiesen, beschnitten Büsche, lasen Abfall auf, strichen Wände, reparierten Fliegentüren. Als Unterkunft bekamen wir einen kleinen Verschlag zugewiesen, eine baufällige Hütte mit kleinerer Grundfläche als eine Umkleidekabine, deren Wände wir nach und nach mit Gedichten bedeckten – haarsträubende Knittelverse, obszöne Limericks, blumige Vierzeiler –, über die wir uns, unzählige Flaschen Budweiser trinkend, gar nicht schief genug lachen konnten. Das Bier tranken wir, weil es nichts Besseres zu tun gab, aber in Anbetracht des Essens, das uns dort vorgesetzt wurde, war der Hopfensaft durchaus auch ein lebenswichtiges Nahrungsmittel. Da zu der Zeit nur etwa ein Dutzend Arbeiter auf dem Gelände beschäftigt waren, wurden wir, was die Verpflegung betraf, mit dem Billigsten abgespeist. Mittags und abends gab es immer dasselbe: Chung-King-Huhn Chow Mein, direkt aus der Dose. Inzwischen sind dreißig Jahre vergangen, und immer noch würde ich lieber hungern, als auch nur den kleinsten Bissen davon in den Mund zu nehmen.
Nichts von alldem wäre erwähnenswert, hätte ich in jenem Sommer nicht Casey und Teddy kennengelernt, zwei Wartungsmonteure, die dort im Haus beschäftigt waren. Casey und Teddy hatten seit über zehn Jahren zusammen gearbeitet und waren dicke Freunde, ein unzertrennliches Gespann, eine dialektische Einheit. Sie machten alles gemeinsam, zogen von Ort zu Ort und von Job zu Job, als wären sie nicht zwei, sondern nur einer. Sie waren Freunde fürs Leben, ein Herz und eine Seele, fast wie ein altes Ehepaar. Nicht dass sie schwul waren, sexuell hatten sie keinerlei Interesse aneinander – sie waren einfach Freunde. Casey und Teddy waren Prototypen des amerikanischen Wanderarbeiters, moderne Vagabunden, die auf mich wirkten, als seien sie einem Steinbeck-Roman entstiegen, und doch waren die beiden so heiter, so witzig, so oft betrunken, so allzeit gut gelaunt, dass sie schlechthin unwiderstehlich waren. Manchmal erinnerten sie mich an irgendein vergessenes Komikerduo, zwei Clowns aus der Zeit des Vaudeville und der Stummfilme. Der Geist von Laurel und Hardy hatte in ihnen überlebt, aber diese beiden unterlagen nicht den Zwängen des Showgeschäfts. Sie bewegten sich in der Realität, sie gaben ihre Vorstellung auf der Bühne des Lebens.
Casey gab die Stichworte, Teddy lieferte die Witze. Casey war dünn, Teddy war dick. Casey war weiß, Teddy war schwarz. An ihren freien Tagen trampten sie in die Stadt und tranken bis zum Umfallen, und wenn sie dann abends zum Chow Mein zurückkehrten, erschienen sie mit identischen neuen Frisuren oder identischen neuen Hemden. Es ging ihnen darum, ihr ganzes Geld möglichst auf einen Schlag auszugeben – und zwar für dasselbe auszugeben, haargenau und Penny für Penny. An die Hemden kann ich mich besonders deutlich erinnern. Die beiden kriegten sich vor Lachen kaum noch ein, als sie in diesem Zwillingslook auftauchten; sie hielten sich die Bäuche und zeigten immer wieder aufeinander, als hätten sie der Welt einen gewaltigen Streich gespielt. Es waren die grellsten, hässlichsten Hemden, die man sich vorstellen konnte, eine doppelte Beleidigung des guten Geschmacks, und Casey und Teddy platzten schier vor Vergnügen, als sie sie Bob und mir vorführten. Danach schlurfte Teddy in den leeren Tanzsaal im Parterre des Hauptgebäudes, setzte sich ans Klavier und begann sein Portweinkonzert, wie er das nannte. Die nächsten anderthalb Stunden hämmerte er schräge Improvisationen vor sich hin und brachte die Wände des Saals mit seinem besoffenen Geklimper zum Beben. Teddy hatte viele Talente, aber die Musik zählte nicht dazu. Dennoch fühlte er sich pudelwohl, wie er da so im Abendlicht hockte, ein Dadameister, der mit sich und der Welt in Einklang war.
Teddy stammte aus Jamaica, hatte er mir erzählt, und war im Zweiten Weltkrieg zur britischen Marine gegangen. Irgendwann wurde sein Schiff torpediert. Wie viel Zeit bis zu seiner Rettung verging, weiß ich nicht mehr (Minuten? Stunden? Tage?), jedenfalls wurde er schließlich von einem amerikanischen Schiff aufgelesen. Von da an, so behauptete er, sei er bei der amerikanischen Marine gewesen, und nach dem Krieg sei er amerikanischer Staatsbürger geworden. Mir klang die Geschichte ziemlich faul, aber so hat er sie mir erzählt, und wie kam ich dazu, seine Darstellung in Zweifel zu ziehen? Er hatte in den zwanzig Jahren zuvor offenbar alles getan, was ein Mann tun kann, um die komplette Skala menschlicher Betätigungen zu durchlaufen. Vertreter, Straßenkünstler im Greenwich Village, Barkeeper, Säufer. Nichts davon bedeutete ihm etwas. Jede Geschichte, die er erzählte, begleitete er mit seinem dröhnenden Bassgelächter, und dieses Lachen wirkte wie eine ständige Reverenz an seine eigene Lächerlichkeit, wie ein Hinweis darauf, dass er mit seinen Erzählungen einzig den Zweck verfolgte, sich über sich selbst lustig zu machen. Er machte Szenen in aller Öffentlichkeit, benahm sich daneben wie ein aufsässiges Kind und zwang die Leute immerzu, Farbe zu bekennen. Manchmal war es ermüdend, mit ihm zusammen zu sein, aber es war immer wieder bewundernswert, wie er es verstand, für Unruhe zu sorgen. Er schien dabei geradezu wissenschaftlich vorzugehen, so, als führe er ein Experiment durch, als wirble er alles durcheinander, um dann den Anblick zu genießen, der sich ihm bot, wenn der Staub sich wieder legte. Teddy war Anarchist, und weil Ehrgeiz ihm fremd war, weil er nicht haben wollte, was andere Leute haben wollten, brauchte er sich nur an seine eigenen Regeln zu halten.
Ich habe keine Ahnung, wie und wo er Casey kennengelernt hat. Sein Partner war längst keine so auffällige Gestalt wie er; am stärksten ist mir von ihm in Erinnerung geblieben, dass er keinen Geruchs- und Geschmackssinn hatte. Einige Jahre zuvor hatte Casey bei einer Kneipenschlägerei einen Schlag an den Kopf erhalten, und seither war ihm jegliches Geschmacksempfinden abhandengekommen. Die Folge war, dass für ihn alles wie Pappe schmeckte. Wenn er sich die Augen zuhielt, konnte er einem nicht sagen, was er gerade aß. Chow Mein oder Kaviar, Kartoffeln oder Pudding – für ihn war alles gleich. Von dieser Beeinträchtigung abgesehen, war Casey hervorragend in Form, ein vitaler Weltergewichtler, der mit seinem irisch eingefärbten New Yorker Akzent wie ein Slumbewohner wirkte. Sein Part bestand darin, über Teddys Witze zu lachen und dafür zu sorgen, dass sein Freund es nicht zu bunt trieb und man ihn nicht einbuchtete. Eines Abends in jenem Sommer war Teddy nahe daran – er baute sich in einem Restaurant in Monticello auf, schwenkte eine Speisekarte und schrie: «Dieses japanische Hundefutter esse ich nicht!» –, aber Casey beruhigte ihn wieder, und wir alle konnten unsere Mahlzeit zu Ende bringen. Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, dass wir uns keineswegs in einem japanischen Restaurant befanden.
Nach objektiven Maßstäben waren Casey und Teddy Versager, schräge Spinner, aber bei mir haben sie einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen, und nie wieder sind mir Menschen wie sie begegnet. Das war, nehme ich an, mein Motiv dafür, überhaupt an Orten wie dem Commodore Hotel zu arbeiten. Nicht dass ich eine Karriere daraus machen wollte, aber diese kleinen Ausflüge in die Notstandsgebiete und Dreckslöcher dieser Welt schenkten mir jedes Mal eine interessante Erfahrung und erweiterten meinen Horizont auf unerwartete Weise. Dafür sind Casey und Teddy ein perfektes Beispiel. Als ich sie kennenlernte, war ich neunzehn Jahre alt, und noch heute zehrt meine Phantasie von ihren Taten.
1967, im vorletzten Collegejahr, meldete ich mich für das Auslandsprogramm der Columbia in Paris. Die Wochen dort nach der Highschool hatten meine Lust auf diese Stadt geweckt, und als sich die Chance einer Rückkehr ergab, griff ich sofort zu.
Paris war immer noch Paris, nur ich war nicht mehr derselbe wie bei meinem ersten Besuch. Ich hatte die letzten zwei Jahre im Bücherrausch verlebt, ganz neue Welten waren mir in den Kopf geströmt, lebensverändernde Transfusionen hatten mein Blut erneuert. Fast alles, was mir in Bezug auf Literatur und Philosophie noch heute wichtig ist, habe ich in jenen zwei Jahren kennengelernt. Wenn ich jetzt auf diese Zeit zurückblicke, erscheint es mir nahezu unmöglich, sich so viele Bücher einzuverleiben, wie ich damals gelesen habe. Ich verschlang sie in ungeheuren Mengen, fraß ganze Länder und Kontinente von Büchern und hatte niemals das Gefühl, genug davon bekommen zu können. Elisabethanische Dramatiker, vorsokratische Philosophen, russische Romanciers, surrealistische Dichter. Ich las, als ob mein Hirn in Flammen stünde, als ob es um mein Leben ginge. Jedes Werk führte zu einem anderen, jeder Gedanke führte zu einem anderen, und meine Ansichten zu allem und jedem wechselten von Monat zu Monat.
Das Auslandsprogramm erwies sich als herbe Enttäuschung. Als ich nach Paris kam, hatte ich den Kopf voll großartiger Pläne und nahm an, dass ich mir die zu besuchenden Vorlesungen und Seminare selbst aussuchen konnte (zum Beispiel bei Roland Barthes am Collège de France); doch als ich dann mit dem Leiter des Programms über diese Möglichkeit sprach, sagte er mir klipp und klar, dass daraus nichts würde. Kommt nicht in Frage, sagte er. Sie sollen hier französische Sprache und Grammatik lernen, an gewissen Prüfungen teilnehmen, soundso viele Scheine machen, soundso viele Stunden hier und soundso viele Stunden da belegen. Ich fand das absurd, das war ein Lehrplan für kleine Kinder. Darüber bin ich längst hinaus, erklärte ich ihm. Ich kann doch schon Französisch. Wozu das alles noch einmal wiederholen? Weil es Vorschrift ist, sagte er, so und nicht anders.
Er war so unnachgiebig, so geringschätzig mir gegenüber, so bereit, meinen Enthusiasmus als Arroganz zu deuten und sich einzubilden, ich hätte es darauf abgesehen, ihn zu kränken, dass wir uns ziemlich schnell in die Haare gerieten. Ich hatte nichts gegen ihn persönlich, er aber schien fest entschlossen, unsere Meinungsverschiedenheit persönlich zu nehmen. Er wollte mich herabsetzen, mich mit seiner Macht erdrücken, und je länger das Gespräch andauerte, desto stärker wurde mein Widerstand. Und schließlich wurde es mir zu viel. Na schön, sagte ich, wenn das so ist, steige ich aus. Aus dem Programm, aus dem College, ich will mit diesem Blödsinn nichts mehr zu tun haben. Dann stand ich auf, gab ihm die Hand und ging aus dem Büro.
Es war ein ziemlich tollkühner Schritt. Dass ich, wenn ich das College verließ, auf einen akademischen Abschluss verzichtete, war mir gleichgültig; aber ich verzichtete damit automatisch auch auf mein studentisches Privileg, vom Wehrdienst zurückgestellt zu sein. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als der Truppenaufmarsch in Vietnam beängstigende Ausmaße annahm, hatte ich mich in eine Lage manövriert, die meine Einberufung plötzlich sehr wahrscheinlich machte. Schön und gut, wenn ich für diesen Krieg gewesen wäre, aber dem war nicht so. Ich war dagegen, und nichts konnte mich dazu bringen, aktiv daran teilzunehmen. Sollte man mich einziehen, würde ich den Dienst verweigern. Notfalls wäre ich eben ins Gefängnis gegangen. Das stand für mich fest – absolut und unumstößlich. Ich würde mich nicht an diesem Krieg beteiligen, und wenn ich mir damit mein ganzes Leben ruinierte.
Trotzdem verließ ich das College. Unerschrocken, bedenkenlos und sehenden Auges wagte ich den Sprung in die Tiefe. Ich rechnete mit einem harten Aufprall, aber der blieb aus. Stattdessen fühlte ich mich in den nächsten Monaten leicht wie eine Feder und so frei und glücklich wie nie zuvor.
Ich wohnte in einem kleinen Hotel in der Rue Clément, unmittelbar gegenüber dem Marché Saint-Germain, einer Markthalle, die inzwischen längst abgerissen ist. Das Haus war billig, aber sauber, etliche Stufen besser als die Absteige, in der ich zwei Jahre zuvor gehaust hatte, und das junge Inhaberpaar war außerordentlich nett zu mir. Der Mann hieß Gaston (kräftig gebaut, schmaler Schnurrbart, weißes Hemd, stets in schwarzer Schürze) und verbrachte den Großteil seiner Zeit damit, die Kundschaft seines winzigen Cafés im Parterre zu bedienen, das nicht nur Treffpunkt für die Nachbarn, sondern auch die Rezeption des Hotels war. Dort trank ich morgens meinen Kaffee, las die Zeitung und wurde flippersüchtig. Wie schon in Dublin, ging ich in diesen Monaten viel zu Fuß, verbrachte aber auch zahllose Stunden auf meinem Zimmer mit Lesen und Schreiben. Das meiste von dem, was dort entstanden ist, ist verlorengegangen, aber ich weiß noch, dass ich Gedichte geschrieben und übersetzt und ein langes, furchtbar kompliziertes Drehbuch für einen Stummfilm verfasst habe (halb Buster Keaton, halb philosophischer Stepptanz). Neben all der Lektüre, der ich mich in den letzten zwei Jahren hingegeben hatte, hatte ich mir auch viele Filme angesehen, hauptsächlich im Thalia und im New Yorker, zwei Broadway-Kinos, die ich von Morningside Heights aus bequem zu Fuß erreichen konnte. Im Thalia gab es eine täglich wechselnde Doppelvorstellung, und da der Eintritt für Studenten nur fünfzig Cent betrug, verbrachte ich dort kaum weniger Zeit als in den Vorlesungen an der Columbia. Und Paris war für Kinobesuche noch besser geeignet als New York. Ich wurde Stammgast in der Cinémathèque und den Kinos am linken Seineufer, wo nur alte Filme gezeigt wurden, und nach einer Weile packte mich diese Leidenschaft so sehr, dass ich mit dem Gedanken zu spielen begann, Regisseur zu werden. Ich ging sogar so weit, mich nach den Aufnahmebedingungen für das I. D. H. E. C., das Pariser Filminstitut, zu erkundigen, aber die Bewerbungsformulare waren so unübersichtlich und einschüchternd, dass ich dann doch darauf verzichtete, sie auszufüllen.
Wenn ich nicht in meinem Zimmer oder im Kino war, stöberte ich in Buchhandlungen, aß in billigen Restaurants, lernte verschiedene Leute kennen, fing mir einen Tripper ein (sehr schmerzhaft) – kurz und gut, ich war überglücklich, dass ich mich so und nicht anders entschieden hatte. Ich müsste ins Schwärmen geraten, sollte ich beschreiben, wie gut ich mich in diesen Monaten fühlte. Ich war beflügelt, ich war im Frieden mit mir selbst. Natürlich war mir klar, dass ich mein kleines Paradies irgendwann verlassen musste, aber ich versuchte den Aufenthalt so lange wie möglich auszudehnen und die Stunde der Abrechnung bis zum äußersten hinauszuschieben.
Ich schaffte es bis Mitte November. Als ich nach New York zurückkam, war das Herbstsemester an der Columbia schon halb vorbei. Ich sah keine Chance für mich, das Studium wieder aufnehmen zu können, hatte aber meinen Eltern versprochen, bei der Universität deswegen anzufragen. Schließlich waren sie besorgt um mich, und immerhin, so viel glaubte ich ihnen schuldig zu sein. Sobald ich die Sache hinter mich gebracht hätte, wollte ich nach Paris zurück und mich dort nach Arbeit umsehen. Die Armee kann mich mal, dachte ich. Wenn ich am Ende als krimineller Fahnenflüchtling dastehe, soll’s mir auch recht sein.
Aber es kam alles ganz anders. Ich bekam einen Termin bei einem Dekan der Columbia, und dieser Mann erwies sich als so einfühlsam und tolerant, dass er meine Gegenwehr nach wenigen Minuten überwunden hatte. Nein, sagte er, er halte mich nicht für töricht. Er habe Verständnis für meine Pläne und bewundere meinen Unternehmungsgeist. Ich dürfe aber andererseits den Krieg nicht vergessen, sagte er. Dem College liege nichts daran, mich gegen meinen Willen in die Armee eintreten zu sehen, und erst recht wolle man mich nicht als Kriegsdienstverweigerer ins Gefängnis wandern sehen. Wenn ich das Studium wieder aufnehmen wolle, stünden mir alle Türen offen. Ich könne gleich morgen anfangen; offiziell sei es dann so, als ob ich keinen Tag versäumt hätte.
Wie kann man sich mit einem solchen Menschen streiten? Das war nicht irgendein Beamter, der bloß seine Arbeit machte. Dafür sprach er zu ruhig und hörte mir zu aufmerksam zu, und ich begriff ziemlich schnell, dass ihn tatsächlich nur das aufrichtige Bedürfnis trieb, einen zwanzigjährigen Grünschnabel vor einem Fehler zu bewahren, ihm auszureden, sein Leben ohne Not zu verpfuschen. Dazu war später immer noch Zeit, n’est-ce pas