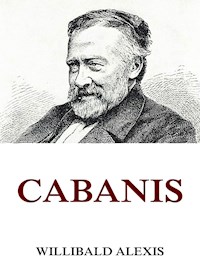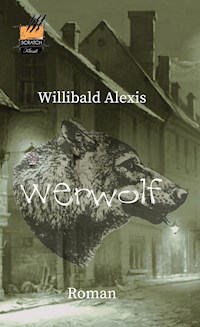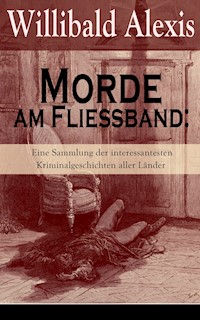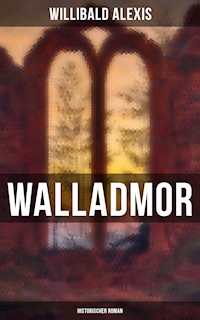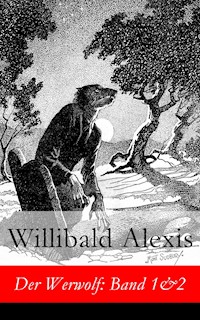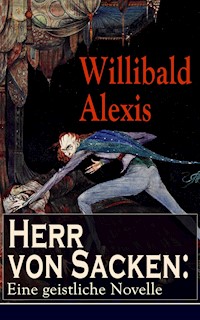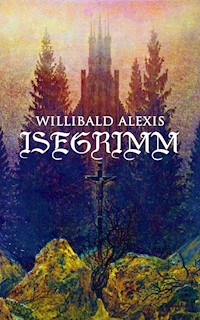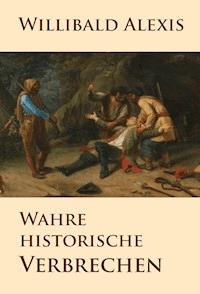
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In der langen Reihe von merkwürdigen Kriminalfällen, die der »Neue Pitaval« seinen Lesern vorgeführt hat, ist der Prozeß: »Karl Friedrich Masch, sein Räuberleben und seine Genossen« einer der merkwürdigsten, und unter der großen Zahl von psychologisch interessanten Verbrechern, die wir im Laufe der Zeit zu schildern Veranlassung hatten, nimmt Karl Friedrich Masch einen hervorragenden Platz ein. Der blutbedeckte Räuber hat, wie in neuester Zeit in zivilisierten Ländern kein anderer, jahrelang im Kriege gelebt mit der Obrigkeit und der bürgerlichen Gesellschaft. Er gleicht an Schlauheit und an Grausamkeit den Raubtieren ... u. v. m.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wahre historische Verbrechen
Willibald Alexis
idb
Vorrede
In der langen Reihe von merkwürdigen Kriminalfällen, die der »Neue Pitaval« seinen Lesern vorgeführt hat, ist der Prozeß: »Karl Friedrich Masch, sein Räuberleben und seine Genossen« einer der merkwürdigsten, und unter der großen Zahl von psychologisch interessanten Verbrechern, die wir im Laufe der Zeit zu schildern Veranlassung hatten, nimmt Karl Friedrich Masch einen hervorragenden Platz ein. Der blutbedeckte Räuber hat, wie in neuester Zeit in zivilisierten Ländern kein anderer, jahrelang im Kriege gelebt mit der Obrigkeit und der bürgerlichen Gesellschaft. Er gleicht an Schlauheit und an Grausamkeit den Raubtieren: er lebte wie diese in den Höhlen des Waldes und zog am liebsten des Nachts von dannen, um hier in ein friedliches Haus zu brechen, dort die Brandfackel in ein Gehöft zu werfen und sich in der durch die Feuersbrunst entstandenen Angst und Verwirrung seine Beute zu holen. Bald lauerte er tückisch dem Wanderer auf und jagte ihm aus sicherm Versteck eine Kugel durch den Kopf, bald erzwang er sich mit Gewalt den Eingang in wohlverschlossene Häuser, erschlug die Bewohner, Mann und Weib, alt und jung, plünderte ihre Habe und frevelte noch an den Leichen. Jetzt hatte man ihn aufgescheucht, aber schnell entschlossen verlegte er den Schauplatz seiner Thätigkeit in eine andere Gegend. Seine Verhaftung war nicht das Verdienst der Polizei, sondern seine Trunkenheit und daß er die gewohnte Vorsicht einmal vergaß, wurde die Ursache seines Verderbens.
Wir haben versucht, das Bild des furchtbaren Bösewichts vollkommen treu und wahr zu zeichnen. Wenn dennoch Rätsel übrigbleiben, so ist das nicht unsere Schuld. Masch war eben nicht bloß ein verruchter Räuber, nicht bloß ein verhärteter Mörder. In der Gefangenschaft löste sich allmählich die Eisrinde seines Herzens, und es ist etwas Tröstliches, daß wir auch in dieser Seele rein menschliche, edlere Regungen entdecken, daß auch ein solcher Mensch noch Reue empfinden und versöhnt sterben konnte. Ob er wirklich zuletzt die Wahrheit gesagt, ob er den entsetzlichen Mord in Chursdorf allein verübt und allein sechs Menschen daselbst umgebracht hat, ob die Hand seines Bruders Martin wirklich rein geblieben ist von Blut, das sind Fragen, die für uns auch heute noch nicht völlig entschieden sind. Die Leser mögen sich selbst ein Urteil bilden, indem sie vergleichen, was der würdige Beichtvater des Delinquenten hervorgehoben hat und was von uns darauf erwidert worden ist.
Benedict Accolti war ein exaltirter Mensch, »ein närrischer Tropf« wie es in den Acten heißt, der den Papst Pius IV. im Jahre 1565 umbringen wollte. Über die Verschwörung, die ihrerzeit ein ungeheueres Aufsehen erregte, bringen wir einen Bericht an den Kurfürsten August von Sachsen.
Unter der Überschrift »Kaspar Trümpy aus Bern« hat ein dem Herausgeber befreundeter deutscher Jurist den berühmten Prozeß wider Dr. Hermann Demme und Sophie Elisabeth Trümpy wegen Giftmords dargestellt. Die beiden Angeschuldigten wurden von den Geschworenen freigesprochen und es erhob sich seinerzeit in der Schweiz ein lebhafter Streit darüber, ob dieser Wahrspruch ein gerechter gewesen sei oder nicht. Die Ansichten sind noch jetzt geteilt. Wir selbst hatten Gelegenheit, in dem verwichenen Sommer an Ort und Stelle mit Fachmännern und mit gebildeten Laien über den Fall zu reden, und überzeugten uns davon, daß namentlich in Bern, wo Dr. Demme gelebt und ein sehr böses Andenken hinterlassen hat, die öffentliche Meinung dahin ging, daß der Angeklagte entweder mit oder ohne Wissen der Frau Trümpy dem Verstorbenen Gift eingegeben habe.
Unser bewährter Mitarbeiter kommt zu einem andern Resultat: er hat das Für und das Wider mit der größten Sorgfalt gegeneinander abgewogen, die juristischen und die psychologischen Momente so zusammengestellt, daß sie eine vollendete Schlußkette bilden, und nicht bloß behauptet, sondern bewiesen, daß Demme kein Mörder gewesen ist.
Von anderer hochachtbarer Seite, in den zu Schwyz erschienenen »Kritischen Briefen«, wird ebenfalls mit stattlichen Gründen für Demme's Unschuld gekämpft, aber doch nicht für seine volle Unschuld. Der Schreiber jener Briefe glaubt vielmehr an einen Selbstmord Trümpy's, und daß Demme ihm dabei geholfen, ihm insbesondere das Gift verschafft habe, mit welchem Trümpy seinem Leben ein Ende machte.
Nach unserm Dafürhalten steht so viel fest, daß Demme dem Trümpy das Gift nicht wider dessen Willen gereicht hat. Einmal fehlte es dazu an jedem Motiv und dann würde er bei der Privatsection, die er bald nach dem Tode vornahm, ganz gewiß nicht bloß die Schädelhöhle, sondern vor allen Dingen auch den Unterleib geöffnet, die Eingeweide herausgenommen und damit jede Möglichkeit der Entdeckung beseitigt haben. Unser Berichterstatter weist sehr schlagend nach, daß Demme dies ohne alle Schwierigkeiten hätte tun können. Wenn er es dennoch unterließ und es der Chemie gelang, aus den innern Teilen der Leiche Strychnin darzustellen, so muß man daraus allerdings den Schluß ziehen, daß Demme entweder gar nichts von der Vergiftung gewußt, oder doch Trümpy nicht vorsätzlich mit Strychnin gemordet hat.
Die andere Frage, ob Demme den Tod Trümpy's gewünscht, ob er Trümpy's Gedanken an Selbstmord mit Freuden begrüßt und genährt hat, möchten wir dagegen bejahen. Wir nehmen an, daß Demme für den heruntergekommenen, dem Trunke und der Lust ergebenen, wüsten Trümpy keine Spur von freundschaftlichem Gefühl, von Mitleid und wahrer Teilnahme besaß. Frau Trümpy und ihre Tochter Flora litten unter der Tyrannei und den Wuthausbrüchen des Vaters, Demme hatte zu der Mutter in einem ehebrecherischen Verhältnis gestanden und auf die Tochter ein Auge geworfen: was war natürlicher, als daß er, um ihrem häuslichen Elend ein Ziel zu setzen, den Wunsch hegte, Trümpy möchte sterben? Wenn dieser selbst, wie er es erwiesenermaßen gegen andere Leute tat, auch gegen Demme Lebensüberdruß und Selbstmordsgedanken aussprach, so mochte Demme darüber erfreut sein, und wir können uns wohl denken, daß er in dem schwachen und feigen Trümpy den Entschluß, sein trauriges Dasein zu endigen, allmählich fest gemacht, ihn über die dazu dienlichen Gifte belehrt und ihm entweder das Strychnin selbst übergeben, oder wenigstens ihn nach und nach so weit gebracht hat, daß er den Giftbecher trank.
Ein Korrespondent der »Luzerner Zeitung« aus Bern hat unsere Darstellung heftig angegriffen und sich nicht entblödet, die Vermutung zu äußern, daß die ganze Arbeit darauf hinauslaufe, die Ehre Demme's zu retten. Da der anonyme Korrespondent nicht einen einzigen Grund gebracht und eine Widerlegung auch nicht einmal versucht, sondern es vorgezogen hat, zu schimpfen, so haben wir uns darauf beschränkt, den Angriff in der »Luzerner Zeitung« zurückzuweisen und zu erklären, daß weder der Herausgeber noch der Verfasser des Aufsatzes mit den beteiligten Familien in irgendeiner Beziehung stehen und daß der letztere völlig objektiv geschrieben hat.
Der »Mord im Kriminalgefängnis von Nürnberg« ist ein grausiges Nachtstück aus der alten Reichsstadt und »Die Meuterei auf der Insel du Levant« ist eine noch viel schrecklichere Tat der Entartung jugendlicher Verbrecher. Der Aufruhr in jener Kolonie, welche die Aufgabe hatte, verwahrloste Knaben und verdorbene Jünglinge zu bessern, die kalte Grausamkeit, mit welcher die Rädelsführer der empörten Rotte ihre Genossen dem Flammentode überlieferten, die unerhörte Pflichtvergessenheit und die Feigheit des Jammermannes von Direktor – das sind freilich traurige, aber doch sehr schlagende Illustrationen zu dem oft und lebhaft besprochenen Thema von der Gesunkenheit dieser verlorenen Jugend und von dem Sinn solcher Besserungsanstalten. Burschen [*typo] dieser Art können eben nur zur Ordnung gebracht werden, wenn sie gehorchen und arbeiten lernen.
Dr. Eduard William Pritchard hat eine gewisse Verwandtschaft mit dem Dr. Demme, nur daß man an seiner Schuld schwerlich zweifeln wird. Er unterscheidet sich von seinen Vorgängern, die einen Platz in unserm Werke gefunden haben, von Dr. Jahn in Dessau, der Coniin, von Dr. Palmer in Rugely in England, der Strychnin, von Dr. de la Pommerais in Paris, der Digitalin anwendete, hauptsächlich dadurch, daß er mit Antimon, einem mineralischen Gift, mordete. Während Jahn, Palmer und de la Pommerais feiner zu Werke gingen und Pflanzengifte wählten, die sich schnell mit dem Blute mischen und überaus schwer zu entdecken sind, machte Dr. Pritchard den Chemikern ihre Aufgabe viel leichter, denn der Brechweinstein war in den Leichen seiner Frau und seiner Schwiegermutter mit geringer Mühe wiederzufinden.
Pritchard hat wenigstens den einen Mord, nachdem er verurteilt war, eingestanden; aber freilich ist damit noch lange nicht alles erklärt und das geheimnisvolle Dunkel, das über dem Feuertode seiner frühern Dienstmagd schwebt, wird niemals aufgehellt werden.
Der Raubmörder Jakob Friedrich Hadopp ist wohl nicht unschuldig hingerichtet worden, obgleich er bis zum letzten Atemzuge dabei geblieben ist, daß die Zeugen gegen ihn falsch geschworen hätten. Übrigens ist der Fall ein neuer Beleg dafür, daß man in Amerika weit weniger scrupulös ist als bei uns. In Deutschland würde sich doch manche Geschworenenbank bedenken, das Schuldig auszusprechen, wenn der Tote nicht einmal identifiziert werden könnte, wie hier, wenn sie nur aus Beschreibungen seiner Kleider und seiner Person schließen sollte, daß der Ermordete wirklich der Freund des Angeklagten gewesen. Und ganz gewiß würde kein Fürst ein solches Todesurteil bestätigen, denn ein Irrtum in der Person bleibt, wenn auch nicht wahrscheinlich, doch auch jetzt noch recht gut denkbar.
Johann Heinrich Furrer , der Mörder seiner Eltern, der im Jahre 1864 vom Großen Rat in Zürich begnadigt, und Heinrich Götti, der Mörder seiner Kinder, der im Jahre 1865, nachdem der Große Rat in Zürich sein Gnadengesuch verworfen, hingerichtet wurde, sind zwei Verbrecher, die für den Seelenkundigen nicht leicht zu enträtseln sind. Die beiden Prozesse haben auch ein kulturgeschichtliches Interesse, insofern sie die Frage über Beibehaltung oder Abschaffung der Todesstrafe praktisch erläutern.
Karl Friedrich Masch, sein Räuberleben und seine Genossen
(Königreich Preußen)
1856-1864
Mancher unserer Leser wundert sich vielleicht darüber, daß wir in der Überschrift von einem Räuberleben in Deutschland aus den letzten Jahren sprechen. Deutschland ist ja, wie man uns täglich versichert, zivilisiert, es kommen wohl einzelne Raubanfälle vor, aber nirgends existieren organisierte Räuberbanden, wie kann es denn ein Räuberleben geben, was zu beschreiben sich der Mühe lohnte? Italien, wo das Stilett des Meuchelmörders in den Geschicken der Familien und in der Geschichte der Staaten von jeher eine Rolle gespielt hat, und das Brigantentum unter einer politischen Maske noch jetzt in leider nur zu hoher Blüte steht; Ungarn, wo noch vor wenig Jahren der gefürchtete Rosza Sandor hauste, Griechenland, dessen Regierung die Räuber durch eine Verordnung vom Januar 1866 förmlich klassifiziert und auf den Kopf eines Räubers erster Klasse einen Preis von 8000 Drachmen gesetzt hat; die Türkei und ihre Nebenländer, vor allen Montenegro, das Land der Schwarzen Berge und der Czernagorzen, welches treffend ein veredelter Räuberstaat genannt worden ist – das sind die Länder, in denen man etwa noch Helden findet, die, im Zwiespalt mit dem Gesetz, Krieg gegen die bürgerliche Gesellschaft und an der Spitze einer kühnen Schar ein abenteuerliches Leben führen, reich an grausamen, reich an edelherzigen Zügen.
Nun freilich, pikante Situationen, romantische Szenen zwischen dem Räuber und seinen Opfern stellen wir nicht in Aussicht, unsere Aufgabe ist, ein treues Bild von einem Menschen zu entwerfen, der in einem christlichen Staate und von christlichen Eltern geboren, in einer christlichen Schule erzogen und trotzdem so tief gesunken ist, daß er zuletzt dem Raubtiere gleich jahrelang in den Höhlen des Waldes lebte und von dort im Dunkel der Nacht die friedlichen Dörfer und Städte der benachbarten Kreise überfiel. Das Bild ist ein furchtbar düsteres, denn die Hände des entmenschten Räubers triefen von Blut, er hat sich niemals weich und mild, niemals großmütig oder edel gezeigt, unser Gemälde würde unwahr sein, wenn wir auch nur einen einzigen hellen, freundlichen Zug anbrächten.
Es handelt sich diesmal nicht um einen oder mehrere Kriminalfälle, sondern um einen Kampf gegen die Menschheit. Der Mann, von dessen grausigen Taten wir berichten, hat sich zwar hier und da Genossen zugesellt, indes ist dies nur ausnahmsweise geschehen, seine Mitschuldigen sind Nebenpersonen, die unsere Aufmerksamkeit in weit geringerm Grade auf sich ziehen.
Gewöhnlich hat er allein und auf eigene Hand operiert. Wir müssen wie bei der Darstellung eines Feldzugs das Auge bald auf diesen, bald auf jenen Punkt lenken, erst am Schlusse wird die Einheit des Ganzen klar werden.
Der Räuber, der in den Annalen des Kriminalrechts neuester Zeit eine unerhörte, schreckliche Berühmtheit erlangt hat, heißt Karl Masch, der Schauplatz seiner Verbrechen ist die Neumark, das südliche Pommern, die preußische Hauptstadt und ihre Umgegend. Masch hat mehr als 300 gewaltsame Diebstähle verübt, sechsmal den Feuerbrand in bewohnte Häuser geschleudert, einige zwanzigmal die Mordwaffe geschwungen und zwölf Menschen erschossen, erschlagen und erwürgt!
Im Anfange des Jahres 1856 wurde das pommersche Dorf Dertzow durch mehrere Diebstähle beunruhigt und unter andern auch der Getreideboden des Gutshofes heimgesucht. Die Diebe hatten die eisernen Traillen vor der Bodenluke herausgebrochen und eine bedeutende Quantität Getreide entwendet. Karl Masch, welcher damals im Hause seines Bruders, des Handarbeiters Martin Masch, in Dertzow wohnte, geriet in den Verdacht, an dem Einbrüche teilgenommen zu haben, er wurde verhaftet und in die Gefängnisse der Kreisgerichtskommission Lippehne eingeliefert. Die Untersuchung zog sich mehrere Wochen hin, dem Gefangenen behagte es nicht in seinem Gewahrsam, und eines Morgens fand man seine Zelle leer. Masch hatte eine Fensterscheibe eingedrückt und war mit der Gewandtheit einer Katze zwischen den Eisenstäben hindurchgeschlüpft.
Noch in derselben Nacht wurden aus den Pferdeställen des Gutshofes verschiedene Effecten gestohlen. In der folgenden Nacht ward in dem benachbarten Dorfe Hohenziethen ein Einbruch verübt. Der Dieb schien entweder einen ganz bedeutenden Appetit oder die Absicht gehabt zu haben, sich für die Zukunft mit Lebensmitteln zu versorgen. Er hatte aus der Speisekammer des Herrenhauses mehrere Schinken, gekochtes Fleisch, Braten, Butter und Schmalz geholt. Am Kammerfenster stand noch der Pfahl, mit welchem das eiserne Gitter auseinandergebogen war.
Schon in der nächsten Nacht wurden die Einwohner von Dertzow durch ein bedeutend schwereres Verbrechen in Schrecken gesetzt. In einem zum Gutshofe gehörigen Wirtschaftsgebäude brach Feuer aus, die Flammen schlugen lichterloh empor und verbreiteten sich mit rasender Schnelligkeit über die mit Stroh gedeckten Scheunen und Ställe. Als der Feuerruf des Nachtwächters erscholl, war das Unglück nicht mehr abzuwenden, drei Scheunen und mehrere Ställe brannten nieder, es gelang nicht einmal das Vieh zu retten, an Rindvieh allein kamen 50 Stück um, der Schade betrug im ganzen gegen 20000 Thaler. Das Feuer war kurz vor Mitternacht aufgegangen, an einer Stelle des Daches, die im Berufswege von niemand betreten wurde. Es mußte vorsätzlich angelegt sein. Jeder Zweifel darüber schwand, als man früh morgens am hintern Fenster der Inspectorwohnung ein Pfluggestell angelehnt und dabei einen Sack liegen sah. Offenbar hatte der Brandstifter die Verwirrung auf dem Hofe benutzen wollen, um einen Diebstahl auszuführen, das Hin- und Herlaufen der Leute mochte ihn jedoch bedenklich gemacht und bewogen haben, sein Vorhaben aufzugeben.
Im Publikum sprach man erst leise, dann immer lauter davon, daß Masch der Verbrecher sei. Der Flüchtling wurde seit seinem Ausbruch ans dem Gefängnis verfolgt, aber nirgends war er gesehen worden. Schon glaubte man, er habe das Weite gesucht und sei auf immer verschwunden, da erschien er eines Tags plötzlich beim Kreisgericht in Soldin und erklärte, in Lippehne habe es ihm nicht gefallen, die Kost sei schlecht und nicht ausreichend gewesen, er wünsche, daß die wider ihn anhängige Untersuchung wegen des Getreidediebstahls in Dertzow hier in Soldin beendigt werde, und stelle sich deshalb freiwillig. Nach wie vor beteuerte er seine völlige Unschuld an jenem Diebstahle und versicherte, daß er auch in der Zwischenzeit nichts Böses begangen habe. Er wollte in Gesellschaft von Handwerksburschen umhergezogen sein und von der Mildtätigkeit der Menschen gelebt haben. Der Mangel an Legitimationspapieren hätte ihn bestimmt, dem lustigen Wanderleben zu entsagen. Masch wurde vom Kreisgericht Soldin an die Kreisgerichtskommission Lippehne, als an die zuständige Behörde, zurückgeliefert und nun mit doppelter Vorsicht bewacht. Einige Tage ertrug er die Gefangenschaft mit Geduld, dann aber erwachte die Sehnsucht nach Freiheit mit desto größerer Heftigkeit, Lippehne war nun einmal nicht der Ort, wo er sich behaglich fühlte, kurz in der Nacht vom 20. zum 21. Mai schwang er sich wieder mit einer wunderbaren Geschmeidigkeit durch das eng vergitterte Fenster und kehrte seitdem nicht mehr aus freiem Antriebe in den Kerker zurück.
Dem Gericht entging es natürlich nicht, wie gefährlich Masch der öffentlichen Sicherheit zu werden drohte, es wurden energische Maßregeln getroffen, ihn festzunehmen, man setzte eine Prämie auf seine Wiederergreifung, allein weder in Dertzow noch in den umliegenden Ortschaften war eine Spur von ihm zu entdecken. Man beobachtete seinen Bruder Martin und dessen Treiben auf das genaueste, es zeigte sich jedoch nichts Verdächtiges; man verdoppelte, verdreifachte, ja endlich verzehnfachte man die ursprünglich ausgeworfene Belohnung, dennoch fand sich niemand, der sie verdienen wollte oder konnte. Im Volke glaubte man unerschütterlich fest daran, daß Masch in der Nähe sei und sich mit Hülfe seiner Verwandten verberge, bei jedem neuen Diebstahl wurde sein Name genannt, und leider folgten sich die verwegensten Einbrüche in immer kürzern Zwischenräumen. Nicht bloß Hohenziethen uud Dertzow, auch die umliegenden Ortschaften Marienwerder, Cremlin, Kerkow, Eichwerder, Beyersdorf und andere wurden von den unheimlichen Gästen heimgesucht, in Beyersdorf allein zählte man in weniger als zwei Jahren mehr als zwanzig gewaltsame Diebstähle, ja nicht selten geschah es, daß in der Nacht die Feuerzeichen erklangen, eine verruchte Hand hatte die Brandfackel geschwungen, um dann in der allgemeinen Bestürzung desto leichter Beute machen zu können. Allmählich bemächtigte sich der gesamten Bevölkerung des soldiner und pyritzer Kreises ein Gefühl der Unsicherheit, Raub- und Mordgeschichten waren das Tagesgespräch, zu den wirklichen Gefahren kamen eingebildete, einer überbot den andern, hier behauptete man, daß in den Wäldern der Umgegend eine Bande mit einem riesenstarken Hauptmann ihr Wesen treibe, dort setzte man alles auf das Konto des entsprungenen Masch, der mit dem Teufel im Bunde sei und die Kunst verstehe, sich unsichtbar zu machen. Holzarbeiter hatten in der Dämmerung finstere Räubergestalten in der Tiefe des Forstes gesehen, Furchtsame waren ihnen sogar auf den Landstraßen uud in der Mitte der Dörfer begegnet.
Im März 1858 erzählte man sich, im Walde bei Pyritz, vier Meilen von Soldin, habe man eine Räuberhohle entdeckt. Die meisten schüttelten ungläubig die Köpfe, sie glaubten ein Märchen zu hören, wie deren damals so viele die Runde machten. Bald stellte sich indes die Wahrheit des seltsamen Gerüchts heraus.
Der Mühlenbesitzer Ebel aus Veversdorf hatte im pyritzer Stadtforst Holz gekauft, in den ersten Tagen des März fuhr er in Begleitung eines Knechtes hinaus, um das Holz wegzufahren. Während der Knecht mit dem Geschirr einen geladenen Wagen nach Hause schaffte, blieb der Müller einstweilen an Ort und Stelle. Er sah sich nach einem Busche um, aus dem er sich einen Spazierstock zurechtschneiden könnte, und kam suchend auf hügeliges, mit jungen Buchen bestandenes Terrain. Am Abhänge eines Hügels, etwa 200 Schritte von dem vielbefahrenen Wege und ebenso viel von dem Heiderande entfernt, bog er das Gesträuch auseinander und bemerkte, daß der Schnee daselbst so glatt gedrückt war, als ob sich Wild gelagert hätte. Um die Sache näher zu untersuchen, arbeitete er sich durch die Aeste hindurch und weiter in das Strauchwerk hinein. Hier sah er einen Haufen Laub ohne alle Schneebedeckung. Der Wind konnte den Schnee an einem so geschützten Platze nicht so vollständig weggeweht haben, das Laub konnte nicht so regelmäßig auf diese eine Stelle gefallen sein. Wer hatte es also zusammengetragen? und zu welchem Zwecke war dies geschehen? Der Müller dachte zunächst daran, daß sich irgendein Tier eine ganz besondere mühsame Arbeit gemacht haben möchte; da er zufällig nichts zu versäumen hatte, wollte er sich noch genauer überzeugen, steckte einen Ast in das Laub und rührte darin herum. Das Laub fiel nicht auseinander, sondern rollte in die Erde hinein wie in einen Trichter. Aha, sagte Ebel vor sich hin, da hat sich ein Dachs oder ein Fuchs eine Höhle gegraben und sie sorgfältig mit Laub zugedeckt. Aber was mußte denn das sein? Nicht weit von dem einen Loch war ja wieder ein anderes, größeres, und der Erdboden klang so sonderbar, wenn er mit dem Fuß stampfte, gerade so, als wenn darunter ein Keller wäre. Der Müller überlegte sich, daß die Löcher unmöglich von Tieren gewühlt sein könnten, denn Tiere bauen ihre Höhlen nicht so, daß Laub und Reisig hineinkollern wie in einen Schornstein. Was er beobachtete, wurde ihm immer unbegreiflicher, er schickte sich an, das Erdloch nochmals mit der größten Aufmerksamkeit zu besichtigen, und bog zu diesem Zwecke die Zweige eines Strauches von neuem auseinander, da fährt plötzlich dicht vor seinem Gesicht ein mindestens sechs Fuß langer, gewichtiger Knittel aus dem Loche empor und gleich darauf taucht der Kopf eines finstern bärtigen Mannes aus der Erde auf. Der Müller bleibt, furchtbar erschrocken, wie angewurzelt stehen und richtet das Auge starr auf den Höhlenbewohner, der vor seinen Blicken der Tiefe entsteigt und drohend auf ihn zukommt. Ebel zieht sich langsam zurück, er lehnt sich mit dem Rücken an einen Baum und faßt den Entschluß, sein Leben so tapfer als möglich zu verteidigen. Der Fremde zeigt indes keine Lust, den Kampf zu beginnen, er droht nur mit dem Knittel, dann wendet er sich seitwärts und eilt mit raschen Schritten in den Wald.
Der Müller erholt sich allmählich von seinem Schrecken, er begibt sich auf den Rückweg und findet in der Nähe den Förster und mehrere Holzschläger. Als er ihnen sein Abenteuer mitteilt, wird er anfänglich weidlich verspottet. Erzählungen von Erdmenschen, die ihr Reich in der schattigen Unterwelt aufschlagen und sich nur dann und wann dem Menschen zeigen, hatten sie wohl an langen Winterabenden in ihrer Jugendzeit gehört, jetzt aber, wo die arbeitsschwiele Hand ein sehr deutlicher Beweis von der harten Wirklichkeit des Lebens war, besaß keiner der Zuhörer Phantasie genug, um an die Gnomen- und Koboldwelt zu denken. Überdies sprach ja auch der Mühlenmeister von einem Manne mit stechenden Augen und rauhen Zügen, der einen sechs Fuß langen Knittel geschwungen, das konnte unmöglich einer von jenen schalkhaften Geistern sein, welche die Menschen wohl necken, ihnen aber eher Gutes als Böses tun. Als Ebel bei seiner Geschichte blieb und man einsah, daß er nichts weniger beabsichtigte, als etwa den Holzhauern etwas aufzubinden, machten sich alle, mit den wuchtigen Aexten bewaffnet, auf, um die Höhle zu durchsuchen. Man entdeckte Folgendes: Ein Bret, dergestalt mit Erde bedeckt, daß es sich von dem übrigen Boden durch nichts unterschied, verschloß die unterirdische Behausung. Ein mannsbreiter Gang führte sechs Fuß senkrecht in die Tiefe. Das Bret war mit einem kleinen Loche versehen, durch welches man von unten Hindurchgreifen und den Deckel je nach Bedürfnis abheben oder auch mit demselben die Höhle schließen konnte. An den Eingang stieß seitwärts ein Gang von ungefähr fünf Fuß Höhe, hier war mit Hülfe von Eisenstücken ein förmlicher Kamin angelegt. Das Loch, welches der Müller wahrgenommen hatte, als er das Laub durchsuchte, bildete den Abzugskanal für den Rauch, die Mündung des Kamins. Hinter dem ebenerwähnten Gange lag der Raum, der als Wohnzimmer diente. Die Höhle war sieben Fuß lang, sieben Fuß breit, fünf Fuß hoch und allem Anschein nach schon lange Zeit bewohnt, denn man fand alle möglichen Geräthschaften, die für die Besorgung des Haushalts notwendig sind. Außerdem lagen daselbst in buntem Wirrwarr eine Menge offenbar entwendeter Sachen: Kleidungsstücke, Wäsche, ein Dolch, ein Beil, ein Hammer, ein Bund Schlüssel und verschiedene Brechwerkzeuge. Die Bauart zeugte von dem Geschick des Erbauers. Er hatte die Seitenwände des Ganges und die Höhle selbst durch starke Balken gestützt, die Wände sorgfältig mit Lehm ausgestrichen, und alle Zwischenräume durch Laub und andere Stoffe verstopft. Auf den Balken waren Querhölzer angebracht, welche die Decke, eine etwa zwei Fuß hohe Erdschicht, trugen. Die nach außen gekehrte Seite der Decke war der Erdoberfläche völlig gleich und mit jungen Buchenstämmen bepflanzt. Auch das geübte Auge des Jägers konnte nicht auf den Gedanken kommen, daß unter den Bäumen eine menschliche Wohnung sei, so künstlich war sie versteckt. In die Pfosten der Höhle hatte Masch Nägel und Pflöcke eingeschlagen, an denen er seine Garderobe und seine Vorräthe: Speck, Schinken und Würste, aufhing, als Stuhl diente ihm ein behauener Klotz, als Tisch ein an der Wand befestigtes Bret, eine Vertiefung an der einen Seite war sein Weinkeller, als Liebhaber und Kenner edler Sorten sorgte er dafür, daß ihm ein guter Rothwein, feuriger Rheinwein und Champagner nicht ausgingen. Auf der andern Seite sah man eine Schicht junger Birkenreiser übereinandergelegt und darauf trockenes Heu ausgebreitet. Die Reiser schützten vor der vom Boden nach oben dringenden Feuchtigkeit und gaben dem Lager jene Elasticität, die dem Ruhenden so angenehm ist.
Wie die Gerippe und Überreste verspeister Tiere den Horst eines Geiers kennzeichnen, so kamen beim Nachgraben auch hier eine Masse Knochen zu Tage, die von Schweinen, Hammeln, Gänsen und andern Hausthieren herrührten.
Der Förster, welcher die Durchsuchung leitete, sandte ungesäumt Botschaft an die Behörde und setzte mit so vielen Personen, als er in der Eile zusammenbringen konnte, dem flüchtig gewordenen Masch nach. Man verstärkte die Gensdarmerie, bot die nächsten Gemeinden auf und durchforschte die Wälder, aber vergeblich, der Höhlenbewohner war von neuem spurlos verschwunden. Seine Behausung ward zerstört und der dort zusammengeschleppte Raub an das Gericht abgeliefert. Es ergab sich, daß man die Früchte von zahllosen Diebstählen in verschiedenen Dörfern vor sich hatte, aber freilich war, was man gefunden, nur ein sehr unvollständiges Register von der Thätigkeit des Räubers. Die Bestohlenen wurden ermittelt, der Dieb war auf und davon, er kam, einmal vertrieben, nie mehr zurück in die pyritzer Höhle.
Wir führen unsere Leser nun in den an den soldiner grenzenden landsberger Kreis, in das Dorf Wormsfelde. Eines Tages im Monat April 1858 begab sich die von dort gebürtige Tagelöhnersfrau Buchholz nach dem nahen See, um Wäsche zu reinigen. Sie ging auf einem in den See hineingebauten Bretersteig bis ans Ende und schöpfte Wasser. Kaum hatte sie ihre Arbeit angefangen, da erblickte sie vor sich im Wasser den Leichnam eines Weibes. Schnell rief sie die Nachbarn herbei, der entseelte Körper wurde ans Land gebracht und die erforderliche Anzeige erstattet. Die Verstorbene war eine Witwe Namens Wall aus dem Dorfe Altenfließ. Man erfuhr, daß sie weder Angehörige noch einen festen Wohnort gehabt, und sich seit Jahren bettelnd herumgetrieben habe. Noch wenige Tage zuvor hatte sie im Kruge von Wormsfelde Branntwein gekauft, das Nachtlager war ihr daselbst verweigert worden. Bei der gerichtlichen Leichenschau zeigten sich am Halse rothgefärbte, blutrünstige Stellen, am Kinn und am Unterkiefer unbedeutende Wundflecken. Die unerheblichen Verletzungen konnte sich die Witwe Wall recht gut bei Lebzeiten selbst zugefügt haben, Spuren eines gewaltsamen Todes waren weiter nicht vorhanden, auch erschien es im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß ein dritter sich an einer Landstreicherin, bei welcher nichts zu finden war, vergriffen haben sollte. Man nahm daher allgemein an, daß die alleinstehende alte Frau in einer Anwandlung von Lebensüberdruß sich selbst in den See gestürzt und dort das nasse Grab aufgesucht habe. Auffallend war nur daß Eine, daß man in einem Backofen unweit des Sees noch etliche der Witwe Wall zugehörige Kleider und eine Branntweinflasche fand. Eine Obduction wurde nicht für nötig gehalten, sondern der Leichnam ohne weiteres der Erde übergeben. Die Sache war hiermit abgemacht und nach wenigen Wochen vergessen.
Im Anfange des Monats August 1858 erzählte man sich in den zum soldiner Kreise gehörigen Dorfe Albertinenburg, das Stubenmädchen des Gutsbesitzers Neumann, Henriette Fehlhaber, sei auf eine völlig unerklärliche Weise ganz plötzlich gestorben. Noch am Abend des 5. Aug. war die blühende, erst zweiundzwanzigjährige Jungfer frisch und gesund gewesen und um die Mitternachtsstunde in ihre parterre gelegene Schlafstube gegangen, um sich zu Bett zu legen. Die Herrschaft war verreist, deshalb schlief die andere Magd, Sophie Schimmel, nicht wie gewöhnlich mit ihr zusammen, sondern in den obern Räumen des Hauses. Als die Fehlhaber am andern Morgen nicht aufstand, wollte die Schimmel sie wecken. Sie öffnete die Schlafkammer, wich aber entsetzt zurück, denn das gebrochene Auge einer Leiche starrte ihr entgegen. Während sie sanft schlief, hatte der Tod ein junges Leben dahingerafft. Der Mund, der noch am Tage zuvor so munter gescherzt, war auf immer verstummt, sie fand einen kalten, entseelten Körper. Die Verstorbene war nicht ohne Kampf aus dem Leben gegangen, denn sie lag entblößt, mit emporgerichteten Knien im Bett, die Decke war bis an das untere Ende der Bettstelle zurückgeschoben, am Kehlkopfe und an den Armen bemerkte man mit Blut unterlaufene Stellen. Allein kein Mensch hatte einen Schrei gehört, das vergitterte Fenster war unbeschädigt, nicht die geringste Kleinigkeit wurde vermißt. Das alles sprach gegen die ohnehin kaum glaubliche Annahme, daß ein Mörder in dem bewohnten, gut verwahrten Hause sein schreckliches Gewerbe verrichtet habe. Der herbeigerufene Arzt untersuchte die Leiche und kam zu dem Resultat, »das Mädchen sei infolge eines Schlaganfalls gestorben, welcher ihr das Genick abgestoßen habe«. Er gab die Erlaubnis zur Beerdigung, die in Blankensee wohnenden Eltern wurden von dem bittern Verlust, der sie betroffen, in Kenntnis gesetzt, sie kamen nach Albertinenburg, nahmen die todte Hülle ihres Kindes in Empfang und betteten sie, tief betrübt, in das kühle Grab.
Wir verlassen nun die Neumark für eine kurze Zeit und begeben uns auf die Landstraße, die von Berlin nach Freienwalde führt. Der Fuhrmann Wattrow war von Neutornow mit einem Fuder Heu nach Berlin gefahren, er hatte das Heu verkauft und machte sich am 10. Sept. 1858 auf den Rückweg. Bis Werneuchen, wo er im Kruge rastete, fuhr er in Gesellschaft, von dort brach er abends um 10 Uhr allein auf und befand sich in der zwölften Stunde zwischen Tiefensee und Heckelberg. Die Chaussee geht hier etwas bergab, zu beiden Seiten ist Wald. Der leichte Wagen rollte auf der glatt gefahrenen Straße so gleichmäßig fort, und die Pferde trabten so lustig vorwärts, daß ihr müder Herr die Augen schloß und sich sorglos dem Schlummer überließ. Auf einmal wird er rauh geweckt, er hat die Empfindung, als ob er einen heftigen Schlag auf den Nacken bekommt, gleichzeitig ziehen die Pferde scharf an und gehen mit dem Wagen in schnellem Laufe davon. Der Fuhrmann greift mit der Hand nach dem Genick, er fühlt einen starken Schmerz, die Hand ist blutig. Er weiß zwar nicht, auf welche Weise er verwundet worden, aber die Unruhe seiner klugen Tiere belehrt ihn, daß er das Schlimmste zu befürchten hat. Er läßt ihnen die Zügel schießen und hofft, binnen kurzer Frist ein Dorf zu erreichen. Plötzlich wird seine Lage kritischer als zuvor, eins der beiden Vorderräder hält die stürmische Fahrt nicht aus, es schwankt und hängt bald darauf nur noch lose an der Achse. Der Fuhrmann erschrickt, er wagt es nicht, anzuhalten und das Rad zu befestigen, wenn der Wagen nur noch eine Viertelstunde Zeit in so rasender Eile vorwärts fliegt, so ist er gerettet, er spornt die willigen Rosse zu neuen Anstrengungen an, aber nach wenig Secunden rollt das Rad in eine Schlucht neben der Chaussee, der Wagen wird mühsam an drei Rädern eine Strecke fortgeschleift, dann bleiben die Pferde stehen. Wattrow faßt sich ein Herz, birgt sein Geld in den Schaft des Stiefels und geht, einen tüchtigen Stock in der nervigen Faust, scharf nach rechts und nach links blickend, zurück, das verlorene Rad zu suchen. Er findet es nicht, sieht indes auch nichts von dem Räuber, der ihn im Schlafe gestört. Langsam schleppen die Pferde den Wagen bis nach Lauenburg. Nachdem der Fuhrmann für die treuen Tiere gesorgt hat, untersucht er die eigene Wunde und ist nicht wenig erstaunt, als er statt eines Schlages eine Menge von Schußwunden entdeckt. Jetzt erst erkennt er die Größe der überstandenen Gefahr, er hat es mit einem zur frechsten Gewalttat entschlossenen Menschen zn tun gehabt, sein Glück war gewesen, daß er dem nächtlichen Wegelagerer nicht zum zweiten mal beim Suchen des Rades begegnete; vermuthlich hatte derselbe den Angriff aufgegeben, als der Wagen so rasch aus seinen Blicken schwand, und war in das Dunkel des Waldes zurückgekehrt. Der Schuß würde den Fuhrmann unbedingt getödtet haben, wenn nicht der dickgefütterte hochaufgeschlagene Mantelkragen die Kraft gebrochen und den Kopf geschützt hätte. Eine beträchtliche Anzahl von Rehposten und Schrotkörnern saß im Rock und in der Weste, man zählte im Genick und im Rücken 18 Wunden. Die Bleistücke wurden herausgenommen, Wattrow mußte sich dem Arzte anvertrauen und konnte sich erst nach vier Wochen von seinem Krankenlager erheben und sein Gewerbe fortsetzen.
Der Meuchelmörder blieb trotz aller Nachforschungen unentdeckt.
Vier Wochen später hörte man von einem ganz ähnlichen, nur noch weit frechern Überfall im soldiner Kreise. Zwischen Bernstein und Dölitz, unweit der pommerschen Grenze, ist eine Chausseegeldhebestelle, welche damals ein gewisser Schmidt verwaltete, ein ehemaliger Soldat, der 1848 im Kriege gegen Dänemark ein Bein verloren hatte. In der Nacht vom 7. zum 8. Oct. 1858 lag Schmidt zusammen mit seinem vierjährigen Kinde im Bett und schlief, in einem zweiten Bett ruhte seine Ehefrau. Eben hatte es 12 Uhr geschlagen, da krachte ein Schuß, die Fenster klirrten, die drei Schläfer fuhren in die Höhe, Schmidt sank mit einem Schrei zurück, er fühlte, daß er getroffen war. Noch hatte sich der Pulverdampf nicht verzogen, als am Fenster das Gesicht eines Mannes sichtbar wurde. Die erschrockenen Eheleute glaubten, daß jetzt der Mörder herannahe, und befahlen ihre Seelen Gott; doch siehe, der Mann winkte ihnen freundlich zu und gab sich als einen Briefträger aus Bernstein zu erkennen, der einen expressen Brief nach dem jagower Forsthaus zu tragen hatte. Auf dem Wege dorthin mußte er an dem Chausseehause vorüber, etwa 100 Schritt davon entfernt sah er das Aufflammen des Pulvers und hörte den Knall eines entladenen Gewehrs. Anfänglich fürchtete er, der Schuß habe ihm gegolten, er war indes unverletzt und lief nun nach dem Chausseehause hin, dem Orte zu, wo der Schuß gefallen war. Hier bemerkte er die dunkeln Umrisse eines Menschen, der vom Hause weg flüchtigen Schrittes dem Felde zueilte.
Ein Fenster des Hauses war durch das im Zimmer brennende Licht erleuchtet gewesen, man konnte es daher von außen überschauen und nicht bloß die Betten, sondern auch die Lage der dort schlafenden Personen erkennen. Der Mörder hatte, um sicher zu zielen, eine Art von Schießstand errichtet, nämlich mehrere von einem Anbau des Hauses losgerissene Breter über den Chausseegraben gelegt, auf dieselben einen Karren gestellt und diesen wieder mit Bretern bedeckt. Von dem improvisirten Gerüste aus wurde es ihm möglich, das auserkorene Opfer genau aufs Korn zu nehmen; der unheimliche Schütze hätte unfehlbar seinen Angriff erneuert und seinen Zweck, sich die Chausseegeldkasse anzueignen, erreicht, wäre er nicht von dem Briefträger verscheucht worden.
Das Bett, in welchem Schmidt und sein Kind lagen, schwamm im Blute, das Kind war jedoch nicht verwundet, der Vater hatte es mit dem eigenen Leibe gedeckt. Dem unglücklichen Manne war die ganze aus Rehposten und Schrotkörnern bestehende Ladung in die eine Seite gedrungen. Er mußte sich einer schmerzhaften Operation unterwerfen und wurde monatelang auf das Siechbett hingestreckt. Endlich schlossen sich die 14 Schußwunden, Schmidt wurde wieder gesund, allein sein Wohlstand war durch die Kosten der langwierigen Krankheit hart beschädigt.
Die Gerichte und die Polizei begannen ihre Thätigkeit schon am Morgen nach der blutigen Tat, es wurden etliche Personen eingezogen, andere scharf inquirirt, aber der Verdacht bestätigte sich nicht, die Untersuchung mußte eingestellt werden.
Im nächsten Monat, also im November 1858, beging der Förster Topp aus Marienbrück sein Revier und traf bei dieser Gelegenheit im tankow-wildenower Forst einen verwildert aussehenden Menschen, der, im Gebüsche versteckt, auf der kalten Erde sich ein Lager zurechtgemacht hatte und fest schlief. Die Beschaffenheit der Lagerstätte deutete darauf hin, daß sie nicht zum augenblicklichen vorübergehenden Gebrauche bestimmt war. Der Förster sah sich den Mann an, der in so tiefem Schlafe lag, als wenn er nachholen wollte, was er in mehrern Nächten versäumt. Ein Freund der Natur, der im Sommer aus Liebhaberei im Walde sein Domicil aufschlägt, um sich von den Vögeln einsingen und von den rauschenden Zweigen in den Schlummer wiegen zu lassen, konnte es nicht sein, denn die Bäume waren fast kahl, die gefiederte Schar hatte ihre Wanderung nach dem warmen Süden längst angetreten, ein rauher Nordost Pfiff durch den Forst. Topp faßte den Schläfer an und rief ihm zu: »Hollah, aufstehen!« Der Fremde dehnte sich, warf sich auf die andere Seite und schnarchte weiter. Nun griff der Forstmann derber an und rüttelte ihn so kräftig, daß er erwachte. Er warf dem Störenfried einen bösen Blick zu, dann sprang er bestürzt in die Höhe. Topp eröffnete ihm, es sei notwendig, daß seine Persönlichkeit festgestellt werde, deshalb solle er ihm folgen. Der Unbekannte erklärte sich dazu ohne Zögern bereit, nahm einen ihm zur Seite liegenden Sack über die Achsel und schritt anscheinend gleichgültig einige Minuten neben dem Förster einher, dann aber warf er den Sack von sich und sprang leichtfüßig in das Dickicht. Topp mußte es sehr bald aufgeben, den Flüchtling einzuholen, er hob den Sack, der eine ziemlich vollständige Sammlung von Diebsinstrumenten: Brecheisen, Bohrer, Sägen, Meißel, Dietriche u. dgl. enthielt, auf und lieferte denselben an das Kreisgericht in Landsberg a. d. W. ab. Diese Behörde erließ eine öffentliche Bekanntmachung und teilte darin die Begegnung des Försters mit; es meldete sich jedoch niemand, der über die genau signalisierte verdächtige Mannsperson Auskunft gab.
Die kurz vor der Entdeckung der phritzer Höhle hart gebrandschatzten Districte des soldiner und des phritzer Kreises hatten sich seitdem einer fast ungestörten Ruhe erfreut, und das Vertrauen war nach und nach zurückgekehrt. In den letzten Monaten des Jahres 1858 und zu Anfang des folgenden Jahres nahmen indes die Verbrechen gegen das Eigentum von neuem überhand. Ein Einbruch folgte auf den andern, der zweite immer dreister als der vorhergegangene. Heute tauchte der Unhold im Norden, morgen im Süden auf. Die Art und Weise, wie er sich den Weg bahnte, war fast stets dieselbe, überall brach er durch die festesten Verschlüsse und raubte im Dunkel der Nacht. Keine Eisenstange war fest, kein Schloß sicher genug, man erkannte, daß man es nicht bloß mit einem entschlossenen, sondern auch mit einem überaus starken Bösewicht zu tun hatte. Er plünderte die Orte Warsin, Klorin, Plönzig, Garz, Brietzig, Lettnin, Craatzen, Alt-Mellenthin, Cremlin, Marienaue, Naulin, Rohrsdorf, Loist, Köselitz, Batow und fand sich abermals auf dem Schauplatze seiner frühern Taten in Dertzow und in Hohenziethen ein. Auf seinen weitern Ausflügen stahl er in Adamsdorf, Giesenbrügge, Görlsdorf und in Stölpchen bei Bärwalde.
Im Frühling 1859 wurden umfassende energische Maßregeln angeordnet, um den zur Landplage gewordenen Räuber endlich zu fangen. Das Militär in Soldin und in Phritz bekam den Befehl, zu manövriren, das zwischen beiden Städten liegende Terrain ward auf mehrere Meilen in die Runde durchsucht, unter Zuziehung der Gemeinden die Waldung durchforscht, an verschiedenen verdächtigen Stellen nahm man zu derselben Stunde Haussuchungen vor. Und dennoch war alle Mühe umsonst, von dem berüchtigten Masch und seinen etwaigen Helfershelfern fand man auch diesmal keine Spur. Schon gab man sich der Hoffnung hin, daß die Geisel des Landes doch vielleicht verjagt sein möchte, als die Kunde erscholl, im königsberger Kreise, in der Nahe von Bärwalde, sei ein gräßlicher Mord verübt worden, den kein anderer als Masch begangen haben könne.
Am Ausgange des Dorfes Stölpchen, an der nach Mohrin führenden Straße, liegt die dem Gutsherrn gehörige Krugwirthschaft. Das Schankgewerbe brachte nicht viel Gewinn, denn Fremde pflegten sich nicht lange aufzuhalten, insbesondere nur selten über Nacht zu bleiben. Die Haupteinnahmequelle waren die Gäste aus dem Orte selbst, die den Krug besuchten. Der Pachtzins betrug 60 Thlr. für das Jahr. Das Haus stand mit der Giebelseite au der Straße, es war gemäß der Gewohnheit jener Gegend an der Vorderseite mit einem Überbau versehen, indem mehrere freistehende Balken den vorgebauten Dachstock trugen. Dieser Überbau, ein vor den Regengüssen geschützter Raum, heißt in der Volkssprache Löwing, bei ungünstigem Wetter fanden die Fuhrleute ein Obdach daselbst, in der heißen Jahreszeit war der Platz von allen gesucht, die kühl sitzen wollten.
Machen wir uns nun mit den Localitäten im Innern bekannt, soweit es zum Verständnis des Folgenden nötig ist.
Das Haus wird links von der Straße von dem Garten umschlossen, rechts sind Wirtschaftsräume und Stallungen, die Rückseite stößt an das freie Feld. Wenn man vom Löwing durch die Haustür eintritt, so gelangt man in den Hausflur, von da führt zur Linken eine Tür in die Schenkstube, an diese stößt die Schlafstube, die erste hat zwei Fenster, eins nach dem Garten, das andere nach dem Felde zu, die letztere ist einfensterig. Die Schlafkammer wird durch eine Tür mit der Wohnstube verbunden, die Fenster von beiden sind dem Felde zugekehrt, aus der Wohnstube kommt man in die Häckselkammer; diese, eine Küche, eine finstere Vorrathskammer und eine Polterkammer nehmen die rechte Seite des Hauses ein. Vom Felde aus führt eine Hintertür direct in die Häckselkammer, von hier passirt man einen Durchgang, der zugleich den Feuerungsraum enthält, und befindet sich dann in der Hausflur. Im Jahre 1860 hatten die Brandt'schen Eheleute den Krug gepachtet, sie waren erst seit kurzem veiheiratet, Frau Brandt erwartete ihr erstes Kind. Am 9. Sept. ging der Meier Zimmermann aus Stölpchen, ein Bekannter von Brandt, der den Krug öfter besuchte und im Hause genau Bescheid wußte, morgens zwischen 5 und 6 Uhr nach dem bärwalder Holze. Vom Felde aus sah er, daß die Hintertür offen war. Da er wußte, daß die Krügersleute erst ziemlich spät aufzustehen pflegten, daß sie Dienstboten nicht hielten und einkehrende Fremde fast nie dort nächtigten, fiel ihm dies auf, um so mehr, da er sich erinnerte, daß schon früher ein Dieb durch das Fenster der Hinterstube eingestiegen sein sollte. Er ging näher heran und fand seinen Verdacht bestätigt. Das Fenster der Häckselkammer war erbrochen, eine Menge Geräthe lagen zerstreut herum, es schien, als wenn der Dieb sich einen erhöhten Tritt zurechtgemacht hatte, um dann bequemer als vom Boden aus eindringen zu können. Zimmermann rief, an der Hintertür stehen bleibend, mit lauter Stimme: »Brandt!« Keine Antwort erfolgte, nur ein Hund fing im Innern des Hauses an zu bellen. Vielleicht war der Krüger in einem Stalle beschäftigt, Zimmermann rief in die Ställe hinein, alles blieb stumm. Nun ging er um das Haus herum und bemerkte, daß die hölzernen Traillen, welche das Küchenfenster verwahrten, zerbrochen waren. Unter dem Löwing lehnte eine Bank am Fenster der Polterkammer, dieses Fenster war vollständig herausgenommen, die Haupttür weit geöffnet. In immer größerer Spannung begab sich Zimmermann in die Schenkstube und rief noch lauter: »Brandt! Brandt!« Die schauerliche Stille wurde durch nichts unterbrochen. Jetzt ahnte ihm, daß hier etwas Schreckliches vorgegangen sei, mit zitternder Hand berührte er den Drücker zur Tür der Schlafstube. Die Tür ließ sich nicht ohne weiteres öffnen, weil sich ein schwerer Gegenstand dagegenstemmte. Sie wich dem stärkern Druck, und das erste, was Zimmermann erblickte, war der auf dem Boden liegende mit Blut bedeckte Körper seines Freundes. Die junge Frau lehnte tot am Bett, der Oberleib war über die Bettstelle zurückgebogen, mit den Füßen stand sie auf den Dielen. Dem Meier rieselte es eisig durch die Adern, als er die beiden Leichen sah, entsetzt floh er von der Stätte des Mordes und berichtete athemlos im Dorfe die grausige Blutthat. Die mutigsten Männerherzen erbebten, denn solch ein verwegener Anfall war unerhört. Schon nach wenigen Stunden erschienen die Gerichtspersonen aus Bärwalde und nahmen die gesetzlich vorgeschriebene Besichtigung vor. Die beiden Eheleute waren erschlagen worden, man fand die Schädel zertrümmert, am Halse klafften breite Wunden. Die Haupthaare starrten, mit Blut getränkt, wirr durcheinander, die Betten und die Dielen unter den Bettstellen schwammen im Blute. An einem Fäßchen lehnte ein blutiges Beil, an welchem noch die blonden Haare von dem Haupte der Frau Brandt klebten. Das Beil gehörte dem ermordeten Brandt, es wurde gewöhnlich im Küchenraume, niemals in der Schlafkammer aufbewahrt. Der Mörder hatte es jedenfalls in der Küche mitgenommen, und dann mit der Rückseite die Köpfe der beiden Schläfer zerschmettert; was das Beil nicht ganz getan, das hatte das Messer, mit dem er die Kehlen durchschnitten, vollendet. Daß ein Raubmord in Frage war, lehrte der Augenschein, die Kommodenkästen waren durchwühlt, Kleider und Wäsche herausgerissen, Papiere umhergestreut, mehrere Schränke aufgeschlossen. Es fehlte eine silberne Taschenuhr und der größte Teil des baaren Geldes, allerdings waren noch einige Groschen in einer Tasche, die an der Tür hing, aber diese mochte der Mörder übersehen haben, die Summe von 24 Thlrn., die der Krugwirth vor wenigen Tagen für verkauftes Getreide gelöst hatte, war geraubt.
Die allgemeine Meinung ging dahin, daß der Mörder im Hause bekannt gewesen sein müsse. Er war nicht den kürzesten Weg durch die Fenster der Schenkstube oder der Schlafstube gegangen, sondern zuerst auf der andern Seite des Hauses durch das Fenster der Häckselkammer eingestiegen. Von hier konnte er in die Küche zu dem Beil kommen, dessen er sich zunächst bemächtigen wollte. Zufällig war der Durchgang zur Küche abgesperrt, der Räuber schritt deshalb zu dem umständlichern Erbrechen des Küchenfensters, konnte aber wieder nicht in den Hausflur gelangen, weil die Tür dorthin verschlossen war. Nun brach er an einer dritten Stelle ein, vom Löwing aus in die Polterkammer, von hier erreichte er ohne Schwierigkeit den Hausflur und konnte nun, mit dem Beil bewaffnet, zu seinem Werke schreiten. Die Ansichten, ob einer allein oder ob zwei Personen die Tat verübt, waren geteilt. Merkwürdigerweise zeigte die durchsuchte Wäsche keine Blutflecke, diese hätten aber vorhanden sein müssen, wenn dieselbe Hand, die das Beil schwang, dann auch die Wäschstücke angefaßt hätte. Der Körper des Mannes war, wie wir wissen, vollständig, der der Frau zur Hälfte aus dem Bett gezogen, die Betten und das Bettstroh aufgewühlt. Ohne mit Blut besudelt zu werden, konnte der Mörder dies nicht getan haben, und dennoch waren die bunt durcheinandergeworfenen Sachen völlig rein. Hatte etwa der eine die Opfer abgeschlachtet, während der andere die Beute auswählte? In jedem Falle war nur Ein Beil benutzt worden, denn die sämtlichen Schlagwunden zeigten die gleichen Dimensionen und rührten von demselben Instrument her. Ein Kampf hatte nicht stattgefunden, namentlich hatte der Krüger den Todesstreich im Bett, und nicht etwa außerhalb des letzteren, empfangen, wie sich daraus ergab, daß im Bett, aber nicht auf dem Fußboden, wo der Leichnam lag, eine Blutlache gefunden wurde. Waren es zwei Räuber, so mußte man annehmen, daß sie schon die Rollen vorher unter sich geteilt, und daß nur einer den Brandt'schen Eheleuten mit Beil und Messer den Garaus gemacht hatte.
In der Regel wurde im Brandt'schen Hause eine Öllampe gebrannt, nur in ganz seltenen Fällen, wenn ein Tanzvergnügen oder sonst eine Festlichkeit stattfand, brannten Lichter, und zwar billige Talglichter. In der Mordnacht dagegen war ein Stearinlicht gebrannt worden, und der Mörder hatte dieses Licht in der Hand gehalten, denn auf den Dielen und dem Beile hafteten kleine weiße Perlchen und Scheiben, die offenbar bei dem hastigen Hin- und Herbewegen des Lichtes heruntergetröpfelt waren. Vorsichtig wurde die Stearinmasse, die sehr bald zu eiuem kostbaren Beweismittel werden sollte, abgelöst und in gerichtliche Verwahrung genommen. In der Tat gelang es, die Person desjenigen zu ermitteln, welcher das verrätherische Stearinlicht entweder selbst in den Krug gebracht oder doch dem Mörder zur Ausführung des Mordes zugestellt hatte. Es war kein anderer gewesen als Karl Ludwig Liebig, der leibliche Bruder der verehelichten Brandt. Ihn bezeichnete die Volksstimme sofort als den Thäter, er war mit allen Örtlichkeiten genau vertraut und ihm vor allen mußte es ein Leichtes sein, den wachsamen, an ihn besonders anhänglichen Hund zu beschwichtigen.
Liebig ist 1832 in Steinbeck bei Wriezen a. O. geboren und der Sohn eines Ackerwirths, der später nach Bärwalde übersiedelte und daselbst eine Wirtschaft übernahm. Der Knabe ging in Steinbeck und in Wriezen zur Schule, nach seiner Confirmation wurde er zu einem Schmied in Bärwalde in die Lehre gebracht. Er war roh und hart wie das Eisen, welches er hämmerte, und gab schon frühzeitig Beweise eines leidenschaftlichen, jähzornigen Charakters. Seiner Schwester Marie versetzte er gelegentlich mit dem Messer einen Stich, daß sie zeitlebens eine Narbe davontrug, seinen lahmen Bruder mishandelte er so unbarmherzig, daß das Blut aus mehrern Wunden floß. Der Zunge ließ er rücksichtslos freies Spiel, er war frech in Reden, verstand es aber, hinter Geschwätz seine wahren Gedanken zu verbergen. Sein schwacher Gliederbau und seine geringe Körperkraft ließen ihn zum Schmiedehandwerk nicht recht tauglich erscheinen, er hatte auch überhaupt keine Lust zur Arbeit und brachte es zu nichts Rechtem. Als Geselle blieb er nicht lange bei einem Meister, sondern kehrte dem Hammer und dem Amboß gewöhnlich schnell den Rücken und half dem Vater in der Wirtschaft. Höchst willkommen war es ihm, als seine Eltern den Krug in Stölpchen pachteten. Im Kruge sitzen, mit den Gästen plaudern und trinken, das behagte ihm weit besser, als im Schweiße seines Angesichts vor den Schmiedebälgen hantieren. Er blieb in Stölpchen und knüpfte ein Liebesverhältnis mit Helene Brandt, der Tochter des Kirchenlandpachters Brandt, an. Ihr Vater wollte jedoch von dem Herumtreiber, den er einen liederlichen Taugenichts nannte, nichts wissen und verbot dem Mädchen jeden Verkehr mit ihm. Dies war um so empfindlicher für Liebig, als seine Angehörigen bald darauf in sehr freundschaftliche Beziehungen zu der Brandt'schen Familie dadurch traten, daß der junge Martin Brandt sich um Emilie Liebig bewarb und sich mit ihr verlobte. Der Groll des verschmähten Freiers stieg, je wahrscheinlicher es wurde, daß Martin Brandt und nicht er die Krugwirthschaft vom Vater erhalten würde. Der alte Liebig starb und setzte im Testament Emilie zur Erbin ein, ihre Geschwister hatte sie mit baarem Gelde abzufinden. Bis zur Erbteilung führte Karl Liebig das Regiment, dann aber kam der Bräutigam seiner Schwester, die Hochzeit wurde gefeiert und dem Bruder die Tür gewiesen. Hatte er schon vorher gedroht: »Meine Schwester hat mich betrogen, aber ich räche mich an ihr«, und: »Wenn die beiden sich verheiraten, so schneide ich ihnen den Hals ab«, so war er nun noch mehr erbittert. Er stattete zwar etlichemal einen Besuch im Krug ab, kam aber immer seltener. Den jungen Pachtersleuten wurde Geld gestohlen, der Verdacht fiel auf Liebig, es entstand ein Wortwechsel, der mit Tätlichkeiten endigte, Martin Brandt warf seinen Schwager zur Tür hinaus.
Liebig gab in der Folge seinen Beruf als Schmied auf und zog nach Alt-Blessin. Er heiratete die Witwe Wegner, die ihm drei Kinder zubrachte, und nährte sich kümmerlich vom Tagelohn. Sein Erbteil, welches gegen 100 Thlr. betrug, hatte er bald zugesetzt; seine und seiner Familie Lage wurde immer trauriger.
Am Morgen des 9. Sept. verließ er das Haus und kehrte erst nach mehrern Stunden zurück. Die Nachricht von dem Morde im Kruge nahm er gleichgültig auf. Er sprach mit seiner Frau über die Kränkungen, die er von Schwager und Schwester erfahren, hin und her, endlich schickte er sich an, selbst nach Stölpchen zu gehen. Unterwegs begegnete er etlichen Leuten, die von der blutigen Tat redeten. Er sagte zu ihnen, es sei ihm so bange zu Muthe, als wenn er seinem Unglück entgegenliefe, sein Benehmen machte den Eindruck der größten Unruhe und Hast. In Stölpchen angekommen, geberdete er sich noch auffälliger. Er warf nur einen einzigen flüchtigen Blick auf die Leichen, dann wandte er sich ab und schluchzte laut, indes bemerkte man, daß er keine Träne hervorbrachte. Zwei Tage später äußerte er zu seinem Dienstherrn, dem Gutsbesitzer Mießling: »Es wäre leicht möglich, daß er nicht wieder zur Arbeit käme«, und antwortete auf dessen Frage nach dem Grunde: »Die Leute halten mich für den Mörder, und wenn mich das Gericht auch dafür hält, dann ist es gewiß, daß ich nicht wiederkomme.« Mießling verwies ihn auf den reuigen Schächer, der einst neben dem Erlöser am Kreuze starb, und ermahnte ihn, vor allem auf sein Seelenheil bedacht zu sein und zu bekennen, wenn er sich schuldbewußt fühle. Liebig hörte aufmerksam zu, dann brach er verzagt in die Worte aus: »Nein, nein, ich sterbe den Tod, den die gestorben, selig kann ich nicht werden.« In diesem Augenblick kam ein dritter herbei, und sofort rief er wie umgewandelt: »Wenn ich es gewesen bin, dann soll mich die liebe Sonne nicht mehr bescheinen!«
Wirklich sah er die Sonne nur noch wenige Stunden als freier Mann. Er wurde verhaftet. Sein ingrimmiger Haß gegen die Geschwister, seine genaue Bekanntschaft mit den Örtlichkeiten und die Anhänglichkeit des Hundes an seine Person machten ihn verdächtig. Es wurde eine Haussuchung in seiner Wohnung angeordnet und ein Stemmeisen gefunden, welches in die Eindrücke an den Fenstern der Häckselkammer und der Küche paßte. Kurz darauf kam ein Umstand zu Tage, der noch entscheidender für seine Überführung werden sollte. Sein dreizehnjähriger Stiefsohn Fritz hatte im Auftrage des Vaters von der Handelsfrau Töpfer ein Fünfdreierlicht verlangt. Die Töpfer besaß dergleichen nicht und bot ihm eins für einen Groschen an. Der Knabe nahm es indes nicht und ging in den Laden des Kaufmanns Pätsch, wo er ein Stearinlicht für 1 Sgr. 3 Pf. erhielt. Drei Tage später kam er wieder und sagte, wenn man behaupte, er habe hier ein solches Licht geholt, so sei das eine Lüge. Vor Gericht räumte er erst nach vielfachem Leugnen den Ankauf des Lichtes ein, dann widerrief er, gestand es aber nochmals zu und entschuldigte sich damit, sein Stiefvater habe ihm mit körperlicher Züchtigung gedroht, wenn er davon etwas verlauten lasse. Die Stearinmasse der von dem Kaufmann Pätsch geführten Lichter wurde von Sachverständigen untersucht und mit derjenigen verglichen, die in der Brandt'schen Schlafstube abgetröpfelt war. Die Masse stimmte vollkommen überein, während in den Bestandteilen des nicht aus einem und demselben Erzeugungsproceß hervorgegangenen Stearins sehr leicht merkliche Unterschiede wahrnehmbar sind.
Die verehelichte Liebig bestritt, daß ein derartiges Licht gekauft worden sei, sie gab an, in ihrem Hause würden nie Lichter gebrannt, sie besäßen nicht einmal einen Leuchter. Nach dem Aufenthalt ihres Mannes in der Mordnacht gefragt, versicherte sie, sie habe fest geschlafen und wisse nur so viel, daß ihr Gatte des Morgens, als sie noch im Bette gelegen habe, aufgestanden sei und sich entfernt habe. Die andern Hausbewohner konnten keine Auskunft geben, jedoch war es recht wohl möglich, daß Liebig, da die Haustür nicht verschlossen gehalten wurde, ohne Geräusch hinausgegangen war.
Die verehelichte Liebig gestand übrigens gegen Privatpersonen zu, ihr Mann könne allerdings aufgestanden und eine Zeit lang auswärts gewesen sein. Dem einen Nachbar sagte sie gesprächsweise: »Wenn ihr Mann der Mörder sei, müsse er einen Mitschuldigen haben«, sie stellte also seine Beteiligung nicht direct und unbedingt in Abrede. Der Witwe Klepsch erzählte sie: »Ihr Mann habe weiter nichts getan, als sich durch den Jungen ein Stearinlicht holen lassen, in der Nacht sei er mit dem Lichte fortgegangen.« Endlich bekannte sie einem Polizeibeamten, »daß ihr Sohn eines Abends vor dem Morde ein Stearinlicht gebracht und es vor ihren Mann hin auf den Tisch gelegt habe«.
Der Angeschuldigte setzte allen Verdachtsgründen das consequenteste Leugnen entgegen. Er bestritt, daß er mit seinem Schwager und seiner Schwester jemals in Feindschaft gelebt habe, daß er auf dem Wege nach Stölpchen ängstlich und unruhig gewesen sei, er wollte von dem Gespräche mit Mießling und von dem verrätherischen Lichte nichts wissen. Vom Gefängnisse aus machte er den Versuch, sich mit seiner Frau in Verbindung zu setzen, er schrieb ihr einen Brief, der in die Hand des Gerichts kam, und forderte sie darin auf, den Fritz zu überreden, daß er den Ankauf des Lichts widerrufen sollte. Da er einfältig genug war zu glauben, er könne seine Richter und die Gefängnisbeamten täuschen, spielte er den Frommen. Er sprach in biblischen Ausdrücken und brachte Phrasen an, die Bruchstücke von dem waren, was er in der Kirche gehört und behalten hatte. Nicht schlau und gewandt genug, seine Rolle durchzuführen, machte er sich durch seine Frommthuerei nur noch verdächtiger. Von Geduld, Demuth, Feindesliebe, Selbstverleugnung und allen echten Kennzeichen eines wahrhaft frommen Herzens bemerkte man bei ihm nichts, er blieb derselbe starrsinnige freche Leugner, der er vorher gewesen war, lehnte sich auf gegen die Gefängnisordnung und brach häufig in förmliche Wuthanfälle aus, zwischendurch faltete er die Hände, sagte lange Gebete her und citirte Bibelsprüche und Liederverse. Der Heiligenschein, den er um sich zu verbreiten bestrebt war, glich einem durchlöcherten Mantel, überall blickten Bosheit und Tücke hindurch.
Man kann es kaum listig, man muß es schlechthin unverschämt nennen, wenn er schließlich mit einer kindischen Fabel hervortrat, die seine Unschuld beweisen sollte und dafür Glauben verlangte. Er behauptete, Gott habe ihm in nächtlichen Visionen die Mörder, an deren Stelle er unschuldig im Gefängnis schmachte, offenbart. Ihm hatte geträumt, so gab er an, er wäre Brandt, und Emilie, seine Schwester, wäre seine Frau gewesen, sie hätten beide im Bett gelegen und geschlafen, durch ein Geräusch aufgeweckt, habe er Personen aus dem Kreise seiner Bekannten, die er mit Namen nannte, in die Schlafstube treten sehen. Sie hätten auf ihn und auf seine Frau blutgierige Blicke gerichtet, ihre langen Messer an einem Feuerstahl gewetzt und sich über sie gebeugt, um sie beide abzuschlachten. Schon sei das Messer gegen ihn gezückt gewesen, da habe er sich aufgerichtet, es ergriffen, sich aber die Hand so aufgeschlitzt, daß ein rother Blutstrahl hoch aufgesprungen sei. Der jähe Schmerz habe ihn aufgeweckt.
Er blieb steif und fest dabei, die Männer, welche ihm im Traume erschienen wären, müßten die Mörder sein, und forderte alles Ernstes, das Gericht solle sie einkerkern und ihn freilassen.
Das gleisnerische Benehmen des Inculpaten bestärkte alle, die davon hörten, in dem Glauben an seine Schuld, und man erwartete mit Bestimmtheit, daß er demnächst unter der Anklage des Mordes vor die Geschworenen gestellt werden würde. Da trat plötzlich die Hauptperson in unserm Drama hervor und beteuerte: »Ich allein habe den Mord verübt, niemand hat mir beigestanden, das Licht, bei dessen Scheine Brandt und seine Frau ihr Leben aushauchten, habe ich selbst an Ort und Stelle gebracht.«
Wir werden später hören, daß Liebig's Hoffnung, dieses Geständnis werde die Tür seines Kerkers öffnen, umsonst war, und daß er trotzdem als der Gehülfe des Mörders erkannt und verurteilt wurde; jetzt tun wir vorerst einen Schritt zurück und müssen von neuen Mordtaten des Menschen berichten, der noch immer in jener Gegend hauste, dessen Blutdurst noch lange nicht gestillt war.
Karoline Hipperling, die Tochter eines Tagelöhners in Adamsdorf bei Soldin, stand mit einem jungen Burschen Namens Karl Friedrich Behling in einem zärtlichen Verhältnis. Behling diente auf einem eine Viertelmeile entfernten Gute als Knecht, besuchte aber seine Verlobte regelmäßig jeden Sonntag, die Eltern des Mädchens hatten dagegen nichts einzuwenden, und es entspann sich sehr bald ein nur allzu vertraulicher Verkehr. Die Braut gebar infolge dessen ein Kind, und der Bräutigam konnte vorläufig nicht daran denken, den eigenen häuslichen Herd zu gründen, denn er war erst 20 Jahre alt und hatte seiner Militärpflicht noch nicht genügt. Im Herbst 1860 wurde er als Soldat ausgehoben und erhielt den Befehl, sich am 18. Oct. mit den übrigen Rekruten in Soldin zu stellen, um dem Garnisonsorte zugeführt zu werden. Die letzten Wochen vorher waren eine schwere trübe Zeit für seine Geliebte, die nun den Vater ihres Kindes von sich lassen mußte und die Hochzeit in ungewisse Ferne gerückt sah. Sie überhäufte ihren Verlobten mit Beweisen ihrer Liebe, beide versicherten einander, daß sie sich treu bleiben würden, und als die Abschiedsstunde nahte, gab sie ihm das Geleite nach Soldin.
Die Eltern warteten vergeblich auf die Rückkehr ihrer Tochter; als die Nacht hereinbrach und sie noch immer nicht zu Hause war, trösteten sie sich mit dem Gedanken, sie werde auf Zureden Behling's oder aus eigenem Antrieb in Soldin geblieben sein, und erst nach dem Abmarsch der militärpflichtigen Mannschaft, der am 19. Oct. in der Frühe stattfinden sollte, den Heimweg antreten. Allein auch am Morgen des 19. Oct. stellte sie sich nicht ein und noch im Laufe des Tages erzählten Einwohner aus Adamsdorf, daß sie die Unglückliche seitwärts neben der Chaussee in einem Graben liegend gefunden hätten, sie war tot, der Mörder hatte sie überfallen, erwürgt und beiseitegeschleppt. Unterhalb des einen Ohres bemerkte man einen auffallenden Flecken, von dort aus lief um den Hals ein gerötheter Streifen. Der Nacken war hochroth gefärbt. Die Ärzte begutachteten, der Tod sei durch Erstickung unter Hinzutritt eines Blutschlags erfolgt. In Betreff der Lage des Körpers ist zu erwähnen, daß die Leiche bis zu den Knien herauf entblößt war; an der Kleidung konnte man keine Spur eines vorausgegangenen Kampfes wahrnehmen, auch schien nichts geraubt zu sein. Das baare Geld, was sie besessen, lag unversehrt in ihrer Lade, es fehlte von allen den Sachen, die sie mitgenommen, nicht ein einziges Stück. Überhaupt war es nicht wahrscheinlich, daß ein Räuber das einfach ländlich gekleidete Mädchen, bei dem er gewiß keine lohnende Beute erwartet haben konnte, ermordet haben sollte. Dicht neben dem Leichnam lag ein Krückstock mit Zinkblechzwinge, nicht weit davon das Umschlagtuch der Ermordeten und ihr Handkorb, an dessen Henkel ein Paar Mannsstiefeln hingen. Der Stock war senkrecht in die Erde gesteckt worden und dann umgerissen oder umgefallen. Der Mörder hatte ihn also nicht zu seinem Vorhaben benutzt, sondern jedenfalls beiseitegestellt, um die Arme frei zu haben und sich ungestört mit der Frauensperson zu beschäftigen. Die Stiefel und der Stock waren das Eigentum des Rekruten Behling, welcher mit Karoline Zipperling die letzte Wanderung angetreten hatte. Er allein zog von dem Tode des Mädchens Gewinn, denn dadurch wurde er frei von einer übernommenen Verpflichtung, von einem Bande, welches ihm vielleicht jetzt, da er ins Leben hinausging, recht lästig wurde. Es stieg der Verdacht auf, daß er sich der Geliebten, deren er überdrüßig geworden, durch eine rasche Tat entledigt und, nach Vollendung des Mordes durch andere verscheucht, seinen Stock und seine Stiefeln zurückgelassen habe.